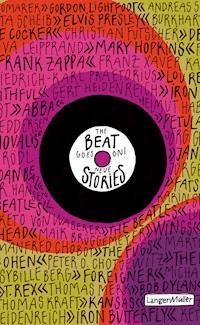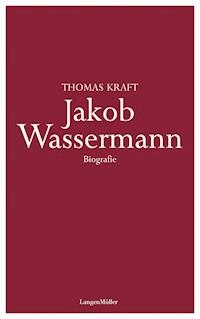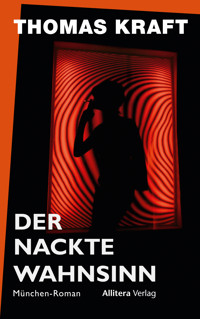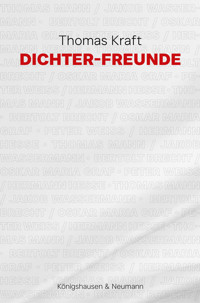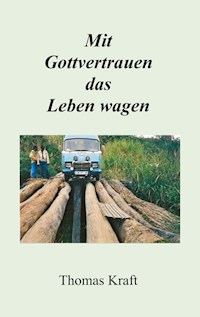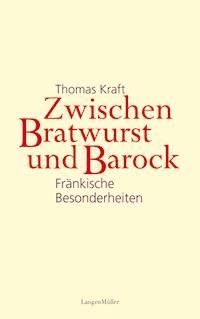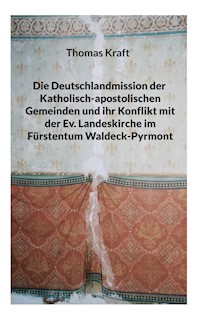
Die Deutschlandmission der Katholisch-apostolischen Gemeinden und ihr Konflikt mit der Ev. Landeskirche im Fürstentum Waldeck-Pyrmont E-Book
Thomas Kraft
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Katholisch-apostolischen Gemeinden sind heute weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden. Obwohl in ca. 40 Städten in Deutschland noch aktive Gemeinden mit zum Teil stattlichen Kirchengebäuden bestehen, treten sie im ökumenischen Miteinander kaum in Erscheinung. Das war nicht immer so. Die Gemeinden, die in England in den 1830er Jahren entstanden, begannen in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine intensive Mission in den deutschsprachigen Ländern. Sie verbanden eine ökumenische Vision mit einer endzeitlichen Erwartung. Ihr Ziel war, die zerteilte Christenheit für die baldig erwartete Wiederkunft Jesu Christi zu einen. Die Missionstätigkeit war sehr erfolgreich: von Marburg (Lahn) und Berlin aus bildeten sich bis zur Jahrhundertwende mehr als 300 Gemeinden. Trotz ihrer ökumenischen Gesinnung und einer freundlichen Haltung gegenüber den bestehenden Kirchen entwickelten sich zahlreiche Konflikte mit den evangelischen Landeskirchen, in deren Gebiet sie wirkten. Diese Arbeit beleuchtet Entstehung, Theologie und Kernanliegen der Katholisch-apostolischen Gemeinden. Sie zeichnet den Beginn der Missionstätigkeit in Deutschland nach, wobei besonders die Gründung der Gemeinde in Marburg (Lahn) und ihr Leiter, der Theologieprofessor Heinrich W. J. Thiersch in den Blick genommen werden. Anschließend wird der Konflikt mit der Ev. Landeskirche an einem konkreten Fall geschildert: In dem kleinen waldeckischen Dorf Rhenegge entstand eine Katholisch-apostolische Gemeinde, deren Mitglieder nach einer Auseinandersetzung mit den kirchlichen Behörden im Jahr 1892 aus der Landeskirche ausgeschlossen wurden. Dazu wird ein Aktenbestand des ehemaligen Waldeckischen Konsistoriums erstmals ausgewertet. Die Arbeit wurde im Jahr 2022 als Masterarbeit im Masterstudiengang Ev. Theologie (M. Th.) in Marburg angenommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
I. Einleitung und Fragestellung
II. Literatur und Forschungsstand
III. Geschichte und Theologie der Kath.-ap. Gemeinden
Die Entstehung der Kath.-ap. Gemeinden
Die Albury-Konferenzen 1826-1830
Die Bildung charismatisch geprägter Gemeinden 1830-1835
Von der „Aussonderung der Apostel“ bis zur Einführung der Versiegelung 1835-1847
Exkurs: „Irvingianer“?
Die Theologie der Kath.-ap. Gemeinden
Ekklesiologie
Eschatologie
IV. Die Deutschlandmission der Kath.-ap. Gemeinden
Die Anfänge
Heinrich W. J. Thiersch und die Gemeinde Marburg
V. Der Konflikt zwischen der Kath.-ap. Gemeinde in Rhenegge und der Landeskirche in Waldeck-Pyrmont
Die kirchliche Situation in Waldeck-Pyrmont
Die Anfänge der Katholisch-ap. Gemeinde in Rhenegge
Konfliktfälle
Konflikt um die Konfirmation
Die theologischen Argumente
Konflikt um die Beerdigung der Karoline Brüne
Die Klärung des kirchenrechtlichen Status: Ausgetreten, ausgeschieden, ausgeschlossen?
VI. Fazit
VII. Schlussbemerkung
Verwendete Abkürzungen
Quellen und Literatur
Vorwort
Meine erste Begegnung mit den Katholisch-apostolischen Gemeinden war eher zufälliger Natur. Bei Spaziergängen während meiner ersten Marburger Zeit in den Jahren 1987-1990 stieß ich auf die Katholisch-apostolische Kapelle am Marburger Schlossberg. Die Bezeichnung am Gebäude angebrachte Tafel mit der Bezeichnung „katholisch-apostolisch“ sagte mir nichts, sodass ich mich in der konfessionskundlichen Literatur über die Gemeinschaft informierte. Was ich dort fand, verband sich kaum zu einem klaren Bild: charismatisch und liturgisch, erwecklich und zugleich nur noch als Restgemeinden ohne geistliche Hierarchie bestehend. So recht konnte ich mir darunter nichts vorstellen. Erst viele Jahre später, nach meinem Studium, das ich in Hamburg und England absolviert hatte, lernte ich in einer anderen Stadt in einem ökumenischen Zusammenhang ein Gemeindeglied der Katholisch-apostolischen Gemeinde kennen. Er lud mich ein, einen der Gottesdienste zu besuchen. Das Angebot nahm ich gerne an. Wir verabredeten uns zu einem Nachmittagsgottesdienst am Sonntag. Das Erlebnis war eindrücklich. Die Gestaltung der Kirche erinnerte mich sehr an die Kirchen in England. Ich erlebte ein intensives Gebet, die Liturgie wurde überwiegend gesungen. Auch liturgische Elemente aus der anglikanischen Tradition erkannte ich wieder. Dem ersten Besuch der Nachmittagsliturgie folgten weitere in anderen deutschen Städten und auch in der einzig noch aktiven Gemeinde in London, wo ich später mehrere Jahre lebte. Während dieser Zeit ergab sich auch ein Besuch in Albury Park in Surrey, wo die Katholisch-apostolischen Gemeinden in der Apostelkapelle ihr geistliches Zentrum hatten. Ich las mich in die Geschichte der Gemeinden ein und lernte ihre reichhaltige geistliche Literatur kennen, die durch das Projekt Albury von Peter Sgotzai heute weitgehend elektronisch verfügbar ist. Der geistliche Ernst, die zutiefst ökumenische und katholische Gesinnung der Gemeinden und die Schönheit ihrer Liturgie beeindruckten mich tief. Zugleich bewegte mich die Frage, warum die Gemeinden ihren geistlichen Reichtum nicht stärker in das ökumenische Gespräch heute einbringen. Dass der Grund dafür nicht in sektiererischer Abgrenzung oder eigenem Exklusivitätsanspruch liegt, wird jedem schnell deutlich, der sich mit der Geschichte und Gegenwart der Gemeinden beschäftigt. Nie habe ich in meinen Gesprächen mit Gliedern der Katholisch-apostolischen Gemeinden ein negatives Wort über andere Kirchen und Gemeinden gehört.
In dieser Arbeit verbindet sich konfessionskundlich-theologisches Interesse mit der Regionalgeschichte. Im Zuge einer Forschungsarbeit über die Erweckungsbewegung in Waldeck stieß ich auf die kleine Katholisch-apostolische Gemeinde in Rhenegge. Der Aktenbestand im Landeskirchlichen Archiv in Kassel zu ihrem Konflikt mit der Waldeckischen Landeskirche war bislang nicht ausgewertet worden. Auch ich konnte dies im Rahmen der damaligen Arbeit nicht erschöpfend tun. Als sich später im Rahmen meines berufsbegleitenden Masterstudiengangs Ev. Theologie an der Philipps-Universität Marburg die Frage nach einem Thema für die Masterarbeit stellte, schlug ich Prof. Dr. Karl Pinggéra vor, diesen Aktenbestand auszuwerten und als Fallstudie in den Kontext der Deutschlandmission der Katholisch-apostolischen Gemeinden einzuordnen. Dankenswerterweise stimmte er zu. Das Ergebnis wurde im Frühjahr 2022 als Masterarbeit am Fachbereich Ev. Theologie angenommen. Diese Publikation ist eine nur leicht überarbeitete Form der eingereichten Arbeit. Die Veröffentlichung wurde durch ein Forschungsstipendium der Stiftung des Fürstlichen Hauses Waldeck und Pyrmont ermöglicht, der ich dafür herzlich danke.
Im Advent 2022 Thomas Kraft
I. Einleitung und Fragestellung
Die Katholisch-apostolischen Gemeinden (im folgenden KAG) sind heute aus der Öffentlichkeit verschwunden. Obwohl in Deutschland noch ca. 40 aktive Gemeinden mit zum Teil sehr stattlichen Kirchengebäuden bestehen, treten sie im kirchlichen Leben und im ökumenischen Miteinander nicht in Erscheinung. Dies war nicht immer so. Die Gemeinden, die ab den 1830er Jahren in England entstanden, verbreiteten sich rasch über viele europäische Länder. Im Jahr 1900 bestanden in Kontinentaleuropa 441, in Großbritannien 390 Gemeinden.1 Die Zahl der Mitglieder überstieg die Marke von 200.000, davon ca. 60.000 in Deutschland.2 Ihre Besonderheit lag in einer Kombination aus evangelikaler3 Frömmigkeit, charismatischer Erfahrung, einer pointierten Eschatologie und hochkirchlicher Liturgie. Alle diese Elemente fanden sich auch in anderen religiösen Bewegungen der Zeit, in ihrer Kombination waren die KAG jedoch singulär. Sie entwickelten nicht nur eine Vision kirchlicher Einheit, lange bevor die ökumenische Bewegung größere Teile der Christenheit erfasste, sie gingen auch konkrete Schritte zu deren Umsetzung. Als ihre Vision einer unter Aposteln4 geeinten Kirche kein Gehör bei den Führern der Christenheit fand, formten sie eigene Gemeinden als „Muster“ und Vorbild für die zukünftige Gestalt der Kirche.
Ebenso wie die Entstehung und Ausbreitung hat ihr Verschwinden das Interesse der Forschung hervorgerufen. Die Gemeinden sahen keinen Auftrag zur Nachberufung von Aposteln nach deren Tod. Somit gingen sie nach dem Tod des letzten Apostels immer weiter zurück, die Hierarchie erlosch. Die Gemeinden verstanden es so, dass der Herr sein „Werk“ zurückgezogen hatte. Über der Frage neuer Apostelberufungen kam es jedoch zu Abspaltungen.5 Die KAG wurden somit gegen ihren Willen zur Keimzelle der Konfessionsgruppe Apostolischer Gemeinschaften, was ihre Bedeutung für die neuere Kirchengeschichte begründet.6
Auslöser für die heutige Faszination ist zumeist die ökumenische Vision der Gemeinden.7 Ihr Anspruch und ihre Verkündigung führten jedoch im 19. Jahrhundert zu Konflikten mit den Mehrheitskirchen, in deren Territorien sie in Erscheinung traten. In dieser Arbeit soll der Konflikt zwischen den KAG und der Evangelischen Landeskirche an einem konkreten Fall untersucht werden: In dem waldeckischen Dorf Rhenegge8 entstand ab 1876 eine kleine KAG, deren Mitglieder nach einem längeren Konflikt 1892 als aus der Evangelischen Landeskirche im Fürstentum Waldeck-Pyrmont ausgeschlossen betrachtet wurden. Dafür wird eine Akte im Landeskirchlichen Archiv Kassel ausgewertet, die die Auseinandersetzung in 18 Einzelvorgängen aus den Jahren 1885-1892 dokumentiert.9
Zunächst soll nach einem Überblick über Literatur und Forschungsstand (Kap. 2) die Entstehung und Theologie der KAG dargestellt werden. Deren Entstehungsgeschichte (Kap. 3.1) lässt sich in drei Phasen einteilen, die jeweils für einen wesentlichen Aspekt ihrer Theologie stehen. Es liegt eine Reihe von Geschichtsdarstellungen katholisch-apostolischer Autoren vor. Da diese von Amtsträgern der Gemeinden verfasst und von den Aposteln autorisiert wurden, neigen sie dazu, die Darstellungen zu glätten und diese vor allem unter dem Aspekt des heilsgeschichtlichen Handelns Gottes zu betrachten. Daher wird auf kritische Studien zurückgegriffen, die – soweit möglich – auch nichtoffizielle Quellen einbeziehen.
Die Darstellung der katholisch-apostolischen Theologie (Kap. 3.2.) hingegen erfolgt auf der Basis der offiziellen und autorisierten Texte der Gemeinden. Diese weisen eine bemerkenswerte Konsistenz auf. Trotzdem wird bei der Auswertung den Schriften der Apostel und anderer hoher Amtsträger der Vorzug vor den Schriften anderer Autoren gegeben, insbesondere wird auf das „Testimonium“ der Apostel10 zurückgegriffen, das als erste umfassende Bekenntnisschrift für die breite Öffentlichkeit erstellt wurde und einen Abriss ihrer Lehre und ihres Selbstverständnisses bietet. Da die KAG an den altkirchlichen Glaubensbekenntnissen festhielten11 und keine Sonderlehren vertraten, wird der Fokus auf Ekklesiologie und Eschatologie gelegt, da in diesen beiden Feldern die wesentlichen Distinktionspunkte ihrer Lehre gegenüber der traditionellen Theologie liegen.
Anschließend sollen die Anfänge der Katholisch-apostolischen Mission in Deutschland beschrieben werden (Kap. 4). Der erste katholisch-apostolische Gottesdienst und die ersten Weihen fanden 1847 in Frankfurt am Main statt. Aus ihnen ging als Gemeindegründung die Gemeinde in Marburg hervor, die 1848 offiziell gegründet wurde.12 Ihr stand Prof. Heinrich W. J. Thiersch vor, der erste in Deutschland geweihte Priester. Der Fall Thiersch ist aus mehreren Gründen für das Thema bedeutsam. Mit Heinrich W. J. Thiersch trat nicht nur ein prominenter evangelischer Theologe den KAG bei, der Konflikt zwischen seiner Marburger Gemeinde und der Ev. Landeskirche in Kurhessen bildete auch einen Modellfall, an dem sich das Vorgehen des Waldeckischen Konsistoriums im Umgang mit der Gemeinde in Rhenegge orientierte. Auch sonst gab es Verbindungen: Die Gemeinde Marburg entsandte zu Missionsaufgaben einen ihrer Evangelisten nach Rhenegge. Ab 1897 wiederum übernahm Christian Arnold aus Rhenegge die Leitung der Gemeinde Marburg. Neben der biographischen Literatur zu H. W. J. Thiersch13 dient hier vor allem seine handschriftliche Chronik der Gemeinde Marburg von 1847 bis 1864 als Quelle.14 Bei der Darstellung stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Was motivierte die Deutschlandmission der KAG, was war ihr Ziel? Welche Strategien wurden angewandt? Wie verstanden die Gemeinden ihre Rolle im Hinblick auf die in Deutschland etablierten Kirchen?
Anschließend soll der Konflikt um die Gemeinde Rhenegge untersucht werden (Kap. 5).
Dabei geht es um die Frage, an welchen Punkten sich der Konflikt zwischen der Landeskirche und den Angehörigen der KAG entzündete? Wie reagierte die Landeskirche, welche Strategie des Umgangs mit der Gemeinde wurde angewandt und welche disziplinarischen Mittel wurden gewählt? Wie gestaltete sich die inhaltliche und theologische Auseinandersetzung mit der katholisch-apostolischen Theologie? Wo liegen die entscheidenden theologischen Unterschiede? Welche unterschiedlichen Zielsetzungen und Tonlagen sind bei den jeweiligen Akteuren erkennbar? Wie wird die Stellung der Mitglieder der KAG zur Landeskirche am Ende entschieden?
1 Allein in Deutschland wuchs diese Zahl auf 347 im Jahr 1912. Die Zahl für Großbritannien bezieht sich auf das Jahr 1906. Vgl. Grass, Work, S. 86-87.
2 Vgl. Born, Werk, S. 184.
3 Der Begriff „evangelikal“ wird in dieser Arbeit für die evangelische Frömmigkeit verwendet, die sich in Folge der Erweckungsbewegung des 18. Jahrhunderts im Methodismus und im Low Church-Flügel in der Anglikanischen Kirche im frühen 19. Jahrhundert gebildet hatte. Der deutsche Begriff „evangelikal“ fand erst im späten 20. Jahrhundert Eingang in die deutsche Sprache als Abgrenzung zum sonst verwendeten „evangelisch“ und bezog sich dann vorwiegend auf die evangelikale Bewegung nordamerikanischen Typs. Vgl. dazu Fiedler, Bewegung, Sp. 1696-1697.
4 Die Amtsbezeichnungen der KAG werden in dieser Arbeit nicht in Anführungszeichen gesetzt. Auch wenn der Anspruch der Leiter der Gemeinden, als Apostel durch Propheten berufen zu sein, von den Gegnern und Vertretern anderer Kirchen bestritten wurde, nahmen sie innerhalb der Hierarchie der KAG diese Ämter ein. Durch die Reproduktion der Amtsbezeichnungen ist kein Urteil über diesen Anspruch intendiert.
5 Vgl. zu den Vorgängen um die nicht autorisierten Apostelberufungen durch den Engelpropheten Geyer: Schröter, Gemeinden.
6 Vgl. Obst, Apostel, S. 17. Die größte dieser Gemeinschaften ist die Neuapostolische Kirche mit weltweit ca. 9 Millionen Mitgliedern.
7 So bei R. F. Edel und auch bei Schröter, vgl. dazu Abschnitt 2.
8 Rhenegge liegt in den nordöstlichen Ausläufern des Rothaargebirges am Rande des Waldecker Uplands und ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Diemelsee.
9 Acta Adorf. Die handschriftlichen Quellen werden in der Orthographie und Interpunktion der Originale zitiert.
10 Vgl. Testimonium.
11 Vgl. Thiersch, Inbegriff.
12 Born spricht von der Marburger Gemeinde als der ersten Gemeinde in Deutschland, weil er das Datum der Priesterweihe Thierschs als Gründung der Gemeinde ansieht. Vgl. Born, Werk, S. 83. Schröter hingegen datiert die Gemeindegründung erst auf den 4. Februar 1849, den Tag der ersten Eucharistiefeier. Damit sieht er Berlin als erste KAG in Deutschland. Vgl. Schröter, Gemeinden, S. 429.
13 Insbesondere Edel, Weg, sowie Wigand, Leben.
14 Chronik Marburg.