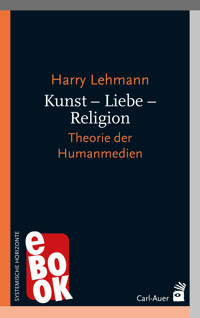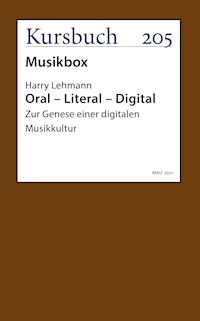Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schott Music
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: edition neue zeitschrift für musik
- Sprache: Deutsch
Musikphilosophie ist, wie Kunstphilosophie überhaupt, keine fest etablierte akademische Disziplin. Sie tritt sporadisch in Erscheinung, wenn es zu einschneidenden Veränderungen in der musikalischen Praxis kommt und es notwendig wird, den Begriff der Musik neu zu fassen. Dies war der Fall, als sich die Symphonie vor gut zweihundert Jahren als prägende musikalische Gattung etablierte, und dies geschah, als es vor gut einhundert Jahren zur Preisgabe der Tonalität kam. Das Ereignis, welches das philosophische Interesse heute auf die Musik lenkt, ist die digitale Revolution. Sie stellt die Idee der Neuen Musik und ihren genuinen Kunstanspruch in Frage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalte
Vorgeschichte
Dispositiv
Musikverlage
Musikhochschulen
Virtuelle Orchester
ePlayer
Digitale Klangarchive
Virtuelle Musik
Notation
Samples
Alte Instrumente
Kulturökonomie
Entinstitutionalisierung
Übersprungene Geschichte
Schlechte Unendlichkeit
Gehaltsästhetische Wende
Absolute Musik
Musikkonzepte
Relationale Musik
Musikkritik
Musikphilosophie
Appendix
Harry Lehmann
Die digitale Revolution der Musik
Eine Musikphilosophie
edition neue zeitschrift für musik
hg. von Rolf W. Stoll
Umschlag unter Verwendung eines Diagramms von Johannes Kreidler. Mit freundlicher Genehmigung des Komponisten.
© 2012 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
Printed in Germany
SDP 7
ISBN 978-3-7957-9154-4
Vorgeschichte
Musikphilosophie ist, wie Kunstphilosophie überhaupt, keine fest etablierte akademische Disziplin. Sie tritt eher sporadisch in bestimmen historischen Konstellationen in Erscheinung, wenn es zu einschneidenden Veränderungen in der musikalischen Praxis kommt und es notwendig wird, den Begriff von Musik neu zu bestimmen. Dies war der Fall, als sich die Symphonie vor gut zweihundert Jahren als prägende musikalische Gattung etablierte und die Instrumentalmusik zur ‹eigentlichen Musik› umgedeutet wurde, und dies geschah, als es vor einhundert Jahren zur Preisgabe der Tonalität kam und die Idee der Neuen Musik als avancierter Kunstmusik der Gegenwart entworfen wurde. Das Ereignis, welches heute das philosophische Interesse auf die Musik lenkt, ist die digitale Revolution. Sie stellt ihre vorherrschenden Selbstbeschreibungsmuster und ihren genuinen Kunstanspruch in Frage. Die digitale Revolution der Neuen Musik ist das Thema dieser musikphilosophischen Untersuchung.
Historische Umbrüche sind in postmetaphysischen Zeiten die Chance und das Wagnis der Philosophie. Sie sind eine Chance, weil sich diese Transformationsprozesse nur kontextübergreifend, d. h. philosophisch beschreiben lassen. Sie bleiben ein Wagnis für das Denken, weil man auf die verschiedenen Wissensbereiche, die miteinander verknüpft werden müssen, nicht als Experte zugreifen kann – im vorliegenden Fall handelt es sich vor allem um technologische, soziologische, historische und ästhetische Theoriekontexte. So ist auch der Autor dieser Abhandlung kein Musikwissenschaftler, kein Musiksoziologe, kein Musikhistoriker und erst recht kein Komponist, sondern ein Philosoph, der sich für die Geschicke der zeitgenössischen Kunstmusik interessiert und seiner Profession entsprechend versucht, sich als Komplexitätsspezialist nützlich zu machen.
Diesem Buch gehen ein «Gedankenexperiment» und eine «Kontroverse» voraus. Im Frühjahr 2008 hatte ich einen Vortrag mit dem Titel «Die Digitalisierung der Neuen Musik – Ein Gedankenexperiment» auf der jährlichen Arbeitstagung des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung in Darmstadt gehalten, der in erster Näherung abzuschätzen versuchte, welche Auswirkungen die digitale Revolution auf die zeitgenössische Musik haben könnte. Überraschenderweise ist bei dem versammelten Auditorium aus Komponisten, Musikwissenschaftlern und Musikpädagogen die ganze Fragestellung auf Ablehnung gestoßen – als ob es von vornherein klar sei, dass solche Auswirkungen nur irrelevant oder negativ sein könnten.
Eigentlich sollte der Untertitel «Ein Gedankenexperiment» nur das Vortragsgenre bezeichnen und die Zuhörer auf das intellektuelle Durchspielen von Möglichkeiten einstimmen. Doch dieses gedankliche Experiment hat – ohne dass es dafür konzipiert wurde – auch handfeste empirische Daten geliefert: Es evozierte ein überaus tiefenscharfes Bild vom vorherrschenden Selbstverständnis der Neuen Musik. Das erste Versuchsergebnis war, dass Neue Musik, die sich gern als ‹experimentelle Musik› beschreibt, nur noch wenig Verständnis für Experimente hat und sich offensichtlich an ganz anderen Werten orientiert. Die Vermutung wurde durch die Reaktion der einschlägigen Fachzeitschriften bestärkt, denen der Vortrag zur Publikation angeboten wurde: ein Journal riet dem Autor ‹in seinem eigenen Interesse› von einer Veröffentlichung ab, ein anderes wollte einen solchen Text nur mit einer entsprechenden Gegendarstellung veröffentlichen, in einem dritten diskutierten die Herausgeber über ein Jahr lang miteinander, ob und wie sie den Vortrag publizieren sollten.
Das «Gedankenexperiment» erschien schließlich zwei Jahre später im regulären Tagungsband1 und wurde zum Ausgangspunkt einer «Kontroverse» zwischen den Komponisten Johannes Kreidler, Claus-Steffen Mahnkopf und mir, die im Sommer 2010 in Buchform erschien.2 Mein Beitrag bestand in einem Text, der die noch vage Grundidee des Gedankenexperiments in eine Theorieform zu bringen versuchte. Die Quintessenz des Argumentes lautete nun, dass die digitalen Technologien die institutionellen Rahmenbedingungen verändern, unter denen sich die Kunstform ‹Neue Musik› gesellschaftlich reproduziert.
Die im Anschluss an den Kontroversenband geführte Debatte erbrachte noch einen zweiten ‹experimentellen Befund›, und zwar den, dass die Neue-Musik-Szene insbesondere mit musiksoziologischen Problemstellungen Schwierigkeiten hat. Die meisten Repliken überlesen geflissentlich das zentrale Argument, demzufolge die digitale Revolution zu einer Demokratisierung und Entinstitutionalisierung der Neuen Musik führt. Ein Komponist hat das Theorieangebot bisher aufgegriffen und in einem Erfahrungsbericht auf seine eigene Arbeit appliziert.3 In einem Fall kam es zu einer Art denunziatorischer Abwehrreaktion, in welcher die analytische Beschreibung von Entinstitutionalisierungsprozessen als Instrument rechtspopulistischer Kulturpolitik umgedeutet wurde.4 Die Zwischenbilanz der Debatte wäre, dass das vorherrschende Selbstbild der Neuen Musik keine Reflexion auf ihre eigenen Möglichkeitsbedingungen verträgt. Die Neue Musik braucht Latenzschutz vor der Musiksoziologie, weil ihr Überzeugungssystem noch ganz in der Klassischen Musik verankert ist, für die es nur menschlichen Subjekte, aber keine sozialen Systeme gibt. Die Einsicht, die der Komponist Georg Katzer kürzlich formuliert hat, zählt zu den absoluten Ausnahmen und ließe sich geradezu als Motto diesem Buch voranstellen: «Die größten Veränderungen ergaben und ergeben sich aber durch die nun für jedermann erreichbare, bezahlbare, bedienbare Digitaltechnik im Soziologischen, nämlich der Demokratisierung der Musikproduktion, ihrer multimedialen Vermittlung und massenhaften Verbreitung. Der Computer hat das obskure Handwerk des Komponisten demokratisiert.»5
Was bislang sowohl im «Gedankenexperiment» als auch in der «Kontroverse» nur andeutungsweise zur Sprache kam, sind die eigentlichen musikphilosophischen Fragen: Wie ändern sich die Idee und der Begriff von Neuer Musik, wenn es tatsächlich infolge neuer digitaler Technologien zu einer allgemeinen Demokratisierung bei der Produktion, Distribution und Rezeption von Neuer Musik kommt? Welche normativen Leitbilder werden dabei technologisch entzaubert? Inwiefern muss das System der ästhetischen Kategorien neu konfiguriert werden, das die Selbstbeschreibung der Neuen Musik bislang getragen hat? Es sind diese genuin philosophischen Problemstellungen, denen sich dieses Buch jetzt zuwenden möchte.
Wenn im Folgenden ohne zusätzliche Erläuterung von ‹der› Neuen Musik die Rede ist, dann ist damit die avancierte Kunstmusik gemeint, die größtenteils auf alten Instrumenten gespielt wird und in einem Traditionskontinuum mit der westeuropäischen Klassischen Musik steht. Normalerweise schreibt sich die Neue Musik heute nicht mehr mit einem großem ‹N›, obwohl dies in der Sache nicht gerechtfertigt ist.6 Doch es hat vor allem einen praktischen Grund, dass wir an der alten Orthografie festhalten und weiterhin von ‹Neuer› und nicht von ‹neuer Musik› sprechen wollen. Der Selbstverzicht auf den Eigennamen, der mit der Kleinschreibung einhergeht, ist nicht nur für einen Leserkreis außerhalb der Neuen-Musik-Szene schwer verständlich, sondern die Kleinschreibung kommt auch einem Akt der Selbstverleugnung gleich. Man könnte meinen, dass sich hier eine Kunstform vorsätzlich namenlos macht, um in der Gesellschaft nicht mehr beobachtbar und ansprechbar zu sein. Letztendlich ist es gleich, ob man von ‹neuer›, ‹zeitgenössischer› oder ‹aktueller› Musik spricht, doch man sollte die Namen zumindest als Eigennamen markieren. Der gemeinsame Nenner der unterschiedlichen Bezeichnungen ist, dass es sich hier um eine Musik mit ausdrücklichem Kunstanspruch handelt. Dieser Anspruch ist konstitutiv für die Neue Musik, der allerdings in jeder Zeit neu eingelöst werden muss. In diesem Sinne versteht sich dieses Buch als eine Musikphilosophie, die in einundzwanzig Kapiteln den Kunstanspruch der Neuen Musik unter den Bedingungen der digitalen Revolution reflektiert.
Dispositiv
Wer aus der Halbdistanz der Philosophie auf das Genre ‹Neue Musik› schaut, steht vor einem Paradox: Es ist offenkundig, dass sich ihre ursprüngliche Leitidee des Materialfortschritts im Kontext der akustischen Musik erschöpft hat, ohne dass sich hier ein Umdenken oder gar ein Paradigmenwechsel vollzogen hätte. Weder hat sich eine musikalische Postmoderne entfalten können, die eine Brücke zur Populärmusik schlägt, noch hat sich die Neue Musik im Windschatten der Elektronischen Musik als ‹Experimentalism› neu erfunden, um an ihrem alten Fortschrittsideal festhalten zu können. Für den Mainstream der Neuen Musik gilt, dass sie in den letzten Jahrzehnten ihre eigene Tradition, ihre eigenen Stile, Techniken und Vorbilder rekombiniert. Auch wenn die Szene sich inzwischen für hybride Darstellungsformen geöffnet hat, so tendiert sie in ihrem Kern zur Neuen Klassischen Musik, die sich – wie die Contemporary Classical Music in den USA – in das Repertoire der Klassikkonzerte integrieren will.
Es müssen strukturelle Gründe vorliegen, wenn eine Kunstszene, die aus dem Geiste der Avantgarde geboren wurde, sich in dieser Aporie eingerichtet hat. Wie kommt es zu diesem Widerspruchskonglomerat, zu dieser Intransparenz der Motivlage? Die Antwort lautet: man stößt hier auf ein Dispositiv, das die Neue Musik vor Kritik von innen und außen immunisiert. Interessant wird die Feststellung allerdings nur, weil sie bereits überholt ist, weil dieses Dispositiv der Neuen Musik an den Folgen der digitalen Revolution zerbricht.
Nach Michel Foucault ist ein Dispositiv «ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architektonische Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfasst. Soweit die Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv ist das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft ist»7. Dispositive sind zudem immer ‹Machtdispositive›, die das Denken, Fühlen, Sprechen, das Verhalten und Handeln aller Akteure in einem sozialen Feld präformieren. Oder mit Foucaults Worten: «Das Dispositiv ist also immer in ein Spiel der Macht eingeschrieben, immer aber auch an eine Begrenzung oder besser gesagt: an Grenzen des Wissens gebunden, die daraus hervorgehen, es gleichwohl aber auch bedingen. Eben das ist das Dispositiv: Strategien von Kräfteverhältnissen, die Typen von Wissen stützen und von diesen gestützt werden.»8 Der produktive Ansatz von Foucaults Dispositivbegriff besteht darin, dass er sowohl das «Gesagte» (die Diskurse) als auch das «Ungesagte» (die Institutionen) gleichermaßen als machtrelevante Faktoren betrachtet, die sich wechselseitig bedingen. Das Gefüge der Institutionen bestimmt eine «Grenze des Wissens» und präferiert bestimmte Wissensformen. Der Ansatz erlaubt es, dass sich die Formationen der Macht in einem Feld wie der Neuen Musik als ein Interdependenzverhältnis zwischen Institutionen und Diskursen rekonstruieren lassen. Die These wäre dann, dass die Form ihrer Institutionalisierung sich in der Idee der Neuen Musik niederschlägt, und dass umgekehrt ihr Musikbegriff die Reproduktion der institutionellen Strukturen stabilisiert.
Peter Bürger hat in seiner Theorie der Avantgarde den Institutionsbegriff für die Künste so definiert, dass er auch ihre Diskurse mit einschließt: «Mit dem Begriff Institution Kunst sollen hier sowohl der kunstproduzierende und -distribuierende Apparat als auch die zu einer gegebenen Epoche herrschenden Vorstellungen über Kunst bezeichnet werden, die die Rezeption von Werken wesentlich bestimmen.»9 Wenn man mit diesem Institutionenbegriff arbeitet, gerät der Unterschied zwischen den institutionellen und diskursiven Aspekten allzu leicht aus dem Blick. Deswegen folgen wir hier Foucault und sprechen vom Dispositiv und nicht von der Institution ‹Neue Musik›.
Ein solches Theoriedesign hat zur Folge, dass dieses Buch sich nicht als Institutionenkritik versteht, obwohl es sehr oft die institutionellen Rahmenbedingungen der Neuen Musik diskutiert. Ich glaube nicht, dass man die Neue Musik auf ihrem bisherigen technologischen Stand – dem Stand der klassisch romantischen Musik aus dem 19. Jahrhundert – hätte irgendwie ‹besser› oder ‹gerechter› organisieren können. Die Dispositivanalyse lenkt den Blick eher auf die Realität der Machtverhältnisse, die sich dem Willen und der Einsicht der Akteure widersetzen. Ein Dispositiv ist wirksam und verstellt den Durchblick auf seine Strukturen, weil sich seine institutionellen und diskursiven Elemente wechselseitig bedingen. Für sich genommen wäre die reine Beschreibung eines Dispositivs affirmativ: Sie zeigte ein kulturelles Feld, wie es ist und nicht anders sein kann.
Ihr emanzipatorisches Potenzial entfalten Dispositivanalysen erst in dem Moment, wo sie nicht nur die Realität, sondern auch die Historizität der Machtverhältnisse, d. h. ihr Gewordensein und ihre Kontingenz aufzeigen können. Bei Foucault liegt der Fall klar, insofern es sich bei seinen Untersuchungen zu den Dispositiven der Sexualität, der Macht und der Wahrheit immer um historische Studien einer vergangenen Epoche gehandelt hat, die sich auf der Kontrastfolie der Gegenwart lesen lassen, aber diese nicht selbst analysieren. Indirekt besitzen solche Studien dennoch ein kritisches Potenzial. Man erkennt die Überreste der alten Dispositive in der eigenen Lebenswelt wieder, die sich als nicht mehr zeitgemäße Relikte identifizieren lassen. Man wird durch eine solche Lektüre für Machtverhältnisse sensibilisiert, die längst nicht mehr in den geschichtlichen Konstellationen zementiert sind, sondern sich nur in sozialen Gewohnheiten verankern.
Wie aber verhält es sich mit Dispositivanalysen, denen dieser historische Abstand fehlt, die sich zum Beispiel auf das sehr gegenwärtige Dispositiv der Neuen Musik beziehen? Hier kann man nicht auf die Differenz zwischen dem, was war, und dem, was ist, zurückgreifen. Stattdessen muss der Unterschied zwischen dem, was ist, und dem, was sein wird, konstruiert werden. Es gilt also nicht nur, ein Dispositiv zu beschreiben, sondern auch die Risse zu finden, an denen es auseinanderbricht. An diesem Punkt zweigt die vorliegende Theorie von Foucaults historischer Dispositivanalyse ab. Es wird eine Art Zusatzannahme benötigt, die erklären kann, weshalb ein Dispositiv wider Erwarten instabil wird. Hier lautet unsere Ausgangsthese, dass die digitale Revolution zu einer Entinstitutionalisierung der Neuen Musik führt.
Damit ist ein Forschungsprogramm formuliert: Es gilt erstens die institutionellen Elemente des Neue-Musik-Dispositivs zu identifizieren und auf ihre machtrelevanten Vernetzungseffekte hin zu analysieren, wobei dies immer mit einem Seitenblick auf die Frage passiert, wie und wo es aufgrund der digitalen Revolution hier zu Auflösungs- bzw. Transformationsprozessen kommt. Zweitens muss man den Diskurs der Neuen Musik modellartig rekonstruieren, so dass deutlich wird, wie durch diesen technologischen Umbruch ihre normativen Leitideen institutionell abgewertet und alternative Musikbegriffe institutionell aufgewertet werden.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Institutionalisierung der Neuen Musik kein neutraler Sachverhalt ist, sondern etwas, das die Praxis dieser Kunst entscheidend prägt und normiert. Der Komponist Peter Ablinger ist so frei und spricht es aus: «Spät, aber doch ist mir aufgefallen, dass die Abhängigkeit der Musik von den Institutionen: Orchester, Ensemblebesetzungen, Akademie, Ausbildung, Instrumententradition, Konzertsaal und Musikwissenschaft nicht nur verantwortlich ist für die erdrückende Historizität des Musikbetriebs, sondern auch zur korrumpierenden Falle wird für die neueste Musik oder zumindest ein vorurteilsbelastetes Klima schafft gegenüber allem musikalischen Tun, welches diese Institutionen auch nur teilweise zu umgehen sucht.»10
Dass Orchester, Ensemblebesetzungen, Akademie, Ausbildung, Instrumententradition, Konzertsaal und Musikwissenschaft zur «korrumpierenden Falle» der Neuen Musik werden, hat allerdings weniger damit zu tun, dass es sich hier im Einzelnen um «Institutionen» handelt, sondern liegt darin begründet, in welcher Form die Neue Musik institutionalisiert ist. Wirft man einen Seitenblick auf die Literatur und die Malerei, dann sieht man einen markanten Unterschied. Der Schriftsteller ist zumeist Autodidakt, sprich er hat das Lesen und Schreiben in der Schule erlernt und konnte sein literarisches Talent durch eigene Schreibversuche entfalten. Institutionell war er bislang auf einen Verlag angewiesen, der sein Manuskript technisch reproduziert und einer Leserschaft zugänglich macht. Der Maler erlernt sein Handwerk an einer Kunsthochschule, sein Erfolg wird im großen Maße von Galerien und Museen bestimmt, doch die Produktionsmittel für seine Arbeit – Farbe, Pinsel, Keilrahmen und Leinwand – kann er privat in jedem Malerbedarfsladen erwerben. Neue Musik, die nach wie vor auf alten Instrumenten gespielt wird, ist im Vergleich mit diesen Künsten ein viel voraussetzungsreiches Unterfangen: Sie benötigt gedrucktes Notenmaterial, sie muss von ausgebildeten Musikern in einem Konzertsaal aufgeführt werden, und sie setzt in der Regel ein akademisches Kompositionsstudium voraus. Dies sind drei spezifische ‹Bedingungen der Möglichkeit›, die erfüllt sein müssen, damit Neue Musik überhaupt entsteht. Da es sich hier um Leistungen handelt, die nicht nur kurzfristig bereitgestellt, sondern in einer Kultur längerfristig bereitgehalten werden müssen, sind sie in Form von Musikverlagen, Ensembles und Musikhochschulen institutionalisiert. Wenn man auf dieser basalen Ebene die drei Künste miteinander vergleicht, dann ist die Neue Musik die am stärksten institutionalisierte, d. h. die am stärksten von Institutionen abhängige Kunst.
Die ‹Stärke› einer ‹starken Institution› gründet darin, dass sie definieren kann, wer ‹Mitglied› oder ‹Teilnehmer› von ihr ist und wer nicht. Ob jemand ein Komponist ist und zur Neuen-Musik-Szene dazugehört, wird fast vollständig von den Spielregeln bestimmt, die institutionell festgeschrieben sind. Die Folge ist, dass Rang und Name eines Komponisten unter solchen Bedingungen in einem hohen Maße von institutionellen Entscheidungen abhängen, die nur von einigen wenigen Verlegern, Festivalleitern, Ensembles und renommierten Komponisten getroffen werden können.
Wenn die Musiksoziologie «das ‹Soziotop› neue Musik» als «eine ‹versäulte› institutionelle Struktur» beschreibt «die sich vor allem aus ihrer Abhängigkeit von der staatlichen Kulturförderung und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ergibt»,11 dann legt dies nahe, dass es auch andere Soziotope geben muss, die nicht ‹versäult› sind. Die institutionellen Elemente des Neue-Musik-Dispositivs – also z. B. der Musikverlag, die Musikhochschule oder das Ensemble – besitzen tatsächlich den Charakter von institutionellen Säulen: sie sind als Institutionen starr und tragend zugleich. Dennoch ist es nicht die staatliche Kulturförderung, welche zu jener ‹Versäulung› der Neuen Musik führt, sondern ihr technologischer Stand im letzten Jahrhundert, der die Ausbildung von solchen ‹versäulten› Institutionsformen bedingt hat. Anstelle von mehr oder weniger institutionell versäulten Künsten könnte man auch von stark institutionalisierten und schwach institutionalisierten Kunstsystemen sprechen. Gemeint ist in beiden Fällen, dass es gravierende Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie eine Kunst durch ihre Institutionen präformiert werden kann.
Die Ausgangslage ist also folgende: Die Neue Musik, wie sie sich im letzten Jahrhundert speziell in Deutschland ausgebildet hat, ist eine stark institutionalisierte Kunst. Warum sollte sich an diesem Zustand etwas ändern? Die kurze Antwort lautet: Die digitale Revolution schafft Alternativen. Der Komponist ist nicht länger in dieser ausschließlichen Weise wie bisher darauf angewiesen, bestimmte Dienstleistungen der Institutionen in Anspruch zu nehmen. Sie gibt den Produzenten jene Produktions- und Distributionsmittel an die Hand, die bislang nur institutionell bereitgestellt werden konnten.
In allen Bereichen der Herstellung, Verbreitung und Kommentierung Neuer Musik entstehen technologische Alternativen zu jenen Leistungen, die bislang von den Institutionen exklusiv bereitgestellt werden mussten. Partituren lassen sich am Computer herstellen, Spezialwissen der Neuen Musik lässt sich im Internet finden, die eigenen Stücke lassen sich ganz oder zum Teil mit Instrumentalsamples einspielen, überhaupt wird das Komponieren im Medium der Samples möglich, jeder kann die eigenen Musik über Internetportale verbreiten, und auch die Musikkritik artikuliert sich in unabhängigen Websites und Blogs. Sobald es aber diese Umwege und Nebenwege gibt, verlieren die Institutionen einen Großteil ihrer institutionellen Macht, die ihnen allein aus der Tatsache zuwuchs, dass sie über die Ressourcenverteilung zugleich Akteure inkludieren und exkludieren konnten.
Genau in diesem Sinne führt die digitale Revolution zu einer basalen Entinstitutionalisierung der Neuen Musik›, wobei dieser Begriff hier dynamisch, im Sinne eines Prozesses verstanden werden soll. Zu einer Entinstitutionalisierung kommt es dann, wenn ein stark institutionalisiertes soziales System sich in ein schwach institutionalisiertes soziales System transformiert. Diese Aussage ist keine normative Forderung – derart, dass die Institutionen abgeschafft oder gar zerstört werden sollten, so wie Boulez einst die Opernhäuser sprengen wollte –, sondern beschreibt einen Funktionswandel der Institutionen innerhalb der Neuen Musik. Eine solche Entinstitutionalisierung schließt auch nicht aus, dass sich neue Institutionen zum Beispiel in Gestalt von Internetplattformen oder privat finanzierten Neue-Musik-Akademien ausbilden können. Aber wenn dies geschieht, dann werden diese in einer digitalen Musikkultur nur noch einen schwachen Institutionalisierungsgrad aufweisen. In Zukunft werden alle Institutionen, ganz gleich ob es sich um traditionsreiche oder neugeschaffene Einrichtungen handelt, die Karrieren in der Neuen Musik sowohl weniger behindern als auch weniger befördern können.
Soviel zum methodischen Ausblick auf den institutionellen Aspekt der Dispositivanalyse. In ihrem Licht lässt sich um die Frage nach den diskursiven Elementen des Neue-Musik-Dispositivs stellen. Zunächst gilt es, die Selbstbeschreibung der Neuen Musik in ihrem stark institutionalisierten Kunstsystem zu rekonstruieren. Anschließend kann man die normativ brisante Frage diskutieren, zu welcher Gestalt der Neue-Musik-Diskurs tendiert, wenn die Musik selbst immer weniger durch Institutionen geprägt und vorgefertigt wird.
Es wird sich zeigen, dass die Leitidee der Neue Musik im 20. Jahrhundert eine invertierte Idee der absoluten Musik war, was sich exemplarisch am Werk von Helmut Lachenmann rekonstruieren lässt. Seine Idee von Neuer Musik steht für ein Komponieren im Widerstreit zur Klassischen Musik und ihrem «ästhetischen Apparat»12. Aber sie garantierte auch den Anschluss an die Institutionen der Klassischen Musik, weil sie weiterhin auf alten Instrumenten gespielt wird. Die Institutionen der Neuen Musik teilen also ein Doppelinteresse: größtmögliche Distanz zur klassischen Tradition und Fortschreibung dieser Tradition mit anderen Mitteln. Man bricht mit den tradierten Kompositions- und Spieltechniken, indem man dezidiert auf erweiterte Kompositions- und Spieltechniken setzt.
Dieses genuine Doppelinteresse führt dazu, dass sich auch die Institutionen der Neuen Musik an jener gemeinsamen Leitidee orientieren, die normativ wirksam wird, wenn Komponisten in Verlage aufgenommen oder nicht aufgenommen, von einflussreichen Lehrern gefördert oder nicht gefördert, von Festivals aufgeführt oder nicht aufgeführt werden. Die Leitideen der Neuen Musik restabilisieren die Institutionen, so wie der von den Institutionen prästabilisierte Diskurs zu eben diesen Leitideen konvergiert. Genau dieses Netz von wechselseitigen Abhängigkeiten und positiven Rückkopplungen bildet das Dispositiv der Neuen Musik, wie es sich im 20. Jahrhundert herausgebildet hat, und das mit der Verbreitung des Personalcomputers und dem Entstehen des multimedialen Internets zu Beginn des 21. Jahrhunderts sich aufzulösen beginnt.
Die Entinstitutionalisierung der Neuen Musik führt mittelbar zu einer verstärkten Pluralisierung miteinander konkurrierender Musikkonzepte und Stilrichtungen. Das latente Einverständnis in Bezug auf Idee, Begriff und Funktion Neuer Musik erodiert und die Institutionen orientieren sich mehr und mehr an ihren Eigen- bzw. Selbsterhaltungsinteressen. Die Folge hiervon ist eine weiterreichende Entkoppelung von Diskursen und Institutionen, was unter anderem eine Zersplitterung in viele verschiedene Musikszenen befördert.
Der Unterscheidung von ‹Institution› und ‹Diskurs› folgt auch die Gliederung dieses Buches: Im ersten Teil wird primär die Frage diskutiert, wie die Institutionen der Neuen Musik beschaffen sind und wie sie sich unter dem Anpassungsdruck der digitalen Technologien transformieren. Im zweiten Teil geht es einerseits um eine Kritik des etablierten Diskurses der Neuen Musik, wie er sich unter dem institutionellen Latenzschutz bis heute unhinterfragt fortschreiben konnte. Und andererseits wird der Versuch unternommen, die Idee der Neuen Musik so zu reformulieren, dass sich ihr genuiner Anspruch als Kunstmusik auch in einer digitalen Musikkultur einlösen lässt.
Musikverlage
Die digitale Revolution bricht an vielen Stellen zugleich ein Dienstleistungsmonopol auf. Bei Musikverlagen wird dies offensichtlich, seitdem Komponisten ihre Partituren selbst am Computer herstellen und ausdrucken können.13 Die Frage ist dabei nicht, ob das Notenmaterial der professionellen Verlage besser oder schlechter ist als dasjenige, was sich im Selbstverlag herstellen lässt, sondern, dass sich Partituren überhaupt unabhängig von Verlagen produzieren lassen. Man muss sich noch einmal vergegenwärtigen, dass es vor gut dreißig Jahren keine öffentlichen Copyshops gab und Musikverlage bis zu diesem Zeitpunkt das Vervielfältigungsmonopol für Noten besaßen. Mit den Notenschreibprogrammen wird ihnen diese Geschäftsgrundlage entzogen, was nicht nur den unmittelbaren Notendruck betrifft, sondern auch die institutionelle Funktion, die der Verlag im Neue-Musik-System mit dieser Dienstleistung erfüllen konnte.
Zusätzlich prekär wird die Situation für Musikverlage, wenn es nicht nur gute Gründe für Komponisten, sondern auch für Musiker gibt, auf gedrucktes Notenpapier zu verzichten. Man kann sich die Noten auch am Notebook anzeigen lassen, was sich immer öfters beobachten lässt. Der Blick auf den Bildschirm entlastet die Musiker vom Umblättern per Hand, das entweder per Fußmaus ausgelöst oder automatisch gesteuert wird. Zudem erlaubt das digitale Notenpult den Musikern, sich ohne Beleuchtungsaufwand flexibel im Raum zu positionieren.
Eine weitere wichtige Funktion besitzen Musikverlage darin, das Werk eines Komponisten zu verbreiten, zu bewerben und zu vermarkten. Das heißt vor allem, den verlagseigenen Komponisten Aufträge und Aufführungen zu vermitteln, sich für die Ausstrahlung ihrer Werke im Rundfunk einzusetzen, ihnen eine CD-Einspielung zu ermöglichen und Pressearbeit zu leisten. Hinter diesen Arbeiten steht ein starkes Eigeninteresse, da die Verlage am öffentlichen Erfolg des Komponisten finanziell beteiligt sind, und zwar an den GEMA-Einnahmen, den Ausleihgebühren für das Notenmaterial, am Notenverkauf und an den Synchronisationsrechten in Film oder Fernsehen. Auch bei diesen sekundären Funktionen verändern sich die kulturökonomischen Parameter. Es ist natürlich nach wie vor von Vorteil, wenn sich ein Verlag mit all seiner institutionellen Macht um diese Dinge kümmern kann, und viele Komponisten werden auch in Zukunft auf diese Dienstleistungen nicht verzichten wollen. Aber auch hier gibt es nun Alternativen zur verlagsgebundenen Herstellung von Öffentlichkeit und Präsens eines Komponisten: über das Internet, über Blogs, Websites und Videoplattformen. Auch solche Nebenwege zum Erfolg, die es vor einem Jahrzehnt noch nicht gab, schaffen für die Musikverlage eine neue Situation.
Vor der digitalen Revolution der Neuen Musik galt: Neue Aufträge können nur an Akteure verteilt werden, die sichtbar und erfolgreich sind. Da aber in der Regel nur Komponisten, die an einen Verlag gebunden waren und von denen sich ein Ensemble das Notenmaterial ausleihen konnte, auf Festivals gespielt wurden, generierte ein Verlag den Erfolg seiner Komponisten zu einem beträchtlichen Teil selbst. Diese Form der Selbstprogrammierung gehörte (und gehört) zum Geschäftsmodell der Musikverlage hinzu.
Im Zeitalter technologischer Umbrüche wechseln traditionelle Vorteile allerdings ihre Vorzeichen und können sich über Nacht in Nachteile verwandeln. So ist damit zu rechnen, dass in Zukunft die Veranstalter der Musikfestivals ihre Aufträge verstärkt an jene Komponisten vergeben, die keinem Verlag verpflichtet sind – weil sich damit unnötige Ausleihgebühren einsparen lassen.14 Viele Komponisten werden von sich aus keine Verlagsbindung mehr eingehen wollen, denn je mehr der Musikverlag seinen angestammten Aufgabenbereich verliert, desto mehr schwindet auch sein Vermögen, hauseigene Komponisten im Festivalbetrieb zu etablieren, bis es sich für die meisten Komponisten schlicht nicht mehr lohnt, mit diesem die GEMA-Einnahmen zu teilen. Wo es nicht um große Bühnen- und Orchesterwerke geht, d.h. um den Großteil der Kompositionen in der Neuen Musik, ist die Situation längst gekippt: Man stellt die Partituren gratis auf Internetportalen wie «copy-us» ein, weil offenkundig geworden ist, «dass sich … der physische Vertrieb und Verkauf von kleinen Partituren nicht mehr lohnt»15.
Durch die Digitalisierung der Neuen Musik ergeben sich auch neue Aufgabenfelder für die Musikverlage, von denen aber noch nicht absehbar ist, dass sich ihre Vermarktung für sie rechnen wird. Wahrscheinlicher ist es, dass hier Eigenverlage wie der von den Komponisten Peter Ablinger, Bernhard Lang u. a. gegründete Verlag Zeitvertrieb entstehen, über den es auf der Homepage programmatisch heißt: Er «soll über das Notenherstellen konventioneller Musikverlage hinausreichen und neben der traditionellen Bereitstellung von Notentexten auch die Vermittlung von Klanginstallationen, Klangobjekten, Tonträgern etc. bewerkstelligen. Eine umfassende Thematisierung von Aufführungsbedingungen kann auch vor der Verlagsstruktur nicht haltmachen; auch diese stammt – wie die klassischen Instrumente – aus früheren Jahrhunderten und wartet wie diese auf eine Neustrukturierung, auf den Umbau.» Das Grundprinzip der neuen Verlagsstruktur sei die «Nicht-Abhängigkeit»16.
Die institutionelle Macht der Musikverlage lag nicht darin begründet, dass sie eine spezifische Leistung erbrachten, sondern darin, dass Komponisten auf einer bestimmten Stufe ihrer Karriereleiter alternativlos darauf angewiesen waren, dass ein Verlag ihre Partituren publiziert. In dieser institutionellen Macht lag auch das symbolische Kapital begründet, mit dem ein Verlag indirekt die Aufführungspraxis beeinflussen konnte, insofern sein Name, sein Programm und die übrigen hauseigenen Komponisten für Qualität bürgten. Doch auch symbolisches Kapital inflationiert, wenn ihm die reale Deckung mit institutioneller Macht abhanden kommt. Gerade weil Komponisten damit rechnen konnten, dass die Bindung an einen Verlag automatisch auch mit einer Akquise von Aufführungen verbunden war, war es selbstverständlich, die Verlage prozentual an den Einnahmen ihrer Aufführungen zu beteiligen. Können Verlage hingegen ihre Dienstleistungen nicht mehr exklusiv anbieten, treten Agenturen auf den Plan, die sich nicht mehr pauschal für symbolisches Kapital, sondern für die je konkrete Auftragsvermittlung bezahlen lassen. Schon Karlheinz Stockhausen kam aufgrund einer einfachen Kosten-Nutzen-Rechnung zu dem Schluss, dass es offenbar lukrativer ist, Universal Edition zur verlassen und seine Werke selbst zu verlegen.
Mit der Digitalisierung der Musik wird sich die Stellung der großen Musikverlage im Neue-Musik-System verändern. Am wahrscheinlichsten ist ein schleichender institutioneller Einflussverlust, wenn diese sich weiterhin auf jene Musik konzentrieren, die auf alten Instrumenten gespielt wird und im Konzertsaal ihren genuinen Aufführungsort besitzt. Den Verlagen bleibt zwar die Kompetenz für die so genannte Contemporary Classical Music erhalten, aber der Kunstanspruch und die Idee von Neuer Musik wird sich infolge der digitalen Revolution so stark verändern, dass sie ihr traditionelles Vermögen, die Wertestandards in der Neuen Musik mit bestimmen zu können, ein Stück weit verlieren werden.
Die andere Option wäre, dass die traditionsreichen Verlage auf diese neue Problemlage aktiv reagieren. Insofern es mit der Absenkung der Zugangsbarrieren heute zu einer zunehmenden Demokratisierung der Hochkulturkünste kommt, führt dies auch zu einer permanenten Komplexitätsüberforderung. Es wird auch in der Neuen Musik immer schwieriger, einen Überblick über die Vielzahl der neu entstandenen Werk und der aktiven Komponisten zu gewinnen und jenes ‹Niveau› aufrechtzuerhalten, das in dem stark institutionalisierten Neue-Musik-System des 20. Jahrhunderts selbstverständlich war. Wenn jedoch die passiven Qualitätsfilter, zu denen auch die Verlage gehörten, nicht mehr den Zugang zur Neuen Musik regulieren können, muss es zu einer aktiven, nachträglichen Filterung der Werke kommen. Das Übermaß an Komplexität lässt sich nur durch ein Mehr an Selbstreflexion kompensieren. Gut sortierte und kommentierte Internetplattformen, welche die Werke von Komponisten stil- und genreübergreifend zugänglich und vergleichbar machen (und sich gerade nicht nur auf die Contemporary Classical Music beschränken), sind hierfür ein probates Mittel. Um den Kunstanspruch der Neuen Musik aufrechterhalten zu können, braucht man verstärkt die Möglichkeit der öffentlichen Reflexion, des wissenschaftlichen Kommentars und der professionellen Kritik. Im Prinzip besitzen die traditionsreichen Musikverlage bereits diese kulturelle Kompetenz. Schott Music führt zum Beispiel die von Robert Schumann begründete Neue Zeitschrift für Musik weiter, publiziert ganze Buchreihen zur Theorie und zum Diskurs der Neuen Musik und unterhält seit einem halben Jahrhundert das für die Neue Musik repertoirebildende CD-Label WERGO. Es scheint zumindest nicht ausgeschlossen zu sein, dass die Musikverlage im Zeitalter der Digitalisierung, in dem ihre alten Geschäftsmodelle kollabieren, sich neu aufstellen und neu erfinden können. Sie müssten allerdings versuchen, den Schwerpunkt ihrer Arbeit zu verlagern: weg von der Produktion des Notenmaterials hin zur Reflexion der Werke.
Musikhochschulen
Bis vor kurzem war das persönliche Studium bei einem Lehrer an einer Musikhochschule die einzige Möglichkeit, sich die avancierten Kompositionstechniken, Spieltechniken und Notationstechniken anzueignen. Entsprechend wurde das kompositorische Wissen der Neuen Musik im 20. Jahrhundert noch ähnlich wie in den mittelalterlichen Handwerkerzünften von Meistern an ihre Schüler weitergegeben und besaß den Charakter eines Geheimwissens. Wo sonst an der Massenuniversität gibt es noch den institutionalisierten Einzelunterricht, wie er im Kompositionsstudium üblich ist, und wo sonst bildet man noch ‹Meisterschüler› aus? Es lag in der Hand des Lehrers, talentierte Schüler zum Studium anzunehmen, sie über Empfehlungen zu fördern, ein ‹Schule› zu begründen und sogar den eigenen Nachfolger im Geiste zu bestimmen. Auch hier kommt es zu einer Schleifenbildung, d. h. einer positiven Rückkoppelung von Reputation in den Lehrer-Schüler-Beziehungen: Der Schüler ist auf persönliche Wissensvermittlung angewiesen, wird damit zum Mitglied einer Schule, der Ruhm des Lehrers wiederum begründet und verbreitet sich über den Erfolg seiner Studenten – allein schon weil sie sich den Verdienst erworben haben, seine Schüler gewesen zu sein.17
Stark institutionalisierte soziale Systeme tendieren dazu, sich in Form einer Großfamilie zu organisieren. Jeder kennt jeden, man fühlt sich wahlverwandtschaftlich miteinander verbunden, so dass auch das Klima in der Neuen Musik um vieles familiärer als in den coolen Kunstszenen ist. Eine solche Form der Vergesellschaftung bringt starke Lehrer-Schüler-Bindung hervor. Aufgrund dieser Umstände war es immer schon ratsam gewesen, bei Rihm, Spahlinger oder Lachenmann zu studieren, und zwar nicht, weil diese Komponisten in einer besonderen Weise ihre Schüler protegiert haben, sondern weil die Institutionen – die Festivals, die Verlage, die Hochschulen, die Ensembles – auf diese Namen hören.
Die hier entwickelte Theorie der Entinstitutionalisierung dient nicht der Dekonstruktion ‹patriarchaler Machtverhältnisse›; wenn es zu einer Entinstitutionalisierung kommt, dann dekonstruiert das betroffene soziale System solche Herrschaftsformen selbst. Vielmehr soll der Nachweis erbracht werden, dass die autoritäre Kommunikation einer bestimmten Form der Wissensvermittlung entsprungen ist, die sich – selbst mit gutem Willen und politisch korrekter Theorie – nicht viel anders hätte organisieren lassen. Erst jetzt – im Zeitalter des Internets mit seinen digitalen Partituren, Einspielungen im MP3-Format, Videomitschnitten ganzer Aufführungen auf YouTube, InstantEncore oder der eigenen Homepage – ergeben sich technologische Alternative zum üblichen Unterricht. Ein Großteil des Spezialwissens in der Neuen Musik wird frei zugänglich, so dass das Kompositionsstudium zwar nicht lehrerunabhängig, aber doch um vieles lehrerunabhängiger wird als bisher und sich über Ländergrenzen, Kulturgrenzen und Genregrenzen hinweg verbreiten kann.18 Im Extremfall wird sich der persönliche Unterricht bei einem Lehrer auf Sommerkurse reduzieren, wenn man ansonsten auf einem anderen Kontinent lebt und virtuell im Kontakt bleiben kann. Kompositionsstudenten aus aller Welt gewinnen so Zugang zur Neuen Musik, auch wenn sich in ihren Kulturen nicht die erforderlichen Institutionen ausgebildet haben.
Die Entinstitutionalisierung der Neuen Musik bewirkt genau jene Öffnung der Musikhochschulen, wie sie von Heiner Goebbels gefordert wird: «Es gibt vor allem noch eine Grenze, die es einzureißen gilt, und die liegt bei der klassischen akademischen Musikausbildung. Es wäre sicher für alle von Vorteil, die Kompositionsklassen auch zu öffnen für Talente mit einer anderen musikalischen Kultur. Viele der besten Performer und Kollegen, mit denen ich in den letzten zwanzig Jahren arbeiten durfte, können vielleicht nicht einmal Noten lesen (ich darf jetzt keine Namen nennen …), ihr Blick auf die Musik scheint aber wesentlich kreativer als so vieles, was aus den klassischen Werkstätten kommt.»19 Dass die Musikausbildung das ganze 20. Jahrhundert hindurch «klassisch akademisch» geblieben ist, hat weniger etwas mit Konservatismus zu tun als mit dem Umstand, dass die handwerklich organisierte Produktionsweise von akustischer Musik bislang alternativlos war. An den deutschen Musikhochschulen werden immer noch zu neunzig Prozent Musiker für die Klassische Musik ausgebildet; an manchen Instituten gibt es fünf Klavierprofessuren und eine Stelle für Komposition in Neuer Musik.
Virtuelle Orchester
Die Entinstitutionalisierung der Neuen Musik dürfte in Bezug auf die institutionellen Säulen des Musikverlags und der Musikhochschule evident und von der Faktenlage kaum zu bestreiten sein. Viel weniger offensichtlich sind hingegen die Folgeerscheinungen der Digitalisierung für ihren Aufführungsapparat. Die Einspielung einer Partitur ist das eigentliche Nadelöhr für den Komponisten. Sie ist ein rares und teures Gut, dessen Wert sich danach bemisst, in welchem Kurs das entsprechende Ensemble steht. Die symbiotische Abhängigkeit von Musikern und Komponisten ist kaum zu überschätzen und führt unter anderem dazu, dass viele erfolgreiche Komponisten – man denke an Schönberg, Stockhausen, Maderna, Boulez, Ruzicka, Zender, Furrer oder Poppe – zugleich Dirigenten waren oder sind. Zum Teil haben sie ihr eigenes Ensemble gegründet und konnten so ihren institutionellen Handlungsspielraum potenzieren. Diese Tendenz zur Doppelkarriere bleibt solang bestehen, solange es zur Praxis und zum Begriff der Neuen Musik gehört, dass sie auf alten Instrumenten eingespielt wird und der Komponist ein ausgebildeter Musiker ist.
Die Überlegung, dass es in der Neuen Musik auch zu einer Entinstitutionalisierung ihres Aufführungsapparats kommen könnte, nimmt ihren Ausgangspunkt im Kontext der Klassischen Musik. Richtungweisend ist hierbei die Erfindung des «digitalen» oder auch «virtuellen Orchesters», wodurch es möglich wird, Partituren mit Hilfe von Instrumentalsamples einzuspielen. Die Idee nahm Anfang der Nuller Jahre Gestalt an, als sich Festplatten im zwei bis dreistelligen Gigabytebereich herstellen ließen, auf denen ein solches ‹virtuelles Orchester› Platz findet, und Computerprozessoren schnell genug wurden, auf diese riesigen Datenmengen in Echtzeit zuzugreifen.
Jeder Klang eines klassischen Instruments kann einerseits in einer Instrumentendatenbank abgespeichert und andererseits von einer digitalen Partitur angesteuert werden. Es lassen sich damit erstmals in der Musikgeschichte alle geschriebenen und ungeschriebenen Partituren des ‹klassischen Genres› akustisch realisieren, ohne dass sie live mit einem Orchester aufgenommen wurden. Die Maßstäbe setzt hier die Vienna Symphonic Library (VSL), deren Einspielungen schon vor Jahren eine solche Qualität erreicht hatten, dass selbst Musikexperten nicht mehr entscheiden konnten, welche Aufnahmen real und welche virtuell sind.20 Wenn überhaupt, dann erkennt man die virtuelle Musik an ihrer Perfektion, sprich an ihrer Fehlerlosigkeit. Sollte es diese Form von Natürlichkeit sein, die vermisst wird, kann sie aber mit einer Verschmutzungsfunktion hinzuprogrammiert werden; man müsste nur eine Samplesammlung mit den häufigsten Spielungenauigkeiten anlegen.
Selbstverständlich können die Partituren nicht bloß maschinell reproduziert, sondern in Bezug auf alle musikalischen Parameter variiert – und damit auch interpretiert – werden. Auf diese Weise lassen sich auch die großen klassischen Orchesterwerke einspielen, was spätestens dann in der Musikwelt registriert wird, wenn ein namhafter Dirigent den digitalisierten Klangkörper für sich entdeckt, so wie einst Glenn Gould das Tonstudio für sich entdeckt hatte und sich aus dem Konzertbetrieb zurückzog.21 Sieht man, dass selbst die Raumwirkung und die menschliche Stimme (zunächst als Chor) Schritt für Schritt in die Vienna Symphonic Library integriert werden, ahnt man, dass das samplebasierte virtuelle Orchester der Kreativität und dem Ausdruckswillen keine technologischen Grenzen setzen wird. Sollten die Musikkritiker und Musikliebhaber auch in Zukunft ihre Listen der besten Klassik-Einspielungen aufstellen, dann dürfte darunter auch die ein oder andere virtuelle Einspielung zu finden sein.
Auf den ersten Blick mag es aussehen, als ob die Erfindung des virtuellen Orchesters rein ökonomische und praktische Effekte haben wird, weil sie die Produktion von klassischer Gebrauchsmusik billiger macht oder überhaupt erst ermöglicht. In diesem Sinne könnte etwa der Organist einer Gemeinde mit seinem Kirchenchor eine Bachkantate aufführen, obwohl ihm hierfür das Orchester fehlt. Bahnbrechende Innovationen entwickeln jedoch eine Eigendynamik – erst das macht sie revolutionär. Sie schaffen sich ihre eigenen Applikationen und können so ganz neue Berufsfelder erschließen. So veranstaltet der Dirigent Paul Henry Smith inzwischen ‹Live-Aufführung› von Beethoven Symphonien, die er vorab mit der Vienna Symphonic Library eingespielt und interpretiert hat.22 Mit Hilfe einer Fernbedienung, die ihm als Dirigentenstab dient, und einem Dirigentenpodest, das auf Gewichtsverlagerungen reagiert, vermag er Lautstärke, Balance und Tempowechsel des Stückes während der Aufführung zu variieren und kann so wie ein normaler Dirigent auf die konkrete Konzertsituation reagieren. Vor allem wenn Smith mit Instrumental- und Gesangssolisten zusammenarbeitet, kommen die Möglichkeiten der Interaktion zum Tragen. Paul Henry Smith hat seinem virtuellen Orchester den schönen Namen The Fauxharmonic Orchestra