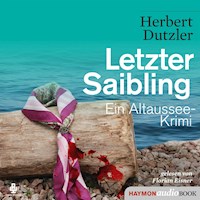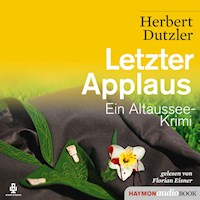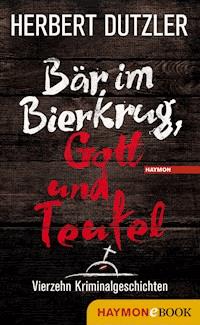Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
DIE WURZELN DES BÖSEN REICHEN TIEF Das kleine Mädchen Alexandra musste schon früh lernen, was es heißt, wenn jemand GRUNDLOS BÖSE ist, wenn jemand voll von HASSE, FRUST UND AGGRESSION ist. Die erwachsene Frau Alexandra scheint die schwere Kindheit völlig hinter sich gelassen zu haben - doch wirkt das nur an der Oberfläche so. Von den düsteren Geheimnissen, die in ihr schlummern, wissen weder ihr Mann noch ihre beiden Kinder. Manchmal sind sie so weit weg, dass selbst Alexandra sie vergisst. EIN LOTTERIEGEWINN: ÜBERRASCHENDER GELDSEGEN ODER FLUCH? Eines Tages gerät Alexandras heile Welt aus den Fugen: EIN MILLIONENGEWINN ENTPUPPT SICH MEHR ALS FLUCH DENN ALS SEGEN. Plötzlich fühlt Alexandra sich allein. Ihr Ehemann wird ihr von Tag zu Tag fremder, Heimlichkeiten vor Freunden sind an der Tagesordnung, die Kinder stellen materielle Ansprüche, NICHTS IST MEHR SO, WIE ES WAR - da beginnt ALEXANDRAS FASSADE ZU BRÖCKELN. Sie spürt: DIE SCHATTEN IHRER VERGANGENHEIT FALLEN NOCH IMMER DÜSTER AUF IHRE SEELE. Und dann regt sich in ihr jenes zornige kleine Mädchen, das damals dem Bösen direkt ins Auge geblickt hat … HERBERT DUTZLER ZEIGT DIE DUNKLE SEITE SEINES KÖNNENS Herbert Dutzler, bisher vor allem durch die sensationell erfolgreiche Krimiserie um Kultfigur Franz Gasperlmaier bekannt, legt einen Kriminalroman vor, der einen packt und nicht mehr loslässt. Seine Figuren zeichnet Dutzler präzise und mit viel psychologischem Tiefgang - kein menschlicher Abgrund bleibt hier unentdeckt. Er schaut in die Seelen seiner Figuren und zeigt, WOZU MENSCHEN FÄHIG SEIN KÖNNEN, WENN SIE IHR GANZ PRIVATES GLÜCK IN GEFAHR SEHEN. Menschen wie du und ich sind es, die hier handeln, und ihre Taten sind so nachvollziehbar, dass man sie sogar den eigenen Freunden zutrauen würde. Das Böse liegt oft bedrohlich nah …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbert Dutzler
Die Einsamkeit des Bösen
I
Ich trage das weiße Kleid mit den roten Punkten. Es ist schmutzig, vorne, am Bauch und über der Brust. Das kommt vom Klettern auf die Bäume im Obstgarten. Ich komme am weitesten hinauf, weiter als Walter und Tobi. Einmal bin ich heruntergefallen. Aber ich habe nicht geweint. Unten am Saum ist das Kleid auch ein bisschen aufgerissen. Mama wird schimpfen, wenn sie mich so sieht, mit diesem Kleid hätte ich nicht auf einen Baum klettern dürfen. Aber Minka war doch oben! Vielleicht habe ich Glück und Papa ist in der Nähe, dann wird Mama mir nur vorwurfsvolle Blicke zuwerfen und schweigen. Sonst gibt es gleich wieder Geschrei und Türenschlagen. Stundenlang. Dass Mama mit der Erziehung überfordert ist und ob sie denn überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, dass sie völlig unfähig ist, zu allem, und warum er sie überhaupt geheiratet hat und so weiter. Wenn Papa in der Nähe ist, lassen wir es auf keinen Streit zwischen uns ankommen, nie. Gott sei Dank ist ihm der Schmutz auf meinem Kleid nicht aufgefallen, als er mich hier eingesperrt hat.
Dafür ist ihm aufgefallen, dass ich unnötig Lärm gemacht habe. Zwei Topfdeckel habe ich zusammengeschlagen, und dazu habe ich gesungen und bin im Vorhaus auf und ab marschiert. Ich habe Musikkapelle gespielt. Ich hätte immer schon gern Schlagzeug gelernt und bei der Kapelle die Becken geschlagen. Und weil ich das eben nicht darf, muss ich im Vorhaus mit Topfdeckeln üben. Ich hätte mir natürlich denken können, dass ihm das zu laut ist, viel zu laut. Und dass er es überall im Haus hören kann. Aber erstens habe ich geglaubt, dass er mit dem Traktor unterwegs ist, und zweitens habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob ich jemanden störe. Ich wollte eben unbedingt Blaskapelle spielen, als mir die Topfdeckel in die Hände gefallen sind. Topfdeckel, finde ich, muss man einfach in die Hände nehmen und zusammenschlagen, wenn sie so lautlos auf der Küchenanrichte herumliegen.
Ich bin furchtbar erschrocken, als er mich plötzlich am Arm gepackt und in die Speisekammer gesteckt hat. „Du warst das!“, hat er nur geschrien, immer wieder. Bis die Tür hinter mir ins Schloss gefallen ist. Jetzt ist sie abgeschlossen.
Normalerweise wird ja Walter eingesperrt. Zumindest viel öfter als ich. Der bekommt allerdings vor dem Eingesperrtwerden noch ein paar Ohrfeigen. Die sind in letzter Zeit immer heftiger geworden, oft hat Walter blaue Flecken im Gesicht, einmal hat er sogar ein blaues Auge gehabt, und Mama hat ihn nicht in die Schule gehen lassen. Damit niemand merkt, dass Papa ihn schlägt. Oft muss Walter auch in den Keller, meistens dann, wenn er mich verprügelt hat. Walter ist hinterhältig, schnappt oft von hinten zu, nimmt mich um die Mitte, hält mich fest. Dann drückt er meinen Kopf in seinen Schoß, bis ich keine Luft mehr bekomme. Wenn Walter dann nach seiner Bestrafung wieder aus dem Keller herausdarf, rächt er sich an mir, reißt mich an den Haaren oder zwickt mich in die Ohrläppchen. Walter ist kein angenehmer Bruder, Tobi ist mir viel lieber.
Ich habe Zeit und schaue mich genau um. Rund um die Türschnalle ist der weiße Lack abgewetzt, an manchen Stellen bis auf das rohe Holz darunter. Ich drücke die Schnalle hinunter und rüttle ein wenig an der Tür. Es ist wirklich zugesperrt, und draußen in der Küche ist es ganz ruhig. Ich spähe durch das Schlüsselloch. Auf der anderen Seite steckt der Schlüssel, man kann nur ein wenig Licht aus der Küche schimmern sehen. Papa ist wahrscheinlich fortgegangen, und Mama wird im Gemüsegarten sein. Himbeeren pflücken vielleicht. Ich würde auch gerne Himbeeren pflücken. Ich drehe mich um und sehe zum Fenster hinaus. Ein Stück geschotterter Hof, in dem da und dort ein Büschel Löwenzahn wächst. Dahinter der Schuppen mit dem riesigen Tor, das fast immer offen steht. Drinnen der Traktor. Der war auch schon wieder kaputt, und Papa hat sich fürchterlich aufgeregt. Zuerst, dass er die Reparatur selber nicht hinbekommen hat, obwohl er einen ganzen Tag mit nacktem Oberkörper im Schuppen gestanden ist und in den Eingeweiden der Maschine herumgewühlt hat. Und dann darüber, wie viel der Landmaschinenmechaniker dafür verlangt hat. Getobt hat er und eine Bierflasche gegen die Wand geworfen, nachdem er das Kuvert mit der Rechnung geöffnet hatte. Dann hat er mit einem Arm ausgeholt und Tobi im Genick getroffen. Walter ist ihm entwischt, Walter ist meistens der Schnellere. Mama hat nichts gesagt.
Manchmal habe ich so einen Traum, nicht im Schlaf, sondern beim Nachdenken. Vielleicht ist Papa gar nicht unser wirklicher Vater. Oder zumindest nicht meiner. Vielleicht bin ich als Pflegekind in diese Familie gekommen oder adoptiert worden. Und bald wird ein großes, glänzendes Auto auf unseren Hof fahren, und meine wirklichen Eltern werden aussteigen und mich mitnehmen. Und ich werde Papa nie mehr wiedersehen müssen.
Der Kühlschrank springt ratternd an. Es ist ein besonderer Kühlschrank, er ist so groß, dass ich und meine Brüder leicht darin Platz hätten. Zwei weiße Türen hat er, und er ist so hoch, dass ich ohne Stuhl höchstens bis zum dritten Regal von unten komme. Drinnen sind Holzroste. Es ist nicht so ein Kühlschrank wie bei meiner Freundin Evi, der ist so niedrig, dass man sich mit Schwung draufsetzen kann, wenn man hochhüpft. Oben hat er eine graue Plastikplatte und drinnen Regalfächer aus Glas. Und er brummt auch nicht so schaurig wie unser Kühlschrank.
Ich ziehe eine Tür auf und sehe hinein. Ob ich mich hineinsetzen soll? Ich müsste ein wenig ausräumen. Und dann zumachen. Und das Licht einschalten, das kann man nämlich auch von drinnen. Tobi hat’s schon einmal ausprobiert. Auf dem untersten Regal steht eine Flasche von dem teuren Saft, den Mama wegen ihrer Gesundheit trinken soll, den dürfen wir nicht einmal anrühren. Ich nehme die Flasche in die Hand und schraube den Deckel ab. Kalt, sämig und süß ist der Saft. Unglaublich gut schmeckt er mir. Ich nehme die Wasserflasche, die danebensteht, und fülle nach, sodass man nichts merkt. Mama wird nicht schimpfen, sie weiß, wie gut mir ihr Saft schmeckt, und manchmal gibt sie mir ohnehin etwas davon ab.
Bei Papa weiß man nie. Wenn er sich über irgendetwas ärgert, fängt er zu schreien an. Und dann genügt jede Kleinigkeit, dass er auf uns losgeht. Mich hat er noch nie geschlagen, mich sperrt er nur ein. Wenn er mich auch nur einmal anrührt, hat Mama gesagt, dann geht sie weg. Dann kann er sie lange suchen und wird sie nicht finden. Wenn er mich auch nur einmal anrührt. Meine beiden Brüder dagegen bekommen immer wieder einmal etwas ab. Er hat selbst auch viele Ohrfeigen bekommen, sagt Papa, und es hat ihm nichts geschadet. Ich glaube aber doch, denn man muss sich vor ihm fürchten. Ich möchte nicht jemand werden, vor dem sich andere Leute fürchten. Ich möchte so werden wie Frau Liebscher, meine Lehrerin. Sie ist immer freundlich und lustig, und ich glaube, sie muss sich auch vor nichts fürchten.
Lange dauert das heute schon. Ich muss aufs Klo. Hoffentlich macht mir bald jemand auf. Ich stelle einen Schemel unter das Fenster und sehe hinaus. Ein Stück blauen Himmel kann ich sehen, und den Schotterboden, der hell in der Sonne gleißt. Ob ich versuche, zum Fenster hinauszukommen? Langsam schiebe ich die Flaschen und Dosen beiseite, die auf dem Regal vor dem Fenster aufgebaut sind. Vorsichtig achte ich darauf, dass nichts hinunterfällt und kaputtgeht. Denn wenn Papa merkt, dass ich etwas hinuntergeworfen habe, dann habe ich noch viele Stunden in der Speisekammer vor mir.
Plötzlich knirschen Schritte draußen auf dem Schotter. Ich erschrecke, schubse unabsichtlich eine Flasche zur Seite und hüpfe vom Schemel. Die Flasche klirrt zu Boden, heller, klebriger Saft läuft aus. Papa ist draußen. Er beschattet die Augen mit einer Hand und versucht, durch die Scheibe zu spähen. Er sieht mir direkt in die Augen. Hat er das Klirren gehört? Drohend deutet er mit dem Finger. Er hat wohl gemerkt, dass ich durch das Fenster flüchten wollte. Aber das Klirren ist ihm anscheinend entgangen.
Ich drehe mich um, flüchte zur Tür. Ich muss jetzt wirklich dringend aufs Klo. Draußen höre ich den Traktor polternd anspringen. Dicht am Fenster vorbei rattert Papa in Richtung Hofzufahrt. Jetzt könnte Mama eigentlich kommen. Ich rüttle an der Tür, obwohl ich weiß, dass sie nicht nachgeben wird. „Mama!“, schreie ich, jetzt, wo ich Papa außer Hörweite weiß. „Mama!“ Es dauert unglaublich lange, bis ich Schritte in der Küche höre. Es ist aber nicht Mama, die die Türe aufsperrt, es ist Walter. „Führ dich nicht so auf, du dumme Gurke!“ Walter versucht mir ein Bein zu stellen, als ich aus der Speisekammer laufe, doch ich springe darüber. Ich kenne seine Tricks. „Blöde Kuh!“, schreit er mir noch hinterher.
Ich haste aufs Klo und verschließe die Tür. Als ich es endlich laufen lassen kann, wird mir ein wenig wohler. Hier bin ich auch eingesperrt, aber ich habe es selbst in der Hand, wann ich wieder hinausgehe und ob ich jemanden hereinlasse. Schön kühl ist es. Am liebsten würde ich hier bleiben.
Ich nehme den Saum meines Kleides in die Hand. Da ist wirklich ein langer Riss im Stoff. Es ist eines von meinen besseren Kleidern. Eigentlich das beste. Das, das ich an besonderen Schultagen und am Sonntag zur Kirche immer anziehe. Ich weiß selber nicht, warum ich es heute nach der Schule nicht ausgezogen habe, ich habe nicht darüber nachgedacht, auch nicht, als ich zu Minka auf den Baum geklettert bin. Gerade, als ich oben war und sie auf meinen Schoß nehmen wollte, um sie zu streicheln, ist das dumme Tier aber wieder hinuntergesprungen.
Ich stehe auf, ziehe meine Unterhose hoch, drücke den Spülknopf und setze mich wieder auf den Toilettensitz, noch während das Wasser unter mir rauscht. Manchmal wäre ich gerne ganz weit weg. Ich habe ein Buch, ein Bilderbuch, für das ich eigentlich schon zu alt bin. Es spielt im Wald, und da leben Zwerge, Insekten und Schnecken friedlich zusammen. Sie wohnen in hohlen Bäumen, in Pilzen und Rindenhäuschen. Und immer sind alle gut gelaunt und fröhlich und vor allem nett zueinander. Dort würde ich gerne wohnen. Ich würde Beeren und Pilze sammeln und mit dem Eichhörnchen und zwei Hasen zusammen in einer Rindenhütte leben. Und jede Woche würde ich zu den Bienen gehen, um Honig zu holen, und jeden Morgen zu den Kühen, um Milch im Haus zu haben.
Dass Papa einmal nett zu mir war, das ist lange her. Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Wenn Mama nicht immer sagen würde: „Er kann auch lieb sein! Ich hätte ihn doch nie geheiratet, wenn er nicht auch lieb sein könnte“, dann würde ich es gar nicht glauben. Und sie sagt, dass es nur die Sorgen sind, die ihn so gemacht haben, wie er jetzt ist. Und zu diesen Sorgen gehören wir auch, Walter, Tobi und ich. Ich habe jetzt zum Beispiel mein bestes Kleid zerrissen, Tobi macht ins Bett, und Walter gehört zu den ganz schlimmen Kindern in der Schule.
„Xandi! Xandi! Wo bist du denn?“ Mama ruft nach mir, und ich stehe auf, spüle noch einmal hinunter und komme aus dem Klo heraus. „Am Klo! Ich komme schon!“
Als ich in die Küche trete, steht Mama an der Anrichte und wäscht Marillen. Sie streicht mir übers Haar, als ich mich neben sie stelle. „Willst du mir vielleicht die Kerne aus den Marillen holen?“ Ich nicke und nehme mir eines der kleinen Messer, um die Marillen auseinanderzuschneiden. „Oh Gott!“, ruft Mama, „Wie sieht denn dein Kleid aus? Das ist dein bestes!“ Ich sehe betroffen an mir hinunter. „Schnell, zieh es aus, und zieh irgendwas Schmutziges an. Mit den Marillen patzt du dich sicher auch noch an. Und tu’s gleich in die Wäsche, damit es der Papa nicht sieht!“ Ich laufe in mein Zimmer und hole mir ein altes, fleckiges T-Shirt und eine kurze Hose, die zusammengeknüllt auf dem Boden liegt. Das Kleid kommt in die Wäschetonne, aber ich lasse es nicht ganz oben liegen, sondern stopfe es unter das andere Zeug, das schon drinnen ist. Papa kümmert sich zwar nie um solche Dinge wie Wäsche, aber wenn er einen Verdacht hat, wirft er vielleicht doch einmal einen Blick in die Wäschetonne.
Schweigend entkerne ich eine Marille nach der anderen. Manchmal stecke ich mir eine Hälfte in den Mund. Sie sind zuckersüß und weich, von unserem eigenen Baum. Mama lächelt. „Die sind gut, gell? Ich freu mich schon auf die frische Marmelade!“ Wenig später, als Mama den Gelierzucker über die Marillen im Kochtopf gestreut hat und nun kräftig umrührt, fängt sie lautlos an zu weinen. Ich merke es nur daran, dass sie ein wenig zuckt und stoßweise atmet. Ich tu so, als würde ich gar nichts merken. Ich mag mit Mama nicht darüber reden, warum sie weint. „Kann ich raufgehen?“ Sie nickt und rührt heftig weiter.
In meinem Zimmer lege ich mich mit einem Micky-Maus-Heft aufs Bett. In Entenhausen würde ich auch gerne wohnen, obwohl dort auch nicht alle nett zueinander sind. Vor allem Onkel Dagobert, der ist manchmal so wie Papa. Wegen Kleinigkeiten rastet er völlig aus. Aber Donald, der ändert sich dadurch nicht. Er fürchtet sich auch nicht vor Onkel Dagobert, und weinen muss er auch nicht. Und das Schönste ist, dass jeder sein eigenes kleines Haus hat, in dem er wohnt und Ruhe vor den anderen hat. Micky hat eins, Minni auch, und Goofy und Donald, die wohnen auch jeder in einem eigenen Haus und müssen nicht ständig aufpassen, ob irgendwo ein Papa um die Ecke kommt, der schon wieder zu viel getrunken hat und sich furchtbar darüber ärgert, dass es alle anderen so leicht haben und er es so schwer.
Das ist eine besondere Spezialität von Papa. Alle anderen können es sich richten, haben Freunde in wichtigen Positionen und das Glück auf ihrer Seite. Nur er ist von Unglück und Pech verfolgt. Aber er kann natürlich nichts dafür. Es sind immer die anderen schuld.
Ich ziehe mir die Decke über den Kopf und schalte meine Taschenlampe ein. Darunter habe ich neben dem Micky-Maus-Heft drei Bücher aufgestapelt, in denen ich heute noch lesen möchte. In einem geht es um ein Mädchen, das mit seiner Familie und seinen Freunden auf einer Insel lebt, und auch dort sind alle nett zueinander, wie bei den Tieren im Wald, kein böses Wort gibt es. Und es ist nie jemand betrunken und schreit herum, und in die Speisekammer gesperrt wird dort auch niemand. Nur einer, der Melcher Melcherson, der muss sich immer wieder furchtbar ärgern und aufregen, aber er tut niemandem was, seine Kinder lachen nur, wenn er herumschreit. Vor Melcher muss auch niemand Angst haben. Dann habe ich noch das Buch mit dem Insektendorf im Wald, wo es sogar eine Schneckenpost gibt. Und zum Schluss noch ein neues Buch, von Walter. Der hat wie jedes Jahr zu Weihnachten auch ein Buch geschenkt bekommen, gelesen aber hat er noch keines davon. Ich habe es mir einfach genommen, er wird es nicht vermissen. Da geht es um eine Reise im Raumschiff durch das ganze Sonnensystem. Es hat fast keine Bilder und ist ziemlich dick, aber ich bin schon gespannt darauf.
1
Alexandra war spät dran. Trotzdem parkte sie nicht direkt vor der Schule. „Ich mag aber nicht zu Fuß gehen“, maulte Annika von der Rückbank. „Die anderen …“ „Die anderen sind mir egal! Und vor der Schule stehen zu bleiben ist verboten! Ich hab dir schon oft genug erklärt, dass man da die Kinder gefährdet, die zu Fuß unterwegs sind“, schimpfte sie etwas zu laut und zu ungehalten, während sie auf den Parkplatz eines Supermarktes einbog, von dem aus Annika höchstens noch drei Minuten bis zum Schultor zu gehen hatte. „Tschüs! Und vergiss nicht, dass du mit dem Bus nach Hause fahren musst, wir haben heute im Verlag eine Besprechung.“ Annika hörte nicht auf zu maulen, murmelte Unverständliches vor sich hin und stieg grußlos aus dem Auto. Erziehung konnte manchmal schwierig sein. Vor allem bei einer Elfjährigen, die schon deutliche Anzeichen pubertärer Launen zeigte.
Sie selbst wäre ja am liebsten mit dem Rad in den Verlag gefahren, die Busfahrt zur Schule war Annika zuzumuten, auch wenn es regnete, fand sie. Leider war sie mit dieser Ansicht zu Hause in der Minderheit geblieben, denn ihr Mann ging viel zu oft bereitwillig auch auf unnötige Forderungen der Kinder ein. „Natürlich bring ich dich, Max!“ Dankbar hatte sich der achtjährige Sohn an Antons Bein geklammert. Die Volksschule war allerdings nur fünf Gehminuten entfernt, und wozu hatten sie eigentlich die teure Regenjacke gekauft …
Sie stellte ihr Auto in der Tiefgarage ab. Sie hasste es, dafür unnötig Geld auszugeben. Nächstes Mal würde sie sich durchsetzen. Was stand heute auf dem Programm? Sie wollte endlich das Manuskript dieses schrecklich untalentierten Autors fertig lektorieren, der sich noch dazu Starallüren wie ein Bestsellerautor leistete. Es war eine Heidenarbeit gewesen, es einigermaßen publikationsfähig zu machen. Gut, sie hatte es in einer ersten Euphorie auch befürwortet, es mit ihm zu versuchen – aber nach hundert Seiten war ihm echt die Power ausgegangen. Nachmittags gab’s dann eine Programmkonferenz. Und sie hoffte, danach noch mit ihrer Übersetzungsarbeit weiterzukommen. Es war zwar nur ein Band aus einer Softporno-Serie, an dem sie arbeitete, aber gerade das musste schnell gehen. Und, so versicherte sie sich selbst, es gab auch gutes Geld dafür.
„Hallo, Morgen!“ Sophie, deren Schreibtisch dem ihren gegenüberstand, war schon in ihre Bildschirmarbeit vertieft. Und auch eine angebrochene Tafel Schokolade lag, wie üblich, neben ihrer Tastatur. Alexandra fragte sich, wie man bei einem derartigen Schokoladenkonsum so schlank bleiben konnte. Kaum hatte sie ihre Arbeit aufgenommen, konnte sie ein Stöhnen nicht unterdrücken, obwohl sie wusste, dass sie Sophie damit störte. Dieser Autor litt wirklich unter derart ausgeprägter erzählerischer Impotenz, dass sie am liebsten ganze Passagen gestrichen oder neu geschrieben hätte. Ob dieser Krimi ein Erfolg werden würde? Sehr zweifelhaft. Und erst die unglaublich gestelzten direkten Reden! So sprach doch kein Mensch!
Sophie reagierte schließlich auf ihr Gestöhn. „Vielleicht sollten wir das Manuskript doch noch einmal vor die Konferenz bringen.“ Sie blickte an ihrem Bildschirm vorbei und schob sich die schwarze Brille auf der Nase hoch. Seit dreieinhalb Jahren saßen sie nun schon einander gegenüber und waren in dieser Zeit leidlich gute Freundinnen geworden. Obwohl Alexandra eigentlich nicht leicht Freundschaften schloss, überhaupt nur wenige Menschen an sich heranließ. Man plauderte beim Mittagessen oft über gemeinsame Probleme. Während Alexandra mit ihrem Mann und den Kindern im durchaus renovierungsbedürftigen Elternhaus Antons wohnte und oft nicht wusste, wo das Geld für eine neue Dachrinne herkommen sollte, wenn die alte zunächst monatelang leckte und schließlich zu Boden krachte, hatte Sophie gerade eine neue Eigentumswohnung gekauft und tat sich mit den Kreditraten recht schwer. Im Mediengeschäft waren eben keine Reichtümer zu verdienen, nicht einmal, wenn man eine erstklassige akademische Ausbildung hatte.
„Wir haben es schon in der Halbjahresvorschau drinnen. Und der Außendienst hat schon Bestellungen aufgenommen, wir können das Projekt nicht mehr aufgeben.“ Sophie zog abschätzig die Mundwinkel nach unten. „Dann solltest du aber wenigstens als Mitautorin genannt werden, finde ich.“ Sie lachte. „Wäre zu schön!“
Beide widmeten sich wieder ihren eigenen Bildschirmen. Ein eigenes Buch – davon hatte Alexandra schon lange geträumt. Aber selbst, wenn man Ideen und Begabung hatte – wenn man andauernd mit den Manuskripten anderer beschäftigt war, ging unterwegs irgendwo die eigene Kreativität verloren. Und mit einem Fulltimejob und zwei Kindern sowieso.
Ihr Handy summte. „Frau Heidegger, wegen dem Rohrbruch. Wir kämen dann jetzt.“ Sie seufzte. „Ich hab Ihnen doch gesagt, am Vormittag ist niemand zu Hause. Ich hab mit Ihrem Chef extra ausgemacht, dass Sie am Nachmittag kommen.“ „Wie Sie meinen!“ Die Stimme am anderen Ende klang arrogant. „Dann können wir aber nicht mehr garantieren, dass wir heute …“ „Natürlich!“, antwortete Alexandra. So heftig, dass Sophie aufsah. „Sie können nie irgendetwas garantieren.“ Sie legte auf. Es war zwar nicht extrem dringend, aber ein zweites Klo war in einer vierköpfigen Familie wirklich kein Luxus. Und den Wasserzufluss zu ebendieser Zweittoilette im Erdgeschoss hatten sie abriegeln müssen, irgendwo musste es ein Leck geben, die Mauer neben dem Spülkasten war immer feucht. Wenn sie nur daran dachte, dass es eigentlich höchste Zeit wäre, die gesamten Installationen im Haus zu erneuern, wurde ihr übel. Außerdem, fand sie, sollte sich eigentlich Anton um solche Dinge kümmern. Wozu war er schließlich Architekt? Allerdings schmetterte er ihre Einwände in der Regel ab. „Man muss auch nicht Mathematik studiert haben, um einen Kassenzettel zu überprüfen. Genauso wenig muss man Architekt sein, um einen Handwerker zu bestellen.“ Manchmal war er schon ein fürchterlicher Klugscheißer. Obwohl – sie musste zugeben, dass er tatsächlich klug war. Wenn man sich seine Entwürfe ansah, von denen allerdings nur wenige umgesetzt wurden … Vor allem aber war er witzig, konnte sie zum Lachen bringen. Man konnte ihm manches verzeihen.
Einmal wurde sie an diesem Vormittag noch unterbrochen. „Wenn du bitte einmal zu mir kommen könntest …“ Martin Sorger, der Verleger, bat sie zu sich ins Büro. Martin war lang, dünn und ein wirklich guter Arbeitgeber. Wenn er auch manchmal dazu neigte, zu sehr zu drängen, wenn Aufträge sich länger hinzogen als geplant. „Deine Softporno-Reihe … Sie hat schon wieder einen geschrieben. Er kommt im November raus.“ Alexandra stöhnte auf. Das bedeutete, dass die Übersetzung bis spätestens Weihnachten fertig sein musste. Für das Weihnachtsgeschäft würde es sich nicht mehr ausgehen, aber da mittlerweile Millionen Menschen Büchergutscheine geschenkt bekamen, mussten unmittelbar nach dem Fest ebenfalls neue Titel auf den Markt.
„Du müsstest mich dann aber von allen anderen Aufgaben freistellen“, forderte Alexandra. „Und ich müsste hauptsächlich zu Hause arbeiten. Damit ich nicht mit dem Hin- und Herfahren auch noch Zeit verliere. Sonst geht sich das nicht aus.“ Sie legte einen Finger an die Lippen. Es dauerte oft ein paar Stunden, bis sie mit solchen neuen Anforderungen seelisch zurechtkam, bis sie sich einen Plan zurechtgeschustert hatte, wie doch alles unter Dach und Fach gebracht werden konnte.
„Darüber lässt sich reden. Magst du einen Kaffee?“ „Schon“, antwortete Alexandra. „Aber ich trink ihn lieber vor meinem PC. Damit ich weiterkomme. Das Manuskript, übrigens, wird heute fertig. Soll ich es selber an den Autor zurückschicken, oder willst du …?“ Martin seufzte. „Wird es was?“ „Meiner Meinung nach – eher nicht. Und wenn du es dir anschaust, der Autor hat auf alter Rechtschreibung bestanden. Eher unüblich für Krimis, aber er kommt sich halt vor wie Heinrich Böll.“ „Schick es mir, wenn du fertig bist. Ich kümmere mich darum. Und um ihn.“ Alexandra nahm es als Entlassung und kehrte an ihren PC zurück.
Alexandra stand in der Küche, mit einem Espresso vor sich, und blickte versonnen durch das Küchenfenster, das Aussicht auf die ganze Stadt bot. Na ja, die halbe. In einer Hand hielt sie ihr Mobiltelefon. Anton war dran. „Ich muss noch mit einem wichtigen Kunden essen gehen. Rechne also nicht zu früh mit mir.“ Alexandra seufzte. Ihr Mann bot ihr zwar wenig Anlass zum Misstrauen, dennoch hoffte sie, dass der Kunde keine attraktive Kundin war. Man konnte Männern doch nie gänzlich trauen.
„Mami, was gibt’s heute?“ Max versetzte der Küchentür einen Stoß, dass sie mit Schwung gegen den Küchenschrank knallte. „Du hast doch in der Schule schon eine warme Mahlzeit bekommen“, erinnerte ihn Alexandra. Er klammerte sich schon wieder an ihr Bein. „Lass los, Max!“ So gern sie mit ihm kuschelte, das ständige Festhalten, während sie mit etwas anderem beschäftigt war, ging ihr auf die Nerven. Sie hob Max hoch. Schwer war er geworden. Ihre Wirbelsäule würde ihr das nicht verzeihen. „Runter!“ Gott sei Dank. „Was hättest du denn gern?“ „Spaghetti!“ „Max, du kannst nicht jeden Tag Spaghetti essen. Vor allem, wenn du schon in der Schule zu Mittag ein komplettes Menü verdrückt hast. Was hat’s denn gegeben?“ „Was Grünes, das hat man nicht essen können, das war eklig! Und Suppe mit nix drinnen!“ Max zog einen Schmollmund, und Alexandra holte den Nudeltopf aus dem Schrank, denn für lange Diskussionen hatte sie heute keine Nerven mehr. Es musste eine Spaghettisoße aus dem Glas reichen, nur durfte Max das nicht sehen. Blubberte sie im Kochtopf vor sich hin, gab es mit der Soße kein Problem. Bekam er aber mit, wie Alexandra sie aus dem Glas in den Topf schüttete, war es vorbei mit seinem Appetit, dann verweigerte er die Nudeln. Sie hatte sich früher niemals vorstellen können, wie heikel Kinder sein konnten. Soweit sie sich erinnerte, hatte sie alles gern gemocht, was ihre Mutter gekocht hatte.
„Hallo!“ Annika stürmte zur Tür herein und ließ ihre Schultasche auf den Boden plumpsen. Alexandra hörte sie darin herumkramen. „Gibt’s was Neues?“ „Gleich!“, rief Annika. Sie kam in die Küche und hielt ihr ein Heft unter die Nase. „Nicht! Das kriegt Tomatenflecken!“ Sie legte den Kochlöffel beiseite, wischte sich die Finger an den Jeans ab und nahm das Heft zur Hand. „Wow! Schon wieder ein Einser!“ Sie wuschelte Annika durch die Haare. „Ich bin stolz auf mein kleines Genie!“ „Sogar mit voller Punktezahl! Darf ich mir jetzt ein Schminkset kaufen?“ Alexandra seufzte. „Darüber reden wir später. Jetzt essen wir erst mal!“
„Aua!“ Sie setzte den Nudeltopf auf dem Tisch ab und drehte sich um. Annika versuchte gerade, Max eine Ohrfeige zu verpassen, doch der duckte sich weg. „Er hat mich an den Haaren gerissen!“ „Schluss jetzt! Sonst geht ihr ohne Essen ins Bett! Dann gibt’s nur mehr eine Banane mit Joghurt!“ Sie wusste, es war keine gute Idee, mit gesundem Essen zu drohen – doch wahrscheinlich war sie selbst schuld. Max musste gehört haben, dass sie Annika ein Genie genannt hatte – und da er sich selbst mit dem Lernen etwas schwerer tat …
Während des Essens wenigstens herrschte Ruhe. Irgendwie war das ungerecht. Anton saß wahrscheinlich in einem Haubenlokal in der Stadt, und sie musste sich mit Spaghetti mit Fertigsoße begnügen. Der einzige Vorteil des Gerichts war, dass beide Kinder es mochten und so wenigstens über das Essen nicht Krieg geführt werden musste.
„Was ist jetzt wegen dem Schminkset?“, fragte Annika, als sie das Geschirr zum Spüler trugen und einräumten. Das Kind konnte hartnäckig sein. Alexandra seufzte. „Du kennst meinen Standpunkt. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn sich Elfjährige schminken. Ich selbst habe erst mit sechzehn …“ „Du hast keine Ahnung!“ Annikas Ton wurde vorwurfsvoll und patzig. „Alle schminken sich! Und ich bin schon fast zwölf!“ Alexandra schloss die Klappe des Geschirrspülers und stützte die Fäuste in die Hüften. „Ich bin für dich verantwortlich, und solche Fragen werden unter uns ausgehandelt. Es spielt keine Rolle, was andere angeblich dürfen oder auch nicht.“
Wie oft hatten sie diese Debatten schon durch! Wie sollte man einer Elfjährigen erklären, dass sie in den Augen von Männern als sexuell aktiv erscheinen konnte, wenn sie sich schminkte? Dass sie zusätzlich zu ihren zumindest bereits sichtbaren Brüsten ein weiteres Merkmal zeigte, das sie älter und somit als potentielle Beute erscheinen ließ? Aber wenn sie sich weiterhin stur stellte, würde Annika wohl beginnen, sich hinter ihrem Rücken zu schminken, auf der Schultoilette wahrscheinlich. Jeder Widerstand trug auch seine Risiken in sich. Annika floh mit einem Wutschrei aus der Küche und stürmte die Stiege hinauf. Oben hörte Alexandra nur mehr die Tür ihres Zimmers knallen.
Zeit für Max, sich in den Vordergrund zu spielen. „Ist die Annika böse? Was hat sie gemacht?“ „Nix!“ Alexandra strich ihm mit dem Finger über die Wange. „Erwachsen wird sie halt!“ „Die blöde Gans wird nicht erwachsen!“, widersprach er.
Alexandra wollte das Thema mit ihm nicht weiter vertiefen. „Was habt ihr denn heute in der Schule gemacht?“ Max ließ sich leicht ablenken. „Ich hab einen Eishockeyspieler gezeichnet!“ „Aber die Saison ist doch schon vorbei?“ Max hatte ein erstes Jahr beim Eishockeyverein hinter sich gebracht und war Feuer und Flamme für den Sport. „Nächstes Jahr spiele ich bei den Großen!“ Alexandra hatte wohl oder übel bei sechs Spielen auf der Zuschauertribüne frieren müssen. Es saßen ohnehin nur die Eltern der Spielerinnen und Spieler auf den Rängen, und manche feuerten ihre Kinder wie besessen an. Nicht einmal vor Beschimpfungen gegnerischer Spieler schreckten manche Väter zurück. Aber auch eine Mutter gab es, die über ein ansehnliches Repertoire an ordinären Ausdrücken verfügte. Alexandra war der Sport nicht nur deswegen zu derb, sie hatte dazu noch ständig Angst, dass Max sich verletzen würde, und sah gar nicht gern hin. Anton machte sich oft ein wenig lustig über sie, wenn sie die Hände vor die Augen schlug, sobald ein Zusammenstoß drohte. „Das macht einen richtigen Mann aus ihm!“, sagte Anton dann. Sie war sich da nicht so sicher.
Now, naked, the knight stood in the dark. Only a few candles behind a column offered some dim, flickering light to the hall. The servant made him sit down, asked him to put his hands behind his back and bound him. The sweet perfume of the servant began to seep through his nostrils, and her hair brushed lightly over his shoulders. His sword began to rise.
Dass das Zeug kreativ wäre, das sie hier zu übersetzen hatte, konnte man nicht behaupten. Andererseits, einfache und klischeehafte Darstellungen waren leichter ins Deutsche zu bringen. Manchmal allerdings konnte sie der Versuchung nicht widerstehen, holprig dargestellte Sexszenen wenigstens um die billigsten Bilder und schwülstigsten Adjektive zu erleichtern. Und was noch erstaunlicher war – manchmal versetzten sie die Texte sogar in Stimmung. Ein paarmal hatte sie Anton schon nach nächtlicher Übersetzungsarbeit verführt. Die ewig gleichen Fesselungsspiele und flotten Dreier allerdings, die in den Büchern die Hauptrolle zu spielen schienen, hingen ihr allmählich zum Hals heraus. Ein Wunder, dass es den Leserinnen nicht ebenso ging – denn wenn man der Marktforschung glauben durfte, wurden diese Werke vornehmlich von Frauen gelesen. Ein wenig Stolz empfand sie dann doch bei dem Wissen, dass Hunderttausende das lesen würden, was sie geschrieben hatte, zumindest in ihrer Sprache. Erfahren würden das die Leserinnen allerdings nicht – als Übersetzerin dieser Werke gebrauchte sie ein Pseudonym.
Mehr als drei Seiten waren aber nicht mehr drinnen, ihr drohten schon die Augen zuzufallen. Manchmal dachte sie, es wäre Zeit, ein erotisches Wörterbuch zu schreiben – wenn es auch dünn ausfallen würde, der Wortschatz, den Autoren zur Beschreibung aller nur denkbaren sexuellen Vorgänge benutzten, schien äußerst begrenzt zu sein, egal, ob die Szenen im Mittelalter oder in einem Raumschiff angesiedelt waren.
Es war bereits elf. Von Anton keine Spur, kein Anruf. Sie ging zu Bett, nahm sich das Buch vor, das sie zu ihrem Vergnügen gerade las, überflog eine Seite, merkte, dass sie nichts mitbekommen hatte, weil ihre Gedanken schon bei der Organisation des morgigen Tages waren, las die Seite nochmals, bekam wieder nichts mit, legte das Buch beiseite und schlief ein.
II
Ich mache Spaghetti. Mama und Walter sind mit Papa auf den Wiesen, Heu machen, und ich habe schon Ferien. Heute Morgen hat es schon wieder Streit gegeben. Walter war frech, „Scheißheu“ und „Scheißbauernhof“ hat er geschrien. Er ist davongelaufen, um sich zu verstecken, aber Papa ist ihm nachgerannt. Nach kurzer Zeit ist er mit ihm zurückgekommen, am Ohr hat er ihn hinter sich hergezerrt. Und als sie in die Küche gekommen sind, hat Papa ihn losgelassen und ihm ein paar kräftige Ohrfeigen verpasst, bis er geheult hat.
Während die Spaghettisoße einkocht, lese ich die Zeitung. Im Lokalteil steht, dass in der Steiermark ein Bauer in seiner Jauchegrube ertrunken ist. Er hat noch gelebt, nachdem er in die Grube gestürzt war, steht da. Die giftigen Gase haben ihn das Leben gekostet. Gefunden worden ist er von seiner Frau. Die Bauernkammer warnt vor den Gefahren, die von unzulänglich abgedeckten Gruben ausgehen. Drei Kinder haben ihren Vater verloren. Drei Kinder. So wie wir. Wir haben auch eine Jauchegrube. Und mein Papa, der ist sehr unvorsichtig und schlampig. Ich glaube, ich könnte gar nicht weinen, wenn ihm so ein Unfall passieren würde.
Ich bin froh, dass alle weg sind. Bis auf Mama, natürlich. Spaghetti koche ich gerne, es geht leicht, und ich kann nicht viel falsch machen. Wenn mir allerdings etwas misslingt, ist es gescheiter, ich bin nicht am Esstisch, wenn Papa kostet. Denn dann verbringe ich wieder ein paar Stunden in der Speisekammer. Tobi liegt auf dem Boden und zeichnet. Immer wieder das Gleiche. Riesige Ritter in Rüstungen, die wie Konservenbüchsen aussehen. Mit ebenso riesigen Schwertern. Eigentlich sollte er in seinem Alter schon besser zeichnen können. Die Ritter sehen alle gleich aus. Sie haben einen eckigen Leib, den er mit schwarzem Stift vollkritzelt. Der Kopf ist auch schwarz vollgekritzelt, nur oben auf dem Kopf erkennt man einen Helm. In der Rechten halten sie eine Art Hellebarde, die sie auf dem Boden abstützen, und in der Linken ihr Schwert. Das malt Tobi fast immer blutrot an, manchmal aber auch schwarz. Er verbraucht viel Schwarz. Außerdem stehen die Beine der Ritter zu weit auseinander. Und seine Helme sind einfach nur Halbkreise, man erkennt keine Einzelheiten. Ich habe in seinem Alter schon Menschen gezeichnet, die die Gelenke dort hatten, wo sie wirklich hingehören. Vielleicht ärgert es Tobi, dass ich so gut zeichnen kann. Wenn ich Tiere zeichne oder Menschen, sehen die genau wie in Wirklichkeit aus. Ich muss mich darum nicht besonders bemühen, es ist einfach so. Frau Liebscher sagt immer, ich bin sehr begabt. Und dass ich vielleicht einmal eine Künstlerin werden könnte. Ich glaube aber nicht, dass ich das will. Künstlerinnen verdienen nämlich sehr wenig Geld, habe ich gehört. Und ich brauche Geld, um von hier wegzukommen, in eine eigene Wohnung und mit meinem eigenen Essen und alles. Das müsste ich eigentlich schaffen, denn Frau Liebscher sagt auch, dass ich erstaunlich reif und klug bin für mein Alter. Nur ein bisschen zu ernst. Ich soll mehr lachen, meint sie. Aber es gibt so wenig, über das ich lachen kann.
Es ist halb eins, aber noch keine Spur von Mama und Papa. Eigentlich sollten sie längst zurück sein. Ich weiß nicht, ob ich die Nudeln schon ins Wasser tun soll. Wenn sie zu weich sind, regt sich Papa auf, aber wenn sie noch nicht fertig sind, wenn er sich zum Tisch setzt, dann auch. Ich rühre in der Tomatensoße und lasse das Wasser einstweilen noch ohne Nudeln kochen.
Da fällt mir ein, dass Mama gesagt hat, ich soll noch Tobis Bettwäsche aus der Waschmaschine nehmen und aufhängen. Tobi hat wieder einmal ins Bett gemacht. Gott sei Dank hat Papa nichts davon gemerkt. Mama hat die Wäsche heimlich in die Maschine gesteckt. Es ist oft schon sehr anstrengend, wenn Mama und ich alles tun müssen, ohne dass Papa es merkt. Manches müssen wir auch vor Walter geheim halten, denn der drischt sofort auf Tobi los, wenn der wieder einmal ins Bett gemacht hat. Oder er verspottet ihn. Bettpisser, Hosenbrunzer, Windelscheißer. Walter ist da sehr kreativ, wenn er auch die gleichen vier oder fünf Schimpfwörter ständig wiederholt, stundenlang. Manchmal wünsche ich mir, mit Mama und Tobi ganz allein zu sein. Wir wären eine richtig glückliche Familie.
Ich stelle die Herdplatten ab und gehe ins Bad zur Waschmaschine. Mama hat gleich drei Garnituren Bettwäsche in die Maschine geräumt, damit es nicht so auffällt. Der Wäschekorb ist schwer, und die Leine ist für mich ziemlich hoch. Natürlich plumpst mir gleich einmal ein Bettbezug ins Gras, aber der Boden ist trocken, keine grünen Flecken auf der frisch gewaschenen Wäsche. Es weht ein bisschen Wind, das Bettzeug wird nicht lange zum Trocknen brauchen. Allerdings sind auf der Wetterseite auch ein paar dunkle Wolken aufgetaucht. Hoffentlich wird alles trocken, bevor der Regen kommt.
Sie sind noch immer nicht da. Wahrscheinlich ist irgendwas dazwischengekommen. Oder Papa hat, wegen der dunklen Wolken, die Mittagspause ausfallen lassen. Ich setze mich zu Tobi auf den Boden. „Warum zeichnest du immer die gleichen Ritter? Und immer schwarz? Du könntest doch auch einmal eine von unseren Katzen zeichnen oder ein Huhn. Huhn geht leicht!“, ermuntere ich ihn. Tobis Hand krampft um den schwarzen Stift, den er mit wilden Strichen über dem Bauch eines Ritters auf und ab führt. „Der Ritter muss kämpfen!“, ächzt Tobi, und der Stift gerät aus dem Bauch des Ritters hinaus, dorthin, wo er nichts zu schwärzen hat. Ich seufze. Tobi muss immer kämpfen. Wahrscheinlich auch, wenn er träumt. Vielleicht macht er deswegen ins Bett. Wenn er einen Kampf verliert, im Traum.
Tobi redet nie viel, und er hat sich auch sehr schwergetan, in der ersten Klasse das Schreiben und das Lesen zu lernen. „Du könntest zum Beispiel die Namen der Ritter dazuschreiben“, ermuntere ich ihn. „Wie heißen sie denn?“ „Ritter!“, grunzt Tobi. Seine Finger sind angeschwollen und rot, weil er den Stift so krampfhaft festhält. Mir fällt auf, dass der schwarze Stift schon ganz kurz ist, zahllose Male gespitzt. Ein Blick in seinen Buntstiftkasten verrät mir, dass der rote zur Hälfte aufgebraucht ist, der Rest kaum benutzt. Rosa, Gelb, Hellgrün, Lila: Die Stifte scheint er überhaupt noch nie verwendet zu haben. Ich nehme ein Zeichenblatt zur Hand und beginne, eine Blume zu malen. Vielleicht gefällt Tobi das ja. Ich male eine mit orangen und gelben Blüten und lila Blättern an einem grünen Stängel. Natürlich gibt es so eine gar nicht, in Wirklichkeit. Sie sieht einer Sonnenblume ähnlich, aber mit ganz anderen Farben. Dahinter eine gelbe Sonne mit einem orangen Gesicht und rosa Strahlen, die hinter der Blume auf dem Boden auftreffen. Eine ganze Blumenwiese werde ich malen. Da höre ich auf dem Hof das Rattern des Traktors. Ich habe auf die Nudeln vergessen.
Schnell werfe ich sie ins Wasser. Die Hälfte davon ist schon verdampft. Schnell gieße ich Wasser nach, doch jetzt ist es natürlich viel zu kalt. Die Nudeln werden verklumpen und verkleben. Ich höre sie schon an der Haustür. Tobi schnappt sich die Decke, auf der er gelegen hat, und flüchtet. Gerade noch rechtzeitig. „Essen fertig?“, brummt Papa. „Ich habe ja nicht gewusst, wann ihr kommt!“, versuche ich mich zu rechtfertigen. „Die Nudeln brauchen noch ein bisschen!“ Papa grunzt, kommt auf mich zu, ich habe Angst, dass er mich am Arm packen und in die Speisekammer sperren wird. Doch er geht an mir vorüber, ohne mich anzusehen, verschwindet in der Speisekammer und kehrt mit einem Stück Wurst zurück. „Geh weg!“, sagt er grob, legt die Wurst auf die Anrichte, schnappt sich ein Messer und schneidet drei dicke Scheiben herunter. Das Messer wirft er achtlos in die Abwasch, während er sich die erste Scheibe in den Mund schiebt. Ich sehe Papa nicht gerne mit einem Messer.
Ich rühre die Nudeln um, die Tomatensoße. Beides hat eben wieder zu blubbern begonnen. Es ist gerade noch einmal alles gut gegangen. Mama kommt herein. „Danke, dass du für uns gekocht hast. Du bist so eine Brave!“ Sie streicht mir über die Haare. „Eine dumme Kuh ist sie!“, schimpft Papa mit vollem Mund. „Sie hätte sich ja denken können, dass wir draußen bleiben, wenn schlechtes Wetter kommt. Und vor zehn Minuten hat es zu regnen angefangen. Da hätten die Nudeln hineingehört!“
„Sei doch nicht so grob zu ihr! Sie ist doch noch ein Kind!“ Papa brüllt. „Na und? Was glaubst du, was ich als Kind arbeiten habe müssen? Und wenn wir aufgemuckt haben, hat’s was hinter die Ohren gegeben! Wo sind denn überhaupt die Buben? Walter! Tobi!“ Ich rühre und schaue in meine Töpfe, so kann ich wenigstens so tun, als würde ich ihn nicht hören.
Mama verzichtet auf eine Entgegnung, die seinen Zorn ohnehin nur anheizen würde. Sie stellt Teller auf den Tisch, legt das Besteck daneben. „Was willst du denn trinken?“ „Meinst nicht, dass ich mir ein Bier verdient hab?“ Papas Stimme klingt lauernd, berechnend, so, als wartete er nur auf Widerspruch. „Hol die Buben!“, flüstert mir Mama zu. „Ich mach das fertig!“ Sie nimmt den Topf mit den Nudeln von der Herdplatte.
Ich gehe über die Stiege hinauf zu Tobi. „Essen kommen!“ Tobi ist zunächst gar nicht zu sehen, nur ein Hügel unter seiner Bettdecke verrät ihn. Nicht einmal sein Kopf ist zu sehen. „Will nicht!“ Ich seufze. „Ist dir lieber, wenn der Papa heraufkommt und dich an den Haaren zum Tisch zerrt?“ Tobi fängt an zu wimmern. Ich setze mich zu ihm aufs Bett und ziehe die Decke weg. „Zehn Sekunden!“, sage ich zu ihm. „Sonst haben wir beide Ärger!“ Er wischt sich Tränen aus dem Gesicht, steht wortlos auf und hängt sich an meine Hand.
Bevor ich hinuntergehe, klopfe ich an Walters Tür. „Essen!“ „Du kannst dir dein Scheißessen sonst wohin stecken!“, brüllt er durch die geschlossene Tür. Ich seufze und steige mit Tobi, der meine Hand immer fester umklammert, die Stiege hinunter. Am Tisch sitzen meine Eltern schweigend. Papa schaufelt die Spaghetti in sich hinein, Mama stochert in den Nudeln auf ihrem Teller herum und blickt ängstlich von einem zum anderen. Ein kurzer Blick zeigt mir, dass Papa sein erstes Bier schon fast geleert hat. Er nimmt neuerlich einen Zug aus der Flasche und stellt sie demonstrativ und lautstark direkt neben Mamas Teller ab. Die springt sofort auf, nimmt die leere Flasche und holt eine neue aus dem Kühlschrank, während sich Tobi wortlos auf seinen Platz schiebt, so weit von Papa entfernt wie möglich. Ich hole ihm eine Portion Spaghetti aus dem Topf und gieße ein wenig Tomatensoße darüber. Ich weiß, er mag sie nicht besonders. Tobi starrt in seine Nudeln, Mama stellt das Bier vor Papa hin, ich fange an zu essen. Am besten ist es, so wie Tobi in den eigenen Teller zu starren, da kann man wenig falsch machen.
„Wo ist denn der Walter? Hast du ihm nicht gesagt, dass wir essen?“ Ich nicke. „Schon.“ „Und warum kommt er dann nicht?“, herrscht Papa mich an. Ich zucke mit den Schultern. „Dass du mir nicht frech wirst!“ Papa holt mit der flachen Hand hinter seine Schulter aus, doch es bleibt bei der Drohung. Es ist unhöflich, mit den Schultern zu zucken. Ich muss in ganzen Sätzen antworten. „Alle haben beim Essen da zu sein!“ „Dem Walter ist schlecht“, sage ich als Entschuldigung.
Auf einmal scheint Papa mehr Interesse an seinem Bier als an Walter zu haben und nimmt einen großen Schluck aus der Flasche. Mama steht auf und verschwindet, ich höre ihre Schritte auf den Stufen. Doch auch sie kommt ohne Walter wieder zurück. „Er wird schon wieder!“, sagt sie. „Vielleicht ein bisschen zu viel Sonne erwischt.“ Sie nimmt Walter in Schutz, doch ich bin mir sicher, er hat auch sie beschimpft, anstatt sie ins Zimmer zu lassen. Mama wehrt sich gar nicht mehr dagegen.
„Nicht schlecht gemacht!“, sagt Papa plötzlich. Sein Blick ist etwas unstet, als er mir einen Finger unter das Kinn schiebt, damit ich zu ihm aufzusehen muss. „Du machst das ja schon richtig gut, du bist ja schon eine richtige kleine Hausfrau geworden!“ Der Ton scheint Mama nicht zu gefallen, sie blickt bestürzt zwischen mir und Papa hin und her, während Tobi versonnen versucht, eine einzelne Nudel auf seine Gabel zu drehen.
Ich weiß nicht, was Mama so irritiert. Papa lässt wieder los und schiebt seinen Teller zur Nudelschüssel. Es ist selbstverständlich, dass Mama oder ich Nudeln nachfüllen müssen, er ist ja schließlich der Hausherr. Er ist noch nie auf die Idee gekommen, sich bei Tisch selbst zu bedienen. Und dass er der Erste ist, der etwas bekommen muss, das ist sowieso selbstverständlich. Ich habe erst drei oder vier Gabeln mit Nudeln gegessen, aber ich kann nicht mehr. Irgendwas schnürt mir die Kehle zu. Vielleicht esse ich noch was, wenn Papa wieder weg ist.
2
Sie wurde von einem Knall wach. Knall? Sie schrak hoch, setzte sich auf und rieb sich die Augen. Durch die Vorhänge drang gedämpft das Sonnenlicht des frühen Morgens. Anton saß ihr gegenüber. Im Anzug? Und er hatte gerade eine Sektflasche geöffnet? Was war los? Hatte sie Geburtstag? Hochzeitstag? „Champagner!“, rief Anton, stand auf und näherte sich ihr. Er stand auf wackeligen Füßen und schwankte. Hatte er etwa die Nacht durchgezecht? Bei einem Kundentermin? Sie ließ sich zurück aufs Bett sinken. „Wie spät ist es? Was willst du?“
„Hoch mit dir!“ Er griff unter ihren Rücken und versuchte sie hochzuschieben. Gleichzeitig setzte er ihr die Champagnerflasche an die Lippen. Weder zielte er gut, noch war sie bereit zu trinken. Der Champagner floss ihr über das Kinn, rann zwischen ihren Brüsten hinab. „Was ist denn mit dir los?“ Ärger kam hoch. Sie wollte schlafen. Ihr Tag würde anstrengend werden, seiner anscheinend nicht. Warum konnte er sie nicht einfach in Ruhe lassen? „Verschwinde!“, zischte sie. „Und schlaf deinen Rausch in deinem Arbeitszimmer aus!“
„Heute wird nicht gearbeitet, mein Schatz! Heute wird gefeiert!“ Er nahm noch einen Schluck aus der Flasche. Sie ließ sich auf ihr Polster zurücksinken. „Weck wenigstens die Kinder nicht auf!“ Ihr Nachthemd war völlig durchnässt. Sie fror. Hoffentlich würde er sich bald beruhigen und das Licht wieder ausschalten.
„Was feierst du eigentlich?“ „Ich hatte schon gedacht, du fragst nie!“ Die Flasche in der einen Hand haltend, tanzte Anton durchs Zimmer, in einem etwas wackeligen Sirtaki-Schritt. Dabei zählte er. „Eins, zwei, drei und vier und fünf und sechs, sieben!“ Alexandra beobachtete ihn stirnrunzelnd. Drehte er durch, oder gab es wirklich etwas zu feiern? Er hielt bei 24 inne. „24 Millionen!“, hauchte er. „24 Millionen Euro! Ich habe 24 Millionen Euro gewonnen! Wir haben gewonnen! Bei den Euromillionen! 24 Millionen Euro!“ Er kniete am Bettrand nieder, zog die Decke von ihren Füßen und nahm die kleine Zehe zwischen zwei Finger. „Eine Million für die Zehe“, rief er, „und eine Million für die nächste!“ „Lass das!“, stöhnte Alexandra. Wer konnte wissen, was er sich in seinem Suff zusammenphantasierte. 24 Millionen gewann man nicht einfach so.
„Du spinnst ja. Lass mich schlafen. Und geh auf das Sofa in dein Arbeitszimmer, ich bin müde.“ Sie drehte sich zur Seite und zog die Decke über den Kopf. 24 Millionen. Was für ein Unsinn. Sie hasste seine dummen Scherze.
„Nein, Schatz, es ist wahr!“ Die Decke wurde ihr weggezogen. „Fünf Zahlen – zwei Sterne!“ Er zog einen ausgedruckten Beleg aus der Innentasche seines Sakkos und entfaltete ihn. „Fünf Zahlen – zwei Sterne! Jackpot! 24 Millionen!“ Er reichte ihr den Beleg, nahm einen weiteren Schluck und tanzte neuerlich durchs Zimmer. Sie besah sich, nun doch neugierig geworden, den Zettel. Es war tatsächlich ein Lotterie-Beleg. Sie wusste zwar, dass Anton regelmäßig Geld in diese Form des Glücksspiels investierte, hatte sich aber kein einziges Mal eine Ziehung mit ihm angesehen. Sie hatte für Lotto und dergleichen nichts übrig, sie hielt das für eine schlechte Angewohnheit der Unterschicht, die ihr mageres Einkommen weiter beschnitt, indem sie es hoffnungslosem Glücksspiel in den Rachen warf. Anton aber hatte ihr immer wieder vorgeschwärmt, was man mit einer Million alles machen könnte. Und dabei hatte er immer von einer, genau einer Million gesprochen. Jetzt sollte er 24 Millionen gewonnen haben? Wahrscheinlich hatte sich Anton getäuscht, er war wohl schon während der Ziehung angetrunken gewesen. Niemand gewann 24 Millionen Euro, schon gar nicht mit einem einzigen Schein. Wahrscheinlich waren es 24.000 oder so.
Sie zog einen Bademantel über und setzte sich vor ihren Laptop. Die Gewinnzahlen konnte man mit Sicherheit im Internet nachlesen. Wenige Minuten später hatte sie die gewünschte Antwort. Die Zahlen, die gezogen worden waren, stimmten mit einer der Zahlenreihen auf ihrem Beleg überein. Anton hatte die entsprechende Kolonne mit Textmarker gekennzeichnet. Aber von einer Gewinnsumme stand da nichts.
Sie kehrte ins Schlafzimmer zurück. „Die Zahlen stimmen. Aber da steht keine Gewinnsumme.“ Sie runzelte die Stirn. „Ein Anruf! Ich hab einen Anruf bekommen! Und natürlich die ganze Nacht kein Auge zugemacht! 24 Millionen!“
Alexandra war verwirrt. Was war in einer derartigen Situation zu tun? Hinlegen und schlafen, am besten, aber ob sie jetzt noch einschlafen konnte? 24 Millionen? Was machte man mit 24 Millionen? Wenn es denn stimmte. Anton hatte etwas von einem Anruf gesagt. Er konnte auch auf einen Scherz hereingefallen sein. Anton war inzwischen samt Anzug neben ihr in das Bett gesunken und hatte zu singen aufgehört. Sie schaltete das Licht ab. Vorläufig, so sagte sie sich, würde alles weitergehen wie bisher. Vor allem, solange alles derartig ungewiss war. Sie würde morgen natürlich pünktlich im Büro erscheinen, sie wollte keinesfalls als unzuverlässige Mitarbeiterin dastehen, die wegen ein bisschen Geld gleich den Kopf verlor. Ebenso würden die Kinder in die Schule gehen, die sollten vorläufig am besten überhaupt nichts von dem Gewinn erfahren.
Anton lag auf dem Bauch, den Kopf zur Seite gedreht. Anscheinend war er soeben eingeschlafen. Leises Schnarchen verriet ihr, dass er auch nicht so schnell wieder aufwachen würde. Die Champagnerflasche hatte er nicht losgelassen, sie hing an seinem Arm über den Bettrand. Alexandra löste sie aus seinen Fingern. Es musste nicht auch noch der Boden überschwemmt werden, wenn er losließ. Sie besah die Flasche. Etwa ein Viertel war noch drinnen. Schnell nahm sie einen Schluck, stellte die Flasche beiseite und sah auf die Uhr. Viel Zeit blieb nicht mehr, bis der Wecker läutete, sie brauchte sich erst gar nicht bemühen, noch einmal einzuschlafen, legte sich wieder neben Anton und wartete, bis sie die Kinder wecken musste.
Erst als sich Max beschwerte, dass der Kakao zu wenig süß war, wurde ihr bewusst, dass sie das Frühstück der Kinder völlig in Gedanken versunken zubereitet hatte. Was war als Nächstes zu tun? Jausenbrote herrichten. Wie viele Jausenbrote konnte man für 24 Millionen Euro kaufen? Ihr wurde schwindelig bei dem Gedanken. Millionen hin oder her, rief sie sich zur Ordnung. Die Kinder mussten zur Schule, und die Jausenbrote mussten in die Schultaschen.
„Wo ist denn Papa?“ Annika rümpfte misstrauisch die Nase. „Er …“ Alexandra zögerte. „Er hat in der Nacht lange gearbeitet. Er geht heute später ins Büro.“ „Und wer bringt mich dann …“ Max begann bereits, ein weinerliches Gesicht zu ziehen. So weit war es also schon gekommen – wenn er fünf Minuten zu Fuß gehen sollte, fühlte er sich bereits zurückgesetzt und glaubte, wenn er ein bisschen Theater machte, würden automatisch seine Ansprüche erfüllt. „Du gehst heute zu Fuß. Und wenn dir das nicht passt, kannst du gerne Papa aufwecken. Der wird eine Riesenfreude haben!“ Das war jetzt etwas zu scharf gekommen. Max’ Mundwinkel zuckten, wanderten nach unten, und er begann bereits, in Vorbereitung eines Heulkonzerts, Rotz aufzuziehen. Schnell setzte sich Alexandra neben ihn, hielt ihm ein Taschentuch unter die Nase und strich ihm übers Haar. „Schau, Max. Die fünf Minuten zu Fuß, das tut dir gut! Heute ist schönes Wetter, und ein bisschen Bewegung vor der Schule, das macht dich munter!“ Max schniefte immer noch. Es ging wohl nicht um den kurzen Fußweg, sondern einfach darum, dass er seine Ansprüche durchsetzen wollte. Alexandra seufzte. Dieses Problem konnte man jedenfalls nicht mit Geld lösen, im Gegensatz zu einer kaputten Dachrinne, zum Beispiel. Wenn der Kleine mitbekam, dass sie nun reich waren, viel zu reich, was für Ansprüche würde er dann wohl erheben? Sie stellte ernüchtert fest, dass sie jetzt zumindest eine Sorge mehr hatte. Ob es auf der anderen Seite vielleicht eine Sorge weniger werden würde, war abzuwarten.
Als die Kinder endlich weg waren, hatte sie sich natürlich um jeweils einen Euro für eine Süßigkeit erpressen lassen, damit endlich Schluss mit dem Geraunze war. Sollte sie Anton jetzt wecken oder ihn einfach in Ruhe seinen Rausch ausschlafen lassen? Sie entschied sich für einen Mittelweg, ging ins Schlafzimmer und suchte sich eine Bluse, einen Rock und frische Unterwäsche aus dem Kasten, ohne besonders darauf zu achten, leise zu sein. An Antons gleichmäßigen Atemzügen hörte sie jedoch, dass er tief schlief. Sollte sie ihn zudecken? Nein. So würde er wenigstens irgendwann zu frieren beginnen und wieder aufwachen.
Sie legte vor dem Badezimmerspiegel eine Halskette um, die, so erinnerte sie sich, weniger als 50 Euro gekostet hatte, und ertappte sich bei dem wohligen Gedanken an den echten, wertvollen Schmuck, den sie nun kaufen würde können. Zunichte allerdings wurde der wohlige Gedanke bei der Vorstellung, von ihren Kolleginnen im Verlag wegen der teuren Neuanschaffungen argwöhnisch gemustert zu werden.
Sie seufzte, als Antons Handy läutete. Sie fand es in seiner Sakkotasche auf dem Boden des Schlafzimmers, ohne dass Anton aufgewacht wäre. Es war Mirko, ein Kollege aus seinem Büro. „Du, Alexandra? Was ist mit Anton? Wir hätten einen Termin zusammen, in einer Stunde. Wir müssten jetzt gleich wegfahren!“ Mirko klang ungeduldig. Er war nicht nur Antons bester Freund und Kollege, auch als Paar verstanden sie sich gut mit ihm, sie alle kannten sich seit ihrer Studienzeit. Oft waren sie zu viert ausgegangen – sie mit Anton, Mirko mit einer seiner häufig wechselnden Bekanntschaften. Die hatten meist glamourös, aber gelangweilt gewirkt. Manchmal hatte ihr Mirko während dieser Zusammenkünfte Blicke zugeworfen, die ihr verrieten, dass er an ihr mehr als nur oberflächlich interessiert war.
Alexandra verließ das Schlafzimmer und antwortete leise: „Es geht ihm nicht gut. Er wird wohl heute nicht ins Büro kommen, zumindest am Vormittag nicht.“ „Kannst du ihn mir geben?“ Alexandra zögerte. Sie wollte nicht verraten, dass Anton betrunken eingeschlafen war. „Er hat irgendwas eingenommen und schläft jetzt.“ Mirko seufzte. „Richt ihm bitte wenigstens aus, dass er sich sofort melden soll, wenn er wach wird. Es wäre dringend.“ „Okay, mach ich!“ Sie legte auf, stellte den Klingelton lauter und deponierte das Handy auf Antons Nachttisch. Beim nächsten Klingeln würde er selber drangehen müssen.
Ein neues Rad, das wäre schon etwas. Alexandra fuhr gerne Rad, wann immer sie Gelegenheit dazu fand. Ein Rad fürs Büro, eines für die Straße und eines für das Gelände. Momentan erledigte sie alles mit demselben nicht ganz taufrischen Mountainbike. Wie viele Räder konnte man für 24 Millionen kaufen? Sie überschlug im Kopf die Zahlen, während sie in einer leichten Brise am Fluss entlangradelte. Sie kam zu dem Schluss, dass es selbst bei teuren Geräten für 12.000 oder mehr Räder reichen würde. 12.000 Räder, das konnte man sich nicht einmal vorstellen. Ob 12.000 Räder auf einem Fußballfeld Platz hatten?
„Hallo, Alexandra!“ Sophie saß schon auf ihrem Platz und lächelte ihr zu. „Wie geht’s?“ „Ja, äh …“ Nicht einmal darauf fiel ihr heute spontan eine passende Antwort ein. „Super, eigentlich!“ Das konnte nicht überzeugend geklungen haben. Sophie zog die Augenbrauen hoch. „Ist was?“ Sie hatte ein Gespür dafür, wenn etwas anders war als sonst, das hatte sie schon mehrfach bewiesen. Alexandra bemühte sich um eine möglichst glaubwürdige Ausrede. „Die Mama, du weißt ja. Sie ist wieder …“ „Oh Gott!“ Sophie nickte verständnisvoll und drang nicht weiter in sie. Oft genug hatten sie sich schon über die labile Psyche von Alexandras Mutter unterhalten. Sie verfiel immer wieder in tiefe Depressionen, musste manchmal Tage oder sogar Wochen in einer psychiatrischen Klinik verbringen und meist starke Medikamente einnehmen. Sophie hatte sicher Verständnis dafür, dass sie jetzt, am Beginn eines Arbeitstages, nicht darüber sprechen wollte. Dabei ging es ihrer Mutter in Wirklichkeit seit drei, vier Monaten überraschend gut.
Großartig war das, dachte Alexandra bei sich. Sie war jetzt zwar reich, dafür aber musste sie gleich in der Früh ihre Freundin hinters Licht führen. Ganz zu schweigen von den Kindern, denen hatte sie nämlich auch ein Märchen aufgetischt – die angebliche Nachtarbeit von Anton. Würde sie jetzt zur notorischen Lügnerin werden, nur um einen Millionengewinn geheim zu halten? Sie dachte an Sophies Eigentumswohnung. Sie konnte deren Schulden mit ein paar Mausklicks begleichen, sobald das Geld auf dem Konto eingegangen war. Sollte sie das tun, konnte man so etwas tun? Würde sich Sophie darüber überhaupt freuen?
Nach einer Stunde merkte sie, dass ihre Arbeit am Manuskript oberflächlich und unkonzentriert gewesen war. Am besten, sie fing noch einmal dort an, wo sie gestern aufgehört hatte. Ihre Leistung, so entschied sie, durfte keinesfalls unter dem Lottogewinn leiden. Obwohl, eigentlich hatte sie es jetzt gar nicht mehr nötig zu arbeiten, überlegte sie. Ob es nicht auch Spaß machen würde, den Tag mit Shoppen und im Kaffeehaus zu verbringen? Sie schob den Gedanken beiseite.
Der Vormittag verlief mühsam, die Konzentration auf ihre Arbeit fiel ihr weiterhin schwer. Sie überlegte schon, ob sie sich nachmittags freinehmen sollte, als ihr Handy summte. Anton. War er doch noch einmal aufgewacht. „Willst du nicht mit mir feiern? Wir müssen doch feiern!“, rief er so laut ins Telefon, dass Alexandra das Gerät unwillkürlich etwas von ihrem Ohr entfernte. Sophie hob interessiert den Kopf. Sie musste mitbekommen haben, was Anton gesagt hatte. Alexandra aber war nicht nach Feiern, eine ihr sonst kaum bekannte Beklemmung hatte sich um ihre Brust gelegt. Sie konnte sich nicht freuen, oder zumindest noch nicht. Sie seufzte und antwortete leise: „Ich frage, ob ich nachmittags freibekomme.“ Es musste ja nicht die gesamte Belegschaft darüber informiert werden, worüber sie redeten.
Anton jedoch dachte gar nicht daran, seine Stimme zu dämpfen. „Was heißt fragen? Du brauchst nie mehr jemanden zu fragen, du kannst tun, was du willst!“ Er hatte sicher recht, so konnte man ihre Situation natürlich auch sehen, aber es gelang ihr eben im Moment nicht, so geradlinig wie er zu denken. Anton hatte anscheinend schon wieder getrunken, man konnte es an seinem undeutlichen Sprechen hören.