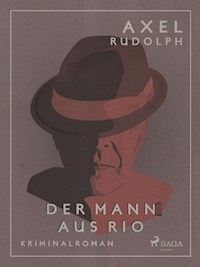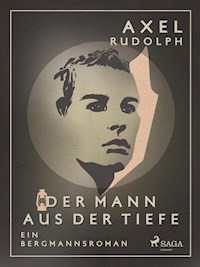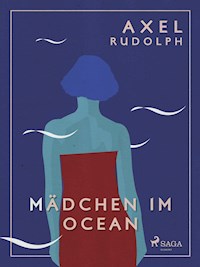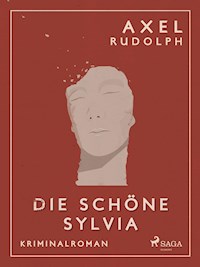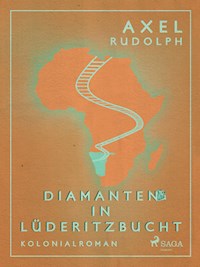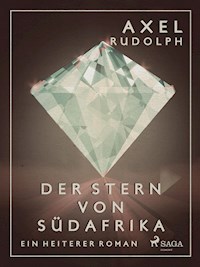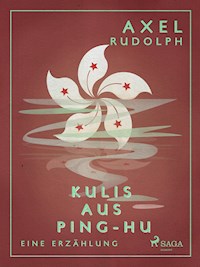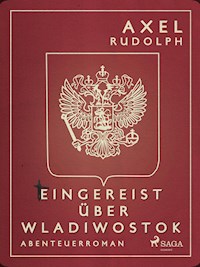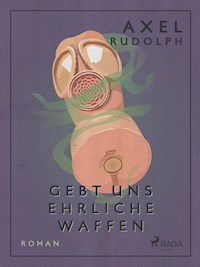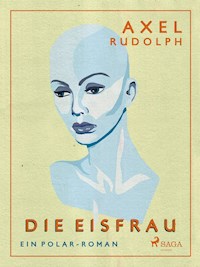
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Luftschiff überfliegt die Arktis. In der Führergondel wendet der Funker den Kopf und sieht den Kapitän fragend an; es gibt plötzlich keine Funkverbindung. Das Flugzeug mit Passageren und Besatzung befindet sich in einer 'Zone des Schweigens', in dem es angeblich ein 'Loch im Äther' gibt.Für die Passagiere ändert sich nichts, denn das Luftschiff gleitet ruhig und unverändert weiter seine Bahn. Die Augen der Offiziere im Führerstand werden aber gespenstisch wach, die Nerven spannen sich. Der Kapitän und seine Mannschaft warten atemlos darauf, dass sie die Stimmen der Welt wieder hören können. Unten im Eis sieht einer die Passagiere plötzlich ein gigantisches Frauantlitz. Eine einsame Eisskulptur, die eine unglaubliche Geschichte besitzt...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Axel Rudolph
Die Eisfrau
Ein Polar-Roman
Saga
1. Kapitel.
Über der Arktis summt und brummt ein Luftschiff. Sein Schatten zeichnet sich deutlich ab auf den endlosen Eisflächen, die unter den Fenstern der Passagierräume vorbeiziehen.
In der Führergondel wendet der Funker den Kopf und sieht den Kapitän fragend an.
„Die Stationen senden nicht mehr.“
Kapitän Fechter gibt dem neben ihm stehenden ersten Offizier einen kurzen Wink. Der Erste tritt an die Karte und mißt, legt dann die Hand an die Mütze.
„In Ordnung, Herr Kap’tän. Wir sind in der stummen Zone.“
„Den letzten Wetterbericht!“ Kapitän Fechter nickt ruhig zu der Meldung, die er nicht anders erwartet hat und studiert den letzten Funkspruch der Wetterwarte von Godthaab, den der Erste ihm reicht.
Der Funker tastet noch immer verwundert an seiner Apparatur herum, um womöglich eine Störung zu entdecken. Er fährt zum ersten Male auf der nördlichen Route und kennt noch nicht die „Zone des Schweigens“, die den Offizieren nur allzu gut bekannt ist, dieses „Loch im Äther“, das sich gürtelbreit über viele Meilen erstreckt. Für die Passagiere ändert sich nichts, sie merken nichts von der Zone des Schweigens, denn das Luftschiff gleitet ruhig und unverändert weiter seine Bahn. Die Menschen im Führerstand aber haben jedesmal das Gefühl, als ob das Schiff ins Nirwana tauche. Die Stimmen der Welt schweigen plötzlich. Das Knacken und Summen im Empfänger hört auf, der Morseschreiber tickt nicht mehr. Stille, lastendes, unheimliches Schweigen. Die Welt ist plötzlich versunken. Man kann weder senden noch empfangen in dieser Zone, wo alle Wellen durch physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt sind.
Das ist die Stunde, in der Kapitän Fechter und Marius Holk, sein erster Offizier jedesmal die eisige Totenmacht der Arktis in den Gliedern fühlen.
Denn sonst hat die Arktis ihre Schrecken verloren. Für den Erdenmenschen zwar sind diese Eiswüsten immer noch unheimlich und gefahrdrohend, für den Mann, der mit Hundeschlitten in sie einzudringen versucht, ein Pünktchen in der Unendlichkeit des Nordlandes, für das Schiff, das zwischen knirschenden Schollen eingeklemmt, jeden Augenblick zerdrückt werden kann, wie eine Laus zwischen den Fingern.
Der Luftfahrer aber schwebt erhaben über der Eiswüste, den tief unten lauernden Gefahren entzogen. Für ihn ist die Arktis ein Ausflugsgebiet geworden, eine Sensation, die man vom sicheren Port, das heißt vom bequemen Korbsessel der Passagierkabinen aus genießt. Man sieht nur das Gigantische, das Wildgewaltige der Natur und braucht sich nicht um die Gefahr zu kümmern, die da unten in ihr schlummern. Die Stewards servieren den Kaffee und den Tee, die elektrische Heizanlagen verbreiten wohlige Wärme, und wenn sich Wolkenmassen heranballen oder Böen aufspringen, nun, dann ändert der Kapitän den Kurs oder läßt das Schiff ein paar hundert Meter höher steigen, bis man dem Wetter entronnen ist.
Hier, in der Zone des Schweigens aber, empfinden die Offiziere jedesmal den Schauer der Arktis: das Schweigen. Es ist, als ob selbst das Brummen der Propeller hier um einen Ton dunkler und drohender geworden sei. Die Gedanken kreisen eigensinnig um bange drückende Vorstellungen. Wenn eine Bö hier das Schiff niederdrückt, wenn ein plötzlicher ernsthafter Motorschaden zwingt, hier in der Eiswüste niederzugehen! Hier, wo das Schweigen des Todes herrscht, wo man keine Nachricht geben, keine Hilfe herbeirufen kann! Dann ist man trotz aller wundersamen technischen Hilfsmittel, mit denen der moderne Luftriese ausgestattet ist, genau so einsam und arm, wie die Polarfahrer früherer Zeiten, die da unten — ein armseliges Nichts in der endlosen Weite — mit der Arktis um ihr Leben rangen; abgeschnitten von der Welt, umschlossen von Eis und Schweigen.
Die Augen der Offiziere im Führerstand werden dann gespenstisch wach, die Nerven spannen sich. Erst wenn dann die wiederaufspringenden Stimmen der Welt im Empfänger anzeigen, daß man den toten Gürtel passiert hat, zieht die Gelassenheit wieder ein in diese Männer, die für Schiff und Passagiere die Verantwortung tragen.
„Ablösung!“ Der kleine, geschmeidige zweite Offizier erscheint frisch gewaschen und gestriegelt im Führerstand und wechselt mit dem abzulösenden Ersten den üblichen, militärisch knappen Gruß.
Käpitän Fechter nickt und reicht den Wetterbericht seinem Ersten zurück. „Wir wollen hier, in der stillen Zone, lieber das östlich stehende Tief umgehen und einen Bogen nach Norden machen. Den Passagieren kann’s egal sein. Die Aussicht auf die Arktis ist überall gleich gewaltig.“
Der Kapitän gibt die nötigen Befehle, die sofort den Riesenleib des Luftschiffes den gewünschten Bogen beschreiben lassen und wendet sich dann noch einmal flüchtig an den Ersten, der sich zum Gehen anschickt: „Kümmern Sie sich bitte mal ’n bißchen um die Unterhaltung unserer Passagiere, lieber Holk, solange der Lautsprecher außer Kraft ist.“
„Jawohl, Herr Kap’tän!“ Holk geht den verdeckten Laufsteg entlang zur Passagiergondel. Der zweite Offizier hat bereits seinen Dienst übernommen. Und auch Kapitän Fechter blickt gespannt gradeaus in das Luftmeer, das die „Z 151“ in ruhiger Fahrt durchschneidet.
„Sehen Sie mal! Da unten! Der Eisberg! Sieht das nicht genau aus wie ein Frauengesicht?“
Einer der Passagiere deutet mit der Hand hinunter auf die stummen, eiskalten Weiten, die da unten vorüberziehen. Sein Nachbar erhebt sich halb aus dem Liegestuhl.
„Allerdings! Ganz wie ein riesiger Kopf.“
„Ist auch ein Frauengesicht, meine Herren,“ sagt verbindlich lächelnd der Erste, der am Nebenfenster im Gespräch mit einer Dame steht. „Was Sie da unten sehen, ist kein Spiel der Natur. Der verstorbene grönländische Bildhauer Arnaluk hat vor Jahren mit unendlicher Geduld und Mühe dieses Frauenantlitz in seinen gigantischen Ausmaßen hier aus dem Eis herausgehauen. Da steht es nun für alle Zeit, denn dieses Festlandeis hier schmilzt nie. Wir nennen das Denkmal: die Eisfrau.
Das Lächeln ist dabei aus dem Gesicht Marius Holks verschwunden. Ernst hebt er die Hand an seinen Mützenschirm und grüßt mit stummem Gruß das Bild da unten, dessen Konturen jetzt rasch deutlicher werden.
Die Passagiere drängen sich neugierig an die Fenster der Steuerbordseite. Ja, dort tief unten, mitten in der unendlichen Einsamkeit vereister Hochplateaus hat eine Künstlerhand das Profil eines Frauenantlitzes in wunderbar reinen, herben Linien im Eis geschaffen, so gewaltig groß, daß es selbst von hier aus, in sechzehnhundert Meter Höhe, deutlich zu erkennen ist.
Die schwatzenden Stimmen der Passagiere verstummen unwillkürlich. Es geht etwas Sonderbares aus von diesem gigantischen Bild da unten in der Einsamkeit. Ewigkeitsgedanken weckt dies ernste herbe Profil in seiner strengen Erhabenheit.
„Man müßte jetzt Beethoven spielen,“ sagt leise ein Passagier mit durchgeistigtem Musikergesicht und hört in seinen Ohren die Akkorde der „Eroika“. Die Dame, die eben noch den ersten Offizier mit neugierigen Fragen über Eisbären und Walfische geplagt hat, starrt wie gebannt auf das Eisbild, über das jetzt schleiergleich der Schatten des Luftschiffes dahinstreicht und bewegt leise die Lippen. „Wächter des Todes.“
„Der Bildhauer Arnaluk?“ wendet sich ein älterer Herr an Marius Holk. „Ah! Dann sind wir über der Stelle, wo die Thornberg-Expedition ihren Untergang fand?“
Marius Holk nickt. „Ja, da unten war’s, Herr Geheimrat.“
„Interessant. Und sagen Sie: Wissen Sie eigentlich etwas Näheres über diese Katastrophe?“
Der Erste macht eine leichte Verbeugung. „Die aufgefundenen Tagebücher Thornbergs im Verein mit den Aufzeichnungen des Bildhauers Arnaluk ermöglichen uns eine sehr genaue Rekonstruktion nicht nur der Katastrophe, die sich hier abgespielt hat, sondern auch ihrer ganzen Vorgeschichte.“
„Ach, bitte! Erzählen Sie doch!“
Die Passagiere ziehen ihre Stühle heran und gruppieren sich erwartungsvoll um den ersten Offizier. Eine Dame schiebt ihm sogar eifrig selber einen bequemen Sessel hin.
„Gern, meine Herrschaften.“ Marius Holk wirft noch einen nachdenklichen Blick aus dem Fenster auf die Eiswüste, in der das riesige Denkmal der Eisfrau langsam in graublauer Unendlichkeit verdämmert, und beginnt seine Erzählung.
„Es war im Anfang des Jahres 1932. Und die Geschichte begann in Kairo ...“
2. Kapitel.
Shepheards Terrasse war immer noch der Sammelpunkt der guten Gesellschaft Ägyptens. Draußen im Mena House wohnten die Snobs, die Sphinx und Pyramiden lediglich als ein Ausstattungsstück betrachteten, das man sich beim Frühstückstisch von einem möglichst mit allem Komfort eingerichteten Hotelsaal aus so nebenbei ansah. Bei Shepheard aber trafen sich die Reisenden, denen ein kultivierter Geist und eine gute Kinderstube mehr bedeuteten als ein dickes Scheckbuch.
Die große Hotelterrasse war bis auf den letzten Platz besetzt. Weißgekleidete Araberboys mit malerischen Fezen reichten Zigaretten und Mokka, Kellner schlängelten sich mit Tabletts voll eisgekühlter Limonaden, Whisky und Soda zwischen den Tischreihen hindurch. Auf den großen, über den Tischen aufgespannten Sonnenschirmen brannte knallend die Nachmittagssonne. Die Agaven in den großen Kübeln an der Brüstung der Terrasse stachen spitz in die vibrierende Luft, und die Wedel der bis über das flache Hoteldach reichenden Palmen verdeckten ihr Grün unter einer weißlichen dicken Staubschicht.
Auf der breiten Straße unterhalb der Terrasse lärmte und schrie das Leben des Orients. Der Ruf der Wasserträger, zankende Fellachenjungen, heiser anpreisende Eseltreiber und koptische Händler. Das langgezogene Gewieher der Grautiere mischte sich zu lächerlichem Kontrast mit dem Stimmengewirr plaudernder Menschen auf der Terrasse und den Geigenklängen der in buntfarbigen Phantasieuniformen steckenden Kapelle.
„Puh! Kinder, ist das ’ne Hitze hier!“
Ein älterer Herr von unverkennbar germanischem Typ wischte sich, an einen der Tische herantretend, mit einem Seidentuch den nassen kahlen Schädel. Fröhliches Gelächter empfing ihn.
„Wenn’s Ihnen zu warm ist, Merker, dann machen Sie doch Frau Kreß ’nen Besuch. Das kühlt ab,“ lachte der Fabrikant Pollmann aus Leverkusen am Rhein. Sein Nachbar, der Ingenieur Witthof winkte ebenfalls lachend, einem vorüberhetzenden Kellner:
„Waiter! ’ne ‚Eisfrau‘! Aber dalli, dalli!“
Gläsergeklirr, unbekümmert laute Männerstimmen, Zigarrenaroma. Ein Stückchen Deutschland, mitten in Kairo, dieser Ecktisch, an dem lauter Herren in mittleren und älteren Jahren saßen. Man hatte sich zusammengefunden hier im Hotel, lauter Landsleute: ein paar Industrielle und Bankmenschen auf der Erholungsreise, Kaufleute und Ingenieure, die beruflich im Nillande zu tun hatten, der Arzt Dr. Schütz, der schon seit Jahren in Kairo ansässig war. Keine einzige Dame dabei. Lauter Strohwitwer und alte Junggesellen, die natürlich sofort hier eine Art Stammtisch aufgemacht hatten. Man trank Münchener Exportbier trotz der unverschämt hohen Preise, die dafür verlangt wurden, man erzählte Anekdötchen, fachsimpelte, diskutierte und politisierte ungemein laut, und das kräftige Männerlachen, das oft genug um den Tisch schütterte, lockte manchen erschrockenvorwurfsvollen Blick von den Nebentischen herüber, an denen blasierte Globetrotter und mimosenhafte Ladies und Demoiselles ihren Whisky oder Absinth schlürften.
„Was ist denn das, eine ‚Eisfrau’?“ erkundigte sich ein schlankgewachsener Herr mit wetterbraunem Teint im hageren bartlosen Gesicht. Der wohlbeleibte Rheinländer schmunzelte. „Kennen Sie noch nicht? Ach so, Sie sind ja Rekrut hier, Thornberg, Eben erst ausgespuckt aus dem Rumpelkasten von Hotelomnibus. Also die ‚Eisfrau’ ist die kühlste Limonadenmischung, die es hier überhaupt gibt. Sollten Sie mal probieren. Wir haben sie einstimmig so getauft. Frau Britta Kreß zu Ehren!“
Die Herren lächelten verständnisinnig. Erich Thornberg, der vor wenigen Stunden in Kairo angekommen war und nur durch Zufall den Weg in diese landsmännisch vertraute Gesellschaft gefunden hatte, sah etwas unsicher drein.
„Frau Britta Kreß? Ist das etwa die Frau des Geheimrats Kreß aus Berlin?“
„Allemal. Kennen Sie den Mann?“
„Persönlich noch nicht.“ Thornbergs Stimme wurde lebhafter, und man sah, daß der Name in seinen Gedanken eine Rolle spielte. „Aber wegen Geheimrat Kreß bin ich im Grunde hergekommen. Ich hatte ihm geschrieben und er sagte mir eine Unterredung zu.“
„Geschäftlich?“
„Ja.“ Erich Thornbergs immer etwas befangenes Gesicht wurde noch um eine Nuance zurückhaltender. „Ich hoffe, daß er meine neue Polarexpedition finanzieren wird.“
Der Bankier Friedenauer legte Thornberg sanft die Hand auf den Arm. „Wenn Sie mit dem Geheimrat Kreß Tachles reden wollen, folgen Sie meinem Rat: Sei’n Sie vorsichtig!“
„Wieso? Warum denn?“
„Er flattert schon.“ Friedenauer hob die Schultern; „der Pleitegeier nämlich.“
Thornberg sah seinen Nachbar mißtrauisch-ungläubig an. „Das Erste, was ich höre, Herr Friedenauer.“
„Ich weiß, was ich weiß. Überhaupt, warum wollen Sie den Kreß beteiligen? Machen Sie die Sache lieber mit mir.“
„Sie interessieren sich auch für meine Expedition?“ Thornberg sah verwundert den kleinen beweglichen Mann an. Es war schwer, sehr schwer, in diesen Zeiten Kapital aufzutreiben. Ein halbes Jahr schon war er in Berlin auf der Geldsuche gewesen. Geheimrat Kreß war eigentlich seine letzte Hoffnung gewesen. Aber was der Bankier da sagte ... Thornberg schüttelte den Kopf und gab sich selber einen Ruck. „Ich kann nicht recht glauben, daß der Geheimrat Kreß schlecht stehen soll.“
„Er glaubt mir’s nicht!“ Friedenauer wandte sich mit tiefgekränkter Miene zu seinem Gegenüber, dem Großindustriellen Rombach. „Sagen Sie doch mal Herrn Thornberg, wie’s mit dem Geheimrat Kreß steht.“
„Faul. Oberfaul.“ Der in ganz Deutschland bekannte Wirtschaftsführer zog die Augenbrauen hoch. „Die Kreß-Werke sind nicht mehr zu halten. Vorigen Monat schon hat Kreß ein Äußerstes getan und sein Gut Altenhagen verkauft, um Geld flüssig zu machen. War ’n Tropfen auf ’nen heißen Stein. Und jetzt, nachdem sein Abschluß auf Lieferung mit Maschinen für die ägyptische Regierung auch noch in den Nilschlamm hier gerutscht ist — nee, nee, da ist nichts mehr zu machen. Höchstens kann er’s noch ’ne Weile hinausschieben, wenn seine Frau ihr Vermögen in die Werke steckt.“
„Was wollten Sie denn für ein Geschäft mit Kreß machen, Herr Thornberg?“ fragte ein entfernt Sitzender über den Tisch.
„Das kann ich Ihnen sagen, meine Herren.“ Friedenauer fegte mit seinen Händen förmlich alles beiseite, was ihn am Sprechen hätte hindern können. „Sie wissen doch alle, daß Herr Thornberg auf seiner letzten Polarexpedition ein neues Land da oben festgestellt hat. Die Zeitungen waren ja voll davon. Nun will er eine zweite Expedition ausrüsten, um das neuentdeckte Land zu erforschen und sucht ’nen Geldmann dazu.“
„Schade.“ Der Fabrikant vom Rhein wiegte bedauernd den mächtigen Kopf. „Ich kenne Kreß. Mit dem ließe sich unter anderen Umständen darüber reden. Aber wie’s jetzt steht, könnte wohl höchstens seine Frau so eine Sache finanzieren. Und Frau Britta dürfte gegenwärtig wenig übrig haben für wissenschaftliche Expeditionen.“
„Sssst! Attention, meine Herren! Die Eisfrau!“
Von der Straße her stieg eine schlanke blonde Dame an dem salutierenden Portier vorbei die Stufen zur Veranda empor. An vielen Tischen wandten sich neugierige Köpfe, die Damen musterten die hochgewachsene Gestalt in dem grauen Straßenkleid aus Rohseide, hier und da grüßten Herren respektvoll. Die Musik intonierte eben den Schlager der Saison. „Kühl wie der Schnee vom Libanon.“ Wiegend, fast zärtlich sangen die Geigen.
Selbstsicher, für die Grüße fast ohne hinzusehen mit leichtem Kopfnicken dankend, schritt Frau Britta Kreß über die Terrasse.
Auch die deutschen Herren hatten sich umgewandt und gegrüßt. Es war unwillkürlich still geworden am „Stammtisch“. Man sah Frau Britta Kreß nach, wie immer ein wenig fasziniert von ihrer eigenartig schönen Herbheit. So bemerkte niemand das sonderbar starre Gesicht Erich Thornbergs.
Der aber saß regungslos und sah — sah ...
Eine Vision.
Während Frau Britta vorüberschritt, versanken vor seinen Augen plötzlich die Palmen, die Agaven und Azeleen, die Tropenanzüge und buntfarbigen Schals, das ganze farbenfrohe Leben der Terrasse. Die blendende ägyptische Sonne schrumpfte zusammen zu einem mattglänzenden Ball. Verschwunden hinter Nebeln das schillernde Sonnenland am Nil. Nur noch die Arktis war da, das grünlich schimmernde unbarmherzige Eis, die weißen Weiten der Schneefelder, der klirrende Frost, die bleischwer lastende Decke des Nordlandhimmels. Und durch die schweigende Schneeeinsamkeit schritt in ihrem leichten rohseidenen Kleid unberührt und hocherhobenen Hauptes Frau Britta Kreß — die Eisfrau.
Frau Kreß war inzwischen am Hoteleingang angelangt. Die schwingende Windfangtür warf ein Blitzen hinter ihr her. Die verkrampfte Starrheit in Erich Thornbergs Gesicht löste sich. Die Schneefelder der Arktis schmolzen dahin. Auf einmal war wieder die Umwelt da: Kairo, die Sonnenglut, die Palmen, die plaudernden, lachenden, flirtenden Menschen. Die Geigen schwangen sehnsuchtsbang. Am Nebentisch summten ein paar junge Damen den Refrain mit:
„Leicht wie die Feder,
Schlank wie die Zeder,
Kühl wie der Schnee vom Libanon.“
3. Kapitel.
In dem Hotel-Appartement des ersten Stockes, das Frau Britta Kreß betrat, saß ein gebrochener Mann.
Geheimrat Kreß lehnte müde in seinem Schreibtischstuhl, und seine Augen sahen glanzlos, tief in den Höhlen liegend, der Eintretenden entgegen. Seine über die Stuhllehne schlaff herabhängende Rechte hielt ein zerknittertes Telegrammformular, dessen Umschlag zerfetzt auf dem Teppich lag.
Frau Britta erschrak. Sie war es gewohnt in der letzten Zeit, daß Kreß schwere Sorgenfalten auf der Stirn trug, aber so zerfallen und verstört hatte sein Gesicht noch nie ausgesehen. Befremdet trat sie an den Schreibtisch heran und berührte leicht seine Schulter.
„Was hast du, Konrad?“
Der Geheimrat hielt seiner Frau das Telegrammformular hin. „Es ist aus, Britta. Die Banken sperren die Kredite. Morgen muß ich —“ er zögerte eine Sekunde und netzte sich die trockenen Lippen; es war unsagbar bitter, das Wort auszusprechen, — „morgen muß ich in Konkurs gehen.“
Frau Britta hatte sich in einen Sessel gesetzt und aufmerksam die Depesche durchgelesen. Jetzt legte sie das Blatt mit einer stillen Bewegung auf den Schreibtisch. Ihre Augen liefen ruhig über die Gestalt des Mannes, der, die Hände auf die Stuhllehne gestützt, mit gesenktem Kopf vor ihr saß. Schmal und wohlgeformt waren diese Männerhände. Und einen guten Kopf hatte er schon, der Geheimrat Konrad Kreß. Der Kopf eines Geschäfts-Gentleman, gute, alte Rasse, geistvoll, distinguiert, eben wie ein Mann auszusehen hatte, der über Millionen gebot. Auch jetzt noch, wo die Falten um Nasenflügel und Mundwinkel scharf geworden, die Augen übernächtigt und eingefallen waren, verleugnete dieser Kopf nicht seine Würde und Vornehmheit.
„Es gibt also keine Möglichkeit mehr, Konrad?“
Geheimrat Kreß hob langsam den Kopf. „Keine. Außer einer einzigen, Britta.“ Wieder wandte der Mann die Augen ab und zögerte. Es war so schwer, so unsagbar schwer, das auszusprechen, was doch die einzige Hoffnung auf Rettung blieb.
„Nun, und die ist?“
Mit schwerem Entschluß hoben sich wieder die Augen des Mannes. Ein demütiges Flehen lag plötzlich in ihnen.
„Die einzige Möglichkeit besteht darin, daß du dein Vermögen in die Kreß-Werke steckst, Britta!“
Stille lag über dem Zimmer. Durch die herabgelassenen Jalousien stachen die spitzen Lanzen der ägyptischen Sonne. Frau Britta hatte das Kinn in die Hand gestützt und dachte angestrengt nach. Wie aus weiter Ferne kam die halblaute Stimme des Mannes. Er sprach von dem Schmerz, sein Lebenswerk aufgeben zu müssen, von den brotlos werdenden Arbeitern, von seinem Ruin als Geschäftsmann. Freundlich, aber ohne innere Anteilnahme hörte sie ihm zu, schüttelte dann ruhig den Kopf.
„Nein, Konrad. Soweit ich die Lage übersehen kann, sind die Kreß-Werke auch nicht mehr durch mein Vermögen zu sanieren. Du kannst deshalb nicht verlangen, daß ich mein Geld in deinen Untergang mit hineinziehen lasse.“
Nicht verlangen — nicht verlangen — hämmerte es im Gehirn des Mannes. Nein, zu verlangen hatte er nichts. Sie lebten von jeher in Gütertrennung, wie es sich für vorsichtige Leute schickte. Mit welchem Recht bat er sie überhaupt? Hatte er sich etwa für diese Frau ruiniert? Pah! Sie war reich und unabhängig gewesen, als er sie heiratete. Sie hatte nie finanzielle Opfer von ihm verlangt. Sie würde ihn, den Menschen Konrad Kreß, auch jetzt nicht im Stich lassen. Oh, er wußte es genau: Britta würde auch jetzt, wo er keinen Pfennig mehr besaß, weiter wie bisher neben ihm durchs Leben gehen, ruhig, kühl, selbstsicher. Was wollte man mehr? Und doch wäre es schön gewesen. — Und das Geschäft! Die Arbeiter! Die Werke! — Einen Augenblick war Konrad Kreß in Versuchung, ein sentimentales Wort auszusprechen, an die Tage ihrer Brautzeit, an die ersten Ehemonate zu erinnern. Das Wort „Liebe“ lag ihm auf der Zunge. Er blickte in die kühlen Augen seiner Frau und sprach es nicht aus. Ihm ekelte plötzlich davor. Es war geschmacklos, von etwas zu sprechen, das eigentlich selbstverständlich war unter zwei Menschen, die eine Ehe führten. Nein, es ging nicht! In ratlos dumpfer Verzweiflung fühlte Konrad Kreß plötzlich, daß diese ganzen Jahre an Brittas Seite eine Lüge gewesen waren, daß es nichts gab, was diese Frau innerlich an ihn band.
„Das Unabänderliche muß man tragen, Konrad.“ Frau Britta stand langsam auf und spielte mit einem Briefbeschwerer, der auf dem Schreibtisch lag. „Ich kann dir nicht helfen.“
„Aber ich bin doch nicht schuld!“ Konrad Kreß’ Gesicht lief plötzlich rot an vor Erregung. „Hab’ ich spekuliert? Verschwendet? Die Geldnot, die Verhältnisse, die Wirtschaftskrise ...“
„Gewiß, Konrad.“ Frau Britta senkte beistimmend den blonden Kopf. „Du trägst keine Schuld. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Die Kreß-Werke sind verloren, und es hat keinen Sinn, mein Vermögen in eine verlorene Sache zu stecken.“
Es lag nichts Unfreundliches in ihrem Ton, nur Kühle, besonnene Überlegung, kalte Bestimmtheit.
„Sprechen wir vorläufig nicht mehr davon. Du bist zu erregt.“ Sie strich leise und oberflächlich noch einmal mit ihrer schmalen Hand über den gesenkten grauen Scheitel des Mannes, nickte ihm zu und ging quer durch das Zimmer zu der Verbindungstür, die hinüber in ihr eigenes Zimmer führte.
„Britta!“ Konrad Kreß wollte aufspringen, ihr nacheilen, sie noch einmal anflehen. Aller Stolz war plötzlich zusammengebrochen. Sie mußte helfen! Die Werke! Die Arbeiter! Mit zitternden Knien fuhr er aus seinem Sessel auf. Die Hitze, die ungeheure Erregung, die Verzweiflung — es war zuviel. Mit einem jähen Stöhnen sank Geheimrat Kreß in den Sessel zurück. Ein Herzschlag hatte seinem Leben ein Ende gemacht.
Die Frau hörte, schon an der Tür, hinter sich den gebrochenen Laut und wandte sich unwillkürlich um. Ihr Blick traf das fahle, starre Gesicht drüben im Sessel. Mit ein paar raschen Schritten war sie bei ihm.
„Konrad?“
Einen Augenblick hob sie mit beiden Händen den leblosen Kopf empor, ließ ihn dann behutsam wieder sinken, ging zur Tür und drückte zweimal scharf auf den Klingelknopf. Die Sonnenspitzen vom Fenster her leckten über ihr blondes Wellenhaar. Unten spielte schmachtend, lockend die Musik.
Ein brauner Boy stand in der Tür und starrte mit erschrockenen Augen auf den regungslosen Mann im Schreibtischsessel. Frau Britta machte eine kurze, befehlende Handbewegung. Ihre Stimme klang ruhig und kühl wie immer:
„Einen Arzt, bitte! Sofort!“
Auch heute spielte die Musik auf der Hotelterrasse. Seit gestern war der Tod im Haus, aber davon brauchten die Gäste nichts zu wissen. Manager und Hotelpersonal hatten ihr Möglichstes getan, den Trauerfall geheimzuhalten. Es war kein behagliches Gefühl, eine Leiche im Haus zu wissen, und die Gäste sollten sich in Shepheards Hotel behaglich fühlen.
Nur an dem „Deutschen Stammtisch“ war die laute Fröhlichkeit seit gestern verschwunden. Einige der Herren kannten Kreß persönlich. Aber auch die andern fühlten aufrichtige Trauer. Jedermann wußte, wer Konrad Kreß war. Ein Ehrenmann, ein tüchtiger Kerl. Wenn auch seine Aktien jetzt faul standen, — lieber Gott, das konnte dem Besten passieren in diesen Zeiten. Und außerdem: ein Landsmann! Daheim merkt man es nicht so, aber hier draußen, in der fremden Welt, da spürt man es plötzlich, daß wir zusammengehören, da ist jeder Deutsche für den anderen ein Stück Heimat, und was ihn trifft, trifft die anderen mit.
Erich Thornberg war vielleicht der, den die Nachricht von dem plötzlichen Tode des Geheimrats Kreß am tiefsten getroffen hatte. Kreß tot! Seine ganze Reise nach Kairo also umsonst! Nun ging das Suchen wieder an, die Jagd nach dem Kapital. Denn die Expedition mußte, mußte noch im kommenden Sommer gestartet werden.
Der Bankier Friedenauer neigte sich vertraulich dicht an Thornbergs Ohr. „Sie werden das Geschäft nun doch wohl mit mir machen müssen, Herr Thornberg.“
Der Forscher antwortete nicht. Er sah. wie die anderen Herren neben und um ihn nach dem Hoteleingang sahen, in dem ehen eine schlanke Dame mit einem ernst-ruhigen Gesicht erschienen war.
„Da ist sie!“
Britta Kreß hatte gestern ihr Zimmer nicht verlassen und alle Besuche abgewiesen. Nur mit dem Arzt und dem Manager des Hotels hatte sie verhandelt. Letzterer gab ihr auch jetzt das Geleit. Er hatte sein offiziellstes Trauergesicht aufgesetzt und erschöpfte sich in leisen Beileidsbezeugungen, schielte dabei ängstlich mit einem Auge nach den Gästen, die fröhlich auf der Terrasse plauderten. Die brauchten nichts zu merken.
Die Herren waren aufgestanden und umdrängten die junge Frau, die ernst, aber vollkommen ruhig und gefaßt die gemurmelten Beileidsbezeugungen entgegennahm. Einer der Herren stellte flüchtig Erich Thornberg vor.
„Mich trifft das unerwartete Unglück ganz besonders,“ konnte der Polarforscher sich nicht enthalten zu sagen, als er sich über die schlanke Hand der Dame beugte, „ich hoffte heute auf eine Unterredung mit Herrn Geheimrat.“
Ein gleichgültiger Blick Brittas streifte sein Gesicht.
„In geschäftlicher Angelegenheit?“
„Ja.“ Erich Thornberg verwünschte innerlich seine Taktlosigkeit. War jetzt der Augenblick, von Geschäften zu reden? Aber das Ungeschick war ihm nun einmal unterlaufen. Er hatte sich hinreißen lassen, von dem zu sprechen, was ihm am schwersten auf dem Herzen lag. Und die kühlen grauen Augen lagen so ruhig, antwortheischend auf ihm. „Es handelte sich um ein Geschäft, das ich Ihrem Herrn Gemahl vorschlagen wollte,“ sagte er abschließend, innerlich unzufrieden mit sich selbst und machte Miene, in den Kreis der Herren zurückzutreten.
Aber die grauen Augen ließen ihn nicht los.
„Ich werde natürlich die laufenden geschäftlichen Angelegenheiten meines Mannes ordnen,“ sagte Frau Britta so nebenbei. „Sie können sich also ruhig an mich wenden.“
Thornberg verbeugte sich. „Ich danke Ihnen, gnädige Frau. Ich werde mir also erlauben, später einmal — in Berlin ...“
„Warum?“ Frau Britta sah ihn kalt und gelassen ins Gesicht. „Sie können mir das ebensogut jetzt gleich sagen, Herr Thornberg.“ Ihre Hand machte eine kleine einladende Bewegung zum Hotelvestibül hin. „Bitte.“
Bestürzt, in peinlicher Verlegenheit folgte Erich Thornberg der gelassen Voranschreitenden. Die Herren sahen sich an. Das war mal wieder so recht Frau Britta Kreß: Kühl bis ans Herz hinan. Gestern war ihr Mann gestorben, der arme Kreß lag noch im Sarg, und diese Frau konnte ohne Aufregung gleichgültige Geschäfte erledigen. Weiß Gott, man war nicht allzu zart besaitet. Man war hart geworden, damals im Krieg und später erst recht im Geschäft, im unbarmherzigen Kampf ums Dasein. Aber das ging denn doch über die Hutschnur. Die Blicke, die die Herren der Frau Geheimrat nachsandten, waren nicht gerade die freundlichsten. Der Rheinländer brummte sogar ein Wort, das verdächtig nach „Hundeschnauze“ klang.
4. Kapitel.
In peinlicher Verlegenheit stand Erich Thornberg in dem kleinen Damensalon, der zu Frau Kreß’ Appartement gehörte. Seine Blicke hingen scheu an der offenen Verbindungstür. Drinnen im Nebenzimmer lag, mit einem weißen Tuch bedeckt, auf dem Ruhebett der tote Geheimrat Kreß. Und er sollte hier, sozusagen im Angesicht des Toten, von Geschäften reden? Unmöglich! Eine ganz unmögliche Situation!