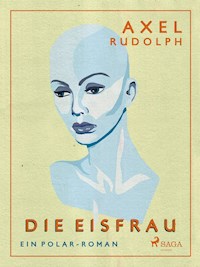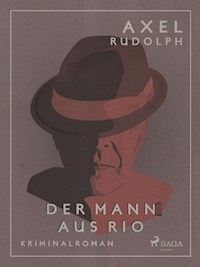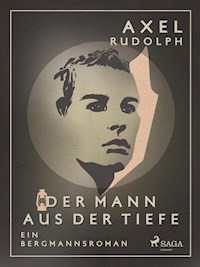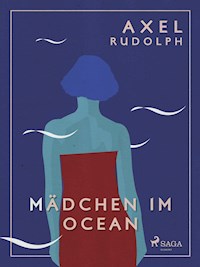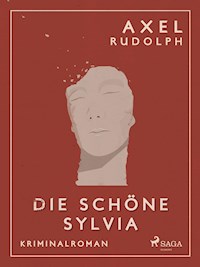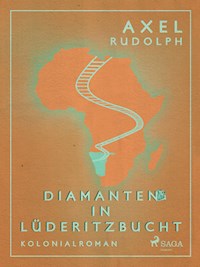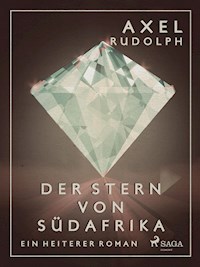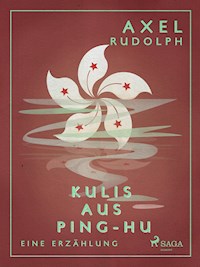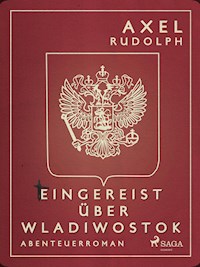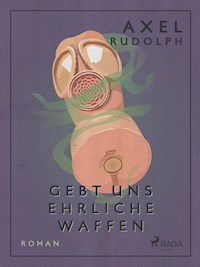
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jane Harnish ist eine der wenigen Ladies ihres Standes, die arbeitet. In der Halle nebenan wird mit dem neuen Gas experimentiert. Dr. Westphal lagert den Tod hübsch in Flaschen und Gläser, denkt nur an seine Wissenschaft und nicht die Menschen, die sich einmal darunter winden werden. Durch die Augen Janes erleben wir das Grauen, das die Versuche Dr. Westphals mit sich führen und auch die Konsequenzen, die diese theoretischen Versuche im Laboratorium durch die graue Wirklichkeit ziehen. Mit diesem aktuellen Gedanken spielte Axel Rudolph bereits 1933 in seinem Roman, den er in den USA veröffentlicht. Hier agitiert er gegen die (in der Fiktion unterstellte) militärische Giftgasproduktion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Axel Rudolph
Gebt uns ehrliche Waffen
Roman
Saga
I.
„Noch mehr Blumen, Mr. Hopkins!“
Charley hält ratlos dem Butler den riesigen Chrysanthemenkorb entgegen, den er eben an der Haustür einem Boten abgenommen hat. Auch Hopkins, der würdige Butler, macht eine verzweifelte Bewegung, als ob er sich allen Anstandsregeln zuwider am Kopf kratzen wolle, sieht sich suchend, wägend nach allen Seiten um.
Blumen, Blumen, Blumen. Üppige Chrysanthemen und feingliedrige, schlanke Rosenknospen, phantastische wilde Orchideen und Wildlinge aus den Wäldern am Potomac, mexikanische Christrosen und ganze Riesenbüsche von Azaleen. Die ganze weite „Hall“ eine Orgie von Farben und Duft, von den kleinen ovalen Marmortischen neben dem Eingang bis hinauf zu der Doppelglastür, die zum Wintergarten hinüberführt. Sie sieht sonst etwas nüchtern und streng aus, die Halle in der Villa Harnish, ganz so, als habe bei der Auswahl der Möbel hier noch ein Hauch jener ersten Harnishs gespukt, die sich im Lande Penns ansiedelten, in der Brust ein Herz und im Kopf eine Rechenmaschine trugen. Aber heute verschwinden die hochlehnig steifen Armstühle mit ihren feierlichen Wappenintarisien ganz unter der Flut der Blumen, die ihre bunten Flügel um die alten, steifen Gesellen schlagen. Marlene Dietrich würde zerplatzen vor Neid, wenn sie diese Halle mit dem Foyer des Roxy bei ihrer Premiere vergleichen könnte.
„Wohin damit, Mr. Hopkins?“
Immer noch hält Charley den Blumenkorb vor sich hin, und immer noch späht der Butler vergebens nach einem freien Platz. Schließlich gibt er sich einen Ruck:
„Wir müssen die Blumen noch mehr zusammenrücken. Los, Charley, Fred, George! Dort drüben an die Wand. Ja, so! Nein, das Arrangement vom Kriegsdepartement natürlich hier auf den Tisch, Idiot!“
Fred, der erst vor vierzehn Tagen neueingestellte jüngste Diener, setzt erschrocken den Riesenkorb, den er eben vom Tisch nehmen wollte, wieder hin. Sein Blick streift dabei die große, elfenbeinfarbene Karte, die an dem Korb befestigt ist. „Kriegsdepartement, Washington“, steht darauf.
Fred ist ein Greenhorn, ein harmloses. Während er schwitzend Blumenkörbe aus einer Ecke in die andere schleppt, vergißt er vollständig die Regeln, die man ihm auf der Dienerschule eingetrichtert hat, und fragt seinen Kollegen Charley neugierig: „Was hat denn Miß Jane mit dem Kriegsdepartement zu tun, daß man ihr von dort Blumen zum Geburtstag schickt?“
Charley, die korrekte Dienerseele, hat für diesen Vorstoß nur einen schweigenden, eisig-verachtungsvollen Blick, und George wirft aus den Augenwinkeln einen erschrockenen Blick nach dem Butler. Aber Mr. Hopkins ist heute in leutseliger Stimmung. Er läßt sich sogar dazu herab, dem Neuling höchstpersönlich eine Antwort zu erteilen:
„Wenn man die Tochter von I. T. Harnish ist ...!“ Und mitleidig fügt er hinzu: „Wann hat denn dich der Wind übers Wasser geweht — Greenhorn?“
Im selben Moment aber hebt Mr. Hopkins den Kopf. Seine Nase wittert in der Luft. Drinnen im Wintergarten sind die plaudernden Stimmen lauter geworden. Ein Mann wie Mr. Hopkins weiß sofort, was das bedeutet: Mr. Harnish und die Gäste nähern sich der Tür. Mit einer einzigen Handbewegung fegt der Butler die Diener aus der Halle: „Raus hier! Was jetzt noch kommt, wird einfach im Treppenflur aufgestellt.“
Dicht auf den Fersen der Hinauseilenden drückt der Butler die Tür ins Schloß, nimmt selber in einer Ecke Aufstellung, ruhig, würdevoll, unpersönlich: ein Stück Inventar des Hauses.
„Wonderful!“ Miß Daisy Glenn bleibt in der geöffneten Tür des Wintergartens stehen und starrt entzückt in die Blumenpracht. Neben ihr drängt sich Mildred Bruce, Gloria Proctor und die anderen Freundinnen Jane Harnishs, flattern — selber ein kostbarer Traum von duftigem Tüll, Seide, Crêpe, Farben und Blumen — wie Kolibris hinunter in die Halle, von einem Blumenarrangement zum anderen. Mr. Hopkins, der Butler, aber hat keinen Blick für diese lachende, lockende, tänzelnde Mädchenschar der amerikanischen obersten Fünfhundert. Seine Augen hängen fest und aufmerksam an dem Mann, der ruhig und selbstbewußt, mit der Würde des Hausherrn, hinter den Damen die zwei Stufen vom Wintergarten in die Halle hinabsteigt: Mr. I. T. Harnish.
Daisy Glenn flattert von einem Blumenstrauß weg auf Mr. Harnish zu und hängt sich an seinen Arm. „Entzückend, Mr. Harnish! Jane liebt die Blumen, nicht?“ Von der anderen Seite tänzelt die plantin-blonde Mildred heran, ungeduldige Neugier in der Stimme:
„Wo ist sie denn nun? Wo bleibt denn Jane?“
„Sie ist noch im Werk, liebe Mildred.“ Mr. Harnishs Stimme ist eine vollkommene Harmonie zwischen väterlicher Nachsicht und dem Respekt, den ein amerikanischer Gentleman einer Dame schuldig ist. „Wie jeden Tag.“
„Aber doch nicht heute?“
Mr. Harnish zuckt ein wenig die Schultern. „Heute wie immer. Sie kennen ja ihre Schrullen.“
Ein vorwurfsvoller Blick Daisy Glenns: „Oh! Sagen Sie nicht so, Mr. Harnish.“
„Ihren Arbeitseifer denn,“ verbessert sich Harnish lächelnd. „Seitdem Jane aus Deutschland zurück ist, bringt sie ja jeden Tag, den Gott werden läßt, im Laboratorium zu.“
„Merkwürdig!“
„Interessant!“
Die ebenfalls seit einiger Zeit jählings erblondete Gwendolyn mischt sich ein. „Ich weiß. Der junge Warren treibt denselben Sport. Er geht täglich in die Fabrik seines Vaters.“
I. T. Harnish sieht von seinen sechs Fuß auf das zierliche, duftige Persönchen herab, und in seine Stimme kommt etwas von dem trockenen Ernst, mit dem er drüben im Verwaltungsgebäude die Geschäfte seines Konzerns leitet.
„Sie irren, liebe Gwendolyn. Jane treibt keinen Sport. Sie arbeitet.“
Einen Augenblick lang ist es, als sei über die heitere Blumenpracht ein Schatten gefallen. Der Schatten der Harnish-Werke, die drüben aus Nebel und Dunstwolken ihre Schlote und Tanks emporrecken. Die jungen Damen fingern unruhig an ihren hauchfeinen Sommerkleidern, als könne das harte Wort, das da eben gefallen ist, sich festsetzen und einen Blütentraum zerstören. Arbeit? Natürlich. Arbeit muß sein. Männer arbeiten. Verdienen Geld. Machen Dollars. Das muß so sein. Aber man spricht doch nicht davon vor Damen! Und eine Lady arbeitet überhaupt nicht. Sie beschäftigt sich, treibt Sport, stellt Rekorde auf — was man will. Aber sie arbeitet doch nicht! Ganz im Innern nennen die Freundinnen die Arbeitswut Janes genau so, wie ihr Vater es eben genannt hat: eine Schrulle einen Spleen. Aber die Daisys, Mildreds und Gwendolyns würden sich lieber die rosigen Zünglein abbeißen, als dieses unhöfliche Wort auszusprechen.
Daisy Glenn bricht mit ihrer süßen Zuckerpuppenstimme den kurzen Bann des Augenblicks:
„Sie sollten noch einmal telephonieren, Mr. Harnish! Jane kann doch nicht an ihrem Geburtstag ihre Gäste im Stiche lassen.“
Für einen wohlerzogenen Gentleman ist der Wunsch einer Dame Befehl. Mr. Harnish macht eine zustimmende Verbeugung und geht zur Türe, die der Butler bereits aufgerissen hat. — — — — — — —
Dumpfe, von Chemikalien durchschwängerte Laboratoriumsluft. Über Retorten und Reagenzgläser beugt sich ein ernstes, herbes Frauengesicht, so gradlinig und nüchtern wie der ganze, praktisch eingerichtete Raum, in dem jedes Glas, jede Tabelle einen geheiligten Platz hat.
„Miß Harnish!“ Eine Assistentin in weißer Kittelschürze steht an der Tür. „Ihr Herr Vater hat eben wieder angerufen.“
Langsam richtet sich Jane Harnish von ihrer Arbeit auf, streicht sich mit einer ruhigen Bewegung das glatte, blonde Haar über den Kopf zurück.
„Ja, ich komme schon.“
Ein paar Anweisungen an die Assistentin während des Händewaschens, ein Umtauschen des Laboratoriumkittels mit einem hellen Staubmantel, der nicht viel anders aussieht, — Janes Gedanken sind immer noch bei der Arbeit. Schon im Begriff zu gehen, wendet sie sich nach der Assistentin zurück:
„Ist Dr. Westphal im Hause?“
„In seinem Labor, glaube ich.“
Jane Harnish macht kehrt und geht zurück durch den ganzen Raum zu der kleinen Tür, die ihr Labor mit den anderen Abteilungen verbindet. Draußen, in dem Verbindungsflur des langgestreckten Gebäudes, erregt ihr Auftauchen heute allerlei Aufsehen. Die Assistentinnen, die mit Tabletts voll Reagenzgläsern durch den Flur eilen, lächeln. Die jungen Assistenten, die fast alle eher einem Sportchampion ähneln als einem Mann der Wissenschaft, lächeln gleichfalls, sogar Gills, der alte Labordiener, zieht den Mund bis an die Ohren.
„Glückwunsch, Miß Jane!“ — „Ich gratuliere!“ — „Meinen herzlichsten Glückwunsch zum Geburtstag!“
Es liegt mehr als bloße, konventionelle Höflichkeit in diesen Geburtstagswünschen, ob sie nun feierlich hergesagt oder im Vorbeigehen ihr burschikos zugerufen werden. Das freundliche Lächeln der Kollegen gilt der Kollegin, nicht der Tochter des Chefs. Und Jane Harnish erwidert jedes Lächeln.
Erst als sie vor der Tür steht, die die Aufschrift „Labor Dr. Westphal“ trägt, verschwindet das Lächeln von ihrem Gesicht. Auch in dem großen Saal, den Jane nun durchschreitet, ist das Lächeln der dort arbeitenden Kollegen um eine Nuance zurückhaltender, die Glückwünsche etwas leiser und flüchtiger. Hier wird mit dem neuen Gas experimentiert, und das erfordert angespannte Konzentration. Eine Glastür führt vom großen Saal in das Privatlabor Dr. Westphals, das fast ebenso groß ist. Aber im Gegensatz zu dem Arbeitsbetrieb im Assistentensaal herrscht hier fast feierliche Stille. Nur wenige Tiegel und Retorten, dafür aber große Schränke voll Aktenbündel und Tabellen. Dr. Westphal, der Chefchemiker der Harnish-Werke, erhebt sich von seiner Schreibtischarbeit, als Jane Harnish eintritt und mit leichtem Gruß die Tür hinter sich zuzieht.
„Entschuldigen Sie die Störung, Dr. Westphal. Aber ich muß Sie fragen: Hat meine Vermutung, daß die Toxine der Cyanitgruppe zersetzend die Blutkörperchen angreifen, sich als stichhaltig erwiesen?“
Dr. Westphal sieht einen Augenblick vor sich hin, wie um seine Gedanken auf diesen Punkt zu sammeln.
„Unsere Tierexperimente haben bis jetzt Ihre Annahme bestätigt, Miß Harnish. Das Material darüber stellt Ihnen Dr. Banft morgen zur Verfügung. Es fragt sich aber, ob bei der wesentlich anders gearteten Zusammensetzung des menschlichen Blutes diese Erscheinung auch am menschlichen Organismus auftritt. Wir haben darüber bis jetzt noch keine Erfahrungen.“
Dr. Westphals Stimme klingt leise, leidenschaftslos, sachlich-kühl. Seine ruhigen Augen sehen an Jane Harnish vorbei. Jane haßt diese kalten Züge und weiß gar nicht, daß sie in diesem Augenblick nicht viel mehr sind als ein Spiegelbild ihres eigenen, kalt verschlossenen Gesichts.
„Danke!“ sagt Jane eisig. „Ich wollte es nur wissen, da ich Dr. Kemblay für heute die weitere Beobachtung überlassen habe. Ich mache heute Feiertag.“
„Oh, ich vergaß.“ Dr. Westphal macht eine förmliche Verbeugung. „Meinen ergebensten Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag, Miß Harnish.“
„Vielen Dank. Mein Vater hat Ihnen eine Einladung zu unserer kleinen Feier geschickt?“
Dr. Westphal nickt. „Ich werde gern davon Gebrauch machen.“
Kühl und konventionell wie Dr. Westphals Worte ist Janes zustimmendes Kopfnicken. Nicht einmal das übliche, nichtssagende Lächeln der Dame vermag sie auf ihre Lippen zu zaubern hier in diesem leeren, großen Raum, vor diesem leeren, kalten Gesicht da. An der Tür wirft Jane Harnish unwillkürlich noch einmal einen Blick zurück durch die Glasscheibe und nimmt den Eindruck des scharf ausgearbeiteten Gelehrtenkopfs mit, der sich am Schreibtisch schon wieder über seine Arbeit gebeugt hat.
„Da sitzt er nun wie die große giftige Spinne im Netz,“ geht es ihr durch den Sinn, während sie zurück durch die Labors wandert. „Kennt keinen anderen Ehrgeiz, als neue Gase, neue Kombinationen zu ersinnen, die eine giftiger und furchtbarer als die andere, lagert den lauernden Tod hübsch in Gläser und Flaschen und denkt nur an seine Wissenschaft, nicht an die Menschen, die einmal sich darunter winden werden. Der Dr. Gerhard Westphal!“ Ein bitterer Zug legt sich um Janes Mund. Einmal, ja einmal, da hat Gerhard Westphal anders ausgesehen. Damals, als sie drüben jenseits des großen Wassers im alten lieben Heidelberg bei ihm im Hörsaal saß, damals, als der Privat-Dozent der Chemie Dr. Gerhard Westphal nach den Vorlesungen wie ein junger Student mit ihr durch die Neckardörfer streifte, lustig, übermütig, sich ausschütten wollte vor Lachen über die Amerikanerin, die nichts begriff von der Schönheit seiner Heimat, und so lange lachte, bis auch Jane Harnish ihre amerikanische Nüchternheit vergaß, herzlich mitlachte und durch das Lachen hindurch einen Hauch jener alten, romantischen Welt Heidelbergs verspürte. Bis sie dann eines Tages eine Fahrt machten zu den Höchster Farbwerken. Bei der Besichtigung dort war es gewesen. Da hatte Gerhard Westphals Gesicht plötzlich einen strengen, harten Zug bekommen, und seither war das Grübeln nicht mehr aus ihm gewichen. Jane Harnish war nach Beendigung ihrer Studien nach Hause zurückgefahren. Und nach einem Jahr war dann der Name Gerhard Westphals als des Entdeckers eines neuen Gases durch alle Fachblätter gegangen. Die Edgewood-Werke waren aufmerksam geworden und hatten sich den Mann herübergeholt durch das Angebot eines Arbeitsfeldes, wie es die Heimat ihm niemals bieten konnte. Gerhard Westphal war der Chefchemiker der Harnish-Werke geworden.
Der bittere Zug um Jane Harnishs Mund bekommt etwas Verächtliches. Schwindel, die ganze Alt-Heidelberg-Romantik. Das also war das Ende des freien, stolzen Burschenliedes: Chefchemiker der Harnish-Werke, der Mann, der aus tausend Retorten, mit allen Fähigkeiten seines Geistes den Tod braute für eine Welt!
In ihrem eigenen Labor hat der erste Assistent, Dr. Murphy, bereits Janes Platz eingenommen und sich in die Arbeit vertieft. Die Laborantin öffnet ihr beflissen die Tür, sieht ihr mit einem leisen Anflug von Neid nach. Vier Stunden Morgenarbeit im Labor! Heute, an ihrem Geburtstag! Wo sie es doch gar nicht nötig hat, sie, die einzige Tochter des großen I. T. Harnish. Unzufrieden macht sich die Laborantin an die Tabellen. Wenn Miß Harnish nicht den Spleen hätte, im Labor zu arbeiten, sondern täte, was ihr zukommt: sporteln, tanzen, reisen, flirten — man könnte längst befördert sein hier im Werk! — — — — — — — — — — — — — — —
Draußen im Werkshof, vor der Tür des Laboratoriums, steht ein eleganter, fabrikneuer Roadster. Jane Harnish geht um ihn herum und besieht ihn kennerhaft von allen Seiten. Ein leises Lächeln huscht dabei über ihr ernstes Gesicht. Der gute Daddy! Vor einigen Wochen hat sie einmal davon gesprochen, daß dieser neue Autotyp ihr gefallen könnte. Nur so nebenbei. Und schon hat er ihr zum Geburtstag den Wagen verschrieben.
Jane Harnish setzt sich ans Volant, probiert sachkundig die Zündung, die Bremsen aus, gibt Gas — der Wagen springt an wie ein Vollblut-Fohlen, das zum ersten Male von der Leine gelassen wird.
Mitten durch die Harnish-Werke geht die Fahrt. An Hallen und Maschinensälen vorbei, hoppla, über Eisenbahnschienen und Drehscheiben. Alles hier im Werk atmet Amerika. Keine Spur von dem unfreundlichen Durcheinander der großen Fabriken, die Jane Harnish während ihres Studienaufenthaltes drüben in Europa kennengelernt hat. Keine rauchgeschwärzten Mauern, keine vernachlässigten, ungepflasterten Wege. Hier ist alles sauber, freundlich im Stil, frisch. Für modernste Maschinen die modernsten Einrichtungen, praktisch, den hygienischen und sanitären Forderungen entsprechend, dabei weitausgedehnt die Anlagen, fast eine Verschwendung von Raum. Sinnbild des weiten Landes, in dem die Fabrik steht. Man könnte diese Fabrikstadt mit ihren breiten, sorgsam asphaltierten Straßen, ihren schnittigen Sandsteinhallen und Gebäuden für ein Erholungsheim halten. Wenn nicht die bedrückende Luft wäre. Dicke, stickig-dumpfe Luft, die über dem ganzen Werk liegt und die freundlichen Farben der Gebäude verblassen läßt. Aus diesem weißlichgelben Qualm, der aus den Schloten steigt, und den der Wind wieder herunterdrückt, daß er wie Nebelschwaden über die niederen Dächer streicht, weht etwas wie Warnung, etwas Undefinierbares, das die Freude an den schönen Anlagen langsam erstickt. Vielleicht kommt es auch daher, daß der Himmel bleischwer und grau über dem Werk hängt, heute wie alle Tage. Vielleicht ist es der Geruch der Chemikalien, der graues Unbehagen weckt, sich beklemmend auf den Atem legt. Trotz ihrer musterhaften Einrichtungen bedrückt diese Fabrikstadt mehr als alle schwarzen Höfe und Maschinenhallen der alten Welt.
Der Wagen biegt um eine Ecke. Breit, massig, unheimlich wuchten über zwerghaft niederen Dächern die gewaltigen Tanks hervor, glotzen augenlos über das Werk hinaus, drohend, stumm: die Ätylenanlage, der Phosgentank, der — Tank III.
Über Jane Harnishs Gesicht läuft jedesmal ein kleines nervöses Zucken, wenn sie an diesem Eisenungetüm vorbeifährt. Der Tank III steht da wie ein Klotz, von Riesenhand in die Erde gestoßen für Ewigkeiten. Und doch hält nur eine dünne Eisenwand die furchtbaren Dämonen gefangen, die in seinem Innern brodeln. Dämonen, die, entfesselt, ganz Edgewood in ein schaurigstilles Totenfeld verwandeln würden. Selbst die Arbeiter, die ein Leben lang zwischen Gasen und Chemikalien, giftigen Dämpfen und lauernden Gefahren verbracht haben, werfen manchmal scheue Blicke nach dem Ungetüm.
Mannsgroße Plakate warnen, Anschläge mit ausführlichen Schutzvorschriften bedecken die Außenwand der Wärterhäuschen. Rund um den Tank patroulliert ein Mann mit einem verbissenen Bulldoggengesicht. Ein Mann, dem man trotz der unauffälligen Zivilkleidung auf zehn Schritte den Werkdetektiv ansieht, auch wenn man die typische Wölbung seiner Hüftentasche nicht bemerkt. Etwas abseits ein zweiter Mann vom gleichen Schlage im Gespräch mit einem Soldaten in der Uniform des in Edgewood stationierten 1. Gas-Regiments.
Jane stoppt ihren Wagen ab und winkt dem Soldaten. Der Zivilist greift gelassen grüßend an seine Melone. Jane beugt sich ein wenig aus dem Wagen vor, das konventionelle, nichtssagende Lächeln der amerikanischen Dame im Gesicht.
„Ist Sergeant Bixton aus Washington zurück?“
Der Soldat salutiert fast dienstlich:
„Nicht gesehen, Miß Harnish. Heute morgen war er noch nicht beim Appell.“
„Thank you.“
Der Wagen springt wieder an. Der Mann mit der Melone schiebt, dem Wagen nachsehend, einen neuen Wrighley in die Mundhöhle.
„Gute Chancen für Sergeant Bixton. Der Leutnant ist ihm sicher.“
Der Soldat nickt vergnügt. „Hat er längst verdient. Kein besserer Soldat im Gas-Regiment als Sergeant Bixton.“ — — — — — — — — — —
Am Werktor IV hält der alte Nel Croft den Pförtner am Rockknopfe fest. Die Hände des alten Arbeiters zittern. In seinen Triefaugen steht ein eindringliches Bitten. Der Pförtner fühlt einiges Mitleid mit dem Mann, aber schließlich kann er nicht gegen seine Instruktionen handeln. Nel Croft hat keine Kontrollkarte, sondern nur einen Krankenschein. Folglich darf er ihn nicht ins Werk lassen. Eine klare Sache.
„Aber ich muß ins Werk!“ Die brüchige Stimme des Alten blubbert vor Erregung. „Sie müssen das doch einsehen, Mr. Corner. Seit acht Wochen bin ich krank. Sie wissen doch, was es an Krankengeld gibt. Meine Tochter hat auch nur Halbschicht in dieser Zeit. Wir schulden im Konsum, wir schulden die Miete. Wo soll das hin, wenn ich nicht arbeiten darf?“
„Wenn Sie doch krank sind ...“
„Krank?“ In dem abgezehrten Gesicht des Alten zuckt und rüttelt es. „Natürlich bin ich krank. Eine Gasvergiftung geht nicht so schnell wieder weg. Aber ich bin doch aus der Behandlung entlassen. Ich kann wieder arbeiten und ich will arbeiten. Verstehen Sie mich, Mr. Corner?“
Der alter Croft will einen Schritt vorwärts machen, gibt es aber wieder auf. Der Pförtner steht wie ein Fels. Da gibt es kein Vorbeikommen. Behutsam schiebt er den alten Mann ein wenig zurück, dem Ausgang zu.
„Mr. Carter ist heute nicht da. Gehen Sie morgen zu ihm ins Büro, so gegen zehn Uhr. Er wird Ihnen dann wohl eine neue Arbeit verschreiben, irgendwo in einer anderen Abteilung.“
Ein krankhaft eigensinniger Zug breitet sich über das Gesicht des Alten. „O no! Ich will in keine andere Abteilung! Ich werde weiter beim Phosgen arbeiten, Mr. Corner.“ Seine Stimme steigert sich plötzlich zu einem schrillen Kreischen. „Bei dem Teufelszeug, das mir die halbe Lunge verbrannt hat! Nirgends anders.“ Der Pförtner hat schon unwillig die Hand gehoben, um den krankhaften Ausbruch des Alten zu dämpfen, aber die Stimme des alten Croft wird ebenso plötzlich, wie die angestiegen ist, wieder ganz still und hilflos: „Ich habe dieses Gas gern,“ sagt er leise. Und als der Pförtner ihn mißtrauisch-zweifelnd ansieht, fügt er in einem greisenhaft-kindischen Ton hinzu: „Es ist doch ein Teil von mir. Ich trag es ja in meinem Körper.“
„Verrückt,“ denkt der Pförtner. Aber er kommt nicht mehr dazu, eine Antwort zu geben. Er läßt den Alten stehen und springt, von einem Hupensignal geweckt, dienstbeflissen an das Tor, um Miß Harnish hineinzulassen. Ais er sich umwendet, ist der alte Croft verschwunden. Er hat den Augenblick benutzt, um sich in den Werkshof zu schleichen und sich seitwärts um einige Schuppen zu drücken.
„Ohne Kontrollmarke,“ brummt der Pförtner verärgert, doppelt verärgert, weil er weiß, daß er seinen Posten nicht verlassen und dem Unbotmäßigen nachsetzen kann. „Aber warte nur, mein Alter! Mußt ja heut abend denselben Weg raus. Da kriegst du von mir eine Zigarre, an der du vierzehn Tage zu rauchen hast.“
Janes Wagen fliegt unterdessen die Landstraße entlang, die von den Harnish-Werken zum Villenviertel von Edgewood führt, eine tadellose, breite, asphaltierte Autostraße. Sie sticht in ihrem Gesamtbild etwas ab von den üblichen Autostraßen Amerikas, denn die Fußsteige an beiden Seiten sind ungewöhnlich breit und — was man in Amerika selten sieht — belebt. Auf den großen Fahrstraßen durch die Staaten ist die Spezies der Fußgänger fast ausgestorben. Die Entfernungen von einer Stadt zur anderen sind zu groß, als daß man sie zu Fuß zurücklegen könnte. Man hat auch keine Zeit dazu. Selbst die Tramps denken nicht mehr daran, zu Fuß zu tippeln. Die Alten, die an der Tradition hängen, nisten sich nach wie vor in den Güterzügen ein. Die jüngere Generation läßt sich von vorüberfahrenden Autos mitnehmen.
Hier aber kommen Scharen von Fußgängern dem Auto entgegen; es sind Arbeiter, die nach Edgewood zur Schicht gehen. Es ist etwas Eigenartiges um diese Arbeiter von Edgewood. Sie haben nichts gemein mit den grauen Massengestalten der Fabrikarbeiter und Bergleute in den europäischen Industriegebieten. Man sieht keine zerschlissenen Kittel und Anzüge, die von Armut und Not reden, keine verbitterten, abgezehrten Gesichter, aus denen der ungestillte Hunger eines unwillig getragenen Daseins spricht. Es sind amerikanische Arbeiter, first class workmen. Edgewood bezahlt seine Arbeiter gut. Harnish und seine Geschäftsfreunde haben längst erkannt, daß es sich bezahlt macht, den Arbeiter bei guter Stimmung zu halten. Und dennoch haben diese Arbeiter von Edgewood etwas, das sie unterscheidet von den selbstbewußten Workmen in anderen amerikanischen Fabriken. Sie gehen nicht, sie trotten. Langsam und schwerfällig, als laste ein Druck auf ihnen. Irgendwie sind alle diese Gesichter den stumpfen, verbitterten Bergmannsgesichtern der alten Welt verwandt, den Menschen, die unter Tage arbeiten, denen die Sonne nur in Feierstunden scheint. Das ist das Gas. Es liegt auf den Leuten von Edgewood wie ein immerwährender Alp, dumpf, erstickend, atembeengend. Es rasselt im Husten des Mannes, der tagsüber im giftigen Nebel stand. Es droht in den zerfressenen Fingern des Arbeiters, der seinen Lohn im Kampf mit Säuren und giftigen Dämpfen erarbeitet. Es spukt in den Träumen der Arbeiterfrauen, die ängstlich hinüberstarren zu den drohenden Tanks, unter deren Schatten ihre Männer leben und schaffen.
Ein junger englischer Maler hat einmal ein Bild von Edgewood gemalt, ein Bild grau in Grau, eine Nebelstadt, die aus fahlgelben, drohenden Schwaden emporwächst. Das Bild ist von der Jury ausgelacht worden, und man hat dem Phantasiegebilde jede Ähnlichkeit abgesprochen mit den wirklichen, mustergültig sauberen, modernen und freundlichen Arsenalen von Edgewood. Und doch hat dieser Maler die Wirklichkeit besser gesehen als alle Kameraplatten der Welt. Er hat das Edgewood gemalt, wie es in den Gesichtern der Arbeiter geschrieben steht.
Einzeln und in Gruppen trotten die Arbeiter der Belegschaft an Janes Wagen vorbei. Hier und da tippt einer grüßend an die Mütze. Andere drehen den Kopf über die Schulter und sehen dem eleganten Car nach. Und man weiß nicht recht, was in diesen Augen geschrieben steht: Wunschträume, Erfolgsbewunderung, Neid oder Feindseligkeit.
Jane Harnish fliegt in ihrem Wagen aus der Dunstatmosphäre der Werke hinaus, dem Villenviertel entgegen, das im blendenden Sonnenlicht des Sommertages daliegt.
Schon von weitem winken von der Veranda der Villa Harnish duftige Spitzentüchlein dem ansausenden Wagen entgegen. Schmetterlingsgeflatter den wohlgepflegten Gartenweg entlang, als Jane in elegantem Bogen einschwenkt und stoppt. Küsse, Umarmungen, Gratulationen.
„Oh, Jane! Warum bleibst du so lange?“
„Wir sind schon über eine Stunde hier!“
„Mildred ist sogar hierher geflogen!“
„Und ich bin heut Morgen ohne Frühstück weg. Mutter fiel beinahe in Ohnmacht.“
Im Triumph führen die Freundinnen das Geburtstagskind zur Veranda hinauf, wo Mr. Harnish lächelnd wartet. Jane nickt ihrem Vater zu. Aber im nächsten Augenblick steht wieder der ernste Zug in ihrem Gesicht.
„Du, Vater. Die Ätylenanlage wirkt allzu stark. Wir produzieren seit gestern...“
Harnish schließt ihr lächelnd den Mund. „Heute nicht, Jane. Heut sprechen wir mal nicht vom Werk. Gefällt dir der neue Wagen? Wir können ihn sonst umtauschen.“
Jane schüttelt dem Vater die Hand. „Nein, er gefällt mir sehr gut. Dank dir, Daddy.“
„Und die Blumen, Jane!“ Daisy Gleen zieht ihre Freundin den anderen voran in die Halle. „Sieh doch nur, diese Pracht!“
Einen Augenblick neigt Jane das Gesicht hinab in die Blütenfülle. Dann wendet sie sich an ihren Vater.
„War Bixton noch nicht hier?“
„Vor dem Lunch. Kind? Würde das sich schicken? Aber wart nur! Wird nicht so lange dauern bis halb Edgewood antritt. Hab so was gehört von Festzug, Aufmarsch usw. Auch ...“ Harnish bricht betroffen ab und sieht seine Tochter an, die plötzlich mit erhobenem Kopf in die Luft sieht und eine kleine Handbewegung macht, als wolle sie Schweigen gebieten. „Was hast du denn?“
„Riecht ihr nichts?“
Daisy Gleen lacht herzlich. „O ja! Blumendüfte! Wer’s nicht riecht, muß bös erkältet sein!“
Janes Hand scheucht das Scherzwort beiseite wie eine Fliege. Ihre Augen suchen den Vater.
„Mir ist doch, als ob ... Vater! Gas?“
Einen Augenblick schnuppert auch Harnish unruhig in der Luft, schüttelt dann den Kopf.
„Ich rieche nichts. Gespenster, Jane. Du hast dich überarbeitet.“
„Vielleicht.“ Jane nickt und der angespannte Ausdruck in ihrem Gesicht verschwindet langsam. „Ich bin tatsächlich nervös.“
Mr. Harnish hält es für Zeit, das Gespräch in andere Bahnen zu lenken. Er schlägt vor, einen Spaziergang zu machen. Daisy widerspricht. „Jetzt, vor dem Lunch, Mr. Harnish. Nein, bis dahin gehört lane uns ganz allein.“ Und während Jane die Freundinnen in den Wintergarten hineinbugsiert, wirft sie in der Tür dem zurückbleibenden Harnish eine Kußhand zu:
„Auf Wiedersehen nachher — Daddy!“
Eine Sekunde lang sieht Harnish mit leisem Schmunzeln auf die Glastür, hinter der das lustige Mädchengeplauder verklingt. Dann steckt er beide Hände in die Hosentaschen und wendet sich an den Butler, der noch immer in geruhsamer Würde an der Türe steht. Mr. Harnishs liebenswürdig-scharmante Stimme klingt auf einmal trocken und geschäftsmäßig:
„Wer wartet?“
„Mr. Utterson, in der Bibliothek. Außerdem noch im Vorzimmer Sergeant Bixton.“
„Bixton?“ Harnish hebt rasch den Kopf.
„Er wünscht Mr. Harnish persönlich zu sprechen,“ fügt der Buttler schnell hinzu.
„Herein mit ihm!“
An dem Butler vorbei tritt ein gutaussehender hochgewachsener Mann in die Halle, einer jener amerikanischen Männertypen, deren trainiertem, beherrschtem Sportgesicht man nie ansieht, ob es nun fünfundzwanzig oder fünfundvierzig Jahre alt ist. Mr. Harnish nickt dem in der Nähe der Tür Stehenbleibenden vertraulich zu:
„Well, Sergeant? Schriftlich oder mündlich?‘
„Beides.“ Sergeant Bixton zieht aus seiner Rocktasche einige verschlossene und versiegelte Briefe und reicht sie dem Großindustriellen hin. Harnish reißt sie auf und überfliegt den Inhalt, gibt sie dann mit einer verächtlichen Handbewegung dem wartenden Butler:
„In die Bibliothek. Utterson erledigt das.“
Kaum hat sich die Tür hinter dem Butler geschlossen, da streckt Harnish die Hand nach seinem Besucher aus:
„Und weiter? Das kann nicht alles sein.“
„In der Tat, Mr. Harnish. Aber das Weitere bringe ich nur mündlich. Der Staatssekretär meinte ...“
„Ein gesprochenes Wort ist weniger gefährlich als ein schriftliches. Also los: Die Ausfuhrerlaubnis ist erteilt?“
„Der Staatssekretär beauftragte mich, Ihnen mitzuteilen, daß in Übereinstimmung mit der an Shefal Brothers erteilten Ausfuhrerlaubnis einem Export in dem von Ihnen angeregten Sinne nichts im Wege steht.“
„Sehr gut.“ Harnish steckt befriedigt die Hände wieder in die Hosentaschen und beginnt im Zimmer auf und ab zu marschieren. „Das Quantum?“
„Wird Ihnen überlassen.“
„Also unbeschränkte Ausfuhrerlaubnis. Ausgezeichnet.“
„So sagte der Staatssekretär. Aber eine schriftliche Bestätigung erhielt ich nicht.“
„Nicht nötig. Staatssekretär Deventer hält sein Wort.“ Harnish unterbricht seinen Marsch und bleibt vor dem Sergeanten stehen. „Sonst noch was?“
Der Mann vor ihm sieht ihm grade in die Augen. Irgend etwas zuckt leise in seinem Gesicht.
„Nichts von Belang, Mr. Harnish. Nur ...“
„Na, was denn? Heraus damit!“
Bixton nimmt einen Anlauf. „Es ist nur ... Der Staatssekretär wunderte sich, daß Sie einen einfachen Sergeanten als Kurier in einer so wichtigen geschäftlichen Angelegenheit schickten.“
Breitbeinig bleibt Harnish vor dem Sergeanten stehen, ein ganz leises Lächeln um die schmalen Lippen.
„So, so. Er wundert sich? Und Sie, Bixton, Sie wundern sich wohl auch?“
„Ich muß gestehen ...“
„Sollte wohl gar einen meiner Sekretäre damit betrauen, wie? Utterson oder den smarten Brokers?“ Harnish nimmt seine Wanderung durch das Zimmer wieder auf. „Nee, mein Junge. Das sind Geschäftsleute. Gewiß, sie sind mir ergeben. Natürlich. Sonst wären sie nicht in meinen Diensten. Aber ihre Ergebenheit hat eine Dollargrenze. Wenn der Chef eines Bankhauses einem kleinen Kassierer einen Check über 100 000 Dollar anvertraut, und der geht dann damit durch, dann verdient er Prügel. Der Chef nämlich. So ist es auch hier: Einem Utterson oder Brokers ein Millionenobjekt anvertrauen, hieße genau so handeln. Hätte wenig Respekt vor ihnen, wenn sie die Konjunktur nicht ausnutzten, und damit zur Konkurrenz gingen.“
„Ich verstehe ...“ Ein klein wenig Bitterkeit liegt in der Stimme Bixtons. „Mich halten Sie für dumm.“
Wieder bleibt Harnish vor dem Sergeanten stehen.
„Machen Sie mich nicht wild Mann! Wer redet von dumm? Aber Sie sind Soldat, Bixton. Für euch Soldaten gelten andere Werte: Vaterlandsliebe, Ehre, Treue. Ihr habt Ideale. Damals im Krieg, da haben Sie täglich, stündlich Ihr Leben aufs Spiel gesetzt für das Vaterland. Wäre es denkbar, daß Sie die Interessen dieses Landes verraten könnten für eine halbe Million Dollar, he?“
Ein Lachen drüben, hart und doch froh:
„Nicht mal für Rockefellers Bankkonto.“
Harnish nickt ruhig wie jemand, der etwas bestätigen hört, was er längst weiß. Macht eine Handbewegung zu Bixton hin: „Da haben Sie das Geheimnis.“ Und nimmt seine Wanderung wieder auf. Ein-, zweimal marschiert er durch das Zimmer, in Gedanken schon ganz bei dem kommenden großen Geschäft. Dann fällt ihm plötzlich ein, daß der Sergeant immer noch dasteht. Er reißt ein Blatt aus seinem Checkbuch, füllt es mit ein paar fliegenden Zügen aus und reicht es dem Sergeanten.
„An der Kasse, Bixton. Machen Sie sich einen vergnügten Tag mit Ihren Kameraden.“
„Vielen Dank, Mr. Harnish.“ Bixton zögert, ein ganz klein wenig nur, aber Harnish hat es schon bemerkt.
„Was noch, Bixton? Wollen Sie Leutnant werden? Ich spreche gern mit Ihrem Obersten darüber.“
„Danke. Das ist es nicht. Die Beförderung ist mir schon vom Regiment in Aussicht gestellt worden.“
„Also was dann?“
Sergeant Bixton schluckt und druckst ganz gegen seine Gewohnheit. „Da ist noch etwas anderes ... Mr. Harnish ...“ Plötzlich hebt er den Kopf und sieht dem Manne vor ihm grad und fest ins Gesicht: „Ist es wirklich im Interesse des Vaterlandes, daß wir jetzt Giftgaswaffen an das — Ausland verkaufen?“
Eine Sekunde lang liegen die Augen der beiden Männer fest ineinander. Dann pfeift Harnish leise durch die Zähne, wendet sich ab und nimmt seinen unterbrochenen Marsch von neuem auf. Einen Augenblick denkt er daran, daß das eigentlich schön ist, dieses ehrliche Vaterlandsgefühl, das da aus der bangen Frage spricht. Aber natürlich muß man dem Jungen die Flausen aus dem Kopf treiben. Er läßt sich in einen der Sessel fallen und deutet mit einer kurzen Kopfbewegung auf einen zweiten hin. Erst als auch Bixton sich gesetzt hat, beginnt Harnish, langsam und bedächtig.
„Vor allem, mein Lieber: Ist es Ihnen klar, daß ich im Dienste der Landesverteidigung arbeite?“
Bixton nickt beistimmend. „Es wurde uns oft genug in der Instruktionsstunde eingeprägt: Die Harnish-Werke sind ein wichtiges Glied der nationalen Verteidigung und stehen unter direkter Kontrolle des Kriegsdepartements.“
„Na sehen Sie! Dienst bei mir ist Dienst am Vaterlande. Sonst würde man mir wohl kaum einen Sergeanten als Kurier zur Verfügung stellen, nicht? Sie sind nur Patriot, Bixton. Ich bin außerdem noch Geschäftsmann. Muß für Absatzmärkte sorgen. Je mehr die Industrie blüht, um so mehr Millionen können wir in die Landesverteidigung stecken. Leuchtet Ihnen das ein?“
„Gewiß, aber ...“
„Bleiben Sie mir mit Ihrem Aber vom Leibe, Bixton! Meinen Sie, der Staatssekretär würde die Erlaubnis erteilen, wenn sie den Interessen des Landes zuwiderliefe?“
„Schwerlich.“
„Na also! Auch Shefal Brothers haben ja neulich Waffen an das Ausland geliefert.“
Jetzt wird Bixton warm. „Maschinengewehre und Infanteriemunition. Und an Mexiko. Warum nicht? Ob die Brüder da unten sich mit unseren Patronen gegenseitig die Köpfe kaputtschießen, kann uns natürlich egal sein. Hier aber handelt es sich um Giftgase! Um Waffen, die bisher im Interesse der Landesverteidigung streng geheim gehalten worden sind. Die neuesten Gase, Projektors und Lancierrohre! Ich weiß wirklich nicht, ob ...“
Harnish hat die eben angezündete Zigarre wieder aus der Hand gelegt und ist aufgestanden. Ganz dicht tritt er an den Sergeanten hin, der sich gleichfalls erhoben hat.
„Und wenn ich Ihnen nun sage, Bixton: Diese Waffen bedeuten keine Gefahr mehr für uns? „Harnish greift in die Tasche und zieht aus einer Ledermappe