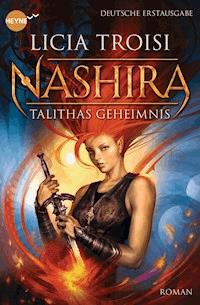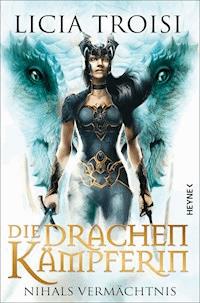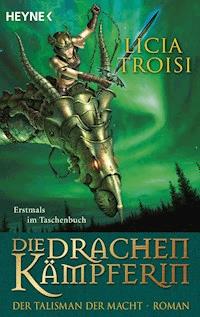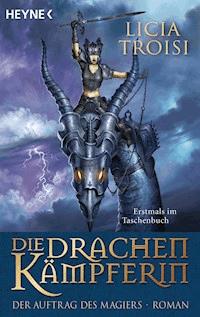9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Dominium-Reihe
- Sprache: Deutsch
An ihrem achten Geburtstag endet die Kindheit der kleinen Myra auf tragische Weise: Ihr Zuhause wird von vermummten Männern überfallen, ihr über alles geliebter Adoptivvater Fadi, wird getötet, Myra selbst gelingt in letzter Sekunde die Flucht in die eisigen Wälder Biaswads im Süden des Tränenreiches. Zehn Jahre später ist aus dem kleinen Mädchen eine starke Kriegerin geworden, die mit ihren beiden brennenden Klingen an der Seite des mächtigen Acrab für Frieden und Freiheit kämpft. Doch dann wird Myra von ihrer Vergangenheit eingeholt. Warum musste Fadi wirklich sterben? Und was weiß Acrab über den Tod ihres Vaters? Auf der Suche nach der Wahrheit stößt Myra auf Geheimnisse, die das ganze Reich in seinen Grundfesten erschüttern könnten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LICIA TROISI
DIE EISKRIEGERIN
DIE DOMINIUM-SAGA
ROMAN
Aus dem Italienischen übersetzt
von Bruno Genzler
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
An ihrem achten Geburtstag endet die Kindheit der kleinen Myra auf tragische Weise: Ihr Zuhause wird von vermummten Männern überfallen und ihr über alles geliebter Adoptivvater Fadi wird getötet. Myra selbst gelingt in letzter Sekunde die Flucht in die eisigen Wälder Biaswads im Süden des Dominiums der Tränen. Zehn Jahre später ist aus dem kleinen Mädchen eine starke Kriegerin geworden, die mit ihren beiden brennenden Klingen an der Seite des mächtigen Fürsten Acrab für Frieden und Freiheit kämpft. So glaubt sie zumindest. Doch dann wird Myra von ihrer Vergangenheit eingeholt. Warum musste Fadi wirklich sterben? Und was weiß Acrab über den Tod ihres Vaters? Auf der Suche nach der Wahrheit stößt Myra auf Geheimnisse, die das ganze Dominium der Tränen in seinen Grundfesten erschüttern könnten …
Die Autorin
Licia Troisi, 1980 in Rom/Ostia geboren, ist eine der bekanntesten Fantasy-Autorinnen weltweit. Sie studierte in Rom Physik und Astrophysik, bevor sie für die italienische Raumfahrtagentur in Frascati arbeitete. Das Schreiben gehörte jedoch schon immer zu ihren großen Leidenschaften und ihr erster Fantasy-Zyklus um die Drachenkämpferin wurde auf Anhieb ein internationaler Bestseller. Darauf folgten Die Schattenkämpferin, Die Feuerkämpferin, Drachenschwester und Nashira. Licia Troisi ist verheiratet und hat eine Tochter.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der italienischen Originalausgabe:
LA SAGA DEL DOMINIO – LE LAME DI MYRA
Deutsche Erstausgabe 12/2017
Redaktion: Ulrike Schimming
Copyright © 2016 Mondadori Libri S.p.A., Milano
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkterstraße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT GbR, München,
Umschlagillustration: Dmitry Grebenkov
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-21618-4V001
www.heyne.de
DIE
EISKRIEGERIN
ERSTER TEIL
DIE STIMME
DER VERGANGENHEIT
Prolog
Zehn Jahre zuvor
Myra stürzt zu Boden und schürft sich die Hände auf. Die Versuchung, einfach liegen zu bleiben, ist groß, aber sie darf ihr nicht nachgeben. Eine unbekannte Kraft befiehlt ihr aufzustehen und weiterzufliehen. Sie muss, sie muss überleben.
So rappelt sie sich hoch und rennt wieder los. Eine Schulter schmerzt höllisch, ihr Blick verschleiert sich, aber sie läuft weiter. Doch sie will sich nicht nur in Sicherheit bringen. Wenn sie nur schnell genug läuft, kann sie vielleicht alles, was passiert ist, hinter sich lassen und ungeschehen machen: Tallia, reglos in der großen Blutlache am Boden, den Mann mit dem Dolch in der Brust, den erloschenen Blick ihres Vaters.
Vor allem den Blick ihres Vaters.
Wieder stolpert sie und stürzt, ihr Atem rast. Sie ist am Ende ihrer Kräfte, sie kann nicht mehr. Noch einmal rafft sie sich auf, schleppt sich voran, kommt aber nur ein paar Ellen weit. Dann bleibt sie liegen. Und die raue Wirklichkeit packt sie mit aller Macht wie ein wütender, alles zerstörender Sturm.
Warum ist das passiert? Warum ausgerechnet ihr? Fadi und sie haben doch niemandem etwas getan, und dieses Stück Land mit seinen Feldern gehört ihnen. Man hat es ihnen überlassen, und vor Ajel, dem Gott der Biaswader, und den Menschen hat man es bezeugt. Aber vielleicht ist das die einzig mögliche Erklärung: Alles war zu gut. Sie hatte alles, was man sich nur wünschen kann, aber es sollte nicht sein. Sie wird bestraft, weil sie die Liebe ihres Vaters und die Sicherheit eines Zuhauses hatte. Sie hat gesündigt, indem sie glücklich war, und Glück kann gefährlich sein, weil es Neid erweckt. War nicht das der Grund, weshalb die Ersten aus ihrer Welt hinweggefegt worden waren?
Der Tag ist wunderschön, vollkommen. Sie wacht auf, als ihr der Duft von Melhaks und Kossuths, ihren Lieblingsspeisen mit viel Honig und getrockneten Früchten, in die Nase zieht und Vater mit dem Tablett in das Zimmer tritt.
»Herzlichen Glückwunsch, meine Süße«, sagt er.
Sie reckt sich hoch und umarmt ihn so stürmisch, dass er fast das Gleichgewicht verliert.
Es ist ihr Geburtstag, sie wird heute acht, und alles ist in herrlichster Ordnung. Sie lebt mit ihrem Vater Fadi in Biaswad, einem Land im Süden des Dominiums, genauer bei der Stadt Antraph, inmitten der Ebene der Fülle. Dies ist die Kornkammer des Kontinents, die einzige Gegend in dieser vereisten Welt, wo der Sommer lang und mild genug für den Ackerbau ist. Ihnen gehört ein kleines Stück Land. Der frühere Grundherr von Vater hat es ihnen geschenkt, und dort bauen sie an, was sie zum Leben brauchen. Sie sind keine Großgrundbesitzer, und Fadi lässt sich bei der Feldarbeit nur von wenigen Thyrren-Sklaven helfen. Allerdings bezahlt er sie, denn Sklaven wollte er nie halten. Ihr Leben ist einfach, aber Myra liebt es. Sie mag die Feldarbeit, liebt es, wie auf wunderbare Weise aus Samen Leben entsteht und heranwächst. Sie arbeitet gern hart. So will sie später, wenn sie groß ist, auch leben, etwas anderes kann sie sich nicht vorstellen.
Einst war Vater ein Rewadir, einer jener biaswadischen Krieger, die die Waluds führen, jene besondere Waffe mit den zwei gekrümmten Klingen, die sich zu einer zweispitzigen Lanze zusammenfügen lassen. Er spricht nicht viel über diese Zeit, nur manchmal, wenn sie zusammen trainieren.
»Heute lassen wir das Üben aber ausfallen«, sagt Myra ernst. Sie liegt noch im Bett und isst ihre Süßigkeiten.
»Myra …«, erwidert Vater.
»Bitte, heute ist doch mein Geburtstag!«
Myra hat nie verstanden, wieso es Vater so wichtig ist, dass sie den Umgang mit Waffen erlernt. Kein anderes Mädchen weit und breit tut das. Alle beschäftigen sich mit viel hübscheren Dingen, lernen nähen, singen, tanzen und anderes. Sie ist die Einzige, die jeden Nachmittag diese langweiligen Übungen absolvieren muss.
»Das tut dir gut: Es macht dich nicht nur stark, sondern auch schön«, sagt Vater immer, aber sie glaubt das nicht so recht. Die Töchter der Munaks, ihre Nachbarn und Großgrundbesitzer, denen einmal ihre Felder gehörten, üben nie mit dem Schwert und sind doch wunderschön, mit Haut wie Ebenholz und schlanken, zierlichen Körpern. Dabei stellt sie sich mit den Waffen eigentlich recht geschickt an. Sie ist flink und gelenkig und lernt auch die schwierigsten Bewegungen mit natürlicher Leichtigkeit. Es ist nur so, dass es sie einfach nicht interessiert.
Fadi stöhnt. »Gut, einverstanden.«
Myra jubelt.
»Da wäre noch diese andere Sache …«, murmelt sie.
Fadis Miene wird ernst. »Nein«, sagt er.
Myra drängelt nicht weiter. Sie schmollt nur, in der leisen Hoffnung, dass es doch etwas nützt.
Aber Vater stellt die Reste ihres Frühstücks auf das Tablett und geht einfach hinaus. So schleppt sich Myra in den Nebenraum, wo Fadi schon wartet. In der Hand hält er ein langes, sehr scharfes Messer, vor ihm steht ein Stuhl. Myra setzt sich, und er beginnt.
Es ist wie ein Ritual, das sie jeden Morgen über sich ergehen lassen muss. Fadi rasiert ihr den Schädel. Dies ist eines der Geheimnisse ihres Lebens: Obwohl sie eine Thyrren ist, wachsen ihr Haare. Alle anderen Bewohner der Insel Thyrra sind kahl. Aber auf ihrem Kopf bildet sich nachts ein Flaum, schneeweiß, wie bei den Menschen aus dem Land Albon.
Schon häufiger hat Myra versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie hat Fadi gefragt, ob ihr Erzeuger vielleicht ein Blutmagier gewesen sei. Fadi hat zwar Nein gesagt, aber nicht sehr überzeugend, wie sie fand.
»Warum muss denn mein Kopf überhaupt rasiert werden?«, fragt sie wieder, so als hätte sie das nicht schon unzählige Male getan.
»Weil die Leute dumm sind und andere ablehnen, die nicht so sind wie sie oder wie sie es gerne hätten. Du bist bereits eine Thyrren, aber keine Sklavin, stell dir nur mal vor, sie würden auch noch deine Haare sehen.« Auch diese Antwort ist immer gleich und hat sie nie zufriedengestellt.
Dennoch wehrt sich Myra nicht gegen das Rasieren. Nicht zuletzt, weil sie die Tätowierungen mag, mit denen Tallia dann ihre Kopfhaut verschönern kann: Über den Ohren hat sie ihr je einen Drachen tätowiert und in der Mitte des Kopfes ein Blumengeflecht. Natürlich würde sie sich die Haare gern einmal wachsen lassen. Der Kontrast der weißen Haare zu ihren großen blutroten Augen sähe sicher toll aus. Zumindest würde sie sich dann aus der Schar der anderen Kinder in ihrer Gegend herausheben. Es wäre schön, etwas Besonderes zu sein.
Aber so wichtig ist das auch nicht. Sie hat heute Geburtstag, und den will sie sich nicht verderben.
Der Tag verläuft in den gewohnten Bahnen, und Myra freut sich. Anstatt zu üben, lässt sie zusammen mit ihrem Vater das Wasser aus einem Reisfeld ablaufen. Das hat sie schon immer geliebt. Sie patscht mit den Füßen durch das Feld, spürt, wie das fließende Wasser ihre Knöchel umspült. Es ist Hochsommer in Biaswad, und warm streichelt die Sonne ihre Haut. In keiner anderen Gegend des Dominiums ist diese Jahreszeit so angenehm.
Am Nachmittag trifft Tallia ein.
»Komm her, meine Kleine, lass dich drücken«, sagt sie zum Geburtstagskind.
Tallia ist eine recht beleibte Thyrren, die als Sklavin im Haushalt der Nachbarn arbeitet. Myra kam sie immer schon alt vor. Vor allem aber war sie immer schon wie eine Mutter für sie. Sie hat Vater geholfen, sie aufzuziehen, war bei allen wichtigen Ereignissen dabei und darf auch heute nicht fehlen.
»Acht Jahre schon, meine Kleine! Wie schnell du groß wirst«, sagt sie gerührt.
»Ja, Tante, aber fang bitte nicht an zu weinen. Es gibt doch Wichtigeres.« Myra streckt die Hände aus. »Zum Beispiel mein Geburtstagsgeschenk.«
Tallia ziert sich, lässt sich bitten und holt schließlich hinter dem Rücken etwas hervor, ein ledernes Etui, das Myra sehr gut kennt.
»Eine neue Tätowierung!«, jubelt sie.
Tallia lächelt. »Genau auf dem Scheitel, habe ich mir gedacht, wie bei einer richtigen jungen Dame.«
»Verstehe ich das richtig?«, fragt Fadi schmunzelnd. »Du willst an deinem Geburtstag leiden?«
»Ach du, sei bloß ruhig! Du hast mir noch gar nichts geschenkt.«
»Später, später«, sagt Fadi geheimnisvoll.
Tätowiert zu werden ist tatsächlich ein wenig schmerzhaft, aber Myra hat sich daran gewöhnt. Sie war zwei, als Tallia ihr zum ersten Mal etwas eingestochen hat. Und diese neue Tätowierung macht Myra dann, als Tallia endlich fertig ist, sprachlos. Eine sich öffnende Rosenknospe, die Farben und Schatten der Blütenblätter so perfekt, dass sie verblüffend echt wirkt.
»Oh, Tante, die ist wunderbar!«, sagt Myra mit glänzenden Augen und umarmt sie stürmisch.
»Du bist wunderbar«, murmelt Tallia, wieder gerührt und stolz.
Am Abend gibt es ein festliches Essen. Tallia hat für zehn gekocht, und die Gewürze verbreiten einen berauschenden Duft. Die drei essen, bis sie fast platzen: Myra, Vater und diese Frau, die ihr so viel bedeutet, wie es nur eine Mutter könnte.
Danach steht Fadi auf und holt sein Geschenk.
»Ich weiß, was es ist«, sagt Tallia, mit verschwörerischer Miene.
»Meinst du, es gefällt mir?«, fragt Myra.
Tallia lehnt sich zu ihr vor. »Ganz gewiss. Es sind neue Waffen«, flüstert sie.
»Wirklich?« Myra ist enttäuscht.
»Noch mal herzlichen Glückwunsch«, sagt Fadi, der ins Zimmer zurückkommt, und reicht ihr ein kleines Bündel. Es ist in Reispapier gewickelt und kann der Form und dem Gewicht nach keine Waffe enthalten.
Tallia lacht, sie hat einen Spaß gemacht.
Aufgeregt packt Myra das Geschenk aus, und zum Vorschein kommt ein herrliches Gewand wie für eine Prinzessin. Es ist nachtblau, die beliebteste Farbe in Biaswad, das weite, lange Oberteil ist mit feinsten Stickereien gesäumt, und die Hose darunter schimmert in einem hellen Grau.
Myra ist begeistert. Mit Tränen in den Augen blickt sie ihren Vater an und weiß nicht, was sie sagen soll.
»So ein Zeug gefällt dir doch, oder?«, sagt Fadi spöttisch.
Myra weiß, dass er keinen Sinn für schöne Kleidung hat und dass er es lieber hätte, wenn sie das mögen würde, was er mag. Aber genau das macht dieses Geschenk noch wertvoller für sie.
»So etwas Schönes hatte ich noch nie. Danke!« Sie presst den Stoff an ihre Brust. Er fühlt sich herrlich glatt und kühl an. Sie springt auf und drückt Fadi so fest, wie sie nur kann. »Du bist der beste Vater der Welt«, murmelt sie und spürt, dass auch er ergriffen ist. Dann läuft sie ins Nebenzimmer und zieht das Gewand über. Sie kommt sich wie eine Prinzessin vor. Am liebsten würde sie gleich zu den Munak-Schwestern hinüberrennen und ihnen zeigen, wie schön sie ist. Aber dazu ist später noch Zeit. Im Moment reicht es ihr, sich von Tallia und ihrem Vater bewundern zu lassen. Und das tun beide.
Myra läuft zum Spiegel in der Ecke, dem einzigen im ganzen Haus, und schaut sich lange an. Sie ist wunderschön.
Als sie zu Bett gehen, ist es schon spät, so spät, dass Fadi Tallia nicht mehr allein zu den Munaks zurückgehen lassen will. Der Weg ist lang und beschwerlich. Tallia wird bei ihnen übernachten, und Fadi wird morgen ihrer Herrschaft diese Nacht bezahlen. Die Munaks werden keine Schwierigkeiten machen: Geld ist das Wichtigste für sie und macht sie nachgiebig. Das ist anders als früher, als Noorjeb noch lebte und das Familienoberhaupt war. Seine Söhne haben nicht sein Format.
Myra ist so müde, dass sie es nicht einmal mehr schafft, ihr Gewand auszuziehen, und Fadi lässt sie darin schlafen.
Bevor sie die Augen schließt, kostet sie in Gedanken noch einmal jeden einzelnen Augenblick ihres Geburtstags aus. Dieser Tag war wirklich vollkommen.
Und so schläft sie langsam ein.
Plötzlich wacht sie auf. Sie weiß nicht, wie spät es ist. Die Wände des Zimmers schimmern im rötlichen Widerschein, und ein beißender Geruch hängt in der Luft. Einige Augenblicke ist Myra verwirrt. Ihr Kopf ist noch voll von dem wunderschönen Tag, den sie erlebt hat, und sie trägt sogar noch das Prinzessinnen-Gewand, das Fadi ihr geschenkt hat.
Da reißt Tallia sie aus dem Dämmerzustand. Nur mit einem weißen Nachthemd über dem üppigen Leib stürzt sie atemlos herein, mit einem Gesichtsausdruck, wie Myra ihn noch nie bei ihr gesehen hat. In der Rechten hält sie einen Dolch.
»Komm, steh auf«, ruft sie und ergreift Myras Arm.
»Was ist denn?« Myra bekommt es mit der Angst zu tun.
»Wir müssen fort.«
»Wo ist Vater?«
Tallia antwortet nicht und zieht sie mit sich hinaus. Doch Myra stemmt sich dagegen, während der erste Rauch durch die Fußbodendielen dringt.
»Wo ist er?«
Da sieht sie ihn zur Tür hereinkommen, und einen Moment lang legt sich die Angst. Sein Körper ist angespannt, zum Kampf bereit, an der Seite trägt er seine Walud-Klingen. Myra hat ihn bislang nur während ihrer täglichen Übungen bewaffnet gesehen.
»Vater!«
»Alles ist gut, aber du und Tallia, ihr müsst fort.«
»Aber was ist denn los, ich …?«
»Frag nicht, Myra, später erklär ich’s dir, ja? Es wird alles gut, aber ihr müsst aus dem Haus und euch in Sicherheit bringen. Sofort.« Fadi zieht einen langen Dolch aus seinem Gürtel und drückt ihn ihr in die Hand. »Den benutzt du, wenn es sein muss, verstanden?«
Myra erschrickt.
»Sag mir doch, was los ist!«
Vater wendet sich an Tallia. »Flieht zum Kanal und versteckt euch dort. Kommt nicht raus, bis ich euch hole«, erklärt er.
Tallia nickt erschrocken, ergreift Myras Arm und zieht sie hinaus.
Als sie aus der Tür treten, steht ringsum alles in Flammen. Die Felder brennen, doch der Weg zum Kanal ist noch frei. Nach wenigen Schritten bleibt Myra stehen und sieht sich um, wie hypnotisiert vom Tanz der Flammen. Wer hat das getan? Und warum?
Da erblickt sie Fadi, der vor ihrem Haus steht, aufrecht, breitbeinig, die Waluds fest in der Hand. Im Lichtschein des Feuers glänzen sie rötlich.
So hat Myra ihn noch nie gesehen. Umgeben von den Flammen wirkt er verändert. Er sieht aus wie ein Krieger, der sich jeden Moment in die Schlacht stürzen wird. Myra kommt sich vor wie in einem Traum. Wie herrlich Vater aussieht, wie unbezwingbar.
Doch schon zieht Tallia sie fort.
Sie rennen am Feldrand entlang und erreichen den Kanal. Er ist Teil des Bewässerungssystems, mit dem sie die Reisfelder regelmäßig fluten und leeren.
Tallia stößt sie ins knietiefe Wasser und springt selbst hinein. Das kalte Wasser kneift in die Haut, sie ducken sich in den Graben. Tallia legt einen Finger auf die Lippen, damit Myra still ist. Sie zittert, und Myra weiß nicht, ob aus Angst oder vor Kälte. Alles um sie herum schimmert blutrot. Myra schaut wieder zurück, zu ihrem Haus, und kann Fadi immer noch sehen: Er wird nicht zulassen, dass ihnen etwas geschieht, er ist wieder der Krieger wie einst.
Da tauchen sechs Männer aus den Flammen auf: Sie tragen lange schwarze Gewänder, Kapuzen verbergen ihre Gesichter. Nur ihre Augen leuchten im Flammenmeer. Wie Gestalten aus der Hölle kommen sie Myra vor. Immer näher kommen sie, nur einer von ihnen, vielleicht ihr Anführer, hält sich ein wenig im Hintergrund. Ihre Fäuste umschließen merkwürdige Schwerter. Bis auf zwei sind es keine Schwerter, wie man sie in Biaswad kennt, sondern Waffen von außerhalb. Was wollen diese Fremden von ihnen?
»Ich geb sie nicht her. Niemals!«, ruft Fadi, und seine Stimme ist mehr ein Brüllen. »Hast du verstanden? Sie gehört mir! Mir!«
Die sechs Männer verharren einen Moment. Plötzlich springen zwei von ihnen vor. Doch Fadi lässt sich nicht überraschen. Gebannt verfolgt Myra den Tanz seiner Waluds. Fadis Bewegungen sind noch eleganter, noch präziser als sonst, wenn sie zusammen üben. Seine Klinge trifft den Bauch eines der Angreifer, doch der springt zurück, und so hinterlässt der Walud nur einen Schnitt im Umhang. Aber dessen Ränder sind verbrannt. Das ist eine Besonderheit von Vaters Waffe: Die Walud-Klingen schneiden nicht nur, sondern versengen auch, denn ihr Eisen glüht durch die Hitze eines verborgenen Feuers.
»Sie wurden ins Blut eines Wüstendrachen getaucht«, hat Fadi ihr erzählt, »dadurch erhielten sie seine Farbe und sein Feuer.«
Die beiden Fremden greifen wieder an, und wieder wehrt Fadi sie ab.
Mit pochendem Herzen, aber voller Stolz und Bewunderung sieht Myra ihn kämpfen. Doch irgendetwas stimmt nicht. In Fadis Bewegungen schleicht sich etwas Unharmonisches ein, das ihrem geschulten Blick nicht entgeht. Jahrelang hat Vater nicht mehr richtig gekämpft. Mindestens acht müssen es sein. Und so reagiert sein Körper nicht mehr so, wie er sollte. Den nächsten Hieb kann Fadi nicht mehr parieren, und die feindliche Klinge bohrt sich in seinen Arm.
Plötzlich tritt der Anführer vor, während zwei andere in Richtung der Felder laufen. Fadi stürzt sich auf sie. Die feindliche Klinge beschreibt einen weiten Bogen, dann bohrt sie sich in Vaters Rücken.
Die Zeit bleibt stehen.
Fadi ist alles für Myra. Er hat sie immer beschützt, hat ihr ein Zuhause gegeben und ihr die Zuneigung einer Familie geschenkt, hat sie vor dem Schicksal einer Sklavin bewahrt und vielleicht vor dem Tod gerettet. Fadi darf nichts geschehen, ihm kann nichts geschehen, denn niemand ist so stark wie er.
Doch er sinkt zu Boden, während der Fremde, dessen Klinge ihn getroffen hat und der der Anführer zu sein scheint, sich vor ihm aufbaut.
Die Waluds noch in Händen, kniet Fadi am Boden. Er schaut zu Myra, mit verzweifeltem Blick, einem Blick, der sie auffordert, das Weite zu suchen und zu leben, ein Blick des Abschieds. Dann fährt er herum und sticht zu. Die Klinge trifft und fährt dem Mann, wenn auch nicht tief, zwischen die Rippen.
Er weicht aus, dann springt er vor, schnell wie ein Raubtier, und versenkt sein Schwert in Fadis Brust. Durch die Flammen sieht Myra, wie sich Vaters Körper aufbäumt, und ihre Blicke suchen sich ein letztes Mal. Als sie sich treffen, ist dahinter nur noch das Nichts.
Alles um Myra verblasst, die Welt zerfällt, und alles verdichtet sich zu diesem einen Bild des geliebten Gesichtes, das sie mit verlöschendem Blick anschaut. Und ihrem Mund entfährt ein nicht enden wollender Verzweiflungsschrei. Sie schreit aus Leibeskräften, die Kehle zerreißt ihr bis aufs Blut. Da presst Tallia ihr eine Hand auf den Mund und zieht sie an sich.
»Schsch, schsch«, raunt sie ihr wie früher zu, als sie noch ein kleines Kind war und einschlafen sollte.
Der Anführer, der Mann, der Vater getötet hat, dreht sich um und zeigt seinen Männern die Richtung. Die beiden, die schon zu ihrem Versteck unterwegs waren, rennen los.
Tallia flucht und hebt Myra aus dem Wasser.
»Lauf, Myra, lauf!«, schreit sie.
Aber sie kann nicht. Ihre Beine rühren sich nicht. Sie kann den Blick nicht von Vaters Körper abwenden, der auf dem Boden liegt. Gleich springt er auf und lässt seine Waluds tanzen. Gleich wird er die Männer töten, wird sie retten, dann werden die Flammen erlöschen und sie drei kehren zusammen nach Hause zurück.
Da ergreift Tallia Myras Hand, und zusammen laufen sie durch die Felder, vorbei an den Flammen. Vor ihnen liegt ein kleiner Wald, und dorthin lenken sie ihre Schritte. Myra versteht nicht, welch mysteriöse Kraft ihre Beine bewegt, und doch rennt sie. In ihrem Herzen herrscht eine große Leere, und im Kopf ist nur Fadis lebloser Blick.
Sie rennen, so schnell sie können, doch Tallia ist zu alt und zu schwer und kann den beiden Verfolgern nicht entkommen. Die Männer kommen näher und näher, ihre Atemzüge sind tief und ruhig, im Takt mit ihren Schritten. Verzweifelt stößt Tallia Myra von sich. Sie fällt neben einen Dornbusch. In ein paar Monaten wird sie dort herrliche Beeren pflücken können, denkt Myra. Welch ein absurder Gedanke.
Da dreht sich Tallia um und sticht blind mit ihrem Dolch zu, und vielleicht gibt es doch einen Gott, denn ihre Klinge trifft einen der beiden Verfolger in die Seite. Aber der andere lässt sich nicht aufhalten. Er stürzt sich auf sie und wirft sie zu Boden.
»Lasst sie … sie ist doch noch ein Kind, ich …«
Mit einer raschen Bewegung schneidet der Mann Tallia die Kehle durch.
Auch Tallias Blick erlischt, so wie Fadis, während ihr Blut einen Bogen aus roten Tropfen in die Luft zeichnet. Noch vor wenigen Stunden hat Tallia sie so fest umarmt, als sie Myra in ihrem Geburtstagsgeschenk gesehen hat, dem wunderschönen Gewand, das sie immer noch trägt. Nur das ist ihr vom schönsten Tag ihres Lebens geblieben.
Da erhebt sich der Mörder von Tallias reglosem Körper. Er ist groß und schlank. Ein Turban verbirgt sein Gesicht. Nur seine Augen erkennt Myra. Blau und kalt sind sie. Aber lebendig.
Da begreift Myra: Vater ist tot und wird nie mehr zu ihr zurückkehren. Und Tallia ebenso. Dieser Mann jedoch, der ihr zusammen mit den anderen diese geliebten Menschen genommen hat, lebt.
Eine wahnsinnige Wut erfasst sie, zerreißt ihr die Brust, macht sie blind. In Händen hat sie immer noch Fadis langen Dolch. Sie schreit auf und greift an, mit einem Stoß von der Seite, der den Mann vollkommen überrascht. Er weicht zurück, und da stößt Myra wieder zu, genau wie ihr Vater es sie gelehrt hat. Doch sie ist nicht schnell genug, der Dolch streift den Gegner nur, und die Klinge bohrt sich nicht in sein Fleisch. Immerhin hört sie, wie seinem Mund unter dem Tuch ein Stöhnen entfährt, und sieht, wie er sich leicht krümmt.
Von unbändigem Zorn getrieben greift sie wieder an. Doch der Mörder verteidigt sich. Mit dem Heft seines Schwertes trifft er sie am Hals.
Myra stürzt.
Als er ausholt und sie im Rücken treffen will, wirft sie sich zur Seite. Der Hieb erwischt ihre Schulter. Ein furchtbarer Schmerz durchfährt sie, so stark, wie sie es noch nie erlebt hat, aber sie rollt noch einmal zur Seite und springt auf. Der Mann flucht in einer Sprache, die Myra nicht kennt. Das Schwert fährt auf sie nieder, und er versucht, sie zu packen. Doch flink duckt sie sich weg und schlüpft durch seine Beine, sodass der Hieb sie nicht mit voller Wucht trifft. Wieder ein furchtbarer Schmerz, sie schenkt ihm keine Beachtung. Mühsam steht sie hinter dem Mann wieder auf.
Er fährt herum, will nach ihr greifen, da braucht sie nur das Schwert auszustrecken. Und während der Feind sich dreht, fährt ihm die Klinge in den Leib.
Er ist so nah, dass er sie berührt, und Myra spürt, wie er im Todeskrampf zusammensackt. Er murmelt etwas, ein Wort, das sich obszön anhört, vielleicht verflucht er sie, dann sinkt er zu Boden und bleibt regungslos liegen.
Die Grillen zirpen, Myra keucht. Sie denkt an den Sommer, an die Spiele draußen, an ihr Leben, das es nicht mehr gibt. Das herrliche Gewand, das ihr Fadi geschenkt hat, ist an mehreren Stellen zerrissen und blutbesudelt. Tallia liegt bäuchlings im Gras. Myra ist allein zwischen all den Toten.
Verzweifelt fällt sie auf die Knie. Sie weint und weint und kann nicht mehr aufhören. Schließt sie die Augen, sieht sie, wie Vater stirbt, sieht seine Augen, den letzten Blick, mit dem er sie anschaut. So wird es nun monatelang sein, jahrelang, aber das weiß Myra noch nicht. Sie weiß nur, dass sie niemanden mehr hat, und ahnt, dass die anderen Männer nach ihr suchen werden. Einen von ihnen hat sie getötet, aber sie waren zu sechst. Schon meint sie, im Gras das Rascheln ihrer Schritte zu hören.
Sie rappelt sich auf, angetrieben von einer unbekannten Kraft.
Langsam tritt sie zu dem Mann, den sie getötet hat, und betrachtet ihn. Kein Mitleid regt sich in ihr: Er ist nur ein Ding, ein Haufen Fleisch und Stoff, und hat den Tod verdient. Furchtlos zieht sie ihm den Dolch aus dem Bauch.
Dann läuft sie los, läuft schneller und schneller, während das Prasseln der brennenden Felder hinter ihr zurückbleibt, läuft trotz der Erschöpfung, trotz des Schmerzes, und während sie läuft, wird ihr immer klarer, was geschehen ist: Tallia hat sich geopfert, um sie zu retten. Schlimmer noch, Tallia ist ihretwegen gestorben: Hätte Myra nicht so laut geschrien, wären sie unbemerkt geblieben. Und Vaters Leiche liegt dort, wo einmal ihr Zuhause war und jetzt nur Flammen sind. Sie hat alles verloren, sie hat nichts mehr auf dieser Welt, und dennoch läuft sie weiter.
Sie läuft und weint.
Myra liegt am Boden und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Die Zeit, da Tränen trösten konnten, ist vorüber. Niemand kann sie mehr in den Arm nehmen und ihr versichern, dass alles gut wird.
Als sie den Mund öffnet, um zu weinen, merkt sie, dass sie keine Stimme mehr hat. Ihr Schrei, als Vater starb, muss ihre Stimme beschädigt haben, denn so wie ihre Wunden schmerzt auch ihre Kehle. Noch einmal sieht sie Vaters leere Augen. Nur noch so wird sie sich an Fadi erinnern.
Dann schwinden ihr die Sinne.
1
10. Oktober, Nachmittag
Der Schnee fiel in dichten Flocken. Am Boden lag er schon sehr hoch, und diese weiße Decke würde rasch noch weiter anwachsen. Ein schneidender Wind heulte über die endlose Hochebene und trieb die Schneewirbel vor sich her. So weit das Auge reichte, war alles flach, so wie fast überall im Land des Eises.
Der Krieger mit den roten Klingen musste ein paar Mal blinzeln, um wieder etwas sehen zu können. Er beneidete seine Gefährten um ihre pupillenlosen blauen Augen, die das blendende Licht gewohnt waren, und ebenso um ihre Körper, die diesem Klima besser gewachsen waren. Aber er war kein Asgarer, und obwohl er seit nunmehr sechs Jahren in Asgarö lebte, zitterte er erbärmlich, sobald die Temperatur schlagartig sank. Und dabei hatte der Herbst gerade erst begonnen.
Er zog die Schultern hoch und verbarg das Kinn tief in seinem Pelzkragen. Ein Helm schützte den Kopf, dazu trug er einen eisernen Brustpanzer und Hosen aus Leder, die in Fellstiefeln steckten. So unterschied er sich nicht so sehr von den anderen Soldaten, abgesehen von seinem recht zierlichen Körper und den beiden langen roten Klingen, mit denen er kämpfte. Feiner Dampf stieg auf, und es zischte, sobald Schnee auf die Klingen fiel.
Der Feind vor ihnen war eine graue Linie am nicht klar auszumachenden Übergang von schneebedeckter Erde zum Himmel. Es mochten nicht mehr als fünfhundert Mann sein, einer der üblichen Familienclans mit ihrem sinnlosen Stolz, eher im Kampf zu sterben, als sich zu beugen.
Aus der Schlachtreihe des Kriegers trat ein Mann in einem weiten Umhang vor, der ebenfalls mit einem hohen Pelzkragen besetzt war. Er trug schwere metallene Beinschützer und war mit einer langen Dofrir bewaffnet, der Doppellanze der asgarischen Stammesoberhäupter. Die durchsichtigen Spitzen aus Frjosinn wirkten zerbrechlich und wie aus Eis, dabei war dieses Material härter und widerstandsfähiger als jedes andere im gesamten Dominium.
Der Mann war allerdings kein Asgarer. Zwar besaß er dunkle, mandelförmige Augen und die gerötete, rissige Haut der Bewohner dieses Landes, war aber nicht dort geboren. Er hätte aus Alkak stammen können, aber es war schwierig, es genau zu sagen. Sein Gesicht war länglich und hager, und in der Tiefe seiner Augen schien sich vieles zu verbergen, nicht zuletzt ein eiserner Wille. Seinen Helm trug er noch unter dem Arm.
»Frey! Noch könnt ihr euch zurückziehen!«, rief er in akzentfreiem Asgarisch. »Ich bin kein rachsüchtiger Mann: Unterwerft euch, und niemandem wird etwas geschehen!«
Aus den feindlichen Reihen erhob sich eine tönende Stimme. »Was glaubst du, wen du vor dir hast? Wir sind Asgarer, wir ergeben uns nicht! Lieber lasse ich mich in Stücke hauen und mein Fleisch verbrennen, als vor einem Fremden ohne Herkunft und Ehre das Knie zu beugen.«
Über das Gesicht des Kriegers mit den roten Klingen huschte ein Lächeln.
»Und ich sage es dir zum letzten Mal«, rief sein Heerführer dem Feind zu. »Unterwirf dich, und du kannst mit all deinen Männern heil nach Hause zurückkehren. Greif mich an, und du endest zerstückelt im Feuer.«
Die Antwort war ein lauter Fluch.
Der Heerführer seufzte und kehrte in die erste Kampfreihe zurück. »Idiot«, brüllte er.
Der Krieger nahm seine roten Klingen fester in die Hand. »Du wusstest doch, dass er so handeln würde, Acrab«, sagte er mit einer rauen, krächzenden Stimme, die kaum menschlich klang.
»Nun, einen Versuch war es wert. Mir ist nicht so sehr nach Kämpfen, wenn man sich auch besaufen könnte.«
Der Heerführer und sein Krieger tauschten ein Lächeln.
Acrab setzte den Helm auf und hob die Lanze. Und als er sie vorreckte, griffen seine Männer laut brüllend an. Der Krieger und ein paar andere liefen jedoch in die Gegenrichtung, so als wollten sie sich zurückziehen.
Freys Männer rannten los. Wie zwei dunkle Flecke, die sich auf einer weißen Fläche ausbreiten, bewegten sich die beiden Heere aufeinander zu. Als sie nur noch wenige Ellen voneinander entfernt waren, öffneten Acrabs Männer die Reihen, und Freys Krieger sahen zwischen den feindlichen Soldaten etwas aufblitzen. Schon erklangen Schmerzensschreie, während sich der Schnee rot färbte.
Acrabs Männer hielten straff gespannte Seile, an denen in regelmäßigen Abständen hölzerne Vorrichtungen angebracht waren. An jedem hing ein Knüppel, in den jeweils vier Frjosinn-Spitzen eingelassen waren. Die Soldaten bewegten die Seile, sodass die Knüppel sich rasant drehten.
Im Nu trennten die Spitzen Arme und Beine ab, bohrten sich in die Leiber der Feinde, durchdrangen Stahl, als handelte es sich um Papier. So rückten Acrabs Soldaten vor. Schließlich ließen sie die Seile los, und ergriffen ihre Schwerter.
Da streckte der Krieger seine roten Klingen aus: Sie waren ungefähr zwei Ellen lang, leicht gekrümmt und bemalt. Sie dampften in der eiskalten asgarischen Luft. Er und die anderen, die sich zuvor scheinbar zurückgezogen hatten, standen im Rücken von Freys Männern. Sie hatten sie umzingelt.
Rasch und ohne Gnade griffen sie an.
Und wie in jeder Schlacht, ging der Krieger im Kampf auf. Sobald er seine Waluds zog, verschwand alles um ihn herum. Sein Kopf wurde leer, und alles war Kampf. Von ihm blieben nur seine Kampfkraft und seine vollkommene Körperbeherrschung.
Er hätte nicht sagen können, dass ihm der Kampf wirklich Vergnügen bereitete. Nach den zahlreichen Schlachten, die er in den zurückliegenden Jahren geschlagen hatte, war das Führen seiner Waffen für ihn eine Arbeit, und wäre sein Leben anders verlaufen, hätte er vielleicht nie ein Schwert zur Hand genommen. Nun aber beherrschte er einzig das Kriegshandwerk und zeichnete sich darin aus.
Um ihn herum warfen sich die Krieger mit aller Kraft aufeinander, und viele sanken zu Boden, getroffen von wuchtigen, wenn auch nicht präzisen Hieben.
Bei ihm war es anders. Er tanzte mit seinen Waffen.
Im Rhythmus der roten Klingen tauchte er ab, richtete sich auf, rotierte um die eigene Achse, während die Waluds todbringende Kreise um seine schlanke Gestalt zogen.
Mit gleichzeitigen Hieben von links und rechts, einer weiter oben, einer weiter unten, streckte er den nächsten Feind nieder. Dessen Kopf flog davon, während in seinem Bauch eine tiefe Wunde klaffte. Das verbrannte Fleisch zischte, und von den Waluds stieg Dampf in die eisige Luft auf.
Der Krieger vollendete die Bewegung, indem er zwei Feinden hinter ihm die Klingen zwischen die Rippen stieß, wirbelte wieder herum, duckte sich weg und riss einem anderen die Beine oberhalb der Knöchel auf. Dann wich er einem niederfahrenden Schwert aus, fügte mit einer geschmeidigen Bewegung die Waluds zusammen, ließ die Doppelklinge rotieren und schlitzte dem nächststehenden Feind den Bauch auf.
Versunken im Kampfesfluss rückte er vor. Einatmen, ausatmen, dem Rhythmus der Herzschläge gehorchen, weiter, immer weiter, die Übelkeit verdrängen, die das blutende Fleisch und das Sterben um ihn herum hervorriefen.
All das tat er für ihn. Für Acrab.
Da, ein Zischen. Der Krieger hörte es zu spät. Sein Rhythmus brach, sein Herz setzte einen Schlag aus. Er fuhr herum, aber der Pfeil war schon zu nah. Dann ein silberner Blitz, der die Spitze aufhielt und ablenkte.
Der Krieger hielt inne und starrte durch die wirbelnden Schneeflocken: Acrab. Er hatte einen seiner Dolche geschleudert und ihn gerettet. Nun nickte er ihm zu, kaum merklich, doch der Krieger mit den roten Klingen erkannte und erwiderte es. Acrab war immer für ihn da. Kurz versetzte es ihm einen schmerzhaften Stich, aber er ließ sich nicht aufhalten.
Erneut stürzte er sich in den Kampf und rückte unaufhaltsam vor, bis Acrab irgendwann einen Ruf ausstieß und für alle sichtbar einen Kopf in die Höhe hielt.
Es war Frey.
Stille senkte sich über das Schlachtfeld. Um sie herum war alles weiß und rot. Der Wind heulte.
»Dieses Schicksal erwartet jeden, der sich gegen mich stellt!«, rief Acrab. »Die Entscheidung liegt bei euch. Folgt ihr dem Beispiel eures Herrn, werdet ihr alle sterben. Schwört ihr mir aber Gehorsam, werde ich diesen blutigen Tag vergessen. Ich mache euch zu meinen Soldaten und führe euch zum Ruhm.«
Es blieb still nach Acrabs Worten, niemand rührte sich.
Schließlich fiel der erste von Freys Männern auf die Knie. Ihm folgte ein weiterer, und noch einer, und wieder einer, bis die Ebene mit grau gekleideten knienden Soldaten übersät war. Nur wenige blieben stehen.
Acrab warf Freys Kopf fort und trat zu dem Krieger mit den roten Klingen.
»Alle, die knien, sollen mit uns trinken. Die Toten überlassen wir den Drachen.«
Der Krieger nickte. »Und was ist mit den anderen?«
Acrab ließ den Blick über die Ebene schweifen.
»Ach, sollen sie gehen. Früher oder später wird das ohnehin alles uns gehören.« Er sah den Krieger genauer an. »Bist du in Ordnung?«
Der Krieger nickte und nahm den Helm ab. Darunter kam ein zerzauster Haarschopf zum Vorschein, der ebenso weiß war wie der Schnee in der Ebene, etwas länger an den Seiten und fast geschoren am Hinterkopf. Das Gesicht war rundlich, die Nase schmal und gerade, mit einigen Sommersprossen gesprenkelt, der Mund klein mit vollen Lippen. Die Gesichtszüge eines Mädchens. Eines Mädchens mit feuerroten Augen.
»Ja, alles in Ordnung«, sagte Myra mit einem Lächeln, »durch deine Hilfe.«
Nacheinander traten die geschlagenen Soldaten vor, setzten den Helm ab und warfen die Waffen zu Boden. Einen Monat lang würden sie ohne auskommen müssen. Hatten sie sich dann als vertrauenswürdig erwiesen, würden sie in die Schar von Acrabs Kriegern eingereiht werden.
Reglos stand Myra da, während der Wind den Schnee über die Ebene peitschte, und betrachtete diese betrübten, niedergeschlagenen Gesichter. Einer rief, er werde zurückkehren und Rache nehmen, um dann nach und nach in dem blendenden Weiß zu verschwinden, auf dem Weg ins Nichts. Denn in Asgarö gab es niemanden mehr, der Acrab die Herrschaft streitig machte. Entweder waren sie auf dem Schlachtfeld besiegt worden, so wie Frey und seine Truppe, oder sie hatten sich kampflos unterworfen und die Überlegenheit von Acrab und seinen Kriegern und die Genialität seiner Kriegsmaschinen anerkannt. Viele von denen, die die Unterwerfung verweigert hatten, würden noch vor dem Abend tot sein. Dafür würde das unbarmherzige Klima in diesen Landen sorgen.
Myra ließ noch einmal den Blick über die Reihe der besiegten Krieger schweifen, die sich ihnen anschließen würden. Einige waren schwerer verwundet. Sie standen vor einem großen Zelt. Wenn die Neuankömmlinge es betraten, würden sie merken, dass es beheizt war, und das nicht durch ein normales Feuer. Denn das Zelt besaß einen hölzernen Fußboden, unter dem, gleich über dem Eis, eine blaue Flamme brannte. Eine Flamme, die nicht mit Wasser zu löschen war und den Raum mit einer angenehmen, beruhigenden Wärme versorgte.
Mixtur nannte Acrab die wärmende Substanz, die er entwickelt hatte. Viel mehr hatte er nicht dazu gesagt, denn er machte gern ein Geheimnis um seine Erfindungen. So wusste Myra zwar nicht, wie dieses Feuer zustande kam, hatte aber schon häufiger mit eigenen Augen gesehen, was es bewirken konnte, einmal sogar bei einem Asgarer: Mit Schaudern erinnerte sie sich an dessen unmenschliche Schreie, während das blaue Feuer seine Knochen verzehrte. Er hatte sich in einen Wildbach gestürzt, doch sein Fleisch hatte weitergebrannt, so lange er noch zu sehen war, während das reißende Wasser ihn fortzog.
In dem warmen Zelt würden die Neuankömmlinge auch einen Tisch vorfinden, auf dem alle möglichen Fläschchen bereitgestellt waren. In Asgarö gab es keine Blutmagier – für die war das Land zu kalt und zu arm – und daher auch keine Magie. Krankheiten und Verletzungen behandelten die Asgarer mit einer Heilkunde, die auf natürlichen Essenzen basierte. Acrab mit seinen reichen Kenntnissen hatte diese geradezu revolutioniert. Viele der Substanzen in den Fläschchen waren seine Kreation, andere waren Weiterentwicklungen von Heilmitteln, die in Asgarö seit Urzeiten bekannt waren. Jedenfalls würden die Verwundeten versorgt werden und eine Schüssel Suppe erhalten. Nicht anders als Acrabs Soldaten auch.
Nach und nach würden die Besiegten die anderen Wunderdinge des Lagers kennenlernen und sich ein Bild davon machen, wozu Acrabs Erfindungsgabe fähig war. Auch das würde sie überzeugen, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, als sie nach der Niederlage das Knie vor ihm gebeugt hatten. Viele von Acrabs Soldaten waren diesen Weg gegangen.
Nur sie nicht. Sie war von Anfang an dabei gewesen.
Erneut spürte Myra diesen Stich in der Brust und schlang ihren Umhang fester um die Schultern. Doch die Kälte kam von innen, nicht von der schneebedeckten Ebene, auf der sie einen weiteren Sieg errungen hatten. Denn nach Jahren treuen Gehorsams und zahllosen Schlachten, in denen sie immer an Acrabs Seite in der ersten Kampfreihe zu finden gewesen war, würde sie bald diese Lande verlassen.
Sie betrachtete ihn, wie er letzte Anweisungen erteilte. Acrab – ihr Lehrmeister, ihr Beschützer, der wie ein Vater für sie war. Gerade hatte er ihr wieder, wie andere Male zuvor, das Leben gerettet, indem er einen auf sie zuschießenden Pfeil abgelenkt hatte.
Und nun, kurz vor der größten Unternehmung seines Lebens, würde sie ihn verlassen.
2
10. Oktober, Abend
Myra blieb einige Schritte vor Arcrabs Holzhütte stehen.
Seit drei Jahren waren sie ständig unterwegs und in Kämpfe verwickelt, und wenn sie irgendwo ihr Lager aufschlugen, war diese zerlegbare Hütte die Unterkunft ihres Anführers. Myra erinnerte sich noch an die Zeit, als dieses Wunderwerk nur als Zeichnung auf dem Papier, als einer seiner vielen, außerordentlichen Pläne existierte. Und nun hatte sie es vor sich, eine Konstruktion wie aus einer anderen Welt.
Die Hütte war im Grunde recht klein, nicht mehr als ein Würfel von vielleicht sechs Ellen Seitenlänge, und besaß ein abfallendes Dach, das mit einer Stoffplane überzogen war. Aus einem Schornstein am hinteren Ende stieg weißer Rauch und löste sich im stärker werdenden Wind auf. Rasch brach die Nacht herein, und es schneite immer heftiger.
Aus den Augenwinkeln sah Myra einige Männer einen Tunnel graben. Acrab erwartete also, dass sich die Wetterlage extrem verschlechterte. Wenn das so weiterging, würden sie bald wieder, wie jeden Winter, unter dem Eis leben müssen.
Sich nach einer Schlacht mit ihm zu treffen war eine feste Gewohnheit für sie, und unter anderen Umständen hätte sie es auch nicht verunsichert, dass er sie zu sich rufen ließ. Doch ihre Entscheidung, einige Tage zuvor getroffen, veränderte alles. Sie fühlte sich entsetzlich angespannt und nervös. In Acrabs Gesellschaft hatte sie sich sonst nie so gefühlt. Das durfte nicht sein.
Sie wechselte einen kurzen Blick mit der Wache vor dem Hütteneingang. Obwohl sie die Kapuze aufgesetzt hatte und der Pelzkragen ihren Mund verdeckte, erkannte der Mann sie. Allerdings brauchte man dazu auch nur ihre Augen zu sehen: Niemand sonst im Lager hatte solche Augen wie sie.
Der Asgarer zog die Lanze zurück und schlug die Hacken zusammen. Myra trat ein, und ein Schwall beruhigender Wärme umfing sie und hieß sie Willkommen.
Das Innere war bequem eingerichtet. An der hinteren Wand war eine Feuerstelle, über der in einem rußschwarzen Kessel etwas vor sich hin köchelte. Darunter züngelten gelbe Flammen.
Doch das wärmende Feuer war verborgen unter den mit Fellen belegten Fußbodenbrettern. Dort, in dem Hohlraum zwischen dem Erd- und dem Hüttenboden, befand sich ein Behälter mit Schmelzwasser. Die Mixtur brannte ununterbrochen und brachte es zum Kochen. Der Wasserdampf strömte durch tönerne Rohre, die in die Seitenwände eingelassen waren, und erwärmte die Hütte.
Vor der Feuerstelle stand in der Mitte des Raums ein großer Tisch, übervoll mit Pergamentrollen, Blättern und Büchern. Auf dem Fußboden und sogar auf dem Bett lag weiteres Material. Ein einfaches Holzgerüst in einer Ecke diente als Ständer für den Brustpanzer ihres Anführers.
Arcab saß an seinem Schreibtisch, in einer Haltung, die er sich nur ihr gegenüber erlaubte: Eine Tasse mit einem dampfenden Getränk in der Hand, und ein Bein über die Armlehne seines Sessels gelegt.
»Da bist du ja«, sagte er, »ich sterbe vor Hitze, komm, hilf mir doch mal.« Er trug noch seinen Brustpanzer und hatte nur seinen Umhang auf den Boden geworfen.
Schon seit Jahren war Myra nicht mehr sein Knappe, und dennoch liebten es beide, weiterhin diese kleine Szene zu spielen. Nie legte er seine Rüstung ohne sie ab.
Myra zog ihren eigenen Umhang aus und hängte ihn an einen Haken neben der Tür. In ihrer schweren Kampfmontur sah ihr Körper noch zierlicher aus. Sie trat auf Acrab zu und öffnete ihm in aller Ruhe Schnalle für Schnalle seiner Rüstung. Dutzende Male hatte sie dies schon getan, doch dieses Mal war es anders. Sie verwendete mehr Sorgfalt darauf und genoss es, immer wieder über seinen Körper zu streichen. Ihre Entschlossenheit geriet ins Wanken.
Aber die Entscheidung war gefallen.
Sie hängte den Brustpanzer an das Gerüst, während Acrab tief durchatmete und zu der Feuerstelle hinüberging. Er schöpfte einige Kellen der köchelnden Flüssigkeit in einen Tonbecher und reichte ihn Myra. Der herrliche Duft des Kylirashs trieb ihr fast die Tränen in die Augen. Es gab nichts Besseres als dieses stark berauschende Getränk aus vergorenem Kyliroth-Saft mit Gewürzen, um sich an den endlosen asgarischen Winterabenden aufzuwärmen – oder um zu feiern.
Sie stießen an.
»Auf den Sieg«, sagte Acrab, bevor beide ihren Becher an die Lippen führten.
Myra nahm sich einen Stuhl und stellte ihn vor den Schreibtisch. Bis zu diesem Moment hatte sie nicht bemerkt, wie erschöpft sie war. Sie setzte sich, nahm den Becher in beide Hände und trank einen weiteren Schluck. Heiß lief ihr das Gesöff die Kehle hinunter und ließ die alte Wunde wieder schmerzen, die nie richtig verheilt war: Die Kehle tat ihr häufig weh, eine bleibende Erinnerung an jenen Tag, an dem sie alles verloren hatte.
»Du solltest achtsamer sein in der Schlacht«, brach Acrab schließlich das Schweigen.
»Es muss am Wind gelegen haben. Er hat das Zischen des Pfeils übertönt«, erwiderte Myra mit rauer Stimme.
»So ist es nun mal in Asgarö, hier weht immer Wind, es schneit, und es ist entsetzlich kalt«, sagte Acrab. »Vergiss nicht, dass ich langsam in ein Alter komme, da ich nicht ständig die Amme für dich spielen kann. Meine Reflexe sind nicht mehr das, was sie mal waren.«
»Ich war einen Moment abgelenkt. Es wird nicht wieder vorkommen.«
»Gut, das hoffe ich.« Acrab lächelte. »Und das nicht nur für dich. Schließlich wüsste ich gar nicht, wie ich ohne meine rechte Hand auskommen sollte.«
Myra schwieg verlegen. Üblicherweise war Acrab nicht sehr freigiebig mit Komplimenten. Und ausgerechnet an diesem Abend musste er ihre Rolle so hervorheben.
»Sei’s drum. Ich habe dich nicht kommen lassen, um mit dir zu schimpfen oder dich zu loben.« Acrab schwieg einige Augenblicke und fuhr dann fort: »Es ist soweit. Ich will es wagen. In Asgarö gibt es niemanden mehr, der meine Herrschaft in Frage stellt. Außer vielleicht diese paar Dummköpfe, die sich jetzt durch den Schnee schleppen. Aber die machen mir keine Sorgen. Das Land ist endlich vereint, und das unter meinem Kommando. Nun kommt der nächste Schritt.«
Im Grunde hatte Myra es gewusst, aber dies noch einmal aus seinem Mund zu hören, traf sie wie ein Messerstich. Seit mindestens sieben Jahren hatten sie auf diesen Moment hingearbeitet.
»Ich werde an deiner Seite sein. Für immer.« Ihre Lippen zitterten leicht.
Acrab lächelte. »Daran habe ich nie gezweifelt. Ich wollte nur, dass du es als Erste erfährst.« Und mit ernster Miene sprach er weiter: »Gewiss werden wir nicht gleich morgen zu dem Feldzug aufbrechen. Die Truppen müssen noch besser organisiert, einige Pläne noch genauer ausgearbeitet werden. Aber in einem Monat ziehen wir los. Und niemand wird uns aufhalten können.«
Myra senkte den Blick.
»Was ist? Du bist so … seltsam«, sagte Acrab. Er musterte sie aufmerksam.
Myras Herz schlug schneller. Diesem Blick konnte sie sich nicht entziehen, hatte es noch nie gekonnt, und das war ihr bewusst. So flüchtete sie sich in eine Halbwahrheit. »Ich wollte dich etwas fragen.«
»Was denn?«
Myra nahm allen Mut zusammen. »Da hier in den nächsten Wochen nichts Entscheidendes passiert, wollte ich dich bitten, mich eine Zeitlang zu entbehren.«
Sie konnte nicht einschätzen, ob Acrab überrascht oder verärgert war.
»Ich soll dich freistellen?«
»Ja. In den zurückliegenden Jahren haben wir uns keine Pause gegönnt. Ich habe unablässig gekämpft und bin nie dazu gekommen, mich einmal auf mich selbst zu besinnen, auf meinen Körper … auf die Verfeinerung meiner Kampftechniken. Ich brauche einfach ein wenig Zeit für mich, um zu trainieren. Dazu hatte ich zuletzt kaum Gelegenheit.«
Acrab sah ihr fest in die Augen. »Hat das mit unserem Gespräch vor einiger Zeit zu tun?«
»Ja.«
»Myra …«, setzte Acrab an.
»Ich weiß, was du sagen willst, aber …« Sie stockte und suchte nach den richtigen Worten, »… aber ich musste an jene Dinge zurückzudenken, die sehr, sehr schmerzhaft für mich sind. Auch deswegen würde es mir guttun, einmal nur für mich zu sein. Damit ich vergessen und mich ganz auf die Gegenwart konzentrieren kann. Auf die großen Dinge, die vor uns liegen.«
Acrab schien sich zu entspannen. »Deine Einstellung gefällt mir. Du weißt, ich habe lange Zeit um dich kämpfen müssen – gegen deine Vergangenheit. Und ich dachte, ich hätte gesiegt. Aber dieses Gespräch …« Er winkte ab. »Nun gut. Hauptsache, du bist mit ganzem Herzen bei mir. Also, ich gebe dir vier Tage frei. Sag mir nur, wohin es dich zieht.«
»Zu den Wasserfällen«, log sie und erschrak, wie leicht ihr das gelang.
»Sehr gut. Erhole dich an Körper und Geist, und kehre mit neuen Kräften zu mir zurück. Da draußen sind viele Männer, treue Berater, tapfere Krieger, aber niemand bedeutet mir so viel wie du. Denn du warst von Anfang an dabei, und ich weiß, dass du mich niemals verraten wirst. Du bist die Einzige, die ich in diesem wichtigsten Kampf meines Lebens unbedingt an meiner Seite wissen muss.«
Myras Kehle schnürte sich zu, und Tränen stiegen ihr in die Augen. Vor Jahren hatte sie zuletzt geweint, und damals hatte sie sich geschworen, sich nie wieder eine solche Schwäche zu erlauben.
Doch die Last ihrer Entscheidung war zu schwer, zu endgültig. Dazu noch Acrabs Nähe. Es war zu viel. So richtete sie sich auf und umarmte ihn, legte den Kopf an seine Brust, wie sie es als Kind getan hatte, und atmete seinen Geruch tief, tief ein, um sich für immer daran zu erinnern.
»Verzeih mir«, murmelte sie.
Ungelenk wie immer umfassten seine Arme ihre Schultern. Ebenso wie sie mochte Acrab körperliche Nähe nicht sonderlich.
»Ist schon gut. Das geht gleich vorüber. Du hast vielleicht ein wenig Angst, weil wir demnächst etwas wirklich Gewaltiges vollbringen«, sagte er. »Zum Teufel, manchmal kommt die Sache sogar mir zu groß vor.« Er lachte. »Aber wir schaffen es.« Er löste sich aus ihren Armen und schaute sie an. »Und wenn du zurück bist, gehörst du ganz mir.«
Sie nickte, und dieses Mal meinte sie es ernst.
Plötzlich streckte Acrab noch einmal die Hand aus und fing eine Träne aus ihrem Augenwinkel auf.
Myra trat von ihm weg. Dies war ihr Abschied.
Während draußen der Schneesturm heulte, feierten sie. In dem großen Zelt, in dem sie sonst ihr Essen fassten, floss der Kylirash in Strömen. Einer zupfte auf seiner Songvarishherum, einem Saiteninstrument, das von den asgarischen Bänkelsängern gespielt wurde, und die Soldaten sangen und tanzten. Sie wappneten sich gegen den Winter und gegen den Tod.
Unter den Anwesenden waren auch einige von denen, die neu zum Heer gestoßen waren. Sie sahen verwirrt aus und hielten sich am Rand. Myra ahnte, was ihnen durch den Kopf ging: Ist es wirklich angebracht zu feiern. Sollte ich nicht lieber meinen Dolch ziehen und ein paar dieser Eindringlinge töten? Oder ihn gegen mich selbst richten, weil ich meinen Stamm verraten habe?
Im Zelt allerdings saß man im Warmen, während sich draußen die Eishölle endlos ausbreitete. Auch radikale Gefühle waren letzten Endes nie so stark wie der Selbsterhaltungstrieb.
»Du bist zu ernst für diesen Abend«, riss eine Stimme sie aus ihren Gedanken.
Myra fuhr herum. Es war Gotín, mit einem Becher Kylirash in der Hand. Sein langes Haar trug er im Nacken zusammengebunden, und seine Augen, wie bei allen Asgarern blau und pupillenlos, glänzten vom Alkohol. Sein Atem stank dermaßen nach Kylirash, dass ihr fast übel wurde. Er war ein typischer junger Asgarer, groß und stattlich, mit schneeweißer Haut und markanten Gesichtszügen. Die asgarischen Frauen fanden ihn unwiderstehlich. Zudem war er ein sehr guter Krieger.
Myra antwortete nicht.
»Geh schon. Ich weiß doch, dass du es kaum aushältst und unbedingt mit ihm tanzen möchtest«, neckte Gotín sie und trat unangenehm nah an sie heran. Er deutete auf Acrab.
Dieser stand mitten im Trubel, den Becher fest in der Hand – der wievielte mochte es sein? – und sang aus voller Kehle. Normalerweise war er ruhig und nachdenklich. Nicht zuletzt war es sein kühler Verstand, der ihn so weit gebracht hatte. Hin und wieder aber wollte auch er alles vergessen und sich gehenlassen. Er selbst behauptete, dass er damit seine Männer noch enger an sich binden würde. Er wollte ihnen zeigen, dass er einer von ihnen war, einer, der mit ihnen trank und vorn in der Schlacht mit ihnen kämpfte.
Myra hatte da ihre Zweifel.
»Komm, geh schon«, lallte Gotín, »zeig doch einmal, dass du eine Frau bist … falls das überhaupt stimmt.«
Er streckte eine Hand zu ihr aus. Sofort zog Myra ihr Walud und hielt es ihm so dicht an den Hals, dass sich die Haut von der Hitze rötete.
»Fass mich nicht an«, zischte sie.
Gotín hob beide Hände und lachte. »Du fängst zu leicht Feuer.« Er spuckte auf den Boden aus. »Halbblut!« Dann kippte er den Rest Kylirash hinunter, gesellte sich zu Acrab und stimmte aus vollem Hals in den Gesang mit ein.
Myra rührte sich nicht. Ihr war, als sei sie bereits meilenweit von diesem Lager entfernt, und habe Acrab schon verloren.
»Gib nichts drauf«, hörte sie eine andere Stimme neben sich. Brennar.
Myra blickte den alten, weisen Mann an. Er war der älteste Krieger in ihrem Heer, trug einen langen weißen Bart und war Asgarer. Er hatte sich als einer der Ersten Acrabs Überlegenheit gebeugt und es ohne Blutvergießen getan. Er hatte sich mit diesem Eroberer unterhalten, hatte seine Fähigkeiten erkannt und ihm, als kluges Stammesoberhaupt, Gehorsam geleistet. Der alte Mann war praktisch der Einzige in Acrabs Heer, mit dem Myra ein wenig befreundet war. Manchmal tranken sie zusammen, meistens schweigend, und spürten, dass etwas Tieferes sie verband. Myra war überzeugt, dass sie Brennar in gewisser Weise seine Tochter Asen ersetzte, die er bei einem Überfall verloren hatte, als sie noch sehr jung gewesen war. Jedenfalls fühlte sie sich bei ihm sicher und von ihm akzeptiert.
»Kümmere dich nicht um ihn. Das sind seine üblichen Spielchen«, sagte Brennar, wobei er mit dem Kinn auf Gotín deutete. »Der kann nicht anders. Weil er weiß, dass du besser bist als er.«
Myra erwiderte nichts, und eine Weile schwiegen sie.
»Du denkst immer noch daran, nicht wahr?«, sagte Brennar schließlich.
Myra nickte. »Ja, sicher, ich mache mir so meine Gedanken.«
»Und alles nur seinetwegen.« Brennar zeigte auf einen Mann mit sehr dunkler Haut, der mit den anderen sang und tanzte. Er war wie die anderen gekleidet, trug allerdings an der Seite zwei Waluds, so wie Myra, nur dass seine aus gewöhnlichem Metall waren. Er war Biaswade. Mehr noch: ein Rewadir-Krieger.
Myra zuckte mit den Achseln. »Ja, aber ich habe damit abgeschlossen.«
Brennar schaute sie an. »Das ist gut. Denn weißt du, ich habe auch lange auf Rache gesonnen. Irgendwann habe ich sogar meinen Stamm verlassen und Jagd auf Asens Mörder gemacht. Ich war wie von Sinnen.« Er hielt inne. Offensichtlich schmerzte es ihn immer noch, davon zu erzählen. »Schließlich fand und tötete ich ihn. Und soll ich dir sagen, was danach passiert ist? Meine Tochter war immer noch tot, und ich kam immer noch nicht damit zurecht. Mit anderen Worten: Es war alles wie zuvor.«
»Wie gesagt, ich habe mich damit abgefunden.«
Brennar seufzte. »Ich mag dich, Myra, und hoffe wirklich, dass das stimmt. Denn dieser Weg führt nur in einen tiefen Abgrund.«
Diesen Abgrund kenne ich schon seit zehn Jahren, dachte sie. »Ich gehe besser schlafen, ich bin müde.«
»Dann gute Nacht.«
Während sie sich zurechtmachte, um in den Sturm hinauszutreten, warf sie einen letzten Blick auf Jamled. Er tanzte und sang, als wenn nichts wäre. So als hätte er ihr Leben nicht zugrunde gerichtet, durch ihre Begegnung.
3
Drei Wochen zuvor
Myra hatte ihn sofort als Biaswaden erkannt. Aber das war auch nicht schwer. Ihre ebenholzdunkle Haut machte die Biaswaden unverwechselbar. Seit Ewigkeiten hatte sie keinen Bewohner ihrer Heimat mehr gesehen, und so hatte die Begegnung sie in helle Aufregung versetzt.
Sie erinnerte sich an Biaswad: Gab es dort noch diese angenehmen warmen Sommer? Und traten die Flüsse noch regelmäßig über die Ufer und sorgten für die Fruchtbarkeit der Felder? Was war von ihrem Zuhause wohl noch übrig?
Dann hatte sie sich auf diesen Mann besonnen.
Hin und wieder kam es vor, dass sich Söldner ihrem Heer anschlossen. Eigentlich aber hatten sich Acrabs Unternehmungen im Dominium noch nicht herumgesprochen, ein Umstand, für den er selbst sorgte, weil er den Überraschungseffekt nutzen wollte, wenn er zur großen Eroberung ansetzte. Doch im Nachbarland Ostar hatte man bereits von Acrab gehört. Und von dort legte immer mal wieder einer den langen Weg durch Schnee und Eis zurück, um diesen Mann zu treffen, von dem man sich so wunderbare und entsetzliche Dinge erzählte.
Zu diesen Männern zählte auch Jamled.
An einem Abend setzte sich Myra bei einer gemeinsamen Mahlzeit wie zufällig neben ihn.
Eine Zeitlang aßen sie schweigend, bevor sie schließlich den Mut fand und ihn ansprach.
»Du kommst aus Biaswad, nicht wahr?«, sagte sie.
Jamled schaute sie erstaunt an.
Myra wusste, wie ihre raue, geschundene Stimme wirkte. Sie passte nicht zu ihrem Mädchengesicht und ihrem zierlichen Körper, war aber das, was mehr als alles für sie stand. Sie war das hörbare Zeichen ihrer inneren Verwundung, einer Wunde, die nichts und niemand heilen konnte.
Jamled nickte.
»Es ist nur, weil ich auch in Biaswad zur Welt gekommen bin.«
Jamled kicherte. »Kann nicht sein.«
»Doch. Und ob das sein kann«, antwortete sie ernst. »Ich bin die Tochter einer Sklavin.«
»Und eines Blutmagiers würde ich sagen.«
»Mag sein.«
»Ich hätte nicht gedacht, dass in Biaswad noch weitere solcher Mädchen geboren wurden. Normalerweise werden schwangere Sklavinnen zur Abtreibung gezwungen.«
Myra spürte einen Stich in der Brust. »Wieso? Wen meinst du denn mit ›weiteren‹?«
Jamled blickte spöttisch, so als habe er es mit einer Begriffsstutzigen zu tun. »Du müsstest in dem Alter sein, um die Geschichte zu kennen. Damals war die Sache in aller Munde. Sie war ein kleines Mädchen, das zwar keine Haare hatte, aber doch zu blass war, um eine Thyrren zu sein. Es hieß, sie sei zur Hälfte Albonitin, aber mit Sicherheit sagen konnte das niemand. Sie war Fadis Tochter.«
Dieser Name riss Myra aus der Gegenwart und schleuderte sie zurück in eine ferne Vergangenheit, dass sie sich manchmal fragte, ob es sie überhaupt gegeben hatte.
Ihr Geburtstag, das Gewecktwerden mit den süßen Leckereien, die wunderschöne Tätowierung, mit der Tallia ihre Kopfhaut verschönt, das Prinzessinnengewand, das ihr Vater ihr schenkt.
»Was ist mit dir?«, fragte Jamled.
Myra schaute ihn verwirrt an.
»Du bist das? Das glaub ich ja nicht! Sie haben doch damals überall nach dir gesucht?!«
Myra versuchte, sich zu fassen. »Was ist nach Fadis Ermordung geschehen?«
»Man hat ihn mit allen Ehren zu Grabe getragen, und nach dir hat man gesucht. Weil man nirgendwo deine Leiche fand, hofften alle, dass dir die Flucht gelungen war. Außerdem war einer der Täter tot.«
»Wer hat die Bestattung ausgerichtet?«
»Die Munaks, wer sonst?«
Myra war sprachlos.
»Wundert dich das? Soweit ich weiß, hatten sie doch Fadi das Stück Land überlassen, ganz zu schweigen davon, dass das Familienoberhaupt in seiner Schuld stand …«
»Aber Noorjeb war tot.«
»Und wenn schon. Niemand hatte vergessen, dass Fadi einmal sein Leben aufs Spiel gesetzt und ihn gerettet hatte.«
In Myras Kopf drehte sich alles. Die Munaks waren es, sie waren es, die ihren Vater getötet hatten. Es konnte nicht anders sein.
Nachdem das alles geschehen war, hatte sie lange darüber nachgegrübelt. Und später hatte Acrab Nachforschungen angestellt, und danach konnte es keinen Zweifel daran geben, dass die Munaks hinter dem Verbrechen steckten. Warum hatten sie dann aber …?
»So viel ich gehört habe, haben sie sich nach Fadis Tod nicht einmal sein Land zurückgeholt. Seine Felder sollen immer noch verlassen daliegen. Als eine Art von Respekt: Vor Ajel hatten sie geschworen, dass es sein Land war, und seines sollte es bleiben, für immer.«
Myra wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Genau erinnerte sie sich noch an die Worte, die ihr Vater seinem Mörder zugerufen hatte. »Ich geb sie nicht her. Niemals. Sie gehört mir.« Sie war immer davon ausgegangen, dass er von ihrer Parzelle gesprochen hatte, jenem Stück Land, das ihm Noorjeb, das kluge Familienoberhaupt, vermacht hatte, und dass seine habsüchtigen, heimtückischen Nachfahren es wieder an sich reißen wollten und ihren Vater deshalb getötet hatten.
»Als am Morgen nach dem Überfall«, fuhr Jamled fort, »der Rauch der Feuersbrunst viele Meilen weit zu sehen war, haben die Munaks ein paar Leute losgeschickt, um nachzuschauen, was los war. Zwei Tage haben sie gebraucht, um alle Brandherde zu löschen. Und nach den Trauerfeierlichkeiten sollen sie Fadi und diese tote Sklavin in derselben Grabstelle beigesetzt haben, in der ihre eigenen Vorfahren ruhen. Es war das erste Mal, dass einer Thyrren und einem früheren Söldner eine solche Ehre zuteilwurde.«
Myra nahm die Hände vors Gesicht. Alles schien zu zerfallen, und die Wirklichkeit zerrann wie die Farbe eines Gemäldes, unter dem sich noch ein anderes Bild verbarg. Nichts, was dieser Mann erzählte, passte zu dem, was sie wusste. Oder zu wissen glaubte. »Das kann nicht stimmen.«
»Jedenfalls haben sich die Munaks sehr anständig verhalten …«
»Nein«, unterbrach sie ihn, »sie wollten sich das Land zurückholen.«
»Aber wozu? Es ist kaum größer als ein Taschentuch, und liegt zudem bei den Sümpfen. Warum sollte ihnen so daran gelegen sein?«
»Aber wieso musste mein Vater dann sterben?«
Jamled zuckte mit den Achseln. »Das wissen nur seine Mörder.«
Myra starrte ihn an, sah ihn aber nicht. Plötzlich verlor alles seinen Sinn. Warum war ihr Leben zerbrochen? Warum waren damals die sechs Fremden aufgetaucht und hatten Tallia und ihren Vater getötet?