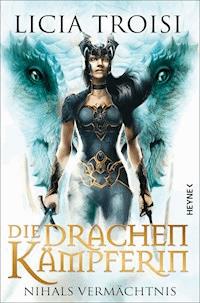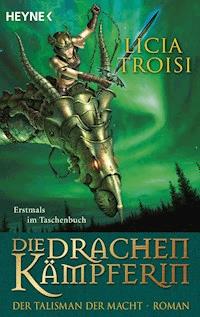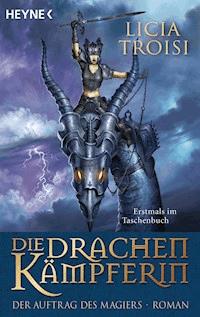Inhaltsverzeichnis
Prolog
ERSTER TEIL
Kapitel 1 – Die Einbrecherin
Kapitel 2 – Alltag
Kapitel 3 – Der erste Sommertag
Kapitel 4 – Ein besonderer Auftrag
Kapitel 5 – Im Hinterhalt
Kapitel 6 – Das letzte Glied in der Kette
Kapitel 7 – Der Prozess
Kapitel 8 – Das Blutbad
Kapitel 9 – Das Siegel
Kapitel 10 – Kriegswirren
Kapitel 11 – Der Tempel des Schwarzen Gottes
Kapitel 12 – Der Weg in die Finsternis
ZWEITER TEIL
Kapitel 13 – Der Meister
Kapitel 14 – In den Katakomben der Gilde
Kapitel 15 – Unter Thenaars Augen
Kapitel 16 – Ja, Meister!
Kapitel 17 – Thenaars kindlicher Prophet
Kapitel 18 – Im Auftrag der Gilde
Kapitel 19 – In der Lehre
Kapitel 20 – Der alte Priester
Kapitel 21 – Ein Selbstmordkommando
Kapitel 22 – Mord im Wald
Kapitel 23 – Opferblut
Kapitel 24 – Alltag eines Postulanten
Kapitel 25 – Die Entscheidung
Kapitel 26 – Ein unmöglicher Auftrag
Kapitel 27 – Die Abmachung
Kapitel 28 – Das erste Mal
Kapitel 29 – Bruchstücke der Wahrheit
Kapitel 30 – Das Gesicht in der Kugel
DRITTER TEIL
Kapitel 31 – Das Ende
Kapitel 32 – Wie alles anfing
Kapitel 33 – Flucht durch die Wüste
Kapitel 34 – Der Rat der Wasser
Epilog
Copyright
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Le guerre del mondo emerso – La setta degli assassinibei Arnoldo Mondadori Editore SpA, Mailand
Breathe in deep, and cleanse away our sins And we’ll pray that there’s no God To punish us und make a fuss.
MUSE, Fury
Prolog
Der Turm stürzte ein, zerbarst in unzählige Splitter schwarzen Kristalls, die die Ebene bedeckten, und eine ganze Weile waren alle wie blind.
Als sich der Staub endlich legte, bot sich ein schier unvorstellbarer Anblick. Die Tyrannenfeste war verschwunden, ausgelöscht. Fast fünfzig Jahre hatte sie dort gestanden, hatte das Leben der Verlorenen, die jetzt in Massen in den Ruinen standen, überschattet, und die Hoffnungen der Siegreichen symbolisiert. Nun aber war der Blick unverstellt und verlor sich weit bis zum Horizont.
Viele jubelten und schrien vor Glück. Widerliche Gnomen, nichtswürdige Menschen, all die Sklaven der sogenannten Freien Länder brüllten wie aus einer Kehle ihre Freude hinaus.
Yeshol aber – der Magier und Mörder – weinte.
Dann begann das Gemetzel.
Menschen und Gnomen, Ritter und Rebellen stürzten sich mordlüstern auf die Überlebenden und machten alle erbarmungslos nieder.
Yeshol ergriff das Schwert eines Gefallenen und begann zu kämpfen, aber ohne Hoffnung. In einer Welt ohne den Tyrannen und ohne Thenaar, wollte er nicht leben.
Als die Sonne in einem rötlichen Streifen am Himmel unterging, stand er immer noch, umgeben von Leichen, mit der Waffe fest in der Hand.
Das Schicksal hatte es anders gewollt. Er lebte.
Schließlich brach die Dunkelheit herein. Das war seine Nacht.
Er floh und versteckte sich tagelang, aber nicht allzu weit vom Schlachtfeld und der geschleiften Feste entfernt. So beobachtete er, wie die Sieger den letzten Widerstand brachen, Gefangene machten und selbstherrlich das Land in Besitz nahmen.
Dabei hatte ihnen Aster nur wenige Tage zuvor noch versprochen, dass Thenaars Wiederkehr nun ganz nahe sei und die Welt in Strömen von Blut untergehen würde.
»Dann wird es einen neuen Anfang geben und das Zeitalter der Siegreichen anbrechen«, hatte Aster mit seiner hohen Stimme verkündet.
»Ja, Meister.«
Und nun war er tot, der einzige Mann, an den Yeshol jemals geglaubt hatte. Sein Führer, sein Meister, der Auserwählte.
Yeshol schwor Rache, während er beobachtete, wie die Sieger mit Karren voller Beutegut aus der zerstörten Feste abzogen: den Zaubertränken und Giften aus den Laboratorien, den kostbaren Handschriften, die Aster mehr als sein eigenes Leben geliebt hatte.
Erfreut euch daran, solange ihr könnt, denn mein Gott kennt keine Gnade.
Er schlich aus seinem Versteck. Jetzt hieß es fliehen, das nackte Leben retten und damit auch den Kult Thenaars. Später würde er die Brüder sammeln, die entkommen konnten, und noch einmal von vorn beginnen und die Macht der Siegreichen wiederherstellen.
Doch noch ein Letztes blieb hier zu tun.
Barfuß lief er durch die Ebene. Bald schon bluteten seine Füße von den schwarzen Kristallsplittern, die ihm die Fußsohlen aufritzten.
Er erreichte die Feste. Obwohl nur noch ein paar Mauerreste standen, war er überzeugt, dass er fündig würde. In und auswendig kannte er das Bauwerk und wusste, wo er suchen musste.
Der Thron lag zertrümmert am Boden. Auch die Sitzfläche war fast vollkommen zersplittert, während sich die Lehne noch fast majestätisch vom Boden erhob. Von Aster keine Spur.
Sanft strich Yeshol über die Thronlehne, über die zahlreichen Verzierungen und stieß auf einen Stoff, der blutgetränkt war. Er nahm das Kleidungsstück in die Hand. Sogar im Dunkeln erkannte er es wieder. Asters Gewand. Das Gewand, das der Tyrann am Tag seines Sturzes getragen hatte.
Die Reliquie, nach der er gesucht hatte.
ERSTER TEIL
So kam es zur Großen Winterschlacht, mit der die Tyrannenherrschaft ihr Ende fand. Die immensen Heerscharen, die ins Feld geführt wurden, wären jedoch nutzlos gewesen, hätte Nihal nicht zuvor die gewaltigen Zauberkräfte der schwarzen Magie gebunden, auf die sich die Tyrannenherrschaft stützte. Um dies zu vollbringen, bediente sich Nihal einer elfischen Magie, die lange Zeit in Vergessenheit geraten war: In den acht Ländern der Aufgetauchten Welt wirkten die acht Urgeister der Natur, die von den Elfen verehrt wurden, und jeder dieser Geister war Wächter eines Edelsteins, dem außerordentliche mystische Kräfte innewohnen. Nihals Aufgabe war es, diese acht Edelsteine in einem speziellen Talisman zu vereinen und dem Tyrannen entgegenzutreten. Als Trägerin dieses Talismans war es ihr gegeben, die Geister zu beschwören, die ihre ungeheure Kraft entfalteten und die schwarze Magie des Gewaltherrschers vernichteten.
Allerdings ist in unseren Tagen von dieser unermesslichen Kraft nichts mehr erhalten. Denn Nihal, die letzte Halbelfe der Aufgetauchten Welt, hat die Energien des Talismans vollkommen erschöpft, der damit heute nichts weiter mehr als ein bloßes Schmuckstück ist.
Auf diese Weise verschwand das letzte Zeugnis elfischer Magie aus der Aufgetauchten Welt.
LEONA AUS DEM RAT DER MAGIER, DER STURZ DES TYRANNEN, KAPITEL XI
1
Die Einbrecherin
Gähnend blickte Mel zum Sternenhimmel auf, und ein dichtes Atemwölkchen bildete sich vor seinem Mund. Obwohl erst Oktober, war es schon unangenehm kalt. Der Mann zog seinen Umhang enger über der Brust zusammen. Warum musste ausgerechnet er hier draußen diese verfluchte Nachtwache halten? Und das auch noch in den schlechten Zeiten, die sein Herr durchmachte. So ein Pech. Früher waren es immer mehrere gewesen, die im Garten patrouillierten. Mit den Männern im Haus waren es mindestens ein Dutzend Wächter gewesen. Nun jedoch waren sie nur noch zu dritt. Er selbst im Garten, Dan und Sarissa vor dem Schlafgemach. Die zweite Sparmaßnahme hatte darin bestanden, sie schlechter auszurüsten.
»Damit ich nicht gezwungen bin, euch den Lohn zu kürzen«, hatte ihr Herr, der Rat Amanta, erklärt.
Es dauerte nicht lange, und Mel fand sich nur noch mit einem kurzen Schwert bewaffnet wieder, dazu trug er einen zerschlissenen ledernen Brustharnisch und den leichten Umhang, in dem er jetzt so fror.
Mel seufzte. Da war es ihm früher als Söldner noch besser gegangen.
Die Friedenszeiten waren schon lange vorbei. Dohor, der König im Land der Sonne, hatte bereits das Land der Tage und das Land der Nacht unterworfen, und der Krieg im Land des Feuers gegen den Gnomen Ido schien wirklich nur ein Geplänkel zu werden. Diese wenigen Hungerleider gegen die stärkste Arme der Aufgetauchten Welt: Das sollte ein Kinderspiel werden.
Gewiss, vor seinem Verrat war Ido Oberster General gewesen und davor noch ein großer Held im Krieg gegen den Tyrannen, aber diese Zeiten waren längst vorbei. Er war ein Greis, und Dohor selbst Oberster General und nicht nur König.
Tatsächlich aber wurde es ein harter, erbitterter Kampf. Ein langer Krieg. Diesen verfluchten Gnomen war nicht beizukommen. Ihre Taktik bestand darin, Fallen zu stellen und aus dem Hinterhalt anzugreifen, und statt eines offenen Kampfes hieß es bald nur noch: herumschleichen, sich verstecken, sich bei jedem Schritt argwöhnisch umschauen. Ein Albtraum, der zwölf Jahre währte – und für Mel kein gutes Ende nahm: wieder mal ein Hinterhalt. Und dann ein entsetzlicher Schmerz in einem Bein.
Er hatte sich nie davon erholt und das Soldatenleben aufgeben müssen. Das war eine schlimme Zeit. Er verstand sich nur auf das Kämpfen. Was sollte er nun tun?
Als er dann diese Stelle als Wächter bei Amanta fand, schien ihm das zunächst eine ehrenvolle Lösung zu sein.
Da wusste er aber noch nicht, welche Langeweile ihn erwartete, eintönige Tage und eine Nacht wie die andere. In den acht Jahren, die er nun schon bei Amanta in Diensten stand, war nie etwas Besonderes vorgefallen. Und doch wurde Amanta immer noch von diesem Sicherheitswahn beherrscht. Sein Haus, voller vielleicht kostbarer, aber gänzlich nutzloser Dinge, ließ er strenger bewachen als ein Museum.
Mel ging an der Rückseite des Hauses entlang. Man brauchte eine Ewigkeit, um dieses Anwesen mit der viel zu großen Villa zu umrunden, die Amanta sich hatte bauen lassen. Und nun war er völlig verschuldet wegen dieses Gemäuers, das ihn bloß an die besseren Zeiten erinnerte, als er noch ein wohlhabender Edelmann war.
Mel blieb stehen und gähnte noch einmal laut vor sich hin. Da geschah es. Völlig überraschend. Ein gezielter Schlag auf den Kopf. Dann Finsternis.
Der Schatten hatte den Garten für sich, blickte sich um, huschte dann zu einem niedrigen Fenster. Seine leichten Schritte bewegten noch nicht einmal das Gras.
Er öffnete das Fenster und kletterte hurtig hinein.
An diesem Abend war Lu besonders müde. Den ganzen Tag über hatte die Herrin sie schon auf Trab gehalten, und nun auch noch dieser absurde Auftrag. Das alte Tafelsilber auf Hochglanz zu bringen. Wozu sollte das gut sein …?
»Falls uns jemand besuchen kommt, dumme Gans!«
Aber wer denn? Der Hausherr war in Ungnade gefallen, und die feinen Damen aus den besseren Kreisen waren daraufhin dem Haus ferngeblieben. Allen stand noch klar vor Augen, was damals, vor fast zwanzig Jahren, mit den Adligen im Land der Sonne geschehen war, die versucht hatten, sich gegen Dohor zu erheben, und ein Komplott gegen ihn geschmiedet hatten. Obwohl rechtmäßig König – er hatte Königin Sulana geheiratet -, wollten sie ihn loswerden. Denn Dohor wurde immer mächtiger, und sein Ehrgeiz schien grenzenlos. Das Komplott war gescheitert, und Amanta war nur um Haaresbreite unversehrt aus der Sache herausgekommen. Er hatte sich seinem König unterworfen und war vor ihm zu Kreuze gekrochen.
Lu schüttelte den Kopf. Sinnlose, müßige Gedanken, die zu nichts führten.
Ein Rascheln.
Sanft.
Wie ein Hauch.
Das Mädchen drehte sich um. Das Haus war groß, viel zu groß, und voller unheimlicher Geräusche.
»Wer ist da?«, rief sie ängstlich.
Der Schatten verbarg sich im Dunkeln.
»Kommt raus«, rief Lu noch einmal.
Keine Antwort. Der Schatten atmete ruhig und leise.
Lu rannte zu Sarissa ins Obergeschoss hinauf, so wie häufig, wenn sie abends allein aufbleiben musste. Sie fürchtete sich vor der Dunkelheit, und außerdem gefiel ihr Sarissa. Er war nicht viel älter als sie und hatte ein schönes, tröstendes Lächeln.
Lautlos folgte ihr der Schatten.
Halb schlummernd auf seine Lanze gestützt, hielt Sarissa Wache vor dem Schlafgemach seines Herrn.
»Sarissa …«
Der Junge schrak auf.
»Lu?«
»Ja.«
»Ach, Lu … nicht schon wieder …«
»Diesmal bin ich mir aber ganz sicher … Da war jemand.«
Entnervt stieß Sarissa die Luft aus.
»Komm doch, nur ganz kurz … bitte …«, ließ Lu nicht locker.
Sarissa nickte, zögernd.
»Gut, aber beeilen wir uns.«
Der Schatten wartete, bis die junge Wache die Treppe hinunter verschwunden war, und schlich dann zur Tür. Das Zimmer war noch nicht einmal abgeschlossen. Er schlüpfte hinein. In der Mitte des Raums, vom Mondschein schwach erhellt, stand ein Bett, aus dem ein sanftes Schnarchen drang, nur hin und wieder unterbrochen von einem seltsamen Röcheln und Stöhnen. Vielleicht träumte Amanta von seinen Gläubigern oder von solch einem Schatten, der angeschlichen kam, um ihm die letzten Kostbarkeiten zu nehmen, die ihm verblieben waren. Alles war wie erwartet. Die Hausherrin schlief, von ihrem Gatten getrennt, in einem Nebenraum. Dort war die Tür.
Der Schatten schlüpfte hinein. Die Schlafgemächer waren identisch, doch hier drang vom Bett kein Atemzug zu ihm. Eine echte Dame, Amantas Gattin.
Mit lautlosen, sicheren Schritten bewegte er sich zu der Stelle, die er im Sinn hatte, und öffnete die Kassette: kleine Brokat- und Samthüllen. Er musste noch nicht einmal hineinsehen, denn er wusste genau, was sie enthielten. Er nahm sie an sich und steckte sie in den Brotbeutel, den er umhängen hatte. Der Schatten warf noch einen Blick auf die Frau im Bett, schlang dann seinen Umhang fester um den Körper, öffnete das Fenster und verschwand.
Makrat, die Hauptstadt des Landes der Sonne, breitete sich wuchernd aus, was vor allem nachts gut erkennbar war, wenn die Lichter der Schenken und Wohnhäuser ihre Silhouette in das Dunkel zeichneten. Im Zentrum standen die protzigen Adelspaläste, in den Außenbezirken die kleinen Wirtshäuser, schlichten Häuschen und Baracken.
Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, lief die Gestalt dicht an den Häuserwänden entlang, lautlos und unerkannt durch die menschenleeren Gassen. Noch nicht einmal zu dieser Stunde, da überall die Arbeit ruhte, hallten ihre Schritte vom Pflaster wider.
Sie lief bis zum Stadtrand, zu einem abseits gelegenen Gasthaus, wo sie in diesen Tagen untergekommen war. Ein letztes Mal würde sie dort schlafen. Sie durfte sich nicht ausruhen, musste ständig ihren Aufenthaltsort wechseln, ihre Spuren verwischen. Bis in alle Ewigkeit wie ein gehetztes Tier.
Langsam stieg sie zu ihrer Kammer hinauf, in der nur ein spartanisches Bett und eine Truhe aus dunklem Holz standen. Draußen vor dem Fenster leuchtete ein greller, klarer Mond am Himmel.
Sie warf ihre Tasche auf das Bett und legte den Umhang ab. Eine Kaskade glänzender, kastanienbrauner Haare, zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst, ergoss sich über ihren Rücken. Sie zündete eine Kerze an, die auf der Truhe stand, und der matte Schein erhellte ein erschöpftes Gesicht mit kindlichen Zügen.
Ein junges Mädchen.
Nicht älter als siebzehn, mit ernstem, blassem Gesicht, dunklen Augen und olivenfarbenem Teint.
Ihr Name war Dubhe.
Sie begann ihre Waffen abzulegen. Dolch, Wurfmesser, ein Blasrohr, Köcher und Pfeile. Im Grunde konnte eine Einbrecherin nicht viel damit anfangen, aber sie hatte sie immer dabei.
Sie legte das Wams ab und warf sich in ihrer üblichen Kleidung, Oberteil und Hose, auf das Bett, lag dann reglos da und blickte hinauf zu den feuchten Flecken an der Decke, die im Mondschein besonders schmuddelig wirkten.
Sie war erschöpft, aber nicht einmal sie selbst hätte genau sagen können ob von der nächtlichen Arbeit, von diesem rastlosen Umherziehen oder von der Einsamkeit. Endlich erlöste der Schlaf sie von diesen Gedanken.
Im Nu verbreitete sich die Nachricht, und bald schon wusste ganz Makrat Bescheid. Amanta, der frühere Erste Höfling und Ratgeber Königin Sulanas, war in seinem Haus bestohlen worden.
Nichts Besonderes eigentlich, das passierte vornehmen Leuten im Umkreis der Stadt in letzter Zeit gehäuft.
Die Ermittlungen verliefen im Sand, so wie immer, und der Schatten blieb ein Schatten, wie immer in den vergangenen beiden Jahren.
2
Alltag
Am nächsten Morgen verließ Dubhe in aller Frühe ihr Zimmer und bezahlte mit den restlichen Münzen, die von ihrem letzten Einbruch übrig waren. Dieser Besuch in Amantas Villa war gerade zur rechten Zeit gekommen, ohne ihn wäre sie wirklich pleite gewesen. Eigentlich kam es selten vor, dass sie sich mit höhergestellten Persönlichkeiten beschäftigte; üblicherweise begnügte sie sich mit kleineren Fischen, die kein großes Aufsehen erregten. Und so gut sie jetzt auch verdient hatte, spürte sie das Messer an der Kehle.
Bald tauchte sie in die Gassen Makrats ein. Die Stadt war immer lebendig, immer wach. Nicht umsonst galt sie als chaotischste Stadt der gesamten Aufgetauchten Welt, dicht bevölkert von Arm und Reich. Während im Stadtkern die Paläste der Adligen das Bild prägten, reihten sich in den Außenbezirken die Hütten der Notleidenden aneinander, die Baracken von Kriegsverlierern und Flüchtlingen aus den acht Ländern der Aufgetauchten Welt, die alles verloren hatten in den Jahren, da Dohor die Macht an sich gerissen hatte. Es waren Geschöpfe aller Völker und Rassen, darunter auch viele Fammin. Diese waren die erbarmungswürdigsten Opfer: heimatlos überall verjagt, isoliert von ihren Artgenossen, unbedarft und hilflos wie Kinder. Früher hatte das anders ausgesehen, da spielten sie als lebende Kriegsmaschinen eine tragende Rolle während der Schreckensherrschaft des Tyrannen. Durch schwarze Magie hatte dieser sie erschaffen, und ihre Herkunft war auch an ihrem Aussehen ablesbar: von plumper Gestalt mit einem rötlichen Fell, unverhältnismäßig langen Armen und scharfen, hervorstehenden Reißzähnen. Damals hatten sie überall Angst und Schrecken verbreitet, und Nihal, die Heldin jener finsteren Zeiten, hatte zahlreiche Schlachten gegen sie geschlagen, die die Bänkelsänger an den Straßenecken besangen. Doch heute erregten die Fammin nur noch Mitleid.
Als Dubhe noch in der Lehrzeit war, hielt sie sich mit ihrem Meister häufig in den Randbezirken Makrats auf. Er fühlte sich dort wohl.
»Die einzigen noch lebendigen Orte in diesem verfaulenden Land«, sagte er und ging dort immer wieder lange mit ihr spazieren.
Auch als der Meister tot war, war Dubhe dort noch häufig zu finden. Wenn sie ihn besonders stark vermisste und nicht mehr weiterwusste, verlor sie sich im Gewirr der Gassen, um seine Stimme wiederzufinden. Und wurde ruhiger.
In den ersten Morgenstunden erwachte die Stadt zu neuem Leben. Läden wurden geöffnet, vor dem Brunnen standen Frauen um Wasser an, Kinder spielten um die große Nihal-Statue herum, die sich in der Mitte des Platzes erhob.
Dubhe fand, was sie suchte: einen Laden, der halb versteckt am Rand des Barackenviertels lag und in dem Kräuter verkauft wurden. So stand es zumindest auf dem großen Schild über dem Eingang, doch das Mädchen war aus anderen Gründen dort.
Tori, der Ladeninhaber, war ein Gnom aus dem Land des Feuers, jenem Land, aus dem, neben dem Land der Felsen, die meisten Gnomen kamen. Seine Hautfarbe war dunkel, sein langes Haar schwarz wie die Nacht und zu zahlreichen Zöpfchen geflochten. Mit stets lächelndem Gesicht lief er unermüdlich auf seinen kurzen Beinen im Laden hin und her und bediente die Kundschaft.
Es reichte jedoch ein bestimmtes Wort, ein Wort, das viele in den einschlägigen Kreisen kannten, und sofort änderte sich seine Miene, und er führte den Kunden in die hinteren Räume, seinen Tempel.
Tori konnte sich des bestsortierten Angebots von Giften rühmen, das man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Als großer Experte auf diesem Gebiet wusste er jedem die für ihn ideale Lösung anzubieten. War ein langsamer, schmerzhafter Tod gewünscht oder aber ein schnelles Dahinscheiden, Tori hatte immer das passende Fläschchen parat. Aber das war noch nicht alles: kein in Makrat erbeutetes Diebesgut, das nicht durch seine Hände ging.
»Guten Morgen. Brauchst du mal wieder meine Hilfe?«, begrüßte er sie, als Dubhe den Laden betrat.
»Ja, wie immer …«, lächelte sie unter ihrer Kapuze.
»Glückwunsch zu deiner letzten Arbeit … Das warst du doch, oder?«
Tori gehörte zu den wenigen Leuten, die mehr über sie und ihre Vergangenheit wussten.
»Ja, sicher«, antwortete Dubhe knapp. Keine Reklame war immer schon ihr Wahlspruch.
Tori führte sie in die hinteren Räume, wo sie sich gleich wie zu Hause fühlte.
Zu einer Zeit, da ihre Treffsicherheit mit Pfeil und Bogen noch zu wünschen übrig ließ, hatte ihr Meister sie in die Geheimnisse der Kräuter eingeführt. Damals bereitete sie sich noch auf eine Zukunft als Auftragsmörderin vor, und unter Anfängern war dies eine weit verbreitete Praxis: Wer noch nicht gut genug war, um die richtigen Stellen exakt zu treffen, behalf sich, indem er den Pfeil oder den Dolch in Gift tauchte, sodass auch eine leichte Verletzung zum Tod führte.
»Gift ist nichts für Könner«, hatte ihr der Meister immer wieder eingeschärft, und dennoch hatte sie eine Leidenschaft dafür entwickelt.
Stundenlang saß sie über einschlägigen Büchern, streifte durch Wiesen und Wälder, um Kräuter zu suchen, und begann irgendwann, ihre eigenen Mixturen zusammenzustellen in unterschiedlichen Graden, von harmlosen Schlafmitteln bis zu tödlichen Giften. Das faszinierte sie: studieren, forschen, erkennen. Und so war Dubhe schließlich zur Expertin geworden.
Irgendwann hatte sich dann alles geändert. Das Geschäft des Mordens war nur noch eine schmerzhafte Erinnerung an einen abgeschlossenen Lebensabschnitt, und Dubhe beschäftigte sich höchstens noch mit Schlafmitteln, die ihr bei der Arbeit, mit der sie heute ihren Lebensunterhalt bestritt, sehr viel nützlicher sein konnten.
Nun holte sie ihren Beutel hervor, breitete den Ertrag ihrer Arbeit auf dem Tisch aus und wartete, bis Tori, der Perlen und Saphire mit Kennerblick prüfte, sein Urteil abgab.
»Gute Machart, schöner Schliff … nur ein wenig zu auffällig … da wird man noch etwas tun müssen.«
Dubhe schwieg. Das wusste sie alles schon. Die Kunst des Mordens hatte sie insoweit verinnerlicht, als sie auch bei ihrer heutigen Arbeit wie vor einem perfekten Mord vorging: Sie sammelte Informationen und überließ nichts dem Zufall, bevor sie zuschlug.
»Ich kann dir dreihundert Denar geben.«
»Das scheint mir etwas wenig.«
Tori lächelte wohlwollend.
»Sicher weiß ich, welchen Aufwand du betreiben musstest, aber versuche auch, mich zu verstehen … Der Schmuck muss bearbeitet werden … geschmolzen … Sagen wir, dreihundertfünfzig.«
Das würde für drei, vier Monate ihres Vagabundenlebens reichen.
Dubhe seufzte leise.
»Gut, einverstanden.«
Tori lächelte sie an.
»Einer Meisterin wie dir geht die Arbeit doch nie aus.«
Dubhe nahm das Geld entgegen, verabschiedete sich und tauchte wieder in das Gassengewirr Makrats ein.
Gegen Mittag verließ sie die Stadt und machte sich auf den Heimweg. In ihre Höhle. Ihr eigentliches Zuhause, eine Hütte am Strand im Land des Meeres, die sie zusammen mit ihrem Meister bewohnt hatte, hatte sie nach dessen Tod, in der Zeit des größten Schmerzes, aufgegeben und war nie wieder dorthin zurückgekehrt. Als Ersatz hatte sie gerade einmal diese Höhle gefunden. Sie lag im Nördlichen Wald, nicht allzu weit von der Zivilisation entfernt, aber auch nicht zu dicht an einem Dorf. Makrat war einen halben Tagesmarsch entfernt.
Als sie dort eintraf, ging die Sonne bereits unter; sie schlüpfte in die Höhle, und sofort schlug ihr ein unangenehmer Schimmelgestank entgegen.
Als Bett diente ihr ein Strohlager, und der Kamin war nur eine Vertiefung in der Höhlenwand. In der Mitte des einzigen Raums standen ein Tisch aus ungehobeltem Holz und an einer Wand ein Regal, in dem sich fast ausschließlich Bücher und Giftfläschchen befanden.
Aus einigen Lebensmitteln, die sie aus der Stadt mitgebracht hatte, bereitete sie sich ein karges Abendessen zu. Draußen war es dunkel geworden, und die Sterne flimmerten klar am Himmel.
Kaum hatte sie fertig gegessen, ging sie wieder hinaus. Das Himmelszelt hatte sie schon immer geliebt, seine Weite tröstete sie. Es war windstill und kaum ein Laut zu hören außer dem sanften Murmeln des Baches. Dubhe wanderte bis zur Quelle und zog sich langsam aus.
Eiseskälte durchzog ihren Körper, kaum dass sie einen Fuß ins Wasser getaucht hatte, doch ließ sie sich nicht abschrecken und ging ganz hinein. Schon bald wich die Kälte einer seltsam wohligen Wärme. Nun tauchte sie auch den Kopf unter, sodass das lange kastanienbraune Haar ihr Gesicht umtanzte.
Nun erst, mit dem ganzen Körper im Wasser, gelang es ihr, zumindest einen Moment lang etwas Frieden in sich zu spüren.
3
Der erste Sommertag
DIE VERGANGENHEIT: I
Aufgeregt springt Dubhe aus dem Bett. Seit sie die Augen aufgeschlagen hat, weiß sie, dass der Sommer da ist. Vielleicht durch das Licht oder den Duft, die durch die abgeblätterten Fensterläden in das Zimmer dringen.
Sie ist acht Jahre alt. Ein lebhaftes Kind mit langen kastanienbraunen Haaren, nicht viel anders als andere Mädchen auch. Sie hat weder Brüder noch Schwestern, die Eltern sind Bauern.
Die kleine Familie lebt im Land der Sonne, in der Nähe des Großen Landes. Nach Ende des Krieges ist dieses Territorium unter den anderen Ländern aufgeteilt worden und nur ein Kern in der Mitte eigenständig geblieben. Dubhes Eltern sind in ein kleines Dorf gezogen, das noch nicht lange besteht. Selva heißt es. Sie suchten Frieden, und dort in Selva scheinen sie ihn gefunden zu haben. Weit entfernt von allem, inmitten eines kleinen Waldes, vernahmen sie von Dohors Eroberungskriegen nicht mehr als ein fernes Echo. Und seit einigen Jahren selbst dies nicht mehr. Dohor hat einen Großteil der Aufgetauchten Welt erobert und so etwas wie einen labilen Frieden geschaffen.
Barfuß, das Haar noch zerzaust, stürmt Dubhe in die Küche. »Die Sonne scheint! Die Sonne scheint!«
Ihre Mutter, Melna, sitzt am Tisch und putzt Gemüse.
»Sieht so aus …«
Melna ist eine etwas rundliche Frau mit rötlichem Gesicht, jung, nicht viel älter als fünfundzwanzig, doch ihre Hände sind schon rau und schwielig von der Feldarbeit.
Dubhe stützt sich mit verschränkten Armen auf die Tischplatte und strampelt mit den Beinen.
»Du hast doch gesagt, dass ich mit den andern im Wald spielen darf, wenn schönes Wetter ist …«
»Ja, aber zuerst hilfst du mir noch, danach kannst du tun, wozu du Lust hast.«
Dubhes Begeisterung verpufft schlagartig. Gestern hat sie mit ihren Freunden abgemacht, dass sie sich treffen würden, wenn die Sonne scheint. Und jetzt scheint sie.
»Aber wenn ich dir helfe, ist der ganze Morgen vorüber!«
Die Frau dreht sich ungeduldig zu ihr um.
»Dann ist es eben so.«
Das Mädchen schnaubt, laut und lange.
Dubhe zieht den Eimer aus dem Brunnen herauf und wäscht sich mit dem eiskalten Wasser. Das ist auch etwas, das ihr Spaß macht, sich mit kaltem Wasser zu waschen.
Zudem fühlt sie sich stark, wenn sie den Eimer hochzieht, und ist stolz auf ihre Kräfte: Von allen Mädchen kann sie es als Einzige mit Gornar aufnehmen, dem Ältesten ihrer Spielkameraden. Er ist zwölf und ein Riese, unumstritten der Anführer ihrer Bande, und diese Stellung hat er sich mit den Fäusten erkämpft. Aber Dubhe kann er nicht in die Knie zwingen, traut ihr nicht über den Weg und gibt Acht, sie nicht zu arg zu reizen. Einige Male schon hat sie ihn im Armdrücken besiegt, und sie weiß, wie sehr ihn das schmerzt. Es ist eine stillschweigende Abmachung: Gornar ist der Anführer, aber gleich danach kommt Dubhe. Und darauf ist sie stolz.
Wir können Schnecken fangen und ein Terrarium bauen oder einfach nur Ringkämpfe machen. Das wird herrlich!, denkt sie und malt sich die Freuden eines Sommertages aus. Unterdessen gießt sie sich das kalte Wasser über den Kopf und schüttelt sich vor Vergnügen. Sie ist dünn, fast zu dünn. Doch der ein oder andere Junge errötet schon, wenn er sie anblickt, und sie freut sich darüber. Allerdings gibt es in ihrem Herzen nur einen Jungen, Mathon mit Namen. Er ist schüchtern und würdigt sie keines Blickes, aber sie denkt häufig an ihn. Am Nachmittag ist er auch dabei, ganz sicher, und wer weiß, vielleicht ist sie in den langen gemeinsamen Stunden so mutig, ihm zu sagen, dass sie ihn mag.
Den ganzen Morgen strahlt sie bei dem Gedanken an den vor ihr liegenden Nachmittag. Sie hilft ihrer Mutter, aber es fällt ihr schwer, ruhig sitzen zu bleiben und das Gemüse zu putzen. Nervös lässt sie ihre Füße baumeln, und immer wieder blickt sie nach draußen.
Hin und wieder ist ihr, als sehe sie dort einen ihrer Kameraden vorbeilaufen, aber sie weiß ganz genau, solange sie nicht mit der Arbeit fertig ist, darf sie nicht hinaus, um keinen Preis der Welt.
Ein kurzer Schmerz am Finger, und ein unterdrücktes »Aua!« lässt ihre Mutter aufschrecken.
»Pass doch auf, Kind! Wo bist du bloß immer mit deinen Gedanken?«
Und dann fängt sie wieder an mit der alten Leier, sie solle mehr lernen und nicht immer mit dieser Horde von Wilden unterwegs sein, die sie sich als Freunde ausgesucht habe.
Dubhe hört schweigend zu. Es hat keinen Sinn, etwas zu entgegnen oder zuzustimmen, wenn ihre Mutter mit diesen Geschichten anfängt. Es ist ja alles Theater, wie Dubhe weiß. Ihr Vater, Gorni, hat es ihr erzählt.
»Als junges Mädchen war deine Mutter tausendmal schlimmer als du heute. Aber das ist normal, das legt sich. Irgendwann taucht ein Mann auf, und die jungen Mädchen verlieben sich und lassen es sein, durch Wald und Wiesen zu jagen.«
Dubhe liebt ihren Vater. Sehr sogar. Mehr als ihre Mutter. Ihr Vater ist so dünn wie sie selbst und witzig.
Und außerdem schimpft er nicht, wenn sie wieder einmal irgendein Tier mit nach Hause bringt, das sie gefangen hat, und schreit nicht auf bei ihren Schlangen, die sie so liebt. Ja, manchmal kommt es sogar vor, dass er ihr ein erlegtes Tier mitbringt. Dubhe besitzt bereits eine ganze Reihe von Gläsern mit Tieren darin, Fröschen, Schlangen, Eidechsen, Kakerlaken – alles Beute, die sie von ihren Streifzügen mit den Kameraden mitgebracht hat. Ein Magier, der einmal durch das Dorf kam, hat ihr eine besondere Flüssigkeit geschenkt. Die gibt man in Wasser und legt die toten Tiere hinein, dann verwesen sie nicht. Diese Sammlung bedeutet ihr viel, und voller Stolz führt sie sie allen vor. Leider hasst die Mutter diese Menagerie, und bringt Dubhe ein neues Exemplar mit nach Hause, will sie gleich in einem Aufwasch alle wegwerfen. Stets endet es mit Tränen und Geschrei, aber ihr Vater mischt sich nicht ein und schaut nur schmunzelnd zu.
Er mag die Tiere, und er ist neugierig.
Und als er jetzt müde und verschwitzt zum Mittagessen in der Küche erscheint, kommt ihr das wie die Rettung vor.
»Papa!«
Dubhe wirft sich ihm so stürmisch an den Hals, dass sie beide fast hinfallen.
»Nicht so stürmisch! Wie oft soll ich dir das noch sagen?!«, schimpft ihre Mutter, doch ihr Vater nimmt es nicht krumm.
Er ist hellblond, fast ein Albino, mit dunkelbraunen Augen, so dunkel wie die von Dubhe. Sein stattlicher Schnauzbart kratzt bei jedem Kuss, doch es ist mehr ein angenehmes Kitzeln.
»Und? Den ganzen Morgen Gurken geschält?«
Dubhe nickt mit gequälter Miene.
»Nun, dann werden dir wohl heute Nachmittag freigeben müssen …«
»Jaaa!«, ruft Dubhe.
Das Mittagessen ist bald vorüber, denn hastig und gierig macht sich Dubhe über ihren Teller her, schlürft geräuschvoll ihre Gemüsesuppe und stürzt sich dann auf die Eier, die mit zwei, drei Bissen verschlungen sind. Dann nur noch der Apfel, bei dem sie sich fast den Kiefer verrenkt, so groß sind die Bissen, und schon ist sie aufgesprungen.
»Ich geh spielen, bis heute Abend«, ruft sie und ist zur Tür hinaus.
Endlich im Freien. Sie beginnt zu laufen.
Sie weiß, wo sie ihre Freunde finden wird, da gibt es kein Vertun. Um die Mittagszeit spielen sie immer unten am Fluss, wo sie sich eine Art Lager eingerichtet haben.
»Dubhe!«, ruft ihr jemand schon von Weitem entgegen.
Es ist Pat, das andere Mädchen in der Bande, ihre beste Freundin, mit der sie all ihre Geheimnisse teilt und die deshalb auch das von Mathon weiß. Sie hat rote Haare und Sommersprossen und ist genauso wild wie Dubhe.
Wie immer sind sie zu sechst. Die anderen brummen ein Hallo. Gornar liegt etwas abseits im Gras mit einem langen Halm im Mund; dann wären da noch die Zwillinge, Sams und Renni, der eine liegt mit dem Kopf auf dem Bauch des anderen. Und schließlich, mit dem Rücken an einen Baumstamm gelehnt, Mathon, der zum Gruß die Hand hebt.
»Hallo, Mathon«, begrüßt ihn Dubhe mit einem schüchternen Lächeln.
Pat grinst, doch ein strenger Blick Dubhes weist sie sofort zurecht.
»Wo warst du denn heute Morgen? Wir haben lange auf dich gewartet«, fragt die Freundin.
»Tja, deinetwegen haben wir viel Zeit verloren«, meint Gornar trocken.
»Ich musste meiner Mutter helfen … Und was habt ihr gemacht?«
»Krieg gespielt«, antwortet Mathon.
Dubhe sieht die Holzschwerter auf einem Haufen liegen.
»Und was machen wir heute Nachmittag?«
»Fischen«, erklärt Gornar bestimmt. »Wir haben die Ruten schon zurechtgelegt, im Versteck.«
Ihr Versteck ist eine Höhle beim Fluss, in der sie auch ihre Beute aufbewahren, meistens Essbares, das sie auf den Feldern oder in den Vorratskammern zu Hause stibitzt haben, aber auch wertvollere Dinge, ja sogar ein langes verrostetes Schwert, vielleicht ein Fundstück aus dem Großen Krieg.
»Los, worauf warten wir?«
Sie teilen sich zu einem Wettangeln in zwei Gruppen auf. Pat und Dubhe wollen zusammen sein, und dazu kommt noch Mathon. Dubhe kann es kaum fassen. Ein Traum wird wahr.
Den ganzen Nachmittag hantieren sie mit Schnüren, Haken und Würmern herum. Pat schafft es, sich mit einem Haken in den Finger zu stechen, und Dubhe tut so, als ekle sie sich furchtbar vor den Würmern, um sich von Mathon helfen zu lassen.
»So widerlich sind die doch gar nicht«, bemerkt der Junge, indem er einen Wurm zur Hand nimmt und Dubhe vor die Nase hält. Das Tier krümmt und windet sich verzweifelt, doch Dubhe achtet nicht darauf. Sie blickt in Mathons grüne Augen und meint plötzlich, noch nie im Leben etwas Schöneres gesehen zu haben.
Dubhe ist eine erfahrene Anglerin, ihr Vater hat sie häufig zum Angeln mitgenommen, doch jetzt spielt sie die Anfängerin.
»Der Fisch zieht zu fest …«, klagt sie, und Mathon muss ihr zu Hilfe eilen und mit ihr zusammen, die Hände dicht an dicht, die Rute festhalten. Für sie ist das alles wie ein Traum: Wenn am ersten Sommertag bereits alles so wunderbar läuft, wird sie gegen Ende des Sommers Mathon vielleicht umarmen können und, wer weiß, vielleicht sogar seine Freundin sein.
Kurz vor Sonnenuntergang zählen sie den Fang aus. Pat hat zwei mickrige Schuppenfische gefangen, Dubhe drei Schuppenfische und eine Forelle und Mathon einen kleinen Katzenwels.
Nichts im Vergleich zu der anderen Gruppe. Gornar kann zwei schöne Forellen vorweisen, Renni und Sams je einen Katzenwels und dazu fast ein Dutzend verschiedene Schuppenfische.
»Ist ja auch kein Wunder«, meint Sams, »mit dem Anführer in der Gruppe …«
Gornar fordert Dubhe auf, die Angelruten wegzubringen.
»Du hast verloren, und außerdem bist du heute zu spät gekommen. Dafür steht mir eigentlich was zu.«
Mit den Angelruten und der Büchse Würmer beladen, marschiert Dubhe zurück zur Höhle. Sie legt die Sachen achtlos in eine Ecke und ist schon wieder auf dem Weg hinaus, als plötzlich etwas ihre Aufmerksamkeit erregt. Ein gräuliches Schimmern auf einem größeren Stein im Kiesbett. Sie nähert sich, um zu schauen, was es ist, und lächelt dann. Eine Schlange, eine Schlange, die ihr noch in der Sammlung fehlt. Tot. Doch perfekt erhalten. Um den schönen silbriggrauen Rumpf winden sich schwärzliche Streifen, einer davon direkt am Hals. Furchtlos streckt Dubhe eine Hand aus und nimmt die Schlange vorsichtig an sich. Sie ist klein, Dubhe weiß, dass solche Schlangen bis zu anderthalb Ellen lang werden können; diese hier ist höchstens drei Spannen groß, aber dennoch eine fabelhafte Beute.
»Schaut mal, was ich gefunden habe!«, ruft sie, während sie zu den anderen zurückläuft.
Rasch umringen sie die Freunde und betrachten neugierig das Reptil.
Pat ekelt sich ein wenig, sie mag solches Getier nicht, doch die Augen der Jungen glänzen.
»Das ist eine Ringelnatter; mein Vater hat mir davon erzählt. Wie lange habe ich danach gesucht …«
»Gib her!«
Gornars Worte wirken wie ein kalter Wasserschwall. Dubhe blickt ihn verwirrt und ungläubig an.
»Gib her, hab ich gesagt.«
»Warum sollte ich?«
»Weil ich das Wettangeln gewonnen habe. Dafür steht mir ein Preis zu.«
»Von einem Preis war aber nie die Rede …«, mischt sich Pat zaghaft ein, »wir haben doch nur so um die Wette geangelt.«
»Das meinst aber auch nur du«, knurrt der Junge. »Gib sie endlich her.«
»Ich denk gar nicht dran. Ich hab sie gefunden und behalte sie auch!«
Dubhe zieht die Hand zurück, in der sie die Schlange hält, um sie vor Gornar zu schützen, doch der Junge ist schon bei ihr, packt sie am Arm und presst ihr Handgelenk zusammen.
»Hör auf, du tust mir weh!«, schreit Dubhe, während sie sich windet und frei zu machen versucht. »Sie gehört mir. Du interessierst dich doch gar nicht für Reptilien, und ich sammle sie!«
»Das ist egal. Ich bin der Anführer.«
»Nein!«
»Gib mir die Natter, sonst beziehst du Prügel, dass du dich morgen mit deinem Gesicht nicht mehr aus dem Haus traust.«
»Versuch’s doch! Aber du weißt ja, dass du mich nicht besiegen kannst.«
Der Tropfen, der das Fass überlaufen lässt. Gornar stürzt sich auf Dubhe, und sie beginnen zu kämpfen. Der Junge versucht es mit den Fäusten, doch Dubhe duckt sich und umklammert seine Beine, beißt ihn mit aller Kraft, kratzt ihn. Die Ringelnatter fällt zu Boden. Dubhe und Gornar rollen aneinandergeklammert durch das Gras, und dabei zieht er ihr so fest an den Haaren, dass ihr die Tränen kommen. Aber Dubhe gibt nicht auf, beißt ihn immer weiter. Mittlerweile heulen beide vor Wut und vor Schmerz. Von den anderen Kindern ringsum kommen Anfeuerungsrufe.
Am Flussufer stürzen sie wieder zu Boden, wälzen sich zappelnd im Kiesbett, verletzen sich an den spitzen Steinen. Gornar taucht Dubhes Kopf unter Wasser, und sie gerät in Panik, Wasser überall, draußen und drinnen, die Luft bleibt ihr weg, während Gornar sie untertaucht, an ihren Haaren reißt, ihren schönen Haaren, ihrem ganzen Stolz.
Mit letzten Kräften gelingt es ihr, sich zu drehen, und plötzlich ist Gornar unter ihr. Dubhe handelt unwillkürlich. Sie hebt seinen Kopf ein wenig an und stößt ihn zurück auf die Steine. Das reicht schon. Sogleich lösen sich Gornars Finger aus ihrem Haar, sein Körper versteift sich einen Moment und wird dann ganz schlaff.
Mit einem Mal fühlt Dubhe sich frei, hat die Situation aber noch nicht begriffen. Schwer atmend sitzt sie rittlings auf ihrem Gegner.
»Mein Gott …«, murmelt Pat.
Blut. Ein Strom Blut färbt das Wasser. Dubhe sieht es und ist wie gelähmt.
»Gornar …! Gornar …!«, ruft sie, immer lauter, erhält aber keine Antwort.
Es ist Renni, der sie von Gornar herunterzieht und ins Gras wirft. Sams fasst Gornar unter den Achseln und schleift ihn ins Trockene, schüttelt ihn, ruft seinen Namen, immer wieder, immer lauter. Keine Antwort. Pat beginnt zu weinen.
Fassungslos blickt Dubhe auf Gornar, und was sie jetzt sieht, wird sich für immer in ihr Gedächtnis einbrennen. Seine aufgerissenen Augen, die Pupillen starr und klein. Sein Blick ausdruckslos, aber dennoch auf sie gerichtet. Anklagend.
»Du hast ihn umgebracht!«, brüllt Renni sie an. »Du hast ihn umgebracht!«
4
Ein besonderer Auftrag
Einige Tage verbrachte Dubhe in ihrer Höhle, was eigentlich unvorsichtig war, denn aus sicherer Quelle wusste sie, dass in Makrat Mörder der Gilde, Assassinen, gesehen worden waren. Vielleicht suchte diese Sekte immer noch nach ihr. Aber sie brauchte einfach ein paar Tage Ruhe.
Fast zwei Jahren lang war sie rastlos umhergezogen, ohne sich irgendwo länger aufzuhalten. Sie war im Land des Meeres gewesen, dann im Land des Wassers und dem des Windes. Als sie schließlich in das Land der Sonne zurückkehrte, hatte es ihr fast die Kehle zugeschnürt.
Es war nicht nur ihr Heimatland, sondern hier lag auch der Ort, wo alles zu Ende gegangen war oder begonnen hatte, je nachdem, wie man es sehen wollte.
Sie hatte es satt, ständig auf der Flucht zu sein, denn je länger dieser Zustand anhielt, desto klarer wurde ihr, dass es in der ganzen Aufgetauchten Welt keinen Platz gab, an dem sie zur Ruhe kommen konnte. Nicht nur die Gilde war überall, es gab noch mehr, dem sie nicht entkam. In den zurückliegenden zwei Tagen hatten die Erinnerungen sie jäh überfallen. Schuld war dieses Nichtstun, sosehr sie es auch gebraucht hatte. Denn solange sie zu arbeiten hatte, war ihr Geist beschäftigt, doch der Müßiggang zermürbte sie. Dann war die Einsamkeit fast mit Händen zu greifen. Und die schmerzhaften Erinnerungen setzten ihr zu.
Dagegen gab es nur ein Mittel. Sich aufraffen.
Der Morgen war kühl und klar. Dennoch zog Dubhe nur ihre leichteste Kleidung an, ein ärmelloses Wams und eine Hose. Keine Schuhe, denn sie liebte es, das Gras unter den Fußsohlen zu spüren, und auch keinen Umhang.
Sie begann mit den Übungen, an die sie mit acht Jahren herangeführt worden war, als sie so stark und eine tödliche Waffe werden wollte wie der Meister. Ein Training für Mörder.
Sie war bereits ins Schwitzen gekommen, als sie ihn hörte. Sofort wusste sie, wer es war. Nur einer von denen, die sie kannte, konnte es nicht lassen, sich immer wieder auf diese unsinnige Weise anzuschleichen.
Blitzartig drehte sie sich um und warf ihren Dolch, der sich knapp hinter einem Jungen in einen Baumstamm bohrte. Der junge Kerl war vielleicht achtzehn, dünn wie eine Bohnenstange, mit Pickeln in seinem nun bleichen Gesicht.
Dubhe lächelte.
»Pass nur auf, Jenna, irgendwann erwische dich.«
»Ja, spinnst du? Oder willst du mich wirklich umbringen?«
»Das nicht. Aber lass doch deine blöden Spielchen.«
Jenna war so etwas wie ein Freund, ein alter Bekannter, den Dubhe wiedergetroffen hatte, als sie in das Land der Sonne zurückgekehrt war. Auch er war ein Dieb, aber auf einem ganz anderen Niveau als sie selbst.
Er arbeitete in Makrat, erleichterte Passanten um ihre Geldbörsen und fristete so sein Dasein als Kriegswaise. Fünf Jahre zuvor hatten sie sich kennengelernt, als er versucht hatte, ihrem Meister einige Münzen zu stibitzen. Als dieser drohte, ihn umzubringen, brach Jenna in Tränen aus und flehte um Gnade. Der Meister hatte überlegt, in Jennas aufgewecktes Gesicht geschaut und war auf eine Idee gekommen.
»Du schuldest mir dein Leben, aber ich will dir einen Vorschlag machen«, sagte er zu ihm und bediente sich seiner fortan als eine Art Gehilfe.
Jenna hatte sich sofort mächtig ins Zeug gelegt und Kontakte für den Meister geknüpft, ihm gute Kunden zugeführt und manchmal sogar die Bezahlung einkassiert, wobei er allerdings nie seine Betätigung als Taschendieb aufgab.
Jenna verfügte über einen wachen Verstand und Hände, die noch flinker waren als sein Kopf. Makrat war sein Zuhause, und er kannte alle Leute in der Stadt. Und auf seine Art verstand er es, treu zu sein.
Dann geschah es. Der Meister starb, und alles war aus. Erneut fand sich Dubhe in Einsamkeit und Verzweiflung wieder, war ständig auf der Flucht und musste sich mit Einbrüchen durchschlagen, bei denen sie die von ihrem Meister erworbenen Kenntnisse nutzte. Damals war sie so überstürzt geflohen, dass sie sich kaum von Jenna verabschieden konnte. Sie verloren sich aus den Augen und fanden sich erst wieder, als Dubhe in das Land der Sonne zurückkehrte. Seitdem trafen sie sich häufig.
Als sie jetzt zusammen Dubhes Höhle betraten, verzog der Junge sofort das Gesicht.
»Wie kannst du hier nur leben in diesem muffigen, stinkenden Rattenloch? Das ist doch kein Zuhause! Noch nicht mal ein Bett hast du. Bei mir hingegen könntest du …«
Immer wieder kam Jenna darauf zu sprechen. Er wollte sie gern in seiner Nähe haben, aber über den Grund war sich Dubhe nicht so genau im Klaren.
»Lass gut sein, Jenna. Komm lieber zur Sache«, schnitt sie ihm das Wort ab, während sie sich setzte. »Also, was führt dich her?«
Jenna fläzte sich auf den einzigen freien Stuhl und legte die Füße auf den Tisch.
»Nun, zunächst mal mein Geld.«
Jenna hatte ihr ein wenig bei den Vorarbeiten zur ihrem letzten Einbruch geholfen, und Dubhe schob ihm rasch hinüber, was sie ihm schuldig war.
»Ich hoffe, du hast den weiten Weg nicht nur wegen des Geldes zurückgelegt.«
Jenna schüttelte den Kopf und legte dann statt der Füße die Ellbogen auf den Tisch.
»In der Stadt ist jemand unterwegs, der sich nach dem besten Einbrecher im weiten Umkreis erkundigt für einen heiklen Auftrag. Das wäre doch was für dich, habe ich mir gedacht und mich ein wenig umgehört, worum es sich dabei handelt, und einige interessante Dinge erfahren.«
Dubhe runzelte die Stirn.
»Das gefällt mir nicht.«
Jenna blickte sie fragend an.
»Wieso? Du hast doch immer mal wieder Auftragsarbeiten übernommen, oder?«
Dubhes Blick blieb finster.
»Du weißt doch, dass ich keine Reklame gebrauchen kann.«
Jenna wartete einen Moment, bevor er fortfuhr: »Aber die Sache ist sicher sehr lukrativ. Der Mann ist ein Vertrauter Dohors.«
»Wer steht heutzutage nicht auf Dohors Seite? Du weißt doch, dass ein Großteil der Aufgetauchten Welt in seiner Hand ist.«
Das stimmte. Aus dem einfachen Drachenritter war durch die Heirat mit Sulana ein König geworden, der sich dann nach und nach an die Eroberung der Aufgetauchten Welt gemacht hatte. Sechs der acht Länder standen mehr oder weniger direkt unter seiner Kontrolle, und mit den letzten drei vollkommen freien Ländern, dem Land des Meeres sowie der Mark der Sümpfe und der Mark der Wälder, die früher einmal gemeinsam das Land des Wassers bildeten, lag er mittlerweile fast offen im Krieg.
Jenna lächelte selbstgefällig.
»Der Mann ist aber kein Handlanger, kein Mitläufer: Man hat ihn häufig in Gesellschaft des Königs persönlich gesehen.«
Dubhes Interesse war geweckt.
»Er ist einer seiner wichtigsten Mitstreiter und gehört zum engsten Kreis.«
»Hast du schon mit ihm gesprochen?«
»Ja, als ich von der Sache hörte, habe ich dafür gesorgt, dass man auf mich aufmerksam wurde. Und jetzt kommt die Überraschung. Nach einer ersten Kontaktaufnahme bestellte man mich in eines der nobelsten Lokale Makrats, du wirst es kennen: das Violette Tuch.«
Das Haus kannte jeder. Dort gingen Generäle und andere hohe Tiere ein und aus.
»Man bat mich in einen Raum, der mindestens viermal so groß war wie meine gesamte Wohnung, und rate mal, wer dort saß?«
Jenna hielt wieder inne.
»Keine Ahnung.«
»Forra.«
Dubhe riss die Augen auf. Forra war Dohors Schwager, vor allem aber seine rechte Hand. Sie hatten sich zu Zeiten kennengelernt, als Dohor von einer absoluten Herrschaft nur hatte träumen können, und waren seit damals unzertrennlich. Gefestigt hatten sie ihre Verbindung durch die Heirat Dohors mit Forras Schwester, und auch auf dem Schlachtfeld sah man den einen nie ohne den anderen. Dohor war zweifellos der Kopf, ein Machtmensch, nicht bloß ein gewiefter Kämpfer, sondern auch ein raffinierter Stratege und gerissener Diplomat. Forra war mehr der reine Krieger. Gab es etwas zu töten, war er nicht weit mit seinem überlangen, mit beiden Händen zu führenden Schwert.
»Mir war doch etwas mulmig, wie du dir sicher vorstellen kannst …«, fuhr Jenna fort. »Na, jedenfalls wurde mir erklärt, worum es geht. Forra – und damit Dohor, auch wenn sein Name nicht ausdrücklich genannt wurde – braucht jemanden, der, ohne Spuren zu hinterlassen, in eine Villa einbricht und einige wichtige versiegelte Dokumente mitgehen lässt. Worum es sich dabei handelt, wollte man mir natürlich nicht sagen.«
»Klar.«
»Für eine perfekte Arbeit ist Forra bereit, dir bis zu fünftausend Denar zu bezahlen. Die Einzelheiten möchte er aber mit dir persönlich besprechen.«
Fünftausend. Eine enorme Summe. So viel Geld hatte Dubhe noch nie auf einem Haufen gesehen, und ihr Meister früher gewiss auch nicht.
Schweigend, den Blick starr auf den Tisch gerichtet, überlegte Dubhe eine Weile. Das war wirklich ein besonders anspruchsvoller Auftrag, wie er noch nie an sie herangetragen worden war. Eine neue Qualität.
»Und mehr hat er dir wirklich nicht gesagt?«
»Nein. Aber er gab mir einen Beweis seiner Freigebigkeit.«
Jenna zog ein Säckchen aus dem Ärmel und ließ den Inhalt auf die Tischplatte kullern. Die Münzen, von reinstem Gold, glitzerten im Halbdunkel der Höhle. Es waren mindestens zweihundert Denar.
Dubhe blieb gelassen. Wortlos betrachtete sie die glänzenden Münzen.
»Forra bat mich, ein Treffen zu arrangieren. Das Geld soll aber auf alle Fälle dir gehören.«
Gespannte Stille breitete sich in der Höhle aus.
Ein Treffen mit Forra. Dubhe kannte ihn, sie hatte ihn erlebt, als sie mit dem Meister im Land des Windes unterwegs gewesen war. Sie erinnerte sich an ihn als einen Riesen mit einem gemeinen, mörderischen Grinsen. Neben ihm stand damals ein blasser Junge, nur wenig älter als sie selbst. Ihre Blicke hatten sich nur kurz gekreuzt, aber sofort war klar, dass sie etwas verband. Die Angst vor diesem Mann.
»Nun? Du sagst ja gar nichts?«, konnte Jenna nicht mehr länger an sich halten.
»Ich denke nach.«
»Wozu denn? Das ist die Chance deines Lebens, Dubhe!«
Aber Dubhe war ein Mensch, der nichts auf die leichte Schulter nahm, am allerwenigstens einen Auftrag, von dem sie so wenig wusste. Und wenn es sich um eine Falle handelte? Wenn die Gilde hinter der ganzen Sache steckte?
»Was kostet es dich, nur mal mit ihm zu reden? Wenn dir das Ganze nicht behagt, kannst du immer noch absagen.«
»Bist du sicher, dass die Gilde nichts damit zu tun hat?«
Jenna machte eine ungeduldige Handbewegung.
»Wieso denn die Gilde? Dohor, ich spreche von Dohor! Von der Gilde ist da weit und breit keine Spur.«
»Hast du ihnen meinen Namen gesagt?«
»Für wie dumm hältst du mich?«
Dubhe schwieg einige Sekunden lang und seufzte dann: »Gut, meinetwegen. In zwei Tagen an der Dunklen Quelle um Mitternacht. Richte ihm das aus!«
Die Dunkle Quelle lag etwas abseits mitten im Nördlichen Wald. Der Name leitete sich von dem Wasser ab, das dort entsprang und einen winzigen See bildete zwischen dunkeln Basaltfelsen, die auch im Sonnenlicht die Wasseroberfläche immer pechschwarz erscheinen ließen. Der Ort war ein wenig unheimlich, aber Dubhe hielt sich gern dort auf, vor allem wenn sie nachdenken musste. Dort fand sie Ruhe und Kraft.
In der verabredeten Nacht war Dubhe etwas früher als notwendig gekommen. Der Himmel war wolkenverhangen und der Wind fast stürmisch. Im Dunkeln saß sie da und lauschte auf das Klagen der Bäume und das Plätschern des Wassers.
Sie mochte die Dunkelheit. Man könnte glauben, sie sei im Land der Nacht geboren, sagte Jenna manchmal, in jenem Land also, in dem ein Magier vor über hundert Jahren, während des Zweihundertjährigen Krieges, eine ewige Nacht hatte heraufziehen lassen. Und in der Tat hatte sie sich immer wohlgefühlt, wenn sie sich mit ihrem Meister dort aufhielt. Dennoch hatte das Land der Nacht auch etwas Tückisches für sie, weil dort die Gilde zu Hause war. Diese Gilde oder Mördersekte, vor der ihr Meister so viele Jahre auf der Flucht war, diese Gilde hetzte nun auch sie.
Als sie die Schritte hörte, war sie bereits ungeduldig geworden. Mitternacht war schon vorüber. Sie kamen zu zweit, ein Mann mit sicherem, schwerem Schritt, und ein Begleiter, dessen Gang unsicherer war. Sie hörte es am Rascheln des Laubes auf dem Boden.
General Forra und ein Handlanger, den er nur zur Sicherheit mitgenommen hat, vermutete sie.
Sie zog die Kapuze ihres Umhangs tiefer ins Gesicht, nahm die Schultern zurück, um stattlicher zu wirken, und war darauf vorbereitet, ihre Stimme rauer klingen zu lassen.
Schon tauchten zwei Gestalten zwischen den Bäumen auf. Über den Schultern des einen ragte deutlich erkennbar der Umriss eines mächtigen, zweihändig zu führenden Schwertes auf, während der andere das Heft eines sehr viel kürzeren Schwertes umklammerte. Sie hatte wohl richtig geraten.
Etwas nervös sprang sie fast zu hastig auf.
Nur die Ruhe, es ist ein Auftrag wie andere auch.
»Ihr habt Euch verspätet«, empfing sie die beiden, um ihnen gleich zu zeigen, mit wem sie es zu tun hatten.
»Ein seltsamer Treffpunkt, nicht gerade leicht zu finden«, erwiderte der zweite Mann.
Es hatte zu regnen begonnen, und so hatten beide ihre Kapuzen hochgeschlagen, aber dennoch erkannte Dubhes geübter Blick trotz der Dunkelheit recht deutlich ihre Gesichtszüge.
Forra sah aus, wie sie ihn in Erinnerung hatte: ein markantes Gesicht mit dicker Nase, eckigem Kinn und dem wie eingebrannten arroganten Grinsen. Er war nur älter geworden, aber kein bisschen sanfter, und etwas von der Furcht, die sie damals als kleines Mädchen vor ihm verspürt hatte, überkam sie auch jetzt wieder.
Der andere war wohl ein beliebiger Soldat. Er war klein gewachsen, trug einen Brustharnisch, und seine weißen Fingerknöchel umklammerten das Heft seines Schwertes.
Copyright © 2006 by Licia Troisi Copyright © 2008 der deutschen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Redaktion: Dr. Ulrike Schimming Herstellung: Helga Schörnig Gesetzt aus der 11,5/13,2 Punkt Weiss
eISBN : 978-3-641-03389-7V002
www.heyne.de
www.randomhouse.de