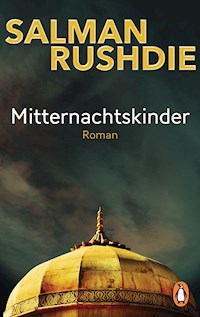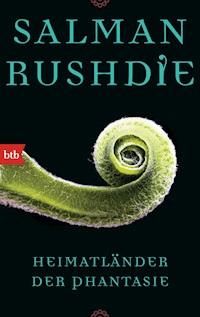24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In fünf Erzählungen setzt sich Salman Rushdie mit dem Leben, dem Tod und der elften Stunde des Lebens auseinander
Indien, England, Amerika – die großen Stationen in Salman Rushdies Leben bilden auch die Schauplätze seines Erzählungsquintetts, in dem er sich mit der elften Stunde des Lebens auseinandersetzt, der Zeit, in der das Leben und der Tod immer näher aneinanderrücken. Zwei streitlustige und doch unzertrennliche alte Männer, eine Musikerin, die ihre Gabe nutzt, um eine Familie zu zerstören, der Geist eines Dozenten, der sich an seinem Peiniger rächen möchte – Rushdies Erzählungen leben von ihren unvergesslichen Charakteren und gehen mit viel Weisheit den großen Fragen des Lebens nach.
Einmal mehr beweist Salman Rushdie, dass er einer der großen Schriftsteller unserer Zeit ist, indem er mit Weitsicht und Klarheit auf unsere Welt blickt, auf ihr Heute und Gestern, auf das Hier und das Dort.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
In fünf Erzählungen setzt sich Salman Rushdie mit dem Leben, dem Tod und der elften Stunde des Lebens auseinander.
Indien, England, Amerika – die großen Stationen in Salman Rushdies Leben bilden auch die Schauplätze seines Erzählungsquintetts, in dem er sich mit der elften Stunde des Lebens auseinandersetzt, der Zeit, in der das Leben und der Tod immer näher aneinanderrücken. Zwei streitlustige und doch unzertrennliche alte Männer, eine Musikerin, die ihre Gabe nutzt, um eine Familie zu zerstören, der Geist eines Dozenten, der sich an seinem Peiniger rächen möchte –Rushdies Erzählungen leben ihren unvergesslichen Charakteren und gehen mit viel Weisheit den großen Fragen des Lebens nach.
Einmal mehr beweist Salman Rushdie, dass er einer der großen Schriftsteller unserer Zeit ist, indem er mit Weitsicht und Klarheit auf unsere Welt blickt, auf ihr Heute und Gestern, auf das Hier und das Dort.
Salman Rushdie, 1947 in Bombay geboren, ging mit vierzehn Jahren nach England und studierte später in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman »Mitternachtskinder«, für den er den Booker Prize erhielt, wurde er weltberühmt. 1996 wurde ihm der Aristeion-Literaturpreis der EU für sein Gesamtwerk zuerkannt. 2007 schlug ihn Königin Elizabeth II. zum Ritter. 2022 ernannte ihn das deutsche PEN-Zentrum zum Ehrenmitglied. 2023 wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.
»Salman Rushdie ist seit 1989 eine Symbolfigur für die Meinungsfreiheit, die Freiheit des Wortes.« Tagesspiegel
»Literatur, das ist für Salman Rushdie immer die Möglichkeit gewesen, der Welt, wie sie ist, andere Welt-Möglichkeiten entgegenzuhalten. Die Welt neu zu erfinden.« Die Zeit
»Manchmal scheint es, als sei Rushdie heute einer der letzten orthodoxen Liberalen unter den Schriftstellern, jemand, der noch mit kompromisslosem Pathos die universellen Werte der Aufklärung beschwört und die Kraft der Literatur gegen ihre mörderischen Zensoren.« Die Zeit
www.penguin-verlag.de
Salman Rushdie
Die elfte Stunde
Fünf Erzählungen
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel The Eleventh Hour bei Random House, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2025 by Salman Rushdie
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by Penguin Verlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Kristine Kress
Covergestaltung: Favoritbuero
Coverabbildung: © Shutterstock/Kot500; Jorm Sangsorn
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-33966-1V001
www.penguin-verlag.de
Dieses Buch ist Steve und Annie Murphy gewidmet.
Und Eliza, natürlich.
Inhalt
Im Süden
Die Musikerin von Kahani
Saumselig
Oklahoma
Der alte Mann auf der Piazza
Im Süden
Der Tag, an dem Junior stürzte, begann wie jeder andere Tag: Vor Gluthitze flimmerte die Luft, das Licht ein Trompetenstoß, das An- und Abschwellen des Verkehrs, die Gebetsgesänge in der Ferne, billige Filmmusik, die aus einem unteren Stock hochwallte, auf dem Fernsehschirm des Nachbarn eine hüftenwackelnde Tanzeinlage, dann das Greinen eines Kindes, die Schelte seiner Mutter, unbegründetes Gelächter, sattroter Hustenschleim, Fahrräder, das frisch geflochtene Haar der Schulmädchen, der Duft nach starkem Kaffee, ein zwischen Baumblättern aufblitzender grüner Flügel. Senior und Junior, zwei sehr alte Männer, öffneten die Augen in ihren Schlafzimmern in einem meergrünen Haus an einer baumbestandenen Gasse, fast in Sichtweite von Elliot’s Beach, an dem sich heute am Abend wie an jedem Abend die jungen Leute treffen würden, um die Riten der Jugend zu vollziehen, unweit vom Dorf der Fischer, die keine Zeit für derlei Frivolitäten hatten, denn diese Armen waren Puritaner, Tag wie Nacht. Und was die Alten anging, so hatten sie ihre eigenen Riten und brauchten nicht auf den Abend zu warten. Sobald die Sonnenstrahlen durch die Jalousien stichelten, mühten sich die beiden alten Männer auf die Beine und taumelten hinaus auf ihre angrenzenden Veranden, traten im selben Moment ins Freie wie Figuren aus einer alten Geschichte, in schicksalhaften Fügungen gefangen, unfähig, den Konsequenzen des Zufalls zu entfliehen.
Fast im selben Augenblick machten sie den Mund auf. Die Worte waren nicht neu. Sie hielten ihre rituellen Reden, Ehrerbietungen an den neuen Tag, dargebracht im Rede-Antwort-Format wie die rhythmischen Dialoge oder »Duelle« der Virtuosen karnatischer Musik während des alljährlichen Festivals im Dezember.
»Sei froh, dass wir Männer des Südens sind«, sagte Junior, reckte sich und gähnte. »Südmänner sind wir, im Süden unserer Stadt im Süden unseres Landes im Süden unseres Kontinents. Gott sei es gelobt. Wir sind warmherzige, langsame, sinnliche Kerle, nicht so wie die kalten Fische aus dem Norden.«
Senior kratzte sich am Bauch, dann am Nacken und widersprach auf der Stelle. »Zuerst einmal«, sagte er, »ist der Süden eine Fiktion, die es nur gibt, weil die Menschen sich darauf geeinigt haben. Mal angenommen, sie hätten sich die Welt andersrum vorgestellt. Dann wären wir Nordmänner! Das Universum weiß nichts von oben und unten, ebenso wenig wie ein Hund. Für einen Hund gibt es kein Norden und Süden. Und zweitens, so warmherzig bist du nun auch wieder nicht; jede Frau müsste lachen, würde sie hören, dass du dich sinnlich nennst – langsam aber bist du, daran besteht kein Zweifel.«
So waren sie nun mal: Sie kämpften, gingen aufeinander los wie alte Ringer, deren linke Fußknöchel aneinandergefesselt waren. Das Seil, das sie so fest aneinanderband, war ihr Name. Durch einen eigenartigen Zufall – den sie im Laufe der Zeit als »Schicksal« zu begreifen lernten, öfter aber einen »Fluch« nannten – teilten sie denselben Namen, einen langen Namen wie für den Süden Indiens so typisch, einen Namen, den keiner von ihnen gern aussprach. Indem sie den Namen verbannten, ihn auf »V«, den Anfangsbuchstaben, reduzierten, machten sie das Seil unsichtbar, was aber keinesfalls hieß, dass es nicht vorhanden war. Auch in manch anderer Hinsicht glichen sie sich, hatten hohe Stimmen, waren beide ähnlich drahtig gebaut und von mittlerer Größe, beide kurzsichtig und mussten sich beide, nachdem sie sich ein Leben lang ihrer guten Zähne gerühmt hatten, mit der beschämenden Unausweichlichkeit künstlicher Gebisse abfinden – der ungenutzte Name, das beidseitige V., dieser Name, der nicht ausgesprochen werden konnte, der war es, der sie seit Jahrzehnten aneinanderband.
Allerdings waren die beiden alten Männer nicht am selben Tag geboren. Der eine war siebzehn Tage älter als der andere, was der Grund dafür gewesen sein dürfte, weshalb sie »Senior« und »Junior« genannt wurden, nur gab es diese Spitznamen schon so lang, dass niemand sich mehr daran erinnerte, wer sie sich ursprünglich ausgedacht hatte. V. Senior und Junior waren sie geworden, Junior V. und Senior V. für alle Zeit, bis zum Tode im Streit verbunden. Sie waren einundachtzig Jahre alt. Hielt man das Alter für einen Abend, der in der Mitternacht des Vergessens endete, war die elfte Stunde für sie längst angebrochen.
»Du siehst schrecklich aus«, sagte Junior zu Senior, wie er es jeden Morgen tat. »Wie jemand, der nur auf den Tod wartet.«
Senior nickte ernst, hielt sich mit seiner Antwort gleichfalls an ihre Tradition und erwiderte: »Immerhin besser, als wie jemand auszusehen, der wie du nur darauf wartet, dass das Leben beginnt.«
***
Beide schliefen nicht mehr gut. Nachts lagen sie auf ihren harten Betten ohne Kissen, und hinter ihren geschlossenen Lidern liefen die unruhigen Gedanken in entgegengesetzte Richtungen. Senior hatte von beiden das erfülltere Leben geführt. Er war der jüngste von zehn Brüdern, die sich allesamt auf den von ihnen gewählten Gebieten ausgezeichnet hatten – als Athleten, Wissenschaftler, Lehrer, Soldaten oder Priester. Er selbst begann seine Karriere als Sieger der College-Meisterschaft im Langstreckenlauf, um später bei der Eisenbahngesellschaft in eine leitende Position aufzusteigen und jahrelang mit der Bahn zu reisen, Zehntausende von Kilometern zurückzulegen und sich sowie anschließend die Behörden davon zu überzeugen, dass die vorgeschriebenen Sicherheitsstandards eingehalten wurden. Er hatte eine nette Frau geheiratet und sechs Töchter sowie drei Söhne gezeugt, die sich ihrerseits wieder als recht fruchtbar erwiesen, was ihm die stattliche Last von dreiunddreißig Enkelkindern eingebracht hatte. Seine neun Brüder zeugten insgesamt weitere dreiunddreißig Kinder, Neffen und Cousinen, womit ihm die Last von nicht weniger als einhundertundelf Verwandten auferlegt wurde. Viele Menschen hätten dies als Beleg ihres Glücks gesehen, denn ein mit zweihundertfünf Familienmitgliedern gesegneter Mann konnte sich doch gewiss wahrhaft glücklich schätzen; bei einem zur Askese neigenden Menschen wie Senior löste eine derartige Überfülle allerdings einen ständigen niederschwelligen Kopfschmerz aus.
»Was für ein friedvolles Leben hätte ich doch gehabt«, sagte er oft zu Junior, »wäre ich nur unfruchtbar gewesen.«
Nach seiner Pensionierung hatte Senior einem Kreis von zehn Freunden angehört, die sich jeden Tag trafen, um in einem nahen Café in Besant Nagar über Politik zu reden, über Schach, Lyrik oder Musik, und manche seiner Kommentare waren in der außerordentlichen örtlichen Tageszeitung veröffentlicht worden. Deren Herausgeber zählte zu seinen Freunden, ebenso einer von dessen Angestellten – ein stadtbekannter Mann, ein rechter Hitzkopf und allzu großer Schluckspecht, aber der Verfasser herrlich grotesker politischer Cartoons. Und dann war da noch der beste Astrologe der Stadt, ein studierter Astronom, der zu der Ansicht gelangt war, dass die wahre Botschaft der Sterne nicht durch ein Teleskop entdeckt werden konnte; dazu ein Mann, der viele Jahre lang an gutbesuchten Renntagen die Startpistole abgefeuert hatte, und so weiter und so weiter. Senior hatte ihre Gesellschaft genossen und seiner Frau oft gesagt, wie wunderbar es doch sei, Freunde zu haben, von denen er jeden Tag etwas Neues lernen konnte. Inzwischen aber waren alle tot. Seine Freunde waren einer nach dem anderen in Flammen aufgegangen, und das Café, das die Erinnerung an sie hätte bewahren können, war abgerissen worden.
Von den zehn Brüdern war er allein übrig geblieben, und auch deren Frauen waren längst dahingeschieden. Sogar seine eigene nette Frau war tot, doch hatte er auf seine alten Tage noch einmal geheiratet, hatte durch einen Heiratsvermittler eine Witwe mit einem Holzbein gefunden, eine Zweckgemeinschaft, mit der jedoch beide unzufrieden waren. Statt in unglücklicher Einsamkeit sahen sie sich nun in unglücklicher Zweisamkeit gefangen. Er legte ihr gegenüber eine Reizbarkeit an den Tag, die seine Kinder und Enkel verwunderte. »Da ich, alt wie ich bin, keine große Wahl hatte«, lautete eine seiner verletzenden Bemerkungen, »musste ich mich mit dir zufriedengeben.« Sie rächte sich, indem sie selbst seine einfachsten Bitten ignorierte, sogar die um Wasser, das zu holen sich kein zivilisierter Mensch weigern sollte, wenn er darum gebeten wird. Sie hieß Aarthi, aber er sprach sie nie mit Namen an. Auch rief er sie nie mit einem zärtlichen oder liebevollen Wort. Für ihn war sie stets nur »Frau« oder »Weib«.
Er ertrug die zahllosen leiblichen Gebrechen der sehr Alten, die täglichen Kasteiungen von Darm und Blase, von Rücken und Knie, die in den Augen aufsteigende Trübe, die Atembeschwerden und Albträume, den langsamen Verfall seines Körpers. Die Tage verliefen mit quälender Untätigkeit. Um sich die Zeit zu vertreiben, hatte er früher Unterricht in Mathematik, Gesang und über die Veden gegeben, aber all seine Schüler waren fort. Blieb nur seine Frau mit dem Holzbein, der verschwommene Bildschirm des Fernsehers und Junior. Das war bei weitem nicht genug. Jeden Morgen bedauerte er, letzte Nacht nicht gestorben zu sein.
Von seinen zweihundertundfünf jüngeren Familienmitgliedern hatte eine ganze Reihe bereits ihr feuriges Ende gefunden. Wie viele wusste er nicht, und auch ihre Namen waren ihm unweigerlich entfallen. Manch ein Überlebender aber kam ihn besuchen und behandelte ihn so freundlich wie fürsorglich. Wenn er sagte, er sei bereit zu sterben, was er oft tat, setzten sie eine verstörte Miene auf, und ihr Körper sackte in sich zusammen oder versteifte sich, je nach Naturell, ehe sie, natürlich in verletztem Ton, beschwichtigend auf ihn einredeten, aufmunternd, vom Wert eines Lebens derart voll der Liebe wie das seine. Doch wie alles andere auch hatte selbst die Liebe angefangen, ihn zu nerven. Die Mitglieder seiner Familie waren wie Mücken, fand er, ein summender Schwarm, ihre Liebe wie juckende Stiche.
»Gäbe es doch so etwas wie eine Mückenspirale gegen Verwandte«, sagte er zu Junior, »wie ein Moskitonetz, das sie fernhält.«
***
Für Junior war das Leben enttäuschend gewesen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass es derart gewöhnlich verlaufen würde. Er war bei liebevollen Eltern aufgewachsen, die ihm das Gefühl mitgegeben hatten, für Größeres bestimmt zu sein, gar, einen Anspruch darauf zu haben, bloß hatte er sich als recht durchschnittlich erwiesen und blieb von seinen durchschnittlichen akademischen Leistungen folglich zu einem Leben als Angestellter in den Büros der städtischen Wasserwerke verdammt. Seine überdurchschnittlichen Träume von Reisen auf der Straße, mit der Bahn oder mit dem Flugzeug musste er bald aufgeben, dennoch war er nicht unglücklich. Die Feststellung, mit der unheilbaren Krankheit der Mittelmäßigkeit geschlagen zu sein, hätte gewiss jeden mit einem weniger überschwänglichen Gemüt entmutigt, Junior aber behielt seinen wachen Blick und begegnete der Welt mit einem bereitwilligen Lächeln.
Trotz seiner offensichtlichen Begeisterung fürs Leben aber gab es da ein gewisses Defizit im Energiebereich. Er rannte nie, er ging, und er ging langsam – hatte es schon in den weit zurückliegenden Jahren seiner Jugend nie anders gehalten. Sportliche Betätigung war ihm zuwider, und er hatte so eine Art, sich sanft über all jene lustig zu machen, denen es anders erging. Für Politik interessierte er sich nicht oder auch nicht für die ach so beliebte, alles prägende Kinokultur oder die von ihr hervorgebrachte Musik. In jeglicher bedeutsamen Hinsicht war es ihm nie gelungen, aktiver Teilnehmer in der Parade des Lebens zu sein. Er hatte nicht geheiratet. Sämtliche großen Ereignisse der letzten acht Jahrzehnte hatten es geschafft, sich ohne das geringste Zutun seinerseits zu ereignen. Ein Reich zerfiel, und eine Nation erhob sich, er aber hatte nur tatenlos zugesehen und es vermieden, dazu eine Meinung zu äußern. Er war ein Mann am Schreibtisch. Die Wasserversorgung der Stadt aufrechtzuerhalten war ihm Herausforderung genug. Und doch war er allem Anschein nach jemand, der das Leben noch immer genoss. Er war ein Einzelkind geblieben, weshalb es nur wenige Verwandte gab, die sich in seinem fortgeschrittenen Alter um ihn kümmerten. Seniors ausgedehnte Familie hatte ihn zudem schon vor langer Zeit adoptiert, brachte Essen vorbei und kümmerte sich um das Nötigste.
Die sich aus Seniors Verwandten zusammensetzenden Besucherscharen brachten gelegentlich die Trennwand zwischen Seniors und Juniors angrenzenden Wohnungen zur Sprache: ob man sie nicht entfernen solle, damit die beiden alten Herren ihr Leben leichter teilen konnten. In dieser Angelegenheit aber waren Junior und Senior einer Meinung.
»Nein!«, rief Junior.
»Nur über meine Leiche«, stellte Senior klar.
»Was das Ganze sowieso überflüssig machen würde«, sagte Junior, als wäre es damit entschieden.
Die Wand blieb, wo sie war.
Junior hatte einen Freund, D’Mello, zwanzig Jahre jünger als er selbst, ein Kollege aus seiner Wasserwirtschaftszeit. D’Mello war in einer anderen Stadt aufgewachsen, in Mumbai, dieser legendären Bitch-City, urbs prima in Indis, und mit ihm musste Englisch geredet werden. Wenn D’Mello seinen Freund besuchte, schmollte Senior und weigerte sich, den Mund aufzumachen, obwohl er insgeheim doch stolz auf sein Geschick war, sich in der von ihm so genannten »Nummer-eins-Sprache der Welt« auszudrücken. Er gab für dieses Schmollen keinen Grund an, für seine duale Feindseligkeit, zum einen gegen die Störung im Rhythmus seiner zänkischen Intimität mit Junior sowie zweitens gegen das Vordringen einer derartigen Lebhaftigkeit, die ihn an seine verlorenen Freunde erinnerte, diese Quasselstrippen. Junior verstand, und so versuchte er, vor Senior zu verheimlichen, wie sehr er sich auf D’Mellos Besuche freute, sprudelte der jüngere Mann doch geradezu vor lauter kosmopolitischem Überschwang, was Junior höchst inspirierend fand. D’Mello kam stets mit Geschichten, manchmal mit ärgerlichen Berichten über Ungerechtes, das den Armen in Mumbais Slums widerfahren war, manchmal mit lustigen Anekdoten über Leute, die sich Entspannung im Wayside Inn gönnten, Mumbais berühmtem Café im Bezirk Kala Ghoda, benannt nach einer nicht mehr vorhandenen Reiterstatue, »diesem Bezirk schwarzes Pferd, aus dem das schwarze Pferd entfernt wurde«. D’Mello verliebte sich in Kinostars (natürlich nur aus der Ferne) und lieferte blutige Einzelheiten zum Amoklauf eines immer noch nicht gefassten Verrückten im Distrikt Trombay. »Der Bösewicht ist weiterhin auf freiem Fuß«, verkündete er frohgemut. Seine Erzählungen waren mit wundersamen Namen durchsetzt: Worli Sea Face, Bandra, Horny Vellard, Breach Candy oder Pali Hill. Orte, die allesamt exotischer klangen als die prosaischen Namen, die Junior gewohnt war: Besant Nagar, Adyar oder Mylapore.
D’Mellos herzzerreißendste Geschichte aus Mumbai war jene von dem großen, Alzheimer zum Opfer gefallenen Dichter der Stadt. Noch spazierte er jeden Tag zu seinem kleinen, mit Zeitschriften vollgestopften Büro, allerdings ohne zu wissen, warum er da hinging. Seine Füße kannten den Weg, also ging er hin, setzte sich und starrte ins Nichts, bis es Zeit wurde heimzukehren und seine Füße ihn zurück zu seiner bescheidenen Bleibe trugen, quer durch die abendliche Menge vor der Station Churchgate, vorbei an den Jasminverkäufern, den frechen Gassenjungen, den vorüberdonnernden BEST-Bussen, den Mädchen auf ihren Vespas und den schnüffelnden, hungrigen Hunden.
War D’Mello da und erzählte, bekam Junior das Gefühl, ein ganz anderes Leben zu führen, ein Leben voller Tatendrang, voller Farben, und gleichsam stellvertretend zu einem Mann jenes Schlags zu werden, dem er nie angehört hatte, dynamisch nämlich, leidenschaftlich und der Welt zugewandt. Sah Senior dieses Licht in Juniors Augen aufleuchten, ärgerte ihn das jedes Mal. Und als D’Mello eines Tages erneut mit gewohnter, heftig gestikulierender Inbrunst von Mumbai redete, durchbrach Senior seine Schweigeregel und fauchte auf Englisch: »Warum kehrt dein Körper nicht dahin zurück, wo dein Kopf doch offenbar längst ist?« D’Mello aber schüttelte bekümmert sein Haupt. Er hatte keine Bleibe mehr in der Stadt seiner Geburt. Nur in seinen Träumen und Erzählungen war sie noch sein Zuhause. »Ich werde hier sterben«, antwortete er Senior, »im Süden, unter lauter Sauertöpfen wie dir.«
***
Seniors Frau, die mit dem Holzbein, rächte sich an ihrem lieblosen Gatten immer öfter dadurch, dass sie Familienmitglieder in ihre Wohnung einlud. Sie selbst stammte ebenfalls aus einer Familie mit aberhundert Personen, und sie begann, insbesondere jüngere Verwandte zu sich zu bitten, die Großnichten und Großneffen mit ihren Frauen oder Männern, vor allem, wenn sie Babys mitbrachten. Die Anwesenheit von Babys, Knirpsen, rasant flinken Mädchen mit Rattenschwänzchen sowie trägen, molligen Jungen in großer Anzahl befriedigte ihren matriarchalen Ehrgeiz und trieb, was sie höchst erfüllend fand, Senior zur Weißglut. Es waren die angeheirateten Babys, die ihn auf die Palme brachten. Diese Schwiegerbabys rasselten mit ihren Rasseln, glucksten ihr Glucksen und schrien ihre Babyschreie. Sie schliefen, und dann musste Senior leise sein; oder sie wachten auf, und dann konnte Senior die eigenen Gedanken nicht mehr hören. Sie aßen und kackten und kotzten, und der Geruch nach Exkrementen und Erbrochenem hing noch in der Wohnung, wenn die Schwiegerbabys längst wieder fort waren, vermischte sich mit einem Geruch, den Senior noch weniger ausstehen konnte, dem nach Talkumpuder.
»Gegen Ende des Lebens«, beklagte er sich bei Junior, in dessen Wohnung er oft vor den kreischenden Horden seiner und seiner Frau Blutsverwandtschaft Zuflucht suchte, »stinkt nichts so schlimm wie des Lebens süßer Beginn, Lätzchen und Windeln, warme Milchfläschchen, Milchpulver und furzende, mit Talkum eingepuderte Popos.«
Junior konnte nicht anders, als darauf zu antworten: »Bald wirst du selbst hilflos sein und auch jemanden brauchen, der sich um deine körperlichen Bedürfnisse kümmert. Die Babydomäne ist nicht nur unsere Vergangenheit, sondern auch unsere Zukunft.« Seniors mörderische Miene verriet, dass seine Worte ins Schwarze getroffen hatten.
Denn es stimmte, sie konnten sich beide glücklich schätzen. Sie waren weder völlig blind noch gänzlich taub, und selbst ihr Verstand hatte sie, anders als der von Mumbais Dichter, nicht im Stich gelassen. Was sie aßen, war weich und leicht verdaulich, war aber auch nicht der Brei alter Saftsäcke. Vor allem aber waren sie noch halbwegs gut zu Fuß, schafften einmal die Woche die Haustreppe langsam runter zur Straße und schlurften mit Hilfe von Gehstöcken und häufigen kleinen Pausen bis zum Postamt, wo sie ihre Rente kassierten. Sie hätten das nicht müssen. Viele jener jüngeren Leute, die sich in Seniors Wohnung drängten und ihn nach nebenan vertrieben, wo er sich mit Junior stritt, wären bereitwillig die Straße hinuntergeflitzt, um die Schecks für die tattrigen alten Herren einzulösen. Aber die Herren dachten nicht daran, die Jüngeren für sie flitzen zu lassen. Die eigene Rente abzuholen war eine Frage des Stolzes – darin, wenn auch in nichts sonst, waren sich beide einig: es aus eigener Kraft bis an den Schalter zu schaffen, an dem ein Postbeamter darauf wartete, ihnen jene wöchentliche Summe auszuzahlen, die ihnen für ihren lebenslangen Dienst zustand. »Der Respekt ist dem Kerl ins Gesicht geschrieben«, sagte Senior laut zu Junior, der lieber den Mund hielt, denn was er hinter dem Schaltergitter sah, glich eher Langeweile oder Verachtung.
Für Senior war ihre Rentenpartie ein Akt der Bestätigung; die wöchentliche Summe, klein, wie sie war, honorierte seine Arbeit, verwandelte die Dankbarkeit der Gesellschaft für seine lebenslangen Dienste in Geldnoten. Für Junior war ihr wöchentlicher Ausflug ein Akt des Trotzes. »Dir bin ich doch völlig egal«, hatte er dem Gesicht hinter dem Schaltergitter einmal gesagt. »Mir Geld auszuzahlen bedeutet dir gar nichts, aber wenn du einmal an der Reihe bist und stehst, wo ich jetzt stehe, dann wirst du begreifen.« Zu den Privilegien hohen Alters gehörte es, selbst Fremden genau das sagen zu können, was man einem durch den Kopf ging. »Die glauben, wir sterben bald«, dachte Junior, »also halten sie es für sinnlos, sich mit uns anzulegen.«
Er verstand die Geringschätzung in den Augen des Postbeamten. Sie war die Verachtung des Lebens für den Tod.
***
An dem Tag, an dem Junior fiel, hatten er und Senior sich zur gewohnten vormittäglichen Stunde auf den Weg gemacht. Es war spät im Jahr. Die ortsansässigen Christen, auch D’Mello, hatten gerade die Geburt ihres Propheten gefeiert, und der folglich nahende Neujahrsabend mit seinem Versprechen einer Zukunft – gar einer endlosen Zukunft, in der eine Abfolge solcher Abende sich in ihren vorherbestimmten Abständen bis in alle Ewigkeit erstreckte – beunruhigte Senior. »Entweder sterbe ich in den nächsten fünf Tagen, was heißt, dass es für mich kein Neujahr mehr geben wird«, sagte er Junior, »oder es beginnt ein Jahr, in dem ich fraglos mein Ende erlebe, was nicht gerade etwas ist, worauf man sich freuen kann.« Junior seufzte. »Deine ewige Schwarzmalerei«, stöhnte er, »ist noch mein Tod.« Sie fanden seine Bemerkung beide so lustig, dass sie lauthals lachen mussten, um gleich darauf schnaufend und keuchend nach Atem zu ringen. Sie gingen gerade die Treppe nach unten, weshalb ihr Lachanfall nicht ganz gefahrlos war. Sie klammerten sich ans Geländer und schnappten nach Luft, Junior einige Stufen tiefer als Senior, der bereits am zweiten Treppenabsatz vorbei war. Sie hatten es sich angewöhnt, die Treppe auf diese Weise hinunterzugehen, immer ein wenig Abstand haltend, damit, falls einer von ihnen fiel, er den anderen nicht mit sich riss. Sie waren zu unsicher auf den Beinen, um einander vertrauen zu können. Auch das Vertrauen war ein Opfer ihres Alters.
Im Hof blieben sie kurz unter dem Indischen Goldregen stehen. Sie hatten diesen Baum wachsen sehen, vom winzigen Steckling bis zu seiner jetzigen, fast zwanzig Meter hohen Pracht. Er war zügig in die Höhe geschossen, und obwohl sie kein Wort darüber verloren, hatte dieses schnelle Wachstum sie verstört, da es sie daran erinnerte, wie rasch die Jahre vergingen. Röhrenkassie, so hieß der Baum außerdem, einer von vielen Namen; Konrai hieß er in ihrer eigenen Sprache, der des Südens, Amaltas in der des Nordens, Cassia fistula in der Sprache der Blumen und Bäume. »Er hat aufgehört zu wachsen«, sagte Junior beifällig, »hat eingesehen, dass Ewigkeit besser als Fortschritt ist. In den Augen Gottes ist Zeit ewig. Das verstehen sogar Tiere und Bäume. Nur Menschen hegen die Illusion, Zeit würde sich bewegen.« Senior schnaubte. »Der Baum hat aufgehört«, sagte er, »weil das in seiner Natur liegt, ebenso wie in unserer. Wir werden auch bald aufhören.«
Er setzte seinen grauen Trilby auf und trat durch das Tor in die Gasse. Junior war barhäuptig und traditionell in ein weißes Veshti mit langem, blau gemustertem Hemd gekleidet, dazu Sandalen, wohingegen Senior es vorzog, als europäischer Gentleman in einem Anzug samt Hut und wirbelndem Spazierstock mit silbernem Griff zum Postamt zu gehen, ganz wie der Mann in dem alten Lied, das ihm so gefiel, who walked along the Bois de Boulogne with an independent air, the man who broke the Bank at Monte Caaar-lo.
Die schattige Gasse ging in die strahlend helle, sonnendurchtränkte Straße über, auf der Verkehrslärm die sanftere Musik des Meers übertönte. Der Strand war nur vier Straßen weiter, der Stadt aber schien das egal. Junior und Senior schlurften bedächtig am Homöopathieshop vorbei, an der Apotheke, in der man problemlos rezeptpflichtige Medikamente bekam, ohne zuvor einen Arzt behelligen zu müssen, am Lebensmittelladen mit Gefäßen voller Nüsse und Chilis, mit Dosen geklärter Butter und importiertem Käse sowie an den Gehwegbuchläden, die dreist die Raubkopien populärer Bücher feilboten, und stets hielten sie die hundert Meter entfernte Ampel im Blick. Dort würden sie die gesetzlose Hauptstraße überqueren müssen, auf der ein Dutzend diverser Transportmittel um jeden Zentimeter kämpfte. Anschließend nach links abbiegen und weitere hundert Meter, dann waren sie am Postamt. Ein Weg von fünf Minuten für die Jungen, für die Alten eine halbe Stunde Minimum pro Strecke. Die Sonne stand in ihrem Rücken, und beide langsam vorwärtsrückenden Männer blickten hinab auf ihre Schatten, die Seite an Seite auf dem staubigen Pflaster ruhten. »Wie Liebhaber«, dachten beide, auch wenn es keiner aussprach, saß die Angewohnheit des Gegensinnigen doch zu tief, um einer derart liebevollen Betrachtung Ausdruck geben zu können.
Hinterher bedauerte Senior, dass er es nicht gesagt hatte. »Er war mein Schatten«, gestand er der Frau mit dem Holzbein, »und ich seiner. Zwei Schatten, die einander beschatteten, was uns auf das minimierte, was wir waren, und nichts sonst. Die Alten bewegen sich in der Welt der Jungen wie Schatten, ungesehen und unbeachtet. Die Schatten aber sehen einander und wissen, wer sie sind. Jetzt jedoch bin ich ein Schatten ohne Schatten, den ich beschatten könnte. Er, der mich kannte, kennt nichts mehr, und das macht mich zum Unbekannten. Was sonst, Frau, ist der Tod?«
»Der ist an dem Tag, an dem du zu reden aufhörst«, erwiderte sie. »Der Tag, an dem dir nicht länger solch närrische Gedanken über die Lippen kommen. An dem das Feuer diese Lippen verbrennt. Das ist der Tag.« So viel hatte sie seit über einem Jahr nicht mehr mit ihm geredet. Er entnahm ihren Worten, dass sie ihn hasste, und er bedauerte, dass es Junior gewesen war, der gefallen war.
***
Es geschah wegen der jungen Frauen auf ihrer neuen Vespa, die, unterwegs zum College, die Zöpfe waagerecht im Wind, giggelnd dem Mord entgegenfuhren. Ihre Gesichter hatten sich Senior nachdrücklich eingeprägt, die schlaksige Lange am Lenker, hinter ihr die molligere Freundin, die sich festklammerte, als hinge das liebe Leben davon ab. Das Leben aber war solchen Leuten nicht lieb. Das Leben war billig wie ein Kleidungsstück, das nach einmaligem Tragen fortgeworfen wurde. Billig wie ihre Musik. Billig wie ihre Gedanken. So jedenfalls schätzte er sie ein, und es war zu spät, seine Meinung zu ändern, als er am Tag danach herausfand, wie ungerecht diese Beurteilung war, erwiesen sie sich doch als ernsthafte Studentinnen, die schlankere Elektrotechnik, die andere Architektur, und der Unfall berührte sie durchaus. Beide erlitten einen schrecklichen, schuldbeladenen Schock; und noch Wochen später konnte man sie nahezu täglich mit gesenktem Kopf und wortlos vor Juniors Wohnung stehen sehen, wo sie reumütig verharrten und Vergebung erhofften. Nur war da niemand, der ihnen vergeben konnte; derjenige, der es getan hätte, war tot, und derjenige, der es hätte tun können, wollte nicht. Hochmütig und verächtlich blickte Senior auf sie herab. Wofür hielten sie denn ein menschliches Leben? Glaubten sie, es wäre so billig zu haben? Nein, das war es nicht. Auch wenn sie tausend Jahre dort stünden, wäre das nicht genug.
Die Vespa war ins Taumeln geraten, daran bestand kein Zweifel; die junge Fahrerin war zu unerfahren, und so taumelte die Maschine und geriet Junior dabei zu nahe, der darauf wartete, die Straße überqueren zu können. Seit einiger Zeit schon klagte er über schwache Fußknöchel. »Wenn ich aus dem Bett steige«, hatte er gesagt, »fürchte ich manchmal, sie könnten mein Gewicht nicht mehr tragen.« Und er hatte auch gesagt: »Wenn ich die Treppe nach unten gehe, habe ich Angst, dass ich mir die Knöchel verknackse. Dabei habe ich mir noch nie Sorgen um meine Knöchel gemacht; in letzter Zeit aber schon.« Senior hielt dagegen, wie es zwischen ihnen Brauch war. »Sorg dich lieber um deine inneren Organe«, sagte er. »Deine Nieren oder deine Leber werden lange vor deinen Knöcheln versagen.«
Aber er hatte sich geirrt. Die Vespa war zu nahe gekommen, und Junior hatte einen Satz zurück gemacht. Als er mit dem linken Fuß aufkam, verdrehte er sich tatsächlich den Knöchel, was zu einem halben Zweitsatz führte, mit dem er sich zu retten versuchte. Ein seltsamer Fall, eher ein Hopser denn ein Hüpfer, der aber zu seinem Sturz führte. Junior taumelte rückwärts zum Gehweg und schlug sich den Kopf an, nicht so heftig, dass er das Bewusstsein verlor, aber heftig genug. Mit einem lauten Zischen entwich ihm alle Luft.
Senior war damit beschäftigt, die entsetzten jungen Frauen auf der Vespa anzuschreien, sie Attentäterinnen und Schlimmeres zu schimpfen, weshalb ihm jener Augenblick entging, als geschah, was am Ende uns allen geschieht, wenn nämlich das letzte bisschen Brodem über unsere Lippen entweicht und sich in miefiger Luft auflöst. »Der Geist, was immer das ist«, pflegte Junior zu sagen. »Ich glaube an keine unsterbliche Seele; ich glaube aber auch nicht, dass es nur Fleisch und Knochen gibt. Ich glaube an eine sterbliche Seele, an eine unkörperliche Essenz unserer selbst, die wie ein Parasit in unserem Fleisch haust, die gedeiht, wenn wir gedeihen, und stirbt, wenn wir sterben.« Senior war in seinen religiösen Überzeugungen eher traditionsverhaftet. Er hatte die alten Schriften oft gelesen, und für ihn klang Sanskrit wie die Musik der Sphären – diese Scharfsinnigkeit und dieser Tiefsinn der Texte, die bereit waren zu hinterfragen, ob das kreative Wesen die eigene Kreativität begriff. Früher hatte er mit seinen Schülern darüber diskutiert, aber Schüler gab es für ihn schon lange nicht mehr, weshalb er genötigt gewesen war, seine Ansichten über die großen Fragen des Seins für sich zu behalten. Jene uralten Vieldeutigkeiten bereiteten ihm Freude; verglichen damit war Juniors laienphilosophische Erfindung einer sterblichen Seele geradezu banal.
Während Senior dies dachte und dabei laut schimpfte, entging ihm jener verräterische letzte Hauch, der ihn vielleicht dazu gebracht hätte, alles noch einmal zu überdenken. Gleich darauf gab es keinen Junior mehr, nur noch einen Körper auf dem Gehweg, etwas, das entsorgt werden musste, ehe die Hitze der Tropen ihm den übelsten Gestank entsteigen ließ. Nur noch eines blieb zu tun. Senior griff in die Tasche seines Freundes und entnahm ihr den Rentenscheck. Dann schickte er die Vespafrauen zu Juniors Wohnung, damit sie seiner Frau und den Verwandten die Nachricht überbrachten, ehe er die Mission allein fortsetzte. Eine Zeit, dem Tod Respekt zu erweisen, würde kommen. Gemäß den Traditionen der Palakkad Aiyars oder Iyers, von denen beide abstammten, Senior wie Junior, währten die Riten zu Ehren der Toten dreizehn Tage.
***
Am nächsten Morgen gab es im Süden des Planeten, weit fort von Seniors Heimatstadt, wenn auch nicht weit genug, ein großes Erdbeben am Meeresgrund, und das mächtige Wasser, wie zur Antwort auf das Leid des Landes unter ihm, bäumte sich zu einer Abfolge riesiger Wellen auf und schleuderte seinen Schmerz um den Globus. Zwei dieser Wellen rasten über den Indischen Ozean, und am Morgen, um Viertel nach sieben, spürte Senior sein Bett wackeln. Weil es in dieser Stadt noch nie ein Beben gegeben hatte, war es ein ebenso verwirrendes wie heftiges Erzittern. Senior stand auf und ging auf seine Veranda. Die Veranda nebenan blieb natürlich leer. Junior war nicht mehr. Junior war nur noch Asche. Die Nachbarn standen draußen in der Gasse, unvollständig bekleidet, Decken um die Schultern geschlungen. Alle hörten Radio. Das Epizentrum des Erdbebens hatte sich nahe der fernen Insel Sumatra befunden. Die Beben hörten auf, und jedermann ging wieder seinem Tagwerk nach. Zweieinviertel Stunden später kam die erste riesige Welle.
Die Küstenregionen wurden zerstört. Elliot’s Beach, Marina Beach, die Strandhäuser, die Autos, die Vespas, die Menschen. Um zehn Uhr vormittags unternahm das Meer seinen zweiten Anschlag. Die Zahl der Toten wuchs. Der verlorenen, vom Meer mitgerissenen Toten, der an den noch verbliebenen Strand angespülten Toten, der zerschmetterten Toten, überall Tote. Bis zu Seniors Haus drangen die Wellen nicht vor. Seniors Gasse blieb verschont. Alle lebten.
Nur Junior nicht.
Zum Glück trafen die Wellen am frühen Morgen auf Elliot’s Beach. Wären sie nachts gekommen, hätten sie gewiss die romantischen Jugendlichen erschlagen, die hier abends lachten und flirteten, so aber überlebten die jungen Freunde und Liebespaare. Die Fischer dagegen hatten weniger Glück. Ihr nahes Dorf – es hieß Nochikuppam – gab es nicht mehr. Ein Strandtempel überdauerte, die Hütten der Fischer jedoch, ihre Katamarane und viele Fischer selbst waren verloren. Nach diesem Tag erklärten die Überlebenden des Dorfes, sie hassten das Meer, und sie weigerten sich zurückzukehren. Lange Zeit danach gab es auf den Märkten kaum Fisch zu kaufen.
Senior mochte das japanische Wort Tsunami nicht, mit dem alle Welt die gefährlichen Wasser beschrieb. Für ihn waren diese Wellen der Tod selbst; sie brauchten keinen anderen Namen. Er war in seine Stadt gekommen, der Tod, um seine Ernte einzufahren, und hatte Junior mitgenommen und viele Fremde auch. Nach dem Rückzug der Wellen sprossen überall um ihn her wie ein Wald jene Geräusche und Taten, die unweigerlich einer Katastrophe folgen, die guten Taten der Gutherzigen, die bösen Taten der Verzweifelten und Mächtigen, die wogende, ziellos treibende Menge. Er verlor sich im Wald der Nachwirkungen und sah nichts außer der leeren Veranda neben seiner und unten in der Gasse die jungen Frauen mit gesenktem Kopf. Ihn erreichte die Nachricht, dass D’Mello zu den Verschwundenen zählte. Vielleicht war er ja nicht tot. Vielleicht war er einfach nur heimgekehrt, endlich, in seine geschichtenreiche Stadt Mumbai an der anderen Küste des Landes. Heim in jene Stadt, die weder zum Norden gehörte noch zum Süden, sondern eine Siedlung am Rand war, die größte, wundersamste und schrecklichste aller solchen Städte, die Megapolis der Grenzlande, der Ort des Dazwischen. Dann wiederum aber war D’Mello vielleicht doch ertrunken, und indem ihn der Tod verschlang, verwehrte er dem Leichnam die christliche Würde eines Grabs.
Er, Senior, war derjenige, der um den Tod gebeten hatte. Der Tod aber hatte ihn leben lassen, hatte das Leben so vieler anderer genommen, sogar das von Junior und D’Mello, ihn aber ließ er unversehrt. Die Welt war ohne Bedeutung. In ihr, dachte er, ließ sich keine Bedeutung finden. Die Schriften waren leer, die Augen blind. Vielleicht hatte er einiges davon laut gesagt, es vielleicht sogar hinausgeschrien. Die jungen Frauen in der Gasse schauten zu ihm hoch, die grünen Vögel im Goldregen wurden unruhig. Und dann meinte er plötzlich, auf der anderen Seite, auf der leeren, angrenzenden Veranda, einen Schatten zu sehen, der sich bewegte. Warum nicht ich?, rief er laut, und wie zur Antwort flackerte ein Schatten, wo Junior immer gestanden hatte.
Tod und Leben waren nur angrenzende Veranden. Senior stand auf der einen, wie er es immer getan hatte, und auf der anderen setzte Junior ihre viele Jahre alte Tradition fort, Junior, sein Schatten, sein Namensvetter, und stritt mit ihm.
Die Musikerin von Kahani
1
Die Geschichte der disharmonischen Musikerin und des Milliarden-Dollar-Babys begann in einer Zeit verstörender Veränderungen, nur dass die in der Luft lagen, haben wir anfangs gar nicht gemerkt. Die Autos, die Busse, die Trams, sie alle zogen ihre vertrauten Bahnen durch die Stadt, und auch unsere Leben verliefen nach immer gleichbleibendem Muster: die sonntagmorgendlichen Spaziergänge rund um die Rennbahn, die Canasta-Abende an filzüberzogenen Kartentischen, die Golfspiele im Willingdon Club. Dann aber, ohne jede Vorwarnung – die es vielleicht gab, bloß waren wir in unserem Leben zu festgefahren, um sie wahrzunehmen –, änderten sich die Namen. Und nach den Namensänderungen begann auch alles andere, anders zu werden.
Der Name unserer Stadt wurde einige Jahre vor dem Millennium geändert, das die Zeit selbst änderte. Viele alte Menschen, ich selbst eingeschlossen, missbilligten, dass der alte Ort aufhörte, der alte Ort zu sein, und zum neuen Ort wurde. Es sei falsch, an der Geschichte herumzudoktern, sagten wir älteren, und gefährlich, die Vergangenheit zu verschmähen. Der alte Name war ein guter Name, der neue Name klang dagegen fremd in unseren Ohren. Also entschied ich mich, selbst den Ort umzubenennen, allein für mich, und ich begann, ihn beim Schreiben und in Gesprächen »Kahani« zu nennen, »Geschichte« also, denn ebendaher kamen meine Geschichten. Manchmal fühlte sich das geradezu verwerflich an, als stellte ich meine persönliche Wahrheit über die Wahrheit selbst, als ersetzte ein Lügner (ich) die Wahrheit und feierte schamlos eine Lüge. Doch ich gab nicht auf, und statt der farblosen Namen irgendwelcher Politiker, die alte Straßennamen ersetzten, begann ich in meiner Fantasie, auch diese Namen wieder nach Belieben abzuändern, alte koloniale Namen durch jene unserer geliebten Dichter und Geschichtenerzähler zu ersetzen, durch Namen dank Buch und Bildschirm bekannter Personen oder gar durch die Titel von Filmen und Romanen selbst. Nissim Ezekiel Marg, Sholay Chowk, Valmiki Drive (z. B: Des Barden Halsband), Amar Akbar Anthony Road (schon bald zu AAA Road abgekürzt), Vyasa Vellard, Tendulkar Terrace, Malgudi Circle nahmen in meinem Kopf ihren Platz ein, ebenso wie – war dies seit jeher doch eine kosmopolitische, weltoffene Stadt – William Shakespeare Bunder, Dahl Market, Bond Bazaar, Petit Prince Parade oder Makioka Row die alten Namen einer beständig wachsenden Zahl neuer Drives, Margs und Chowks überblendeten. Kahani wird also bleiben, zumindest für mich, schließlich war und ist die Stadt selbst schon immer eine Art Wundermärchen gewesen.
***
Das zwanzigste Jahrhundert ging zu Ende. Es endete auf all diesen Straßen und auch auf vielen anderen. Es endete im Breach-Candy-Bezirk unserer Stadt. Und um Mitternacht, in jenem Teil der Welt die bewährte Stunde für wundersame Geburten, wurde einer Familie in Breach Candy zu Beginn dieser neuen tausendjährigen Zeitspanne ein Kind geboren. Das Millenniumbaby war ein Mädchen, was manche Eltern bedauerlicherweise wohl enttäuscht hätte, die Eltern dieses Kindes aber waren überglücklich. Raheem Contractor, der Vater, ein Mathematikprofessor an der städtischen Universität, war fünfzig Jahre alt und sich, ehrlich gesagt, seiner Fähigkeit unsicher geworden, überhaupt noch ein Kind zeugen zu können. Die Mutter, Meena Contractor, galt gleichfalls als numerische Expertin, doch nicht eine der »reinen«, sondern der angewandten Mathematik, eine Frau, die weniger an abstrakten Problemen als daran interessiert war, sich mit ihren Fähigkeiten den Herausforderungen der modernen Welt zu stellen, etwa auf dem neuen Gebiet der Informationstechnologie. Sagen wir einfach, sie war … jünger als ihr Mann. Ich gehöre jener Generation an, vielleicht der letzten, die es unhöflich findet, über das Alter einer Dame zu sprechen. Wer es aber unbedingt genauer wissen will … Sie war zwanzig Jahre jünger. In jener Nacht, der Nacht des neuen Millenniums, schien nur ein Sichelmond – laut Almanach die dritte Nacht nach Neumond –, doch leuchtete er trotzdem hell, weshalb Raheem und Meena ihre Tochter nach diesem prophetischen Mondlicht benannten. Chandni. Chandni Contractor. Das ist unser Mädchen.
Eines aber will ich gleich klarstellen. Diese Chandni ist nicht das Milliarden-Dollar-Baby, von dem schon die Rede war. Ach was, nein. Sie wuchs heran und wurde, könnte man behaupten, nicht eine, sondern gleich zwei bedeutende Persönlichkeiten, erst die gefeierte Musikerin von Kahani und danach, wie wir noch sehen werden, die Mutter jenes gewissen Babys.
***
Breach Candy, das ist eine gefällige Gegend. Krankenhaus, Schwimmbecken, schnieke Läden, das Sophia College, Jugendstilgebäude, Scandal Point, Gärten und Meeresblick. Und dann der Name. Über seine Herkunft war man sich nicht einig, doch sagte er allen zu. Und so blieb er in unserer Zeit der Änderungen unverändert. Die Menschen, die hier lebten, waren gefällige Menschen. Religionen aller Art, Hindus, Muslim, Parsi, Christen, Jain und den einen oder anderen Sikh, sie kamen gut miteinander aus. Alte, Junge, Seite an Seite, Reiche, na klar, wohlhabende Familien, sogar schwer angesagte Familien, wenn auch nicht so reich wie die Leute auf den Hügeln, hoch oben in bestimmten Gegenden von Malabar Hill oder fast die ganze Altamount Road lang. Du lieber Himmel, nein. Die da oben sind richtig reich, supersupersuperreich, für die ist reich ein zu armes Wort. Hier unten genügt ein schlichtes »reich«.
Meena Contractor hatte schon immer in Breach Candy wohnen wollen, doch mit Akademikergehalt und ohne ererbtes Geld war das schier unmöglich. Anfangs, nach ihrer Hochzeit, mieteten die Contractors eine Wohnung in einem eher bescheidenen Viertel der Stadt, in der Nähe des Hauptbahnhofs von Kahani, und da war es gar nicht mal so übel. Doch das Herz verlangt nun mal nach dem, wonach es eben verlangt, nicht wahr? Und manchmal findet das Herz auch einen Weg.