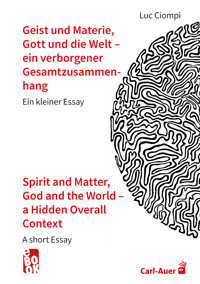Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das menschliche Denken, individuelles wie kollektives, organisiert sich ständig und unausweichlich in komplexen Wechselwirkungen zwischen Emotionen und Erkenntnissen. Für das Verständnis dieser selbst sich schaffenden Prozesse hat die gute alte Suche nach Kausalitäten ausgedient, ebenso kybernetische Modelle, die zwar Dynamiken von Wechselwirkungen beschreiben und simulieren können, nicht aber die ihnen eigene Kraft zur Selbstschöpfung, zur wieder und wieder sich hervorbringenden Selbstähnlichkeit, ja zu ihrer fraktalen Ästhetik. Unerhört ist, dass erstmals in der Geschichte des Denkens über das menschliche Denken Philosophie, Psychologie als Human- und Erfahrungswissenschaft, aber auch die jüngsten Erkenntnisse der Neurobiologie, nicht mehr unvermittelt nebeneinander stehen oder sich gegenseitig auf Defizite aufmerksam machen. In dieser radikal neuen Sicht ergänzen sie sich nicht nur, vielmehr klinken sie hier erstmals ineinander, sie bestätigen sich. In der Erkenntnis fraktaler Selbstorganisation heben sich ihre Widersprüche auf. Das Chaos wird – erst wenn es als Chaos begriffen wird – als sich bahnende Struktur von Emotion und Kognitionen erkennbar. Luc Ciompi fügt in diesem Buch zusammen, was sich in überkommenen Bildern vom Menschen der Zusammenschau widersetzt hat. Aus Angst vor dem Chaos haben wir menschliches Denken in der materiellen Welt uns immer nur beherrschend oder als höchst abhängig vorzustellen vermocht. Ciompi vollzieht den Schritt in ein neues Zeitalter: Wenn wir das Chaos akzeptieren als elementare Gegebenheit unseres Fühlens, Denkens und Handelns, können wir deren Logik erfassen, eine Logik höherer Ordnung. Es ist eine kreative Erkenntnis: Selbstschöpferisch und lustvoll ist der Mensch in seinem Fühlen und Denken, und gleichfalls voller Lust und Kreativität ist es, ihn darin zu begreifen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sammlung Vandenhoeck
Luc Ciompi
Die emotionalen Grundlagen des Denkens
Entwurf einer fraktalen Affektlogik
Mit 6 Abbildungen
4., unveränderte Auflage
Vandenhoeck & Ruprecht
Im Größten das KleinsteIm Kleinsten das Größte– unendlich abgewandelt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99803-9
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
Umschlagabbildung: Benita Koch-Otte, Farbfächer, um 1925; Historische Sammlung der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel
© 2016, 1997 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen /Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.
www.v-r.deAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: KCS GmbH, Buchholz/HamburgEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Inhalt
Danksagung
Über dieses Buch
ErsterTeil
Theoretische Grundlagen
ErstesKapitel
Zur erkenntnistheoretischen Ausgangslage: Ein obligat beschränkter Horizont
Das Bild vom obligat beschränkten Horizont
Postmoderne Pluralität in Philosophie und Wissenschaftstheorie
Die Welt als radikales Konstrukt?
Radikaler versus relativer Konstruktivismus
Der Mensch als »Sensor der Wirklichkeit«
Persönliche Horizontbeschränkungen
Paradoxe Schlußfolgerung. Relative Sicherheit in der Unsicherheit
ZweitesKapitel
Grundbegriffe der Affektlogik. Ausgangspostulate, biologische Grundlagen, Definitionen und Phänomenologie
Integrierte funktionelle Fühl-, Denk- und Verhaltensprogramme als grundlegende Bausteine der Psyche
Biologische Grundlagen der Affektlogik
Was sind »Affekte«, »Gefühle«, »Emotionen« und »Stimmungen«? – Definitorische Verwirrung und Klärung
Zum Begriff der Kognition
Zum Begriff der Logik
Was für Gefühle gibt es? – Grundgefühle und deren unendliche Abwandlungen
Trieb und Instinkt, Motivation und Wille, Wertsysteme und Werthaltungen
Zur reziproken strukturellen Koppelung zwischen dem psychischen, sozialen und biologischen Phänomenbereich
DrittesKapitel
Affekte als grundlegende Operatoren von kognitiven Funktionen
Organisatorisch-integratorische Operatorwirkungen der Affekte auf das Denken
Affektspezifische Formen von Denken und Logik
Stimmige Denkwege sind lustvoll
Erkenntnis kommt von Leiden, Leid
Auch Abstraktion ist lustvoll
Vorläufige Synthese. Ein Grundgesetz, fünf Grundgefühle – und unendlich viele kognitive Modulationen
Bewußtes und Unbewußtes aus der Sicht der Affektlogik
Ein neurophysiologischer »affektiver Inprint« in kognitive Strukturen als Grundlage der Operatorwirkungen der Affekte?
ViertesKapitel
Fraktale Affektlogik – ein chaostheoretischer Zugang zur Psyche
Zum Schlüsselbegriff des »deterministischen Chaos«
Nichtlineare Phasensprünge, Bifurkationen und dissipative Strukturen
Hohe Sensitivität für Anfangsbedingungen – der sogenannte Schmetterlingseffekt
Von Attraktoren und Repulsoren oder Energiesenken und -kuppen
Selbstähnlichkeit oder Fraktalität in deterministischchaotischen Systemen
Ein chaostheoretisch-affektlogisches Modell der Psyche
Methodologische Knacknüsse
Aspekte der Fraktalität von psychischen Systemen
Zusammenfassung und Relativierung. Die fraktale Affektlogik als Grundlage einer neuen Psychologie und Psychopathologie?
ZweiterTeil
Facetten der fraktalen Affektlogik. Beispiele
FünftesKapitel
Zur Entstehung von affektiv-kognitiven »Schienen« und »Eigenwelten«
Angst und Angstlogik
Wut und Wutlogik
Trauer und Trauerlogik
Freude, Lust- und Liebeslogik
Über Interesse-, Alltags- und Wissenschaftslogik
SechstesKapitel
Psychopathologie – Über krankhafte affektiv-kognitive Verrückungen
Vom Mann, der nie nein sagen konnte
Sucht oder »psychischer Krebs« – eine weitere Form von affektiv-kognitiver Verrückung
Dissoziative Störungen, multiple Persönlichkeit
Sprunghafte »Verrückungen« des Fühlens und Denkens im Rahmen von Psychosen
Ist auch die Schizophrenie eine »affektive Psychose?«
Zusammenfassung und Ausblick – Zur Schlüsselrolle der Affekte in der Psychopathologie
SiebentesKapitel
Kollektive fraktale Affektlogik
Affekte als Energielieferanten und Organisatoren des sozialen Raums
Affektive Kommunikation, emotionale Ansteckung und Versklavung
Affekte als kontinuitätsschaffende Öffner und Schließer von kollektiven Gedächtnispforten.
Über kollektive affektiv-kognitive Verrückungen und Verblendungen
Nichtlineare Phasensprünge und »Schmetterlingseffekte« im sozialen Klein- und Großraum
Fazit: Bestätigung des Konzepts einer fraktalen Affektlogik und neue Einsichten zum Problem der Emergenz
DritterTeil
Theoretische und praktische Konsequenzen
AchtesKapitel
Theoretische Vernetzungen und Abgrenzungen
Psychoanalyse, genetische Epistemologie und allgemeine Systemtheorie
Neurobiologie, Emotionsforschung, evolutionäre Erkenntnistheorie und biologisch fundierter Konstruktivismus
Psychopathologie, Strukturdynamik, Phänomenologie und Zeiterleben
Zusammenfassung: Was bringt die fraktale Affektlogik Neues?
NeuntesKapitel
Praktische Konsequenzen. Möglichkeiten und Gefahren
Psychiatrisch-psychotherapeutische Anwendungen
Fraktale Affektlogik und Körpererleben, Körpertherapien, und verwandte Praktiken
Alltagspraktische Implikationen
Ängste, Gefahren, Hoffnungen
ZehntesKapitel
Zum Menschenbild der fraktalen Affektlogik und seinen ethischen Konsequenzen – oder: »Denken mit Gefühl«
Das Problem des Bewußtseins aus der Sicht der Affektlogik
Willensfreiheit und Gedankenfreiheit, Verantwortung
Zum Welt- und Menschenbild der fraktalen Affektlogik
Was tun und wohin zielen? – Das Gleichnis vom Wasser
Literaturverzeichnis
Personenverzeichnis
Sachverzeichnis
Danksagung
Vielen Menschen, mit denen ich während der mehrjährigen Arbeit an diesem Buch im Austausch stand, bin ich für Anregung und Kritik zu Dank verpflichtet. An erster Stelle nenne ich Professor Rupert Riedl aus Wien, der mir mit seiner Einladung ans Konrad-Lorenz-Institut in Altenberg ermöglicht hat, viele Monate lang in einer denkbar günstigen interdisziplinären Umgebung an meinem Manuskript zu arbeiten. Viel habe ich dort auch von seinen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlichster Fachrichtung – namentlich von Manfred Wimmer, Manuela Delpos und Martin Baatz – gelernt. Großen Dank schulde ich des weiteren den Professoren Ilya Prigogine und René Thomas von der Université Libre in Brüssel, an deren Forschungsinstituten ich während einer Vorphase mehrere Wochen lang chaostheoretische Zugänge zur Dynamik komplexer Systeme studieren konnte. Meinen früheren Mitarbeitern Hanspeter Dauwalder und Wolfgang Tschacher habe ich für viel Anregung in der gemeinsamen jahrelangen Auseinandersetzung mit dem Problem der Anwendung chaostheoretischer Konzepte auf den psychologischen und psychopathologischen Phänomenbereich zu danken. Das permanente Gespräch mit meinem besten Freund seit Jugendzeiten, dem Psychoanalytiker Dieter Signer und seiner Frau Rita aus Bern bedeutete mir einmal mehr eine unschätzbare Hilfe. Auch mein früherer Chef und lieber Freund Christian Müller war mir weiterhin in mancher Hinsicht Vorbild und Mentor. Philippe, mein Sohn, hat von Anfang an als gewissenhafter Lektor und scharfer Kritiker zum Gelingen des Werkes beigetragen. Und Mary, meine Frau, hat mich die ganze Zeit in jeder nur möglichen Weise unterstützt. – Darüber hinaus möchte ich vielen hier nicht mit Namen zu nennenden Freundinnen und Freunden, Kollegen, auch früheren Mitarbeitern und Patienten aus der Sozialpsychiatrischen Universitätsklinik Bern, und selbst einigen Feinden oder Widersachern für bedeutsame emotionale Erfahrungen danken, die sie mir in der täglichen Arbeit, in der Psychotherapie, in Zusammenarbeit und Streit, in kritischen wie glücklichen Augenblicken durch Jahre hindurch vermittelt haben. Zusammen mit wissenschaftlichen Befunden bilden solche Erfahrungen die wichtigste Grundlage dessen, was ich in diesem Buch über die emotionalen Grundlagen des Denkens mitzuteilen versuche.
Über dieses Buch
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!
Emotionale Einflüsse auf Denken und Verhalten sind bisher hauptsächlich als Störfaktoren betrachtet worden, die aus dem »reinen Denken« und »rationalen Handeln« so radikal wie nur möglich zu verbannen wären. Daß indessen affektive Komponenten nicht nur mit allem Denken immerzu untrennbar verbunden sind, sondern darin auch unverzichtbare organisatorische und integratorische Funktionen zu erfüllen haben, ist eine Erkenntnis, die sich erst in den letzten Jahren auf mehreren Gebieten der Wissenschaft zugleich Bahn zu brechen beginnt.
Zu den Faktoren, die eine solche Erkenntnis jahrzehntelang verzögert haben, gehört der Umstand, daß Fühlen und Denken – oder Emotion und Kognition, Affekte und Logik – von der spezialisierten psychologischen und biologischen Forschung in der Vergangenheit ganz vorwiegend gesondert, nicht aber in ihren gesetzmäßigen Wechselwirkungen untersucht worden sind. Überhaupt wurden von der Wissenschaft emotionale Phänomene, nicht zuletzt aus methodologischen und definitorischen Gründen, lange Zeit vergleichsweise stark vernachlässigt. Die Folge war ein einseitig intellektzentriertes Welt- und Menschenverständnis, das, obwohl mit der beobachteten Wirklichkeit offensichtlich nicht übereinstimmend, das wissenschaftliche Denken doch lange Zeit fast ausschließlich beherrscht hat.
Seit einiger Zeit ist – parallel zu gleichsinnigen gesellschaftlichen Entwicklungen – in dieser Hinsicht ein Umschwung im Gang. Einerseits sind dank großer Fortschritte in der neurobiologischen Grundlagenforschung die zentralnervösen Grundlagen von Emotionen und deren enge Verflechtungen mit Wahrnehmung und Denken wie Verhalten immer genauer aufgedeckt worden. Andererseits, und damit zusammenhängend, ist ebenfalls in der Psychologie das Interesse für affektiv-kognitive Wechselwirkungen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Nach einer »kognitiven Wende« in den siebziger Jahren, die eine Abkehr vom radikal nur am beobachtbaren äußeren Verhalten orientierten Behaviorismus bedeutete, ist heute mancherorts bereits von einer zweiten, nämlich einer »emotionalen Wende« die Rede. Immer klarer wurde überdies, daß sich – teilweise im Gefolge von großen geistigen Bahnbrechern wie CharlesDarwin, SigmundFreud, JeanPiaget, auch KonradLorenz – eine Reihe von Pionieren abseits vom Hauptstrom gerade mit Interaktionen zwischen Fühlen und Denken schon vor Jahrzehnten auseinandergesetzt und dabei Einsichten gewonnen haben, deren Bedeutung erst heute allmählich anerkannt wird. Zu ihnen gehören die Neurobiologen PaulMcLean und MagdaArnold, die Soziologen NorbertElias und ThomasKuhn, die Erkenntnistheoretiker und Philosophen LudwikFleck und Otto F. Bollnow. LudwikFleck etwa hatte schon in den dreißiger Jahren Theorien zum wissenschaftlichen »Denkstil« vorweggenommen, die den späteren revolutionären Thesen von ThomasKuhn zu den sozialen (und damit implizit auch emotionalen) Hintergründen der Wissensentwicklung verblüffend ähnlich sehen. OttoBollnow seinerseits weitete in den fünfziger Jahren Heideggers Erkenntnisse zur zentralen existentiellen Bedeutung der Angst durch Einbezug auch von Glücksgefühlen zu einer umfassenden anthropologischen Theorie über den Einfluß von affektiven Stimmungen auf unsere gesamte Weltsicht aus. Auch Psychiater wie EugenBleuler mit seiner Lehre von der »Schaltkraft der Affekte« aus den zwanziger Jahren, WernerJanzarik mit seiner schon seit den fünfziger Jahren entwickelten »Strukturdynamik«, und in den späten siebziger Jahren ebenfalls Autoren wie WilliamGray und PaulLaViolette mit ihren Ideen zur Bedeutung von emotional-kognitiven Strukturen beim kreativen Denken wären hier zu nennen. In jüngerer Zeit wurde in der Psychologie die Frage von affektiv-kognitiven Wechselwirkungen namentlich im Zusammenhang mit grundlegenden Untersuchungen PaulEkmans zum transkulturellen Ausdruck von Emotionen und einer langwierigen Kontroverse zwischen Forschern wie R. B. Zajonc und RichardLazarus für oder wider ein Primat der Emotion über die Kognition aktuell. Nicht zuletzt eine ganze Reihe von Publikationen, die erst während der Niederschrift dieses Buches (1994–96) erschienen sind (vgl. Kap. 8, S. 281), deuten darauf hin, daß zusammengenommen all diese Entwicklungen im Begriff sind, zu einem grundlegend neuen Verständnis der Bedeutung von emotionalen Faktoren für alles Denken hinzuführen, das zweifellos für unser ganzes Menschen- und Weltverständnis nicht ohne Folgen bleiben wird.
Im vorliegenden Buch wird diese Problematik von einer Perspektive her aufgerollt, die ich, ausgehend von Untersuchungen zur Langzeitentwicklung der Schizophrenie und anderen psychiatrischen Fragestellungen, vor über zwanzig Jahren zu entwickeln begonnen und 1982 unter dem Namen »Affektlogik« erstmals in Buchform vorgestellt habe. Wichtigster Ausgangspunkt war dabei von Anfang an das Postulat, daß affektive und kognitive Komponenten – oder Fühlen und Denken – in sämtlichen psychischen Leistungen obligat zusammenwirken. Inzwischen haben die damaligen Konzepte, die wesentlich auf einer systemtheoretisch fundierten Synthese von klinischen Beobachtungen mit Erkenntnissen aus der Piagetschen genetischen Epistemologie und der Freudschen Psychoanalyse beruhten, durch den Einbezug von neuen biologischen Forschungsbefunden und theoretischen Gesichtspunkten eine beträchtliche Vertiefung und auch Veränderung erfahren. Gleichzeitig hat sich das Blickfeld von der Psychiatrie und Psychologie auf Fragestellungen allgemeinerer Art ausgeweitet, in denen emotionale Wirkungen auf das Denken eine mindestens ebenso große Rolle spielen wie in der Psychopathologie. Von zentraler Bedeutung für diese Grenzüberschreitung waren dabei für mich namentlich neue Erkenntnisse zur nichtlinearen Dynamik und sogenannten fraktalen – also auf Ebenen verschiedenster Größenordnung selbstähnlichen – Struktur von komplexen Systemen und Prozessen genau von der Art, wie sie im psychosozialen Klein- wie Großraum durchwegs anzutreffen sind. Sie ergaben eine tragfähige wissenschaftliche Basis für die in diesem Buch entwickelte Hypothese, daß grundsätzlich gleichartige affektiv-kognitive Dynamismen in psychischen und sozialen Phänomenen jeglicher Dimension wirksam sind. Das Ergebnis ist der vorliegende »Entwurf einer fraktalen Affektlogik«, der die emotionalen Grundlagen von Denken und Verhalten in individuellen Mikro- und sozialen Makroprozessen unter einheitlich systemdynamischen Gesichtspunkten zu verstehen sucht.
Der Aufbau des Buches ist einfach: In einem ersten Teil werden die empirisch-forschungsmäßigen und theoretischen Grundlagen dieser neuartigen Sichtweise psychischer Phänomene dargestellt, in einem zweiten Teil folgt die Analyse von konkreten Beispielen aus verschiedensten individuellen und kollektiven Ebenen mit Einschluß von psycho- und soziopathologischen Erscheinungen, und in einem dritten Teil werden deren mögliche praktische und theoretische Konsequenzen reflektiert. Das erste und letzte Kapitel ist den komplexen erkenntnistheoretischen Problemen gewidmet, die durch das Postulat von unausweichlichen emotionalen Einflüssen auf alles Denken und Erkennen aufgeworfen werden. Auch ethische Fragen kommen – unter anderem angesichts möglicher Mißbräuche der vorgeschlagenen Konzepte – abschließend zur Sprache. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei durchweg auf den emotionalen Einwirkungen auf die kognitiven Funktionen, während ebenso wichtige, aber schon zur Genüge bekannte umgekehrte Effekte von Kognition und Sprache auf die Emotion, ohne deren Bedeutung im geringsten zu verkennen, weniger im Brennpunkt der Betrachtung stehen. Auch haben übergeordnete strukturelle und dynamische Aspekte einen gewissen Vorrang vor spezifischen Inhalten.
Entsprechend seiner facettenreichen Thematik wendet sich das Buch an eine Leserschaft, die neben Spezialisten der berührten Wissensgebiete – insbesondere der Psychologie und Psychiatrie, der neurobiologischen Grundlagenwissenschaften sowie der Soziologie und der evolutionären Erkenntnistheorie – ebenfalls Fachleute aus weiteren Sachbereichen und Laien umfassen könnte, die sich für emotionale Einflüsse auf Denken und Verhalten interessieren. Interdisziplinäre Allgemeinverständlichkeit ist demnach angestrebt. Indes handelt es sich nicht etwa um eine bloße popularisierende Zusammenfassung von bereits in der Fachpresse erschienenen Befunden für ein größeres Publikum, sondern um die erstmalige wissenschaftliche Darstellung eines Gesamtkonzepts zum Fragenkomplex der emotionalen Grundlagen des Denkens, von dem mehrere wichtige Bausteine allerdings schon seit den achtziger Jahren publiziert worden sind.
Fast die Hälfte der für die Niederschrift des Manuskripts nötigen rund zwei Jahre durfte ich, nach meiner im Herbst 1994 erfolgten Emeritierung als akademischer Lehrer und Leiter der früheren Sozialpsychiatrischen Universitätsklinik Bern, als Gastprofessor am Konrad Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung in Altenberg bei Wien verbringen. Sicher hat die einzigartige Atmosphäre dieses interdisziplinären Forschungsinstituts und gleichzeitigen Geburts- wie Sterbehauses von Konrad Lorenz, vielleicht sogar etwas vom dort sehr spürbaren genius loci, auf meine Schreib- und Denkarbeit nachhaltig abgefärbt. In erster Linie die auf Schritt und Tritt spürbare evolutionär-konstruktivistische Grundperspektive, aber auch manche interessanten Einzelkenntnisse verdanke ich den unvergeßlichen täglichen Mittagsdiskussionen mit dem Institutsleiter Rupert Riedl und seinem Kreis. Auf weitere wesentliche Einflüsse wird im Text selbst sowie in der voranstehenden Danksagung hingewiesen.
Vielleicht wird ebenfalls spürbar, daß das, was Sie, sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, in den nachfolgenden zehn Kapiteln erwartet, für mich keineswegs von Anfang an einfach feststand, sondern über allerhand Um- und Irrwege, viel Lektüre und manche sicher nach wie vor stehengebliebene blinde Flecke hinweg erst Schritt für Schritt erarbeitet werden mußte. Ich hoffe, daß die Lust am Erhellen und Verstehen von zunächst schmerzlich Unklarem, die durch das ganze Buch hindurch eine zentrale Rolle spielt, auch Sie ein Stück weit packen wird, und wünsche dazu viel Vergnügen!
Luc Ciompi
Erster Teil
Theoretische Grundlagen
Erstes Kapitel
Zur erkenntnistheoretischen Ausgangslage: Ein obligat beschränkter Horizont
Statt mich aber im Hafen der Philosophie umzuschauen, welche Schaluppen oder welchen Dampfer ich besteigen soll, […] bleibt mir nichts anderes übrig, als mein eigenes Floß zu besteigen, um so mehr als ich mich mit ihm schon längst in diesem Ozean herumtreibe, ohne Ruder und ohne Segel.
Friedrich Dürrenmatt(1990, S. 206)
Das Bild vom obligat beschränkten Horizont
–Ich weiß, daß ich nichts weiß.
–Ich weiß nicht, daß ich nichts weiß.
–Ich weiß nicht, daß ich weiß.
–Ich weiß, daß ich weiß.
Alle diese Aussagen, und weitere mögliche Abwandlungen dazu, sind auf bestimmte Weise richtig, sinnvoll, »wahr«. Sie kennzeichnen unsere Grundsituation der Welt und uns selbst gegenüber und enthalten mit dem berühmten sokratischen »Ich weiß, daß ich nichts weiß« zugleich ein seit zweieinhalb Jahrtausenden nicht gelöstes Paradoxon. Wir wissen etwas von uns und der Welt und wissen zugleich nicht – und auch das wissen wir nicht recht! Seit seinen Uranfängen ringt das abendländische Denken mit der Frage, ob (und wie) wir überhaupt etwas Sicheres wissen und erkennen können.
Auch heute noch, oder wieder, spielt dieses Problem in den verschiedensten Sparten der Wissenschaft und Philosophie eine bedeutsame Rolle, von der genetischen Epistemologie Jean Piagets über die evolutionären Erkenntnistheorien der Biologie bis zum postmodernen Konstruktivismus. Es stellt sich ebenfalls, und zwar in mindestens zweifacher Weise, im Rahmen der vorliegenden Untersuchung: Zum einen geht es um die Grenzen unseres wissenschaftlichen Erkennens im allgemeinen, und zum anderen fragt es sich, welche besonderen Probleme sich allenfalls aus dem Versuch ergeben, die affektiven Grundlagen des Denkens mit ebendiesem Denken selbst zu explorieren.
Vorgängig der Hinwendung zu unserem eigentlichen Thema sollen in der Folge – gewissermaßen als Prolog – aus dieser komplexen Fragestellung einige für uns besonders wichtige Aspekte herausgegriffen werden. Ziel dieser Vorüberlegungen ist es, die erkenntnistheoretischen Grundlagen unseres ungewissen Wissens vom Wissen zumindest so weit zu reflektieren, daß wir daraus – wiederum paradox, wie sich zeigen wird – eine einigermaßen tragfähige Ausgangsbasis für alle weiteren Überlegungen zu gewinnen vermögen. Eine ins einzelne gehende Erörterung der damit aufgeworfenen, tief in die ganze Philosophie und Erkenntnistheorie hineinreichenden Problematik ist freilich hier weder möglich noch beabsichtigt. Auf zusätzliche Facetten des angeschnittenen Fragenkreises werden wir überdies im Lauf unserer Untersuchung immer wieder stoßen.
Als Leitmetapher für unsere erkenntnistheoretische Reflexion benützen wir das Bild vom obligat beschränkten Horizont. Wo immer wir uns befinden, wird unser Blick begrenzt durch Hügel oder Berge, durch die Erdkrümmung, oder auch durch das Auflösungsvermögen unserer Augen selbst. Dies gilt, wie die Astronomen mit dem Begriff des sogenannten Ereignishorizontes klargemacht haben, selbst dann noch, wenn wir unser Gesichtsfeld mit starken Fernrohren oder sonstigen Hilfsmitteln maximal erweitern: Hinter einem kosmischen »Ereignishorizont« verbergen sich alle diejenigen Ereignisse, die aus verschiedensten Gründen der menschlichen Beobachtung für immer entzogen bleiben müssen – also beispielsweise Lichtstrahlen aus sogenannten »schwarzen Löchern« (Himmelskörper von so ungeheuerlicher Dichte und gravitationeller Anziehung, daß selbst das Licht ihnen nicht mehr zu enfliehen vermag) oder Galaxien an der Peripherie des expandierenden Universums, die sich so schnell von uns (und wir von ihnen) wegbewegen, daß ihr Licht uns niemals wird erreichen können (Kanitschneider 1984, S. 390).
Das Bild vom beschränkten Horizont kennzeichnet in trefflicher Weise die Situation, in welcher sich sowohl jeder einzelne wie auch jede Gruppe, ja letztlich die Menschheit als ganze grundsätzlich immerzu befindet: Unser Wissens- und Verstehenshorizont ist unausweichlich begrenzt. Gleichzeitig aber bilden wir mit unserem Bewußtseinsfokus ständig das subjektive Zentrum des Universums und neigen deshalb fortwährend zu der naiven Annahme, das Wahrgenommene sei bereits »die ganze Welt«. Dies gilt gleichermaßen auf der individuellen wie kollektiven Ebene. Erst wenn wir uns in Raum oder Zeit bewegen, werden wir fähig, etwas von der steten Begrenztheit dieses Horizonts zu erfassen. Mit wachsender Klarheit erkennen wir dann, daß wir das, was wir gerade sehen, immer wieder gewaltig überschätzen. Momentweise mag uns sogar bewußt werden, daß wir – wie Dürrenmatt so schön beschreibt – mit unserem mit Wissen vollbepackten Schifflein die ganze Zeit in einem ungeheuren Meer von Nichtwissen herumschwimmen. Piaget stellt den langwierigen Prozeß der sogenannten Dezentration, wie er die Entwicklung von einem zunächst (beim Säugling oder primitiven Menschen) gänzlich egozentrischen zu einem zunehmend allozentrischen Weltbild nennt, in den Mittelpunkt der geistigen Entwicklung nicht nur des Kindes, sondern des Menschen überhaupt. Sowohl auf der individuellen wie kollektiven Ebene ist dieser ständig rückfallgefährdete Prozeß zweifellos noch lange nicht abgeschlossen. Namentlich das Verhalten von Kollektivitäten mag vielfach so aussehen, als hätte er so richtig noch gar nicht begonnen (was natürlich nicht stimmt, denn allein schon die Bildung einer Kollektivstruktur setzt mannigfache Dezentrationen voraus).
Für die Tatsache, daß unser Horizont obligat begrenzt ist, gibt es zahlreiche Gründe, darunter seit langem bekannte sinnesphysiologische, biologische, wissenschaftstheoretische und philosophische – und hinter den alten Argumenten, die für diese schmerzliche Einsicht sprechen, tauchen sozusagen laufend neue auf. Dazu gehören, wie wir sehen werden, auch diejenigen der Affektlogik. Insgesamt führt die zunehmende Dezentration unserer Weltsicht unweigerlich zur Verneinung jedes absoluten Wahrheitsanspruchs, ja wohl überhaupt jeder Möglichkeit zur Erkenntnis irgendeiner ontologischen »Wahrheit an sich«, entsprechend den Positionen sowohl des aktuellen Konstruktivismus wie auch der postmodernen Philosophie.
Bevor wir (in den nachfolgenden Kapiteln) spezifisch affektlogische Aspekte eines solchermaßen begrenzten Horizonts ins Auge fassen, wollen wir uns mit einigen der für uns wichtigsten philosophischen und wissenschaftstheoretischen Grundlagen der These von der unausweichlichen Beschränkung unserer Erkenntnismöglichkeiten vertraut machen. Für die philosophischen Zugänge stütze ich mich hauptsächlich auf GianniVattimos »Das Ende der Moderne« (1990) und WolfgangWelschs »Unsere postmoderne Moderne« (1988), für die wissenschaftstheoretisch-konstruktivistischen Zugänge auf JeanPiaget, Ernst von Glasersfeld, Rupert Riedl und weitere Autoren (Lorenz 1973; Piaget 1974, 1977a, 1977b; Riedl 1979, 1994; Maturana 1982; von Glasersfeld 1991; Fischer et al. 1992; Rusch et al. 1994).
Postmoderne Pluralität in Philosophie und Wissenschaftstheorie
Die »Moderne« kann nach Vattimo und Welsch verstanden werden als die durch die Aufklärung begründete Epoche der ungebrochenen Hoffnung auf einen virtuell grenzenlosen Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis in geradliniger Fortsetzung der Tradition des gesamten abendländischen Denkens seit Plato und Aristoteles. Die aktuelle Post- oder auch Spätmoderne dagegen bezeichnet nach den genannten Autoren weniger eine zeitlich neue Phase der Philosophie als vielmehr eine seit langem im modernen Denken selbst angelegte Haltung der Überwindung (oder, wie Heidegger formuliert, der »Verwindung« oder verändernden Vollendung) der Moderne. Die radikale Besonderheit dieser Postmoderne besteht im schmerzlichen Bewußtsein, daß nach mehr als zweitausend Jahren vergeblicher Suche nach einer zuverlässigen ontologischen Begründung unseres Wissens von der »Realität« oder »Wirklichkeit« heute der Anspruch auf die Erkenntnis von irgendwelchen absoluten Wahrheiten definitiv aufgegeben werden muß. Nichts anderes war schon mit Nietzsches schockierendem Ausspruch »Gott ist tot« gemeint (»Gott« hier verstanden als der absolute Grund, die absolute Wahrheit), und in die gleiche Richtung weisen auch die Schlüsse, zu denen Jahrzehnte vor den zeitgenössischen »Denkern der Postmoderne«* wie Derrida, Lyotard, Rorty zumindest in der Interpretation Vattimos auch schon der in seinen Augen profundeste Philosoph unseres Jahrhunderts, nämlich MartinHeidegger, gelangt ist.
Daß ein Erkennen einer absoluten Wahrheit oder Realität grundsätzlich nicht möglich ist, liegt zunächst und in erster Linie an den unausweichlichen Beschränkungen unserer Sinnes- und Denkorgane. Wir vermögen von der Welt um uns nur wahrzunehmen, was unsere Sinnesorgane – und allfällig noch deren technische Verbesserungen durch Fernrohre, Mikroskope, Wellendetektoren und andere Geräte, die wir indessen wiederum nur mit unseren beschränkten Sinnes- und Denkmöglichkeiten bauen und beurteilen – davon übermitteln. Irgendein Außenkriterium, an dem wir unsere Wahrnehmung und Deutung der Wirklichkeit validieren könnten, gibt es nicht. Zudem ist auch die Faßkraft unseres Denkapparats beschränkt, woran sich durch die Tatsache der enormen Ausweitung unseres Speicher- und Informationsverarbeitungsvermögens durch moderne Computer prinzipiell wenig ändert: Denn erstens sind es wiederum nur Menschen mit begrenzten Fähigkeiten, die Computer bauen und ihnen damit »ihren Geist einhauchen«, und zweitens sind es nur Menschen – und letztlich trotz aller »kollektiven Führung« oder »delegierten Verantwortung« nur je einzelne Menschen –, die die Ergebnisse der Computerarbeit sinnvoll in den Gesamtkontext ihres Denkens und Handelns einzubeziehen haben.
In der Tat plädiert die (post-)moderne Philosophie und Wissenschaftstheorie in hunderterlei Weisen immer wieder für den gleichen Abschied von einer absoluten Wahrheit, respektive (was dasselbe ist) für eine radikale Pluralität der Wahrheit. »Modernes Wissen hatte je die Form der Einheit, und diese Einheit war durch den Rückgriff auf große Meta-Erzählungen zustande gekommen«, schreibt Welsch. »Die gegenwärtige Situation hingegen ist dadurch gekennzeichnet, daß diese Einheitsbande hinfällig geworden sind […]. Totalität wurde als solche obsolet, und so kam es zu einer Freisetzung der Teile« (Welsch 1988, S. 32). Und Vattimo, der dem alten Suchen und Denken einer absoluten »starken Wahrheit« das »schwache Denken« einer pluralistischen »schwachen Wahrheit« entgegensetzt (1983), spricht (mit Nietzsche und Heidegger) von einer »Destruktion der Ontologie«, von einem historisch-temporären und kontextgebundenen (statt »ewigen« und kontextunabhängigen) »ereignishaften Charakter der Wahrheit und Logik«, einem notwendigen, ja (um seiner befreienden Wirkung willen) durchaus positiv zu konnotierenden »Denken des Irrtums« beziehungsweise des Irrens und der Vermischtheit oder Kontamination verschiedener möglicherweise widersprüchlicher Wahrheiten (»In der Tat geht es nicht darum, Irrtümer zu entlarven und aufzulösen, sondern sie als eigentliche Quelle des Reichtums zu sehen, der uns ausmacht und der Welt Interesse, Farbe und Sein verleiht« (Vattimo 1990, S. 185). – Freilich impliziert die Anerkennung einer Pluralität der Wahrheit zugleich die Unausweichlichkeit von Spannung und Konflikt, denn »auf mehreren Hochzeiten zugleich tanzen« bleibt trotz des Willens zu Toleranz sowohl im praktischen Leben wie in Theorie und Wissenschaft, wo Stellungen zu beziehen und Entscheidungen zu fällen sind, schwierig. Unsicherheit und Orientierungslosigkeit machen sich breit. Gibt es also beliebig viele »Wahrheiten« – »anything goes«, nach dem vielzitierten Wort von Feyerabend (1983)? Auf welche von ihnen sollen und können wir abstellen, wenn zuverlässige Kriterien fehlen? Nicht umsonst heißt Lyotards Hauptwerk »Der Widerstreit« (1983). Was dies gerade auch aus der Perspektive einer fraktalen Affektlogik bedeuten mag, wird uns noch nachhaltig zu beschäftigen haben.
Gleichzeitig wird von allen Denkern der Postmoderne (im Gefolge insbesondere von Wittgenstein und Gadamer) die Bedeutung der Sprache beziehungsweise der »Sprachspiele« betont, durch welche jede Erkenntnis notwendig bestimmt sei. »Nicht ist der Mensch Herr der Sprache, sondern die Sprache ist strukturell wie ereignishaft vorgängig, und der Mensch tritt in das von der Sprache eröffnete Spiel nur ein«, sagt Lyotard (1979, 1983, zit. nach Welsch 1988, S. 249). Folgerichtig sind alle Wahrheiten im Grunde rhetorischer Art im Sinn von Gadamer (1976, nach Vattimo 1990, S. 145 ff.). Sogar wissenschaftliche Theorien lassen sich »… nur innerhalb von Paradigmen beweisen, die ihrerseits nicht ›logisch‹ bewiesen, sondern nur aufgrund einer Überredung rhetorischer Art akzeptiert sind – wie auch immer sie sich faktisch etablieren« (Vattimo 1990, S. 99, 148). – Wer den Wissenschaftsbetrieb von innen kennt, wird eine solche auf den ersten Blick vielleicht überraschende Aussage nur bestätigen. In der Tat bedarf es neben »harter Fakten« zur Annahme von neuen Wahrheiten oder Thesen selbst in der Naturwissenschaft »… eines komplexen Systems von Überredungen, von aktiver Teilnahme, von Interpretationen und Antworten« (S. 100), in welchem auch ästhetische, hermeneutische oder rhetorische (und ich würde anfügen: zwischenmenschliche, soziale, politische) Aspekte eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.
Parallel zur Philosophie ist ebenfalls innerhalb der Naturwissenschaft die Idee einer absoluten Wahrheit im Verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts immer brüchiger und schließlich völlig obsolet geworden. Schon mit Einsteins Relativitätstheorie (1905) wurde klar, daß es einen festen Bezugspunkt nicht gibt und selbst Raum und Zeit nicht zum vornherein gegeben sind, sondern von Ereignissen abhängen, das heißt sich verändern können. Und mit der Quantentheorie und der Heisenbergschen Unschärferelation (1927), die die Unmöglichkeit einer gleichzeitigen exakten Bestimmung von Ort und Impuls eines Ereignisses und deren Abhängigkeit vom Meßvorgang selbst nachwiesen, erwies sich die Hoffnung auf eine eindeutige Erfassung der Realität noch radikaler als trügerisch. Goedels Unvollständigkeitstheorem von 1931 zeigte vollends, daß selbst in der Mathematik ein in sich geschlossenes System ohne irgendwelche Vorannahmen nicht denkbar ist. Damit entfällt zugleich die langgesuchte Möglichkeit einer mathematisch begründbaren widerspruchsfreien formalen Logik – »eine Kathedrale stürzte zusammen«, wie Riedl kommentiert (1994, S. 238). Etwa gleichzeitig machte Popper klar, daß wissenschaftliche Hypothesen nur widerlegt, nicht aber positiv bewiesen werden können, so daß auch alle Erkenntnisse der Wissenschaft bloß als vorläufige und bis zu ihrer Falsifizierung durch neue Fakten operational sinnvolle Annahmen innerhalb bestimmter Voraussetzungen und Perspektiven, nicht mehr aber als ein für allemal gesicherte »ewige Wahrheiten« betrachtet werden müssen. Damit postuliert die zur Zeit zweifellos führende wissenschaftliche Erkenntnistheorie zwar die Unmöglichkeit, eine absolute Wahrheit zu erkennen, wohl aber die Möglichkeit der Erkenntnis einer (beinahe) absoluten Unwahrheit. Nicht zu vergessen ist ferner, daß Grundphänomene wie »Materie« oder »Energie«, die sämtlichen Vorgängen in der Natur zugrunde liegen, ungeachtet der relativitätstheoretischen Erkenntnis ihrer tiefen Äquivalenz letztlich undefinierbar, das heißt in ihrem »eigentlichen Wesen« so rätselhaft bleiben wie eh und je (Russel 1972).
Sicher zu Recht bezieht Welsch ebenfalls das in den letzten 20 bis 30 Jahren von Thom, Prigogine, Mandelbrot, Feigenbaum, Haken und anderen Forschern entwickelte revolutionäre Paradigma der Katastrophen- und Chaostheorien, das auch in der vorliegenden Untersuchung eine wichtige Rolle spielen wird, in dieselbe Denkrichtung mit ein. Zentral postulieren diese Theorien eine grundsätzliche Nichtlinearität – und damit Unvorhersehbarkeit – vieler fundamentaler Naturvorgänge. »Deterministisch chaotische«* Schwankungen sind offenbar selbst im vermeintlich »ehernen Lauf der Gestirne« nachweisbar. Bezieht man schließlich auch noch die Thesen von LudwikFleck (1935) und ThomasKuhn (1962) zur zeit- und kontextbedingten Natur aller wissenschaftlichen Erklärungssysteme (der sogenannten Paradigmata nach Kuhn, s. später) in diese Übersicht mit ein (Fleck 1935, 1993; Kuhn 1967), so wird die Relativität einer jeden Erkenntnis noch einmal überdeutlich.
Die Welt als radikales Konstrukt?
Von ganz anderer Warte aus gelangt ebenfalls der zeitgenössische Konstruktivismus zu grundsätzlich gleichlautenden Schlüssen, obwohl Querverweise auf diese sicher nicht zufällige Parallelentwicklung in der oben zitierten Literatur erstaunlicherweise fast völlig fehlen. Er basiert wesentlich auf JeanPiagets genetischer Epistemologie, in welcher gezeigt wird, daß und wie das Kind alle seine geistigen Begriffe »aus der Aktion«, das heißt aus dem handelnden Erleben richtiggehend konstruiert. Analoges gilt, mutatis mutandis, höchstwahrscheinlich für die Menschheit als ganze. Ausgangspunkt sämtlicher kognitiver mentaler Strukturen oder »Schemata« sind demnach zunächst immer wieder senso-motorische Abläufe, die auf der Grundlage angeborener Reflexe vom ersten Lebenstag an stufenweise weiterentwickelt, auf jeweils höherem Niveau neu äquilibriert, operationalisiert und schließlich zu rein mentalen Abläufen verinnerlicht werden*. »Denken ist Probehandeln mit kleinen Energiequanten«, sagte ganz übereinstimmend auch Freud; umgekehrt kann man Handeln gewissermaßen als »Probedenken mit großen Energiequanten« auffassen. Die sprachliche oder anderweitige symbolische Kodierung solcher mentaler Schemata ist, wie Piaget nachwies, nicht etwa Ursache, sondern Folge dieses Prozesses (Sinclair 1976). Eine Schlüsselrolle spielen dabei die komplementären Phänomene der Assimilation und Akkommodation. Unter ersterer ist der Einbau neuer Elemente in bereits bestehende kognitive Strukturen, unter letzterer der Umbau dieser vorbestehenden Strukturen unter Anpassung an die begegnende Realität zu verstehen. Beide gegenläufigen Vorgänge sind untrennbar miteinander verbunden und entsprechen fundamentalen biologischen Prozessen auf rein stofflicher Ebene (zum Beispiel bei der Verdauung). – Piagets hohes Verdienst ist es, als erster die Verankerung von geistigen Strukturen in der Biologie nicht nur in ihrem Prinzip verstanden, sondern auch in zahlreichen Einzelaspekten minutiös nachgewiesen zu haben. Jede biologische Tätigkeit hat nach Piaget insofern kenntnisgewinnenden Charakter, als sie bestimmten Bedingungen der Umwelt Rechnung trägt. Gleichzeitig stellt sie eine typische Konstruktion entsprechend den eigenen Gesetzmäßigkeiten des Organismus dar. Seiler nennt dies in seiner Diskussion des Piagetschen Konstruktivismus treffend den »Erkenntnischarakter der Strukturen« (Piaget 1969, 1974, 1977b; vgl. auch Seiler 1994, S. 74 ff.), denn schon im reinen Handeln ist ein intuitives Vorstellungswissen enthalten. Bei der Konstruktion von kognitiven Strukturen im Sinn von Piaget handelt es sich also keineswegs um einen notwendigerweise bewußten oder gar gewollten Prozeß, sondern um ein typisch selbstorganisatorisches Phänomen.
Neben dem Konstruktivismus Piagetscher Prägung gibt es noch eine ganze Reihe von – teilweise davon abgeleiteteten und teilweise unabhängigen – Varianten, darunter namentlich den ebenfalls biologisch begründeten evolutionären Konstruktivismus von Konrad Lorenz und Rupert Riedl (Lorenz 1973; Riedl et al. 1980, 1994). Letzterer hat eine differenzierte »Systemtheorie der Evolution« und »Evolutionäre Erkenntnistheorie« entwickelt, in welcher der stufenweise Erwerb von Wissen über eine (zwar nie »an sich« erkennbare, aber doch durchaus vorhandene) äußere Realität als evolutionärer Selektionsprozeß vom niederen Tier bis zum Menschen verstanden wird, der unter dem Einfluß von evolutionsbegünstigenden wie -beschränkenden Faktoren (Dispositionen und Prädispositionen, »Bürden« und »Constraints«) steht. Aus der gleichen Perpektive analysiert Riedl auch die Entwicklung des ganzen abendländischen philosophischen und wissenschaftlichen Denkens und identifiziert darin zwei große Stränge, die beide bis zu den Vorsokratikern (Parmenides, Zenon, Heraklit) zurückreichen: Der eine, aristotelische, beginnt bei den ionischen Naturphilosophen und führt zum modernen wissenschaftlichen Empirismus und Positivismus. Die dominierende, vor allem auf die Sinne vertrauende Denkmethode ist hier die Induktion. Der andere, platonische, mißtraut dagegen den Sinnen zugunsten von sprachlicher Logik und Deduktion. Er geht von den Pythagoräern aus und führt bis zum neuzeitlichen Idealismus, zum Rationalismus, zur formalen wie mathematischen Logik, und letztlich auch zum zeitgenössischen Konstruktivismus. Ersterer stütze sich auf den Selektionsvorteil einer möglichst guten Übereinstimmung (»Korrespondenz«) mit einer »außersubjektiven Wirklichkeit«, letzterer dagegen auf den Selektionsvorteil einer möglichst kohärenten und eindeutigen Kommunikation. Als Nachteil (»Bürde«) handelt sich die induktive Methode nach Riedl die Abhängigkeit von angeborenen Formen der sinnlichen Anschauung ein, während die deduktive Methode durch allgegenwärtige sprachliche Grundstrukturen – die sogenannten Universalien – limitiert wird. Unter letzteren ist insbesondere die unausweichlich lineare Grundstruktur der Sprache sowie die Unterscheidung zwischen Verb und Substantiv hervorzuheben. Die Linearität der Sprache zwingt zu einer in der Zeit gestaffelten Darstellung von eigentlich als gestalthaft-simultanes Ganzes erlebten (oder »gesehenen«) Zusammenhängen – eine grundsätzliche Schwierigkeit, die sich nicht zuletzt beim Schreiben eines Buches wie dem vorliegenden noch und noch bemerkbar macht. Ähnlich führt ebenfalls die zumindest im Okzident praktisch durchgängige Verwendung einer Copula (»ist« beziehungsweise »sein«) zu einer versachlichenden und ontologisierenden Verzerrung der erlebten Wirklichkeit mit Tendenz zur Überbetonung von definitorischen Unterschieden und Grenzen auf Kosten von Übergängen. Des weiteren sind evolutionär tief verankerte Denkautomatismen identifiziert worden, die die evolutionären Erkenntnistheoretiker als »angeborene Lehrmeister« bezeichnen (Piaget 1973c; Lorenz 1973; Riedlet al. 1980; Kihlstrom 1987). Darunter sind automatisierte Vorannahmen über Wahrscheinlichkeits- und Kausalbeziehungen zwischen ähnlichen, kurz nacheinander oder miteinander auftretenden Ereignissen (beispielsweise Blitz und Donner) zu verstehen, die häufig (aber nicht immer) zutreffen und deshalb im Lauf der Evolution als überlebensgünstig selektioniert wurden. All dies hat weitreichende Folgen für die Art und Weise, wie wir gewohnheitsmäßig die Welt wahrnehmen und konstruieren.
»Keiner der beiden Zugänge wird darum entbehrlich. Jeder für sich aber wird in die Irre führen; zunächst in einen Irrglauben, dann in einen Konflikt mit der Welt«, schließt Riedl seine Überlegungen über die Vor- und Nachteile von Deduktion und Induktion (Riedl 1994, S. 274). Er diagnostiziert dabei eine gefährliche »deduktive Schlagseite unserer Zivilisation« und leistet so auch einen Beitrag zum sogenannten kulturhistorischen Konstruktivismus, der auf dem gestaltpsychologischen Ansatz von Kurt Levin aufbaut und die hochgradige soziale Bedingtheit jeder Auffassung von Wirklichkeit aufzeigt. Gergen und andere soziale Konstruktivisten (oder vielmehr »Konstruktionisten«, wie sie sich zu nennen vorziehen; Gergen 1985, 1991, vgl. Portele 1994, S. 127 f.) bezeichnen die Begriffe, in denen wir die Wirklichkeit verstehen, geradezu als soziale Artefakte. Das Wirklichkeitsverständnis sei nicht in erster Linie von der empirischen Gültigkeit von Begriffssystemen, sondern von sozialen Austauschprozessen (wiederum mit Einschluß insbesondere der Sprache) und deren historischen Wandel abhängig.
Eine ähnliche Wichtigkeit räumt dem »Linguieren« und »Konversieren«, wie das hier genannt wird, der ebenfalls biologisch begründete Konstruktivismus von Humberto Maturana und Francisco Varela ein. »Nichts existiert außerhalb der Sprache«, behauptet Maturana geradezu (1988, S. 80). Diese beiden Autoren, die – als meines Wissens einzige Konstruktivisten – auch die grundlegende Bedeutung von Emotionen (»des Emotionierens«) für alles Denken erkannt haben und uns schon aus diesem Grund noch wiederholt beschäftigen werden, entwickeln seit den siebziger Jahren mit großer Folgerichtigkeit eine streng konstruktivistische Theorie der kognitiven Entwicklung, in deren Zentrum die Konzepte der Autopoiese und strukturellen Koppelung oder Ko-Ontogenese zwischen in sich operational geschlossenen, aber interagierenden Systemen stehen* »Was in einem lebenden System vor sich geht, entspricht dem Geschehen bei einem Instrumentenflug, bei dem der Pilot keinen Zugang zur Außenwelt hat und lediglich als Regulator der durch seine Fluginstrumente angezeigten Werte fungieren darf«, schreibt Maturana (1982, S. 74). Jede biologische Tätigkeit impliziere zwar einen Erwerb von Wissen über die Welt, aber dieser sei in erster Linie »strukturdeterminiert«, das heißt durch die vorbestehende Struktur und Organisation des betreffenden Organismus selbst bestimmt. Als Struktur werden »… die Bestandteile und Relationen, die in konkreter Weise eine bestimmte Einheit konstituieren und ihre Organisation verwirklichen«, als Organisation dagegen die Relationen zwischen den Bestandteilen eines Systems definiert, die es als Mitglied einer bestimmten Klasse kennzeichnen. Unter Autopoiese schließlich ist die Tatsache zu verstehen, daß Lebewesen in der Anpassung an das umgebende Milieu zwar andauernd ihre Struktur verändern, gleichzeitig aber ihre Organisation aufrechterhalten. Deren Zusammenbruch wäre gleichbedeutend mit dem Tod. Zwischen interagierenden und damit koevolutionierenden Systemen – also etwa zwischen einem Lebewesen und seiner Umwelt – komme es in einem begrenzten Interaktionsbereich zu wechselseitigen Strukturveränderungen, die »strukturelle Koppelung« heißen (S. 244). – Erkenntnistheoretisch besonders wichtig ist nach den beiden Autoren dabei die klare Unterscheidung von verschiedenartigen Phänomenbereichen, darunter namentlich auch des Bereichs des Beobachters selbst, der allein nach ebenfalls in erster Linie durch seine eigene Struktur und Sprache determinierten Gesetzen zwischen verschiedenen Systemen, ihren Interaktionen, strukturellen Koppelungen und so weiter unterscheidet.
Auch so gesehen wird jede »unvoreingenommene« Wahrnehmung einer »Realität an sich« prinzipiell unmöglich. Wie das nachfolgende Zitat von Varela sehr klar zeigt, interveniert die »Eigenstruktur« des Beobachters bereits beim Setzen von elementaren Unterscheidungen – ein Umstand, der, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, über unsere operationalen Definitionen von Kognition und Logik auch im Rahmen der Affektlogik eine grundlegende Rolle spielt.
»Der Ausgangspunkt […] ist das Setzen einer Unterscheidung. Mit diesem Urakt der Trennung scheiden wir Erscheinungformen voneinander, die wir dann für die Welt selbst halten. Davon ausgehend bestehen wir dann auf dem Primat der Rolle des Beobachters, der seine Unterscheidungen an beliebiger Stelle macht […]. Sie beziehen sich viel mehr auf den Standpunkt des Beobachters als auf die wahre Beschaffenheit der Welt, die infolge der Trennung von Beobachter und Beobachtetem immer unerfaßbar bleibt« (Varela 1979 [nach Seiler 1994, S. 79 ff.]).
Ernst von Glasersfeld, Heinz von Foerster, Paul Watzlawick und andere haben solche Überlegungen konsequent zu einem »radikalen Konstruktivismus« ausgebaut, der jede Möglichkeit von Realitätserkenntnis grundsätzlich leugnet (v. Foerster 1985; v. Glasersfeld 1985, 1991, 1994; Watzlawick 1981, 1991). Hauptanliegen des radikalen Konstruktivismus ist das Begreifen der Interdependenz zwischen Beobachter und beobachteter Welt. Strenggenommen existiert die Wirklichkeit für die radikalen Konstruktivisten einzig in unserem Gehirn, respektive in unseren konstruierten Begriffen. Überlegungen, wie weit zwischen diesen Konstrukten und der effektiven Realität allenfalls irgendwelche Beziehungen bestehen könnten, werden – etwa unter Hinweis auf Wittgensteins »Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen« – vermieden oder mit Verdacht belegt. VonGlasersfeld bekämpft, ganz ähnlich wie Maturana und Varela, in erster Linie jede Idee von irgendwelchen »Repräsentanzen« der Wirklichkeit im Gehirn; er möchte auch Piagets häufigen Gebrauch dieses Ausdrucks umdeuten in »Re-präsentanzen«, das heißt bloße Vergegenwärtigungen von Konstrukten aus dem Gedächtnis. Sogar für den zentralen Piagetschen Begriff der Kognition als assimilatorisch-akkommodatorischen Adaptationsprozeß verneint vonGlasersfeld (1994, S. 29) vehement jede Übereinstimmung der konstruierten Begriffe mit »an sich« in einer Außenwelt existierenden Objekten. Er zieht den Begriff der »Viabilität« oder des »Passens« demjenigen der »Anpassung« oder »Adaptation« an eine äußere Wirklichkeit vor und sieht darin nur eine interne »Verbesserung des organismischen Gleichgewichts relativ zu den erfahrenen Beschränkungen«. – Einen ebenfalls sehr radikalen Ausdruck findet eine solche Position bei dem Physiker Olaf Diettrich (1991, 1996), der unter Rekurs auf die evolutionäre Erkenntnistheorie vorschlägt, den einzig durch die operationalisierten Meßinstrumente definierten Realitätsbegriff der Physik auf den gesamten kognitiven Erkenntnisbereich zu übertragen. Den Meßinstrumenten der Physik würden dabei die »kognitiven Operatoren« (das heißt, der ganze Sinnesapparat oder »ratiomorphe Apparat« im Sinn von KonradLorenz) entsprechen, und sämtliche Beobachtungen, auf die wir die Naturbeschreibung stützen, wären einzig als Invarianzen von solchen Operatoren zu verstehen. Da validierende Außenkriterien wie gesagt fehlen, fällt folgerichtigerweise auch für Diettrich jede Möglichkeit der Erfassung einer »an sich« bestehenden Außenwelt dahin.
Ebenso folgerichtig muß freilich ebenfalls der radikale Konstruktivismus selbst bloß als ein Konstrukt verstanden werden, das keiner »ontologischen Wahrheit« entspricht. Maturana und Varela geben dies auch ohne weiteres zu, wenn sie gestehen, daß sie – ganz im Sinn der oben erwähnten Rhetorik – ihre Leser oder Hörer zur Annahme ihrer Konzepte nur »überreden« oder »verführen« wollen, ohne deren absolute Gültigkeit zu behaupten.
Radikaler versus relativer Konstruktivismus
Einer solchen Verführung braucht man indessen allein schon aus Gründen, die vom Konstrukt des radikalen Konstruktivismus selbst nahegelegt werden, nicht unbedingt zu erliegen. An der operationalen Nützlichkeit oder Viabilität eines Konstrukts, das mit der Leugnung jeglichen Realitätsgehalts unserer Welterfahrung auch alle Schranken zur vollen Beliebigkeit beseitigt und zugleich, statt Verflechtungen nach allen Seiten aufzuzeigen, das menschliche Fühlen und Denken aus dem Ganzen des Naturgeschehens radikal herauslöst, kann man nämlich zweifeln. Mindestens ebenso sinnvoll für das kollektive Überleben erscheint jedenfalls die Annahme, daß wir mitsamt all unseren Theorien Teil eines ungeheuren Wirkgefüges – eben der angenommenen »ontischen Realität« – sind, für welche unsere mentalen Produkte, genauso wie unser Körper und unsere Existenz überhaupt, in einer allerdings von uns selber nie klar erfaßbaren Weise signifikant sind.
Ein solcher nur »relativer Konstruktivismus«, wie ich diese meines Erachtens nötige Einschränkung eines allzu radikalen Konstruktivismus nennen möchte, anerkennt zwar voll, daß unsere Welterklärungen durch unsere eigenen Bedürfnisse und Strukturen determinierte Konstrukte sind, die sich an keinerlei externer »Realität an sich« validieren lassen. Zugleich aber hält er an der Hypothese fest, daß es eine solche Realität tatsächlich gibt, und daß gerade auch die genannten Bedürfnisse und Strukturen mitsamt den dadurch hervorgebrachten Welterklärungen nichts als ein Teil dieser Realität sind, die sie also sowohl enthalten wie auch (anhand von informationsverarbeitenden Strukturen, wie zu zeigen sein wird) ein Stück weit laufend verdichten (und gleichzeitig sicher auch verzerren). Von »Wissen« in einem strengen Wortsinn kann dabei freilich nicht die Rede sein.
Zu den Gründen, die für einen solchen bloß relativen statt radikalen Konstruktivismus sprechen, zählt zunächst der Umstand, daß letzterer wesentlich eine (Über-)Reaktion auf einen ebenso radikalen wissenschaftlichen Positivismus und reduktionistischen Realismus darstellt, der, obwohl unbestreitbar in manchen Bereichen der Naturwissenschaft weiterhin grassierend, doch wissenschafts- und erkenntnistheoretisch in Wirklichkeit längst überholt ist. Anstelle eines naiven Realismus (es gibt eine reale Welt, und diese ist so, wie wir sie wahrnehmen) oder auch kritischen Realismus (es gibt eine reale Welt, aber sie ist nicht in allen Zügen so beschaffen, wie sie uns erscheint) dominiert heute wissenschaftstheoretisch entweder der »streng kritische Realismus« (es gibt eine reale Welt, aber keine ihrer Strukturen ist so, wie sie uns erscheint) oder aber der »hypothetische Realismus« im Sinne von Campbell (wir nehmen an, daß es eine reale Welt gibt und daß deren Strukturen teilweise erkennbar sind, aber alle unsere diesbezüglichen Aussagen haben hypothetischen Charakter; Campbell 1974, 1984; Vollmer 1980; Riedl 1994). Beide letzteren Positionen, auf denen wesentlich auch die evolutionären Erkenntnistheorien von Konrad Lorenz und Rupert Riedl fußen, werden meines Wissens von den radikalen Konstruktivisten nicht vertieft reflektiert.
Auch Jean Piaget war, allen gegenteiligen Interpretationen zum Trotz, höchstwahrscheinlich kein so radikaler Konstruktivist, wie ihn die Vertreter dieser Auffassung gerne hinstellen möchten, unter anderem indem sie in seinen Konzepten einseitig bloß assimilatorische, das heißt durch die eigene Struktur bedingte Mechanismen in der »Konstruktion der Realität« betonen, akkommodatorische, das heißt fremdbestimmte Mechanismen dagegen vernachlässigen. Zu diesem Schluß gelangen jedenfalls praktisch alle Autoren außer von Glasersfeld selber, die sich in einem kürzlich erschienenen Sammelband zum Thema »Piaget und der radikale Konstruktivismus« geäußert haben (Rusch et al. 1994). Daß Piaget zutiefst Konstruktivist sei, bestreitet niemand. Zugleich sei er mit seiner gleichgewichtigen Mitberücksichtigung einer akkommodatorischen Anpassung und Einpassung an die begegnende Wirklichkeit aber auch Adaptionist. Nach Seiler geht Piaget »… sogar so weit, die Erkenntnisentwicklung als ein Streben nach, vielleicht sogar einen Marsch hin zu Objektivität und Wahrheit zu konzipieren. Menschliches Erkennen erreicht zwar dieses Ziel nie oder nie ganz, aber es nähert sich ihm konstant an« (Seiler 1994, S. 84).
Ob eine solche extensive Interpretation tatsächlich berechtigt ist, bleibe dahingestellt. Fest steht indessen, daß sich nach Piaget alles Denken von einem anfänglichen egozentrischen Übergewicht von assimilatorischen über zunehmend auch akkommodatorische Mechanismen zu einem Gleichgewicht mit seiner Umwelt hin entwickelt, das gleichbedeutend ist mit einer wachsenden Fähigkeit zum Absehen vom eigenen Standpunkt, das heißt zur früher schon genannten Dezentration. Dieses Gleichgewicht ist indessen massiv gestört, wenn der radikale Konstruktivismus die ganzen erdrückend wahrscheinlichen Befunde der empirischen Wissenschaften kurzerhand »ausklammern« (wie Maturana sagt) will, die für einen seit Milliarden von Jahren vor (und jedenfalls auch nach) dem Menschen ganz unabhängig von ihm evoluierenden Kosmos sprechen und dadurch Entscheidendes zu ebendieser Dezentration beitragen. Ähnlich ungleichgewichtig müßten dem radikalen Konstruktivisten frühere Weltentwürfe bloß als wirre Folge von Hirngespinsten erscheinen, während ein relativer Konstruktivismus es zwanglos erlaubt, »Wahrheitstheorien« aller Art, von tastend erarbeiteten frühen animistischen Welterklärungen über komplexe religiöse Systeme bis zu den Theorien der modernen Wissenschaft als in bestimmtem Kontext eine Zeitlang viable »Lösungen« innerhalb einer evoluierenden Gesamtsituation zu verstehen, die alle einen gewissen Realitätsgehalt besitzen.
Ähnlich ist auch für KonradLorenz die Evolution bereits auf der rein organismischen Ebene immer schon ein kenntnisgewinnender, weil Informationen über die umgebende Wirklichkeit zunehmend differenziert verwertender und verarbeitender Prozeß. Alle biologischen »Lösungen«, die dieser Wirklichkeit nicht hinreichend Rechnung tragen, werden mit der Zeit unbarmherzig ausgemerzt. Es ist leicht einzusehen, daß analog auch auf dem Niveau der evoluierenden kognitiven Konstrukte Welterklärungen, die einer »externen Realität« kraß widersprechen, von einem bestimmten Punkt an nicht mehr gangbar, sondern tödlich sind. Einfach beliebig können operante Denksysteme deshalb nicht sein. So würde etwa jede (wörtlich gemeinte) Theorie, wonach der Mensch imstande wäre zu fliegen, zum sofortigen Tod all seiner Adepten führen. Alles, was viabel ist, hat sich der »Natur der Dinge« notgedrungen ein Stück weit angepaßt und spiegelt sie deshalb auch in irgendeiner Weise wider. Allein schon durch die Eliminierung von gravierend überlebenswidrigen Ideen durch den evolutionären Selektionsprozeß aber enthalten die »überlebenden« Theorien, so abstrus sie sonst auch sein mögen, obligat ein »Körnchen Wahrheit«. Im selben gleichsam negativen Sinn in erster Linie, und viel weniger in ihren positiven Aussagen, besteht nach Popper ebenfalls in der Wissenschaft der Wahrheitsgehalt von immer bloß vorläufigen operationalen Hypothesen.
Ein weiteres Argument, das gegen einen allzu radikalen Konstruktivismus spricht, ist die Tatsache, daß die Vernachlässigung von externen Einflüssen und Zwängen (constraints) auf das Denken geradewegs zu einer neuen Art von ego- oder anthropozentrischer Überschätzung der Eigenständigkeit des menschlichen Denkens, das heißt von Solipsismus zu führen droht, dessen Folgen auf die Dauer verheerend sein könnten. Denn im Ernst anzunehmen, es gebe eine »außersubjektive Realität« nur »in unserem Kopf«, läuft ja auch darauf hinaus, den Menschen und seinen Geist noch mehr, als dies ohnehin der Fall ist, illusionistisch abzukoppeln von einem ungeheuren Geschehen außerhalb und über und lange vor und nach uns, dem wir – sofern jedenfalls Viabilität, das heißt Nützlichkeit für unsere ureigensten Bedürfnisse tatsächlich zum obersten Kriterium erhoben werden soll – vielmehr wohl unsere Konstrukte mit Vorteil so gut wie irgendmöglich akkommodieren sollten, anstatt die ganze Natur gewaltsam unseren eigenen Bedürfnissen assimilieren zu wollen. Wohin uns die Vernachlässigung von naturgegebenen Grenzen und Zwängen möglicherweise einmal bringen könnte, zeigt sich unter anderem daran, daß bereits die Möglichkeit in Sicht kommt, daß wir uns eines Tages selbst ausrotten könnten, wenn wir unser Denken und Handeln einer übergeordneten »Natur der Dinge« nicht rechtzeitig und tief genug anpassen.
Streng logisch ist dank dem Kardinalargument vom fehlenden Außenkriterium zur Validation unseres Erkennens freilich die Position des radikalen Konstruktivismus zweifellos unangreifbar. Indes kann man die radikalkonstruktivistische Theorie auch für ein flagrantes Beispiel jener einseitigen Überschätzung von sprachlich-logischen Deduktionen zuungunsten einer induktiven Hypothesenbildung halten, die RupertRiedl als »deduktive Schlagseite des abendländischen Denkens« bezeichnet hat. Im gleichen Sinn erscheint ebenfalls der Diettrichsche Vorschlag, unser gesamtes Realitätsverständnis nach dem Muster der Physik zu operationalisieren und damit auf jeden externen Realitätsbegriff zu verzichten, trotz seiner logischen Stringenz als unzulässige Ausweitung einer physikalisch nützlichen Methode auf unser gesamtes Weltverständnis. Dies mag zwar in der Physik, nicht zwingend aber auch überall sonst sinnvoll sein. Ohnehin läßt sich eine rein physikalistische Operationalisierung der Biologie und Psychologie nicht konsequent durchführen, da sie einmal mehr einen fundamentalen Widerspruch, der allen solchen naturwissenschaftlichen Übergriffen fast immer unbemerkt innewohnt, geflissentlich übersieht: Die »streng objektivierende« Naturwissenschaft tätigt ja sämtliche ihre Entdeckungen und methodenkritischen Überlegungen selbst immerzu einzig und allein mit jenem von affektiven Einflüssen nie freien Instrument – nämlich der Psyche –, deren Existenz und Validität sie, weil ungenügend operationalisierbar, zugleich mit Verdacht belegt oder leugnet.
Nicht so entgegen der Saga allerdings Descartes, der Erzvater des modernen naturwissenschaftlichen Rationalismus, der ja, was oft übersehen wird, sein ganzes nach Objektivität strebendes Gedankengebäude mit seinem berühmten »cogito, ergo sum« – »ich denke, also bin ich« – ausdrücklich gerade auf eine Art von Subjektivität gegründet hat. Zudem sonderte er, wenn man neueren Untersuchungen Glauben schenken darf, affektive Faktoren keineswegs so scharf von kognitiven, wie man das immerzu von ihm behauptet. »Descartes, der dem spezifisch Emotionalen der Rationalität sehr wohl Rechnung getragen hat, ist nie der Buchhalter eines gereinigten Denkens effektiver Zweckmäßigkeit gewesen. Vielleicht kann sich das am ehesten verdeutlichen, wer Descartes’ – zweitletzte – Schrift, die »Passions de l’âme« konsideriert. Dort jedenfalls zeigt sich der »Begründer der neuzeitlichen Rationalität« […] als Vertreter einer ganz spezifischen Rationalität, welche die Nähe zur Affektlehre sucht«, ist etwa bei J. P. Jauch zu lesen (1996). In einer modernen Version hätte Descartes also sein grundlegendes »Ich denke, also bin ich« möglicherweise explizit in »Ich denke und fühle, also bin ich« umformuliert. In jedem Fall aber bleibt sein subjektivistisches »cogito«, richtig bedacht, als Ausgangspunkt allen weiteren Fragens und Nachdenkens über das Realitätsproblem auch im Zusammenhang mit der Frage »Radikaler versus relativer Konstruktivismus?« unverzichtbar. Denn ohne eine solche existentielle Grundlegung müßte die formallogisch durchaus richtige Behauptung der Radikalkonstruktivisten, es gebe nichts Beweisbares außerhalb der »Realität in unserem Kopf«, letztlich ja auf die Absurdität hinauslaufen, es gebe auch diesen Kopf, beziehungsweise uns selbst, »in Wirklichkeit« gar nicht.
Der Mensch als »Sensor der Wirklichkeit«
Die Realität ist, so gesehen, nicht mehr eine statische »Sache« oder gar »Sachheit« (wie man wörtlich eigentlich übersetzen müßte), sondern die Summe alles Wirkenden. – Was ist damit gewonnen? Ein wesentlich dynamischerer und wohl auch plausiblerer Begriff des Gemeinten, denn kein Mensch wird vermutlich abstreiten wollen, daß wir andauernd einer unübersehbaren Fülle von Wirkungen ausgesetzt sind. Was und wie wir sind, ist durch diese Wirkungen bestimmt und stellt (wie alles, was ist) hierfür zugleich ein signifikantes Zeichen dar. Des weiteren wird klar, daß wir von all diesen Wirkungen immer nur einen beschränkten – nämlich einerseits den uns physiologisch überhaupt zugänglichen und andererseits den gerade jetzt für uns als relevant beachteten – Ausschnitt wahrzunehmen vermögen. An dieser (komplexitätsreduzierenden) »Selektion des Relevanten« aber sind, so werden wir sehen, immer auch Affekte maßgeblich beteiligt. Denn was für uns Realität ist oder wird, hängt (auch) von unserer affektiven Stimmung ab. Gleichzeitig wandeln wir uns selbst in der Perspektive, die ein solcher Wirklichkeitsbegriff eröffnet, vom unbeteiligten Außenstehenden zum Mitwirkenden – zum Mitspieler, sozusagen – in einem unübersehbar weitverzweigten Wirkgefüge, das wir mit unserem eigenen Handeln und Denken (wenn auch vielleicht bloß in minimalstem Ausmaß) mitbeinflussen.
Mit berücksichtigt ist in einem solchen Realitätsbegriff ferner, daß – denken wir nur an das bekannte Phänomen der sich selbst erfüllenden Prophezeiung – auch unsere Weltbilder und Vorstellungen ihrerseits einer »Wirklichkeit« im genannten Sinn entsprechen: Sie entfalten Wirkungen, die keineswegs bloß die »weiche Realität« des psychischkognitiven oder sozialen Bereichs betreffen müssen, sondern unter Umständen – wie etwa die Wirkungen unseres aktuellen Welt- und Naturverständnisses bis hin zu einer möglichen »hausgemachten« Klimaveränderung drastisch zeigen – durchaus auch die »harte Realität« unserer materiellen Umwelt massiv zu verändern imstande sind. Wirklichkeit im selben Sinn ist somit ebenfalls das gemäß unseren Plänen oder Vor-Stellungen künftig zu Erwartende und bereits Vorauswirkende, wie auch das aus der Vergangenheit weiter Nachwirkende, für das wir dank unserem hochdifferenzierten Sensorium sensibel sind.
In einem in diesem Sinn dynamisierten und gleichsam handgreiflich gemachten (weil dem subjektiven Erleben, Erleiden, »Begreifen« und »Behandeln« viel näheren) Begriff der Wirklichkeit klingt deshalb immer zugleich auch das Motiv der Verantwortung für unsere Wirklichkeitskonstrukte mit an, mit dem wir uns indes erst gegen Schluß des Buches des näheren beschäftigen wollen. Halten wir zusammenfassend vorderhand lediglich fest, daß wir im weiteren Verlauf unserer Untersuchung von einem Realitäts- und Menschenverständnis ausgehen, in welchem der Mensch mit all seinen Konstrukten sowohl als Produkt und signifikanter »Sensor der Wirklichkeit« wie auch als aktiver (Mit-)Gestalter und Bewirker dieser Wirklichkeit selber erscheint. Damit aber sind, weil sowohl Wirkungspotential wie Sensibilität eines derartigen Sensors naturgemäß den vielfältigsten Beschränkungen unterliegen, neben Möglichkeiten der Erkenntnis im Sinn eines relativen Konstruktivismus, nach allen Seiten hin erneut auch unüberschreitbare Grenzen in all unserem Verstehen aufgezeigt.
Persönliche Horizontbeschränkungen
Zu diesen Grenzen gehören ebenfalls alle Horizontbeschränkungen, die man als »persönliche« bezeichnen kann, obwohl auch sie prinzipiell unausweichlich sind. Trotz ihrer Allgegenwart werden sie meines Wissens weder von konstruktivistischen noch von anderen Erkenntnistheorien gebührend reflektiert, sei es, weil sie zum vornherein als selbstverständlich gelten, sei es, weil die Beschäftigung mit ihnen besonders unangenehm ist. Um die Ausgangsbasis einer interdisziplinären Untersuchung wie der vorliegenden genauer zu bestimmen, ist es aber unumgänglich, sich auch hierüber einige Gedanken zu machen.
Alles, was ich wahrnehme und denke, ist unweigerlich von meiner Herkunft, meinem persönlichen wie beruflichen Werdegang und, allgemeiner gesagt, von der Summe meiner Erfahrungen geprägt und limitiert. Ebenso beschränkt sind meine persönliche Wahrnehmungsund Aufnahmefähigkeit, mein Gedächtnis und meine intellektuellen Fähigkeiten überhaupt. Weitere Grenzen sind mir von meinem Charakter, meinen Energien, meinem Alter und meiner gesamten persönlichen Situation gesetzt. Auch der Moment, in dem ich gerade zu leben das Privileg habe, ist eine unüberwindbare Grenze: Schon morgen wird das, was heute gilt, zum größeren Teil überholt sein. Solchen Schranken entgeht, ganz gleich ob sie im einzelnen weiter oder enger gezogen sein mögen, grundsätzlich niemand. Ein wesentlicher Aspekt dieser Sachlage ist die Tatsache, daß heute selbst der trefflichste Gelehrte nicht mehr imstande ist, auch nur sein engstes Spezialgebiet einigermaßen erschöpfend zu beherrschen – geschweige denn interdisziplinär fundiert zuständig zu sein. Im Gegenteil: Je besser er eine umschriebene Fragestellung kennt, desto bewußter werden ihm neben den generellen auch die persönlichen Beschränkungen, die selbst da noch seinen Verstehenshorizont einengen.
So ist es beispielsweise sogar in einem für den Außenstehenden so marginalen Problembereich innerhalb einer ohnehin eher randständigen Wissenschaft, wie es die Psychiatrie und darin das Schizophrenieproblem – meine persönlichen Spezialgebiete seit über 30 Jahren – sind, völlig unmöglich geworden, auch nur einen Bruchteil der jährlich hierzu veröffentlichten neuen Forschungsresultate zur Kenntnis zu nehmen. Denn Jahr über Jahr erscheinen darüber Hunderte von Büchern und Zehntausende von Zeitschriftenartikeln. Kennt man dieses scheinbar periphere Problemfeld von innen, so scheinen sich in ihm überdies nicht nur alle anderen psychologischen Probleme zu einem zentralen pluridisziplinären Fragenkomplex erster Güte – der Frage nämlich nach der psycho-sozio-biologischen Funktionsweise unserer Psyche überhaupt – zu verdichten, sondern diese »marginale Frage« fächert sich ihrerseits weiter auf in eine unübersehbare Fülle von neuroanatomischen und neurophysiologischen, psychopathologischen, psycho- und soziodynamischen, epidemiologischen, ökonomischen, ethnokulturellen, psychiatriehistorischen (usw.) Spezialproblemen, die sich ihrerseits wieder in zahllose Einzelfragen mit komplexen Querbeziehungen zu unbestimmt vielen anderen solchen Einzelfragen weiter differenzieren. Darüber hinaus gibt es – nicht nur in der Psychiatrie und Schizophrenielehre, aber hier vielleicht besonders ausgeprägt – eine Vielzahl von unterschiedlichen ideologischen Schulen und Perspektiven (beispielsweise die biologische, klinisch-phänomenologische, behavioristische, psychoanalytische, familien- und soziodynamische, system- und chaostheoretische), unter denen die gleichen Einzelbefunde in immer wieder anderem Licht und Zusammenhang erscheinen. Gerade diese sehr unterschiedlichen möglichen Beleuchtungen enthüllen zudem mit erschreckender Deutlichkeit, wie sehr die persönlich gewählte Sichtweise von den oben erwähnten Umständen und Begrenzungen abhängt. Versucht man gar, alle bisher nur auf abstrakter Ebene beschriebenen Zugangsmöglichkeiten auf eine konkrete Sonderfrage – etwa einen einzelnen kranken Menschen oder einen einzelnen Untersuchungsbefund – anzuwenden, so potenziert sich die erwähnte Problematik zusätzlich durch die Tatsache, daß solche allgemeine Erkenntnisse immer wieder der Spezifikation je nach individuellem Kontext bedürfen. Je tiefer man in irgendein psychisches Sonderproblem eindringt, desto mehr wird somit die Brüchigkeit dessen offenbar, was darüber mit angeblicher Sicherheit gewußt und ausgesagt werden kann.
Nun mag man freilich einwenden, eine solche Sachlage sei vielleicht für die ungenauen »Wissenschaften von der Seele«, keinesfalls aber für die exakten Naturwissenschaften typisch. Allein, von nahe besehen scheint ebenfalls in der Molekularbiologie, der Chemie, ja der Physik und Mathematik die Problemlage grundsätzlich wenig anders zu sein, wie uns die nachdenklicheren unter den Vertretern dieser Sparten versichern. Zum mindesten gilt auch dort, daß längst kein Mensch mehr in der Lage ist, die in jedem kleinsten Untergebiet exponentiell wachsende Informationsflut wirklich zu bewältigen. Weil das affektiv-kognitive Fassungsvermögen des einzelnen, der mit dieser Information sinn- und kontextgerecht umgehen sollte, so beschränkt bleibt wie eh und je, vermag, wie schon einmal vermerkt, auch die enorme Vergrößerung der Speicher- und Verarbeitungskapazität durch immer leistungsfähigere Computer keine Abhilfe zu bringen. Außerdem erzeugt gerade die moderne elektronische Datenverarbeitung selbst infolge der ungeheuren Beschleunigung der Produktion und Verbreitung von Information, die sie kennzeichnet, eine ständig wachsende Datenmenge. Aber nicht nur der einzelne, sondern auch eine Gruppe ist prinzipiell überfordert, denn die Kollektivisierung der Denkabläufe bringt ihrerseits neue und – wie schon weiter oben im Zusammenhang mit der »Pluralität der Wahrheit« und den daraus unausweichlich sich ergebenden Konflikten deutlich wurde – nicht zuletzt auch affektiv bedingte Probleme der Kommunikation und Informationsverarbeitung mit sich. Leichter noch als beim einzelnen nehmen angesichts dieser Überforderung in der Gruppe die ältesten und nach wie vor effizientesten Mittel zur Komplexitätsreduktion überhand, die es gibt: nämlich die affektiven, von der passiven Gleichgültigkeit gegenüber allem, was nicht zur eigenen Ideologie paßt, bis zur aktiven Abwehr alles Störenden durch Aggression und offene Verachtung.
So berichtete Konrad Lorenz (1987, S. 30), daß für einen seiner Königsberger Kollegen, den Philosophen Leider, die gesamte Naturwissenschaft nichts als »der Gipfelpunkt der dogmatischen Borniertheit« war, während umgekehrt sein berühmter naturwissenschaftlicher Lehrer Heinroth alle Philosophie kurzerhand als »pathologischen Leerlauf der dem Menschen zum Zwecke der Naturerkenntnis mitgegebenen Fähigkeiten« zu bezeichnen pflegte.
Jeder Versuch, interdisziplinäre Schranken zu überwinden – ein angesichts der immer extremeren Spezialisierung überall dringliches und im Rahmen der vorliegenden Untersuchung geradezu unausweichliches Gebot – wird mit bewußten oder unbewußten Abwehrhaltungen dieser Art zu rechnen haben. Aber auch der gegenteiligen Gefahr, nämlich der Gefahr, problematische Befunde aus benachbarten Disziplinen mangels präzisen Sachwissens zu wenig kritisch zu begegnen, ist ein Stück weit überhaupt nicht zu entgehen. Je größer die Entfernung vom eigenen Sachgebiet, desto mehr verdünnen sich unweigerlich Quantität und Qualität von Teilkenntnissen; mögliche Vorteile einer weiteren Distanz ergeben sich nur in Glücksfällen. Als einzige Lösung bleibt, will man nicht auf jeden Versuch eines Brückenschlags zu Nachbardisziplinen zum vornherein verzichten, derartige Einschränkungen bewußt in Kauf zu nehmen und ihrer eingedenk aus der eigenen Perspektive nichts als Vorschläge zu machen, deren Beurteilung dann Sache der jeweiligen Partner aus anderen Disziplinen ist.
Spätestens an dieser Stelle dürfte im übrigen klargeworden sein, daß zusätzlich zu allen bisher in Sicht gekommenen Faktoren, die unseren Verstehenshorizont obligat einengen, noch zahlreiche weitere zu berücksichtigen wären, die mit spezifischen Affektwirkungen auf Denken und Verhalten zu tun haben. Diese sind indessen Thema der nachfolgenden Kapitel und müssen vorderhand ausgeklammert bleiben. Damit überlappend ist außerdem an den gewaltigen unbewußten Unterbau zu denken, von dem sich nach SigmundFreud und der Psychoanalyse alles herleitet, was wir bewußt denken, fühlen und tun. Die Existenz eines solchen »affektiven Unbewußten« – zur Zeit seiner Entdeckung durch Freud ein Ärgernis, das weltweite Empörung hervorrief – ist heute allgemein anerkannt. Forscher wie Piaget und Lorenz, neuerdings auch Kihlstrom, postulieren darüber hinaus sogar noch ein eigenes »kognitives Unbewußtes«, in welches namentlich sämtliche automatisierten kognitiv-sensorischen Abläufe im Sinn des weiter oben erwähnten »intuitiven Handlungswissens« und der sogenannten »Erkenntnis der Strukturen«, sowie auch alle angeborenen Formen der Anschauung mit Einschluß der früher erwähnten sprachlichen Universalien und angeborenen »Lehrmeister« des Denkens einzuordnen wären (Piaget 1973; Lorenz 1973; Riedl et al. 1980; Kihlstrom 1987). Obzwar aus meiner Sicht die Auftrennung in ein affektives und kognitives Unbewußtes wenig Sinn macht, da nach der eingangs erwähnten Grundthese der Affektlogik beide Komponenten gerade auch im Unbewußten untrennbar miteinander verbunden sind, ist doch klar, daß die Anerkennung eines zunehmend ausgedehnten unbewußten Unterbaus all unseres Denkens, Fühlens und Handelns einer zusätzlichen Einschränkung unseres persönlichen wie kollektiven Horizonts unbestimmten Ausmaßes gleichkommt.
Je genauer wir die Voraussetzungen unseres Denkens überdenken, desto mehr schrumpfen also unsere Freiheitsgrade. Bevor wir hier weiterdenken, wollen wir uns kurz noch mit der schon einmal gestreiften, im angelsächsischen Schrifttum etwa als sogenanntes »cross-mapping-problem« (vgl. z. B. Cicchetti 1983, S. 117) bezeichneten Frage befassen, ob es wohl grundsätzlich überhaupt möglich und zulässig sei, dem Problem von affektiv-kognitiven Wechselwirkungen, oder von affektiven Phänomenen überhaupt, vorwiegend mit den Mitteln des Denkens und der Wissenschaft beikommen zu wollen, oder ob etwa Gefühle nur über spezifisch affektive, Gedanken dagegen nur über intellektuelle Wege zugänglich sein mögen. – Eine erste Antwort könnte sein, daß diese Frage für uns im Grund gegenstandslos sein muß, da wegen des Ausgangspostulats eines obligaten Zusammenwirkens von Fühlen und Denken beide Komponenten an sämtlichen psychischen Leistungen unausweichlich beteiligt sind, ganz gleich welche Seite dieses Bipols wir zu untersuchen haben. Darüber hinaus ist indes auch einzuräumen, daß wir wohl kein einziges vernünftiges Wort über Gefühle zu sagen vermöchten, wenn wir nicht ständig auf unsere eigenen emotionalen Erfahrungen zurückgreifen könnten. Und ebenso selbstverständlich wird unser Denken stets an fremde und eigene gedankliche Vorarbeit anknüpfen müssen. Im weiteren Verlauf unserer Untersuchung sollte überdies klarwerden, daß affektive Komponenten – unter anderem in Form der sogenannten Intuition – auch Wesentliches zur Lösung von intellektuellen Problemen beizutragen haben, genauso wie umgekehrt unser Denken die Gefühle in mannigfachster Weise beeinflußt und erhellt.
Paradoxe Schlußfolgerung. Relative Sicherheit in der Unsicherheit
Wenn wir uns abschließend die verschiedenen Aspekte unseres Wissens und Nichtwissens, die innerhalb des uns zugänglichen Horizontes in diesem Kapitel nacheinander zum Vorschein gekommen sind, nochmals vergegenwärtigen, so finden wir uns als Ausgangsbasis für alles Folgende in einer zwiespältigen Situation.