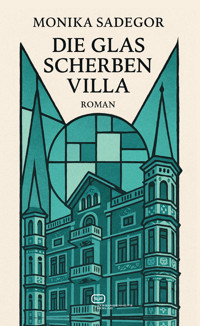Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vergangenheitsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Oktober 1913. Für die junge Gwenddydd Herkomer hängt der Himmel voller Geigen. Von fremdartiger Schönheit, klug und vielseitig künstlerisch begabt, wächst sie als verwöhnte Tochter des deutsch-englischen Malerfürsten, Sir Hubert Ritter von Herkomer und einer walisischen Mutter frei und unbeschwert auf. Als Lieblingstochter ihres Vaters reist sie mit ihm um die Welt und ist im Schloss der Familie in England genauso zuhause wie in der deutschen Heimat des Vaters. An ihrem 20. Geburtstag feiert sie ein rauschendes Fest am Sommersitz der Familie in der Idylle der bayerischen Kleinstadt Landsberg am Lech. Die Welt liegt ihr zu Füßen und eine glanzvolle Zukunft vor ihr. Doch mit einem Paukenschlag ändert sich ihr Leben: Der geliebte Vater stirbt und am Himmel Europas ziehen dunkle Wolken auf. Der Große Krieg überrascht die Deutsch-Engländerin und Weltenbürgerin in der bayerischen Stadt am Lech, und plötzlich gilt sie nicht mehr als geachtete und bewunderte Tochter des Ehrenbürgers der Stadt, sondern als englische Feindin und Spionin. Monika Sadegor erzählt diese wahre Geschichte anhand akribischer Recherchen und zahlreicher neu entdeckter Quellen und zeichnet dabei ein breites gesellschaftliches Kaleidoskop des späten Kaiserreiches und des Zusammenbruchs der "alten Ordnung" in Europa durch den Ersten Weltkrieg. Ein Lesegenuss!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Monika Sadegor
Die englische Tochter
Das Leben derGwenddydd Herkomer
Romanbiografie
[…]
Die Zeit verwischt mein Gesicht,
sie hat schon begonnen.
Hinter meinen Schritten im Staub
wäscht Regen die Straße blank
wie eine Hausfrau.
Ich war hier.
Ich gehe vorüber ohne Spur.
Die Ulmen am Weg winken mir zu
wie ich komme,
grün blau goldener Gruß,
und vergessen mich, eh ich vorbei bin.
[…]
HILDE DOMIN
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.d-nb.de
ISBN: 978-3-86408-294-8
eISBN: 978-3-86408-295-5
Satz und Layout: Darius Samek · www.dariussamek.de
© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin / 2023
www.vergangenheitsverlag.de
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Abbildungen:
Cover: Bushey Museum and Art Gallery, Bushey, GB (https://busheymuseum.org/)
vordere Klappe Umschlag: Portrait: Bushey Museum and Art Gallery, Bushey, GB (https://busheymuseum.org/) // Grab: M. Sadegor
hintere Klappe: M. Sadegor, Foto: Johannes Schmieg
S. 4: Bushey Museum and Art Gallery, Bushey, GB (https://busheymuseum.org/)
S. 245: Bushey Museum and Art Gallery, Bushey, GB (https://busheymuseum.org/)
S. 359: Von Stefan Karl – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121590629
INHALT
DER GEBURTSTAG
IN DER SPÖTTINGER VILLA
IN ENGLAND
ABSCHIED VOM VATER
IN WALES
DIE NEUE HEIMAT
UND PLÖTZLICH FEINDIN
EINE VERHÄNGNISVOLLE AFFÄRE
GEHEIMNISSE
KRIEGSWIRREN
DIE NEUE ZEIT
DER DRACHE
DAS VERMÄCHTNIS
EPILOG
ANHANG
DER GEBURTSTAG
Sieben Uhr am Morgen
7. Oktober 1913
Dumpf schwangen die Kirchturmschläge der Stadtpfarrkirche über den Fluss. Noch waberte grauweißer Nebel über der Landschaft und verdeckte den Blick auf den Lech und die mittelalterliche Stadt. Die pittoresken Altstadthäuser von Landsberg am Lech, die das gegenüberliegende Flussufer wie eine Perlenschnur säumten, ließen sich nur erahnen. Die Luft roch nach Herbst und Laub, das sanft von den Bäumen zur Erde schwebte. Die Gischt des Flusses, der tollkühn über die hölzernen Stufen des Lechwehrs polterte, wirbelte wassergetränkte Luft das Flussbett entlang.
Die junge Frau, die in ihrem Schlafzimmer im zweiten Stock des Turms am Fenster stand, hatte dieses geöffnet und sich weit über die Brüstung gelehnt. Bis hier oben war das Rauschen der Wassermassen zu hören und die feuchte Kühle ließ sie frösteln.
Ein Schwarm schwarzer Krähenvögel hob sich plötzlich aus dem Geäst der hohen Birken und flog kreischend davon.
„Good morning and happy birthday, dear Gwenny … Oh, dear God, Gwenddydd, weg vom Fenster, du holst dir noch die Schwindsucht … aber auf mich hört ja niemand.“ Rose, die Perle des Hauses, Köchin, Faktotum und Kinderfrau zugleich, stellte erschrocken das Tablett, mit dem sie zur Türe hereinkam, auf dem Tisch ab. Vom Heraufsteigen der steilen Wendeltreppen kurzatmig geworden, keuchte sie schwer. Energisch zog sie die junge Frau vom Fenster weg und schloss es. Immer noch ließ sie der Blick nach unten schaudern. Mit vier Stockwerken erhob sich der im normannisch romantisierenden Stil erbaute Turm majestätisch am linksseitigen Lechufer und sein goldenes Dach leuchtete weit hinein in die Stadt. Der englische Malerfürst Hubert von Herkomer hatte den Turm zu Ehren seiner verstorbenen Mutter erbaut. Gwenddydd, seine Tochter, war seit Kindertagen vernarrt in diesen Turm, und zu ihrem 16. Geburtstag hatte sie durchgesetzt, hier oben im zweiten Stock ihr Reich einzurichten.
„Ach Rose, du bist ein alter Angsthase, ich muss doch sehen, wie das Wetter an meinem Geburtstag wird. Daddy hat versprochen, dass wir bei schönem Wetter alle einen Ausflug mit dem Automobil machen. Aber schau“, die junge Frau stellte sich auf die Zehenspitzen, „siehst du nicht auch da drüben am Berg etwas Goldenes aufblitzen? Ich glaube, es ist das Kreuz der Jesuitenkirche, das aus dem Nebel auftaucht – ein gutes Zeichen, dass sich die Sonne durchsetzen wird.“
„Jetzt erst mal marsch wieder ins Bett, junge Dame, aufwärmen und einpacken!“ Resolut zog Rose die junge Frau, die nur mit einem weißen Musselin-Nachthemd bekleidet war, endgültig vom Fenster weg und scheuchte sie ins Bett zurück. Sie baute das Frühstückstablett vor ihrem Schützling auf: „Jetzt gibt’s erst mal deinen early morning tea, du weißt ja: Tee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen … und alles Liebe zum Geburtstag, liebe Gwenny. Ich mag es kaum glauben, gestern noch hab’ ich dich auf meinen Knien geschaukelt, und jetzt bist du eine junge Dame von 20 Jahren … Ach Gott, wie doch die Zeit vergeht!“ Die alte Rose seufzte und zog liebevoll die Bettdecke über die gertenschlanke Mädchengestalt.
Behaglich räkelte sich Gwenddydd noch einmal im Bett, nahm einen Schluck Tee mit einem Bissen Keks und seufzte wohlig. „Danke liebe Rose. Ich bin ja schon so aufgeregt, Daddy und Mummy taten so geheimnisvoll, es werde einige Überraschungen geben … ich kann es kaum erwarten … weißt du etwas?“
Rose gehörte schon seit Urgedenken zum Haushalt der Familie. Die Sechzig hatte sie schon gut überschritten. Wohlbeleibt und stets mit einer weiß gestärkten Schürze bekleidet stellte sie das Idealbild einer viktorianischen Köchin dar. Sie kannte Gwenddydd von Kindesbeinen an. Jetzt strich sie ihr zärtlich eine Strähne ihres langen schwarzen Haares aus dem Gesicht: „Und wenn ich es wüsste, my little princess, würde ich es dir nicht sagen, sonst wäre es ja keine Überraschung mehr … So – und nun trink deinen Tee, und ich schicke dir gleich Babette, dass sie dir beim Ankleiden hilft. Du weißt ja, der Professor schätzt es, wenn alle pünktlich um neun Uhr zum Frühstück erscheinen – obwohl – wer weiß – er hatte eine ziemlich schlechte Nacht heute …“
Den letzten Satz hatte sie kaum hörbar gemurmelt und damit das Zimmer verlassen.
Die Westminster-Melodie der großen Standuhr schwang noch durch das Haus, als Gwenddydd beim letzten Glockenschlag Punkt neun Uhr die Treppe im Mutterturm herunterkam und durch den hölzernen Gang, der Turm und Wohnhaus verband, das Speisezimmer betrat. Sie war sportlich gekleidet, eine weiße hochgeschlossene Spitzenbluse und ein schmal geschnittener brauner Wollrock mit hoch angesetzter Taille ließen sie noch schlanker und zarter als sonst erscheinen. Die Haare waren – dank Babettes Künsten – zu einer eleganten Hochfrisur aufgesteckt. Die Familie, der Vater, die Mutter und ihr älterer Bruder Lorenz standen schon erwartungsvoll um den Esstisch. Wie auf Kommando tönte es durch den Raum: „Happy birthday, dear Gwenddydd …“
Auf dem Tisch war der Geburtstagskuchen, ein sponge cake, aufgebaut, prächtig bunt verziert und von 20 brennenden Kerzen umrahmt.
„Oh, wie schön!“ Gwenddydds dunkle Augen strahlten vor Freude, dann lief sie auf Eltern und Bruder zu und umarmte sie stürmisch.
„Gemach, gemach, kleiner Wildfang, das ist ja erst der Auftakt zu deinem ganz besonderen Geburtstag. Jetzt stärken wir uns erst einmal, Bescherung danach im Blauen Salon.“ Der Vater löste sich aus der Umarmung seiner Tochter und ging voraus zum Buffet. Das Frühstück wurde auch am bayerischen Sommersitz der Familie englisch zelebriert: Rose hatte gebratenen Schinken und Speck, Rührei, kleine Würstchen, Porridge, Orangenmarmelade und Toasts appetitlich angerichtet. Letzteres ein Zugeständnis an die Mutter, Lady Margaret, die Süßes zum Frühstück bevorzugte. Außer Tee, Kaffee und Fruchtsaft stand heute ein Kübel mit einer Flasche eisgekühltem Champagner bereit.
„Auf dich, kleine Schwester, jetzt kann man allmählich etwas mit dir anfangen …“ Lorenz, der vier Jahre ältere Bruder, ließ den Korken knallen. Der Champagner perlte überschäumend in die Kristallgläser. Lachend stießen sie mit dem Geburtstagskind an, und sogar Hubert von Herkomer, der sonst nie Alkohol trank, nippte am Glas und prostete Gwenddydd zu.
„Nun, Darling“, schmunzelte die Mutter und nahm sie in den Arm, „vorbei das Jungmädchendasein, jetzt ist Zeit, eine Lady zu werden!“
„Ach was, lasst mir nur mein Küken, meine kleine Zauberfee, wie sie ist.“ Der Vater drückte Gwenddydd an sich. „Seit 20 Jahren ist sie mein Sonnenschein, ich mag gar nicht daran denken, dass sie nun bald flügge ist und uns irgendwann davonfliegt …“ Für einen Moment wurde er ernst, dann lächelte er wieder und hob nochmals das Glas: „Auf dich, my sweetheart, bleib, wie du bist, du bist wunderbar.“
„Aber Daddy, du weißt doch, wie ich euch liebe, ich denke nicht daran, euch zu verlassen, ein Leben ohne euch kann ich mir gar nicht vorstellen!“
„Na ja, irgendwann, mein Kind, wird es aber einmal so sein …“ Die Stimme des Vaters klang seltsam verhalten.
„Ach was, eines Tages kommt der Prinz auf dem Schimmel angeritten und entführt dich. Also – noch vor ein paar Jahren war man mit zwanzig schon eine alte Jungfer …“, feixte der Bruder.
„Unsinn, ich will überhaupt nicht heiraten, ich bleibe bei Daddy und Mum.“
Jetzt lachten wieder alle und bedienten sich schließlich am Buffet. Lady Margaret und Lorenz griffen kräftig zu, nur Gwenddydd brachte vor Aufregung kaum einen Bissen hinunter. Wenn doch nur das Frühstück schon vorbei wäre und sie die Geschenke auspacken könnte! Auch der Vater aß nur ein paar Löffel Porridge und eine Gabel voll Rührei.
„Geht’s dir gut, Daddy?“ Besorgt blickte Gwenddydd auf ihren geliebten Vater. Kam es ihr nur so vor, oder war er heute ganz grau im Gesicht? Als wäre er über Nacht um Jahre gealtert? Einen Moment lang überkam sie ein ungutes Gefühl. Sie umarmte ihn ungestüm: „Ist auch alles in Ordnung, Daddy?“
„Ja, ja, Darling, keine Sorge! So – und wenn ihr fertig seid, lasst uns in den Salon hinübergehen. Ich sehe ja, meine kleine Gwenddydd platzt schon vor Neugierde.“ Hubert von Herkomer nahm die Hand seiner Tochter und ging mit ihr voraus in den Blauen Salon. Im ersten Stock des Anbaus gelegen und nach der Farbe seiner Tapeten benannt, war er der repräsentative Aufenthalts- und Empfangsraum des Anwesens. Hier traf sich die Familie gern am Abend, und hier empfing sie ihre Gäste. Die übrigen Räume des Hauses dagegen waren schlicht und ländlich eingerichtet.
Ignaz, der Hausdiener, hatte im Kamin bereits ein Feuer angezündet und das Knistern der brennenden Holzscheite verbreitete eine heimelige Atmosphäre. Vor dem offenen Kamin luden zwei sich gegenüberstehende wuchtige Ottomanen zum Verweilen ein, dazwischen stand ein kunstvoll geschnitzter Eichentisch. Darauf waren die unterschiedlichsten Päckchen und Schachteln drapiert, allesamt in bunt glitzerndes Papier eingepackt. Eine dicke Schriftrolle lag obenauf und zog Gwenddydds neugierigen Blick auf sich. Sie sah ihren Vater fragend an, und als dieser aufmunternd nickte, griff sie danach. Sie löste das dicke rote Band, mit der sie verschnürt war. URKUNDE war auf der ersten Seite der Dokumentenmappe zu lesen, die außerdem mit einem Siegel mit Bändchen, einem eingravierten Wappen und den Angaben des Notars versehen war. In der Mappe viel Text und ein großer Lageplan, auf dem sie das Herkomer-Anwesen samt Grundstück, Wohnhaus und Turm erkannte. Und obwohl sie genauso gut Deutsch wie Englisch sprach, verstand sie nicht recht, was hier geschrieben stand und was es bedeutete. Wieder blickte sie fragend auf ihren Vater.
„Meine liebste Gwenddydd,“ Hubert von Herkomers Stimme klang geradezu feierlich, „mit dieser Urkunde ist es amtlich verbrieft, dass du die stolze Besitzerin dieses Anwesens bist mitsamt Grundstück, Wohnhaus, Nebengebäuden und dem Mutterturm. Ich weiß, wie du diesen Sommersitz und den Turm hier liebst. Schon immer hatte ich das Gefühl, hier gehörst du her, hier ist dein Zuhause, mehr als in Bushey. Mir scheint, in dir kommt das deutsche Erbe meiner Familie, speziell das meiner verstorbenen Mutter, am meisten durch. Du bist ihr sehr ähnlich, nicht nur im Äußeren, auch die Liebe zur bayerischen Heimat, zu Pflanzen und Tieren und auch die musikalische Begabung hast du von ihr. Deshalb habe ich dir das Anwesen schon vor einigen Jahren überschrieben. Bis zu deiner Volljährigkeit, heute in einem Jahr an deinem 21. Geburtstag, ist unser Freund Georg Mayr noch als Vormund hierüber eingesetzt. Danach kannst du frei über alles verfügen. Zwei Einschränkungen gibt es allerdings: Solltest du kinderlos sterben (was ja eher unwahrscheinlich ist), fällt das Anwesen an die Familie zurück. Und zweitens: Für Vetter Peter mit Familie ist ein lebenslanges Wohnrecht in der Wohnung im Erdgeschoss und eine monatliche Leibrente von 100 Goldmark eingetragen. Heute an deinem 20. Geburtstag ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, dir dies mitzuteilen.“ Seine Augen glänzten verdächtig feucht, als er Gwenddydd an sich drückte.
Diese schaute von ihrem Vater auf das Dokument und zurück und wusste nichts zu sagen. Eine geradezu andächtige Stille breitete sich im Salon aus. Schließlich brach Lorenz das Schweigen und kniff sie in die Seite: „Ja, Schwesterherz, wir sind hier nur zu Gast – und wenn wir uns nicht ordentlich benehmen, kannst du uns des Hauses verweisen …“
Nun war das Eis gebrochen und Gwenddydd lachte und weinte gleichzeitig und fiel ihrem Vater um den Hals. „Und ist das denn für euch auch in Ordnung?“ Ein wenig besorgt schaute sie auf Mutter und Bruder.
„Nun, die Gefahr, dass wir anderen Familienmitglieder deshalb am Hungertuch nagen, ist gering. Und du weißt ja, dein Bruder wird überdies in Kürze eine gute Partie machen und in eine der ersten Familien in London einheiraten. Na ja – und zu Hause in Bushey ist ja auch noch ein wenig Vermögen vorhanden. Nein, das ist schon richtig so, niemand passt so gut hierher wie du, das war schon so, als du hier noch als Kind das Ritterfräulein oder die walisische Zauberin spieltest“, die Mutter blinzelte Gwenddydd zu und nahm sie in den Arm, „und außerdem beherrschen Lorenz und ich die deutsche Sprache im Gegensatz zu dir nicht besonders gut.“
Langsam wich die Röte der Aufregung aus Gwenddydds Gesicht und sie ließ sich auf eine der Ottomanen am Kamin nieder.
„Ja – und das muss nun schließlich auch gebührend gefeiert werden, meinst du nicht auch?“ Der Vater schmunzelte und reichte Gwenddydd einen verschlossenen Umschlag.
„Sir Hubert Ritter von Herkomer lädt zum Dinner mit anschließendem Ball in den Zederbräu-Saal, Samstag, den 11. Oktober 1913, 7 Uhr“, stand auf der Karte, die Gwenddydd aus dem Kuvert zog.
„Oh, Daddy“, Gwenddydd sprang auf, „das ist ja unglaublich, das ist ja wunderbar – ja – aber ich habe dafür gar keine Garderobe dabei …“ Kurz überzog ein Schrecken ihr hübsches Gesicht.
„Nun, vielleicht solltest du einfach mal weiter die Geschenke auspacken …“ Die Mutter lächelte verschwörerisch und deutete auf ein großes Paket, das den Kamintisch nach allen Seiten überragte. Das ließ sich Gwenddydd nicht zweimal sagen. Ungeduldig riss sie das Geschenkpapier auf und löste das Band, das den Karton umfing. Chic Parisienne stand darauf. „Oh, Mummy, es wird doch nicht …?!“
Mit vor Aufregung zitternden Händen öffnete sie nun den Karton und vor ihr lag eine komplette Abendrobe mit Kleid, Seidenschuhen, Haarschmuck und kleiner Abendtasche. Behutsam nahm sie das Kleid heraus und hielt es in die Höhe: ein warmroter Brokatstoff, golden bedruckt, mit einem Überwurf aus feiner goldener Spitze, einer leicht angedeuteten Schleppe, vorne mit durchsichtigem goldenen Spitzenbesatz hochgeschlossen, aber mit einem verführerischen Rückendekolleté. „Oh, Mummy, wie wunderschön … und die Farbe – Rot ist doch meine Lieblingsfarbe …“ Gwenddydd betastete bewundernd den Stoff.
„Weiß ich doch, Darling, es sind ja auch die Herkomer-Farben: Rot und Gold … Ich hoffe, es passt, aber Madame Madeleine von Chic Parisienne meinte, wenn du seit letztem Jahr nicht zugenommen hast, müsste es perfekt sitzen. Wir haben ja schon öfter bei ihr schneidern lassen.“
„Schon ein bisschen gewagt für die bayerische Provinz“, der Vater runzelte leicht die Stirn, „aber was soll’s, in jedem Fall bestehe ich auf dem ersten Tanz.“
„Und ich auf dem zweiten.“ Lorenz nahm die beiden übrigen kleinen Päckchen vom Tisch und überreichte sie seiner Schwester. Ein Tanzbüchlein enthielt das erste, und das zweite einen Gedichtband von Rainer Maria Rilke. „Du liebst ja die deutsche Lyrik und sagst immer, damit lerne man die Sprache am besten, diesmal also ein zeitgenössischer Dichter …“
Und vom großen Bruder Siegfried, der diesmal wegen dringlicher Geschäfte in England geblieben war, fand sich noch ein Glückwunsch-Telegramm mit einer Einladung zu einem Opernbesuch im Royal Opera House London mit anschließendem Dinner im ersten Hotel der Stadt.
„Ach, ich danke euch allen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, alles ist so aufregend. Was für ein wunderbares Jahr, dieses 1913. Zu Hause die großartigen neuen Filmaufführungen von Daddy, die Ausstellung in der Leicester Gallery in London, der neue Rosengarten, der herrliche Sommer hier, diesmal nur mit der Familie, ganz ohne Besucher, die Daddy porträtieren soll, eure Silberhochzeit, jetzt mein Geburtstag, und Weihnachten steht ja auch noch ein Höhepunkt ins Haus, Lorenz’ Hochzeit …!“ Gwenddydd blickte plötzlich ein wenig wehmütig zu ihrem Bruder: „Obwohl, ich bin schon ein bisschen eifersüchtig, dann spielen wir nicht mehr die erste Geige in deinem Herzen … und du ziehst fort!“
„So, und jetzt ist Schluss mit Sentimentalitäten! Schaut mal zum Fenster hinaus, die Wolkendecke hat aufgerissen, der Nebel hat sich aufgelöst und es verspricht, ein goldener Oktobertag zu werden. Lasst uns aufbrechen. Ignaz hat schon den Daimler startklar gemacht. Schließlich wollen wir pünktlich zum Dinner wieder hier sein. Onkel Peter wird am Abend zu uns stoßen, er ist heute in München. Und was ich so flüstern hörte, gibt es zum Dinner einige deiner Leibspeisen und noch eine weitere Überraschung“, zwinkerte der Vater Gwenddydd zu.
Diese hielt immer noch ihr neues Ballkleid in den Armen und wirbelte Walzer tanzend durch den Salon.
„Jetzt los, Gwen, Hut und Jacke geholt, das Kleid kannst du später anprobieren.“ Mutter Margaret schubste die Tochter liebevoll, aber bestimmt zur Türe hinaus und seufzte: „Ich fürchte, unsere Schöne wird nie erwachsen oder gar eine Lady werden …“
Was für ein herrlicher Tag!
Ein wenig müde und vom Fahrtwind zerzaust stieg Gwenddydd am späten Nachmittag die Treppen zu ihrem Zimmer im Turm empor. Sie riss den ungeliebten Hut vom Kopf und warf sich glücklich, aber erschöpft auf die Chaiselongue. Noch eine kleine Weile ausruhen, danach umziehen und sich auf das Dinner und Onkel Peter freuen, der sicher auch noch ein Geschenk brachte.
Bis nach Dießen am Ammersee waren sie mit dem Daimler gefahren. Sie durfte neben dem Vater auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, und bald schon tauchte vor ihnen zum Greifen nahe die gesamte Alpenkette auf, die Zugspitze und Karwendel waren schon weiß bemützt und glänzten in der Sonne. Im Gasthof Unterbräu hatten sie das in Bayern so beliebte Weißwurstfrühstück eingenommen und das selbstgebraute Weizenbier genossen.
Das Wetter war Stunde um Stunde schöner geworden. Der Föhn machte seinem Namen alle Ehre und sorgte für tiefblauen wolkenlosen Himmel und beste Fernsicht. Das Kloster Andechs mit der barocken Zwiebelhaube auf seinem Kirchturm grüßte von der anderen Seite des Sees herüber. Der Wald am darunterliegenden Hochufer hatte sein buntes Herbstkleid angelegt und flammte in Rot, Gold und Kupfer in der Sonne auf. Weiße Segelschiffe zogen über den See, der blau und ruhig wie ein Kristallspiegel im Sonnenlicht lag. Ein Hauch von Sommer wehte noch einmal über die Seepromenade, und nur das Rascheln des Laubs unter ihren Füßen kündete vom Herbst. Ein goldener Oktobertag wie aus dem Bilderbuch.
Am Nachmittag war es so warm geworden, dass die Familie ausgiebig am Seeufer promenierte. Gwenddydd hatte sich standhaft geweigert, auf die Ermahnungen der Mutter zu hören und den Sonnenschirm zu nehmen. Sie genoss die warmen Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht und lachte nur, als Lady Margaret meinte, sie bekäme einen Teint wie eine Bäuerin und nicht die vornehm blasse Haut, die einer Lady gezieme.
Auch jetzt in ihrem Turmzimmer vermeinte sie, die Sonnenstrahlen noch auf ihrer Haut zu spüren. Aber es war wohl nur die Wärme des kleinen Ofens in der Ecke, die sie einlullte und einnicken ließ.
„Miss Gwenddydd, aufwachen, halb acht, Sie sollten sich umkleiden. Ich helfe Ihnen.“ Babette, das Hausmädchen, stand vor ihr. „Was möchten Sie anziehen?“
„Eigentlich wollte ich das dunkelgrüne Kleid aus London anziehen, aber ich weiß nicht – was meinst du – wäre es nicht eine hübsche Überraschung für Vater, wenn ich das neue Dirndlkleid anziehe, das wir im Sommer bei unserem Ausflug nach Garmisch gekauft haben? Wo er doch so begeistert von seinem ersten Aufenthalt mit seinem Vater dort erzählte und auch heute wieder so viel von seiner Mutter schwärmte, der ich angeblich so ähnlichsehe. Ich habe sie ja leider nicht mehr kennengelernt …“
„Oh ja, das Dirndlkleid steht Ihnen ganz ausgezeichnet, Miss Gwenddydd, das ist eine gute Idee und wird den Herrn Professor sicher freuen.“
„Dann musst du mir aber auch die Haare zu Zöpfen flechten und so um den Kopf winden, wie ihr es hier tragt.“
„Mach’ ich gerne, Miss, jetzt aber Beeilung!“
Acht Uhr am Abend
Die Familie, einschließlich Onkel Peter und Tante Theres, saßen bereits um den ovalen Eichentisch, den einst der Großvater geschnitzt hatte und der mit Kerzen und Blumengestecken prächtig dekoriert war. Man hatte im Blauen Salon gedeckt. Die funkelnden Kristallgläser und das extra für diesen Abend herausgeholte Essgeschirr aus feinstem Porzellan mit Goldrand und Blumendekor ergaben ein festliches Bild. Alles wartete auf das Geburtstagskind. Es war schon 15 Minuten über der Zeit und Hubert von Herkomer, der Wert auf pünktliche Essenszeiten legte, blickte leicht ungeduldig auf die große Standuhr.
Endlich öffnete sich die Türe zum Salon und bei Gwenddydds Eintritt ging ein Raunen durch den Raum. Das burgunderrote, knapp bodenlange Dirndlkleid bauschte sich über ihren weiß bestrumpften Beinen, die in schwarzen Trachtenschuhen steckten. Eine blassblaue Seidenschürze mit Blumenornamenten, ein ebensolches Schultertuch mit langen Fransen und ein schwarzes Mieder mit Zinn-Geschnür über der weißen Bluse rundeten das Ensemble ab. Für das Dekolleté hatte Babette aus den letzten Blumen im Park ein kleines Gesteck gezaubert. Am beeindruckendsten aber war Gwenddydds Haarpracht: Die üppigen schwarzen Haare waren in einem dicken Zopf kranzförmig um den Kopf gelegt und umrahmten ihr ebenmäßiges Gesicht. Jetzt blitzten die dunklen Augen schelmisch und voll Vergnügen über ihren Auftritt.
Der Vater fasste sich als Erster, erhob sich und ging auf seine Tochter zu. „Die Überraschung ist dir gelungen. Du siehst wunderbar aus, wie eine echte bayerische Prinzessin.“
Gwenddydd strahlte und drehte sich vergnügt im Kreis. Der Vater nahm sie bei der Hand, führte sie zum Sitzplatz und rückte ihr als vollendeter Gentleman den Stuhl zurecht. „Ja“, sagte er, und sein Blick ging in die Ferne, „wir hatten einen besonders schönen Sommer dieses Jahr: echte Ferien, gänzlich ohne Arbeit, ohne Besuch, ohne Kunden, kein Zeitdruck, nur Familie und Freunde, Stadt und Land hier genießen – wirklich eine neue Erfahrung. Das hätte ich schon viel früher machen sollen.“
Beim Geburtstagsmenü übertraf sich Rose wieder einmal selbst. Nach dem obligatorischen Sherry als Aperitif servierte sie Garnelensalat, anschließend eine würzig-sahnige Currysuppe und als Hauptspeise Gwenddydds absolutes Lieblingsessen: Lammbraten mit Minzsauce, Karottengemüse und roasted potatoes. Apple Pie und Kaffee schlossen das Dinner ab. Alle griffen kräftig zu, nur Hubert von Herkomer beschränkte sich auf Suppe und das extra für ihn zubereitete Lammhaschee. Sein Magenleiden machte ihm wieder zu schaffen.
„Jetzt lasst uns hinüber in den Mutterturm gehen und bei einem Gläschen Portwein schauen, was der Abend noch so alles bringt …“ Peters Stimme klang geheimnisvoll und er tauschte mit seinem Vetter Hubert einen bedeutsamen Blick. Alle erhoben sich, froh, ein paar Schritte durch den hölzernen Verbindungsgang vom Wohnhaus hinüber in den Turm gehen zu können. Der Raum mit dem achteckigen Grundriss im ersten Geschoss des vierstöckigen Turms war ursprünglich als Atelier gedacht. Aber schnell war es zu mühsam geworden, die oft großen Gemälde über den Fallboden ins Erdgeschoss abzulassen. Und so hatte Hubert von Herkomer sein Atelier in eine eigens dafür errichtete Hütte am Rande des Herkomer-Parks verlegt. Nun diente das Zimmer als repräsentativer Wohnraum, der schon viele Festlichkeiten gesehen hatte: vor nunmehr über 25 Jahren die Hochzeit der Eltern und vor Kurzem ihr silbernes Ehejubiläum. Berühmte Persönlichkeiten hatten Hubert von Herkomer hier Modell gesessen, viele Gesprächsrunden fanden statt, aus denen oft große Projekte entstanden. Und immer blickte das Bildnis seiner Mutter, das einzige, das er je von ihr malen durfte, von der Wand herab.
„Wo ist denn Onkel Peter plötzlich abgeblieben?“ Gwenddydd blickte sich fragend um. Doch da kam er auch schon die Treppe vom Erdgeschoss des Turms heraufgestiegen, einen ovalen Korb im Arm, daraus ein klägliches Winseln zu vernehmen war.
„Einen kleinen Kameraden für dich, liebe Gwenny, ich weiß ja, wie traurig du warst, als du deinen Moody vor zwei Jahren begraben musstest …“
„Oh, mein Gott, ein Hundebaby, ach, ist der süß …“ Gwenddydd nahm das kleine Fellbündel auf den Arm und drückte es zärtlich an sich.
„Ein Border Collie, gerade mal zehn Wochen jung …“ Peter schmunzelte und freute sich an ihrem Entzücken, kannte und liebte er seine Nichte Gwenddydd doch wie eine eigene Tochter.
„Was für ein weiches Fell er hat, wie Plüsch! Er ist wahrhaft eine Schönheit: schwarz und weiß! Schwarzes Fell, weiße Pfoten, weißes Näschen, weiße Brust, sogar am schwarzen Schwanz noch eine weiße Spitze, und diese blauen Augen … Oh, lieber Onkel Peter, danke, danke …“ Gwenddydd strahlte und drückte den Welpen an ihre Brust.
„Die blauen Augen wird sie noch verlieren, die haben alle Hundewelpen, sie werden dunkel, aber sonst bleibt sie, wie sie ist. Sie ist nämlich eine Sie, eine Hundeprinzessin. Ich dachte, sie passt zu dir, genau wie du wird sie eine sportliche, kluge und etwas eigenwillige Lady … Ich freue mich, wenn sie dir gefällt.“
Nun standen alle um Gwenddydd und das Hundebaby herum und streichelten es.
„Ich werde sie Bonny nennen.“ Gwenddydd vergrub ihr Gesicht in dem weichen Fell der Hündin.
„Auf dich, mein Kind, und deine neue Freundin!“ Der Vater entkorkte die Portweinflasche, die die gute Rose bereits mit Gläsern und einer herrlichen Käseplatte mit Walnüssen bereitgestellt hatte. „Ich finde es beruhigend, dass du nun eine Kameradin hast, die dich auf deinen ausgedehnten Spaziergängen begleitet und beschützt. Wer weiß, was noch alles kommt … möge sie stets gut auf dich aufpassen, Border Collies sind ja die geborenen Hütehunde.“
Unvermittelt lag ein gewisser Ernst über der Runde.
„Was meinst du, Daddy? Glaubst du, es kommt doch zu einem Krieg?“ Lorenz blickte besorgt zu seinem Vater.
„Nein, das denke ich eigentlich nicht. Am Balkan kriselt es zwar mächtig, aber das ist ja schon seit Langem so. Nein, mittlerweile sind die Länder Europas wirtschaftlich und finanziell so miteinander verzahnt, dass ein Krieg so gut wie unmöglich geworden ist.“
„Trotzdem spüre ich bei uns zu Hause in England seit einiger Zeit so etwas wie eine Deutschfeindlichkeit – will doch die Familie meiner Braut unbedingt, dass ich meinen deutschen Vornamen Lorenz anglisiere und mich Lawrence nenne …“
„Macht nichts“, feixte Gwenddydd und kniff den Bruder, „für uns bist du nach wie vor Tutti …“
„Ja, aber im Ernst, ich habe auch so ein Gefühl, als ändere sich die politische Großwetterlage“, Peter Herkomer runzelte nachdenklich die Stirn, „auch bei uns ist so ein neues Nationalbewusstsein und Säbelrasseln bei den Militärs zu spüren. Der 1870/71er Krieg liegt wohl schon zu lange zurück, als dass man sich noch an seine Schrecken erinnert …“
„Ach was, der deutsche Kaiser liebt zwar das Militär, aber nur für Paraden und Kaisermanöver, ansonsten widmet er sich der Jagd, seinen Schiffen und träumt davon, eine Kolonialmacht nach britischem Vorbild zu werden. Nein, ihm sind Hofzeremoniell und neue Kleiderordnungen wichtiger als ernsthafte Politik, und er lässt sich schließlich gerne als Friedenskaiser feiern. Nein, von ernsthaften Kriegsabsichten ist er weit entfernt. Und England hat schon gar kein Interesse an einem Krieg, der doch nur den florierenden Welthandel stören würde. Außerdem sind die Herrscherhäuser ja geradezu eine Familie und samt und sonders miteinander verwandt. Wilhelm II. ist doch ein Enkel unserer Queen Victoria, Gott hab sie selig, nicht wahr? Und schließlich: Der Balkan ist weit weg. Was geht uns das an?“ Hubert von Herkomer hatte sich in Rage geredet.
„Ja, ja, mag alles sein, dennoch hat der Kaiser im Juni einer enormen Verstärkung des Heeres zugestimmt … und manchmal merkt man sogar in dieser sonst so friedlichen Kleinstadt so etwas wie eine neue nationalistische Grundstimmung …“ Peter seufzte sorgenvoll.
„Ach, die Herren sind schon wieder bei der Politik“, seufzte Lady Margaret, „nicht mal heute am Geburtstag unseres Nesthäkchens können sie es lassen.“
„Ja, du hast recht, Maggie. Heute ist nicht der Tag dafür. Wir wollen ihn heiter ausklingen lassen.“ Hubert von Herkomer stand auf, ging zu einem Wandschrank, holte die Zither hervor und begann, darauf deutsche und englische Lieder zu improvisieren. Und bald stimmte Gwenddydd mit ein und ihr voller Mezzosopran verzauberte zusammen mit dem Klang der Zither die Nacht.
Der Mond stand schon voll am Himmel, als die Familie das Turmzimmer verließ und untergehakt den hölzernen Wandelgang hinüber ins Wohnhaus ging, während Gwenddydd die Wendeltreppen hinauf in ihr Schlafzimmer im zweiten Stock des Mutterturms stieg. Den Hundekorb mit der kleinen Bonny drückte sie fest an sich. Nach ein paar Stufen wandte sie sich noch einmal um.
„Ich danke euch allen von Herzen, das war so ein wundervoller Tag, ach, könnte es immer so bleiben …“
Sie stellte das Körbchen neben ihr Bett, streichelte das Hundebaby zärtlich und machte sich daran, das Dirndlkleid abzulegen und die Haarpracht zu lösen. Müde, aber glücklich ließ sie sich endlich ins Bett fallen und schlief sofort ein.
Halb zwei Uhr in der Nacht
Schon von Weitem hörte sie ihn. Feuerspeiend und bedrohlich grollend war er in den Park eingebrochen. Jetzt schlurfte er mit schweren Schritten die Treppen des Turms herauf, immer näher, Stufe für Stufe, und Gwenddydd erstarrte vor Angst.
„Oh Gott, wo sind nur meine Ritter, meine Beschützer? Wer hilft mir, ihn abzuwehren? Wie war nur gleich der Zauberspruch, der ihn bannt? Hilfe, gleich ist er da …“ Schweißgebadet schreckte sie hoch.
Immer wieder mal verfolgte sie dieser Albtraum von dem Angriff des Drachen. Doch bisher war sie stets in letzter Minute gerettet worden, gerade so wie in den alten Rittersagen und Märchen, die sie seit Kinderzeiten so gerne las. Heute hörte sie seine Tritte überdeutlich. Jetzt war ihr, als böge er ab in das Wohngebäude, in dem die Schlafzimmer der Eltern und des Bruders lagen. Ihr Herz raste. Sie richtete sich auf. Schließlich gab sie sich einen Ruck und stieg zitternd aus dem Bett. Barfuß und sorgsam bedacht, keinen Laut zu verursachen, schlich sie durch den hölzernen Verbindungsgang hinüber in das Haus. Vor dem Schlafzimmer der Eltern hielt sie an. Die Tür stand einen Spalt weit offen. Dämmriges Licht drang nach außen, und ein qualvolles Stöhnen ließ sie erschaudern. Vorsichtig näherte sie sich der Türe und schob sich sachte einen Schritt weit hinein. Jetzt erkannte sie einen schwarzen Schatten über das Bett des Vaters gebeugt. Gwenddydd stand starr vor Schreck. Sie hielt den Atem an. Ihr Herz pochte so lautstark, dass sie meinte, jeder müsse es hören. In dem Moment winselte Bonny, die ihr nachgelaufen war, und der Schatten wandte den Kopf. Gwenddydd glaubte, das Herz bliebe ihr stehen, und sie schloss entsetzt die Augen. Als sie es schließlich wagte, sie wieder zu öffnen, war sie fast überrascht, dass sie in ein menschliches Antlitz blickte und nicht in das erwartete Reptiliengesicht. Der Schatten, ein schlank gewachsener Mann mit strengen Augen und einer rahmenlosen Nickelbrille, musterte kurz und durchdringend die Mädchengestalt. Gwenddydd starrte ihn fassungslos an. Sie fröstelte. Und plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie barfuß, mit offenen Haaren und nur mit einem leichten Nachthemd bekleidet war. Sie zog es enger um sich und verschränkte die Arme über der Brust. Endlich wandte der Schatten den Blick von ihr, drehte sich um und beugte sich wieder über das Bett des Vaters.
„Gwenny, geh zurück in dein Bett, Dr. Rupfle kümmert sich schon um Vater. Sein Magen hat wohl einiges heute nicht gut vertragen …“ Die Mutter drängte Gwenddydd zur Türe hinaus. Sie nahm gerade noch wahr, dass der Vater mit schmerzvoll verzerrtem Gesicht dem Arzt den Arm hinhielt und dieser eine Spritze aufzog. Dann schloss die Mutter die Türe.
Nur langsam beruhigte sich Gwenddydds Herzschlag. Eine Weile horchte sie noch an der Türe, aber es waren nur gedämpfte Stimmen zu hören, die sie nicht verstand. Sie zitterte.
Der Welpe schmiegte sich an ihre nackten Beine und wimmerte. Schließlich nahm Gwenddydd ihn auf den Arm, hastete den Gang zum Turm hinüber und eilte die Treppen hinauf in ihr Zimmer. Sie drehte den Schlüssel zweimal im Schloss herum und warf sich auf ihr Bett. Immer noch vermeinte sie, die Augen des Mannes auf sich zu fühlen. Sie schauderte und ihr Kopf dröhnte. Ein ums andere Mal wälzte sie sich im Bett umher und konnte keinen Schlaf finden.
Plötzlich spürte sie etwas Warmes an ihren Füßen: Der kleine Hund hatte sich angekuschelt. Sie legte die Hand auf sein plüschiges Fell und endlich konnte sie einschlafen. Und wieder kam es ihr vor, als sei sie in letzter Minute gerettet worden.
Neun Uhr am Morgen
8. Oktober 1913
Schweigend saßen die Geschwister am Frühstückstisch. Die Kerzen am Tisch waren entzündet und verbreiteten ein diffuses Licht. Obwohl nicht mehr ganz früh am Tag, war es noch dämmrig im Raum. Der Föhn war zusammengebrochen und Nebel und Regen verbreiteten eine düstere Stimmung. Der Herbstwind ließ die schon müden Blätter von den Bäumen regnen und über dem gestern noch grünen Rasen des Parks breitete sich ein brauner Laubteppich aus. Von den Trauerulmen lief silbrig glänzend der Regen wie eine Fontäne herab. Der Nebel war so dicht, dass nicht einmal der nahe Fluss zu sehen war. Selbst der sonst so dominante Mutterturm mit seinen golden glänzenden Dachziegeln war unsichtbar, als gäbe es ihn gar nicht.
„Hast du das heute Nacht auch gehört?“, fragte Gwenddydd ihren Bruder und stocherte lustlos in ihrem Frühstücksbrei.
„Ja, natürlich, ich schlafe ja gleich im Zimmer nebenan. Ich ging hinüber, weil ich Vater stöhnen und röcheln hörte. Mum rief Ignaz und schickte ihn nach dem Arzt. Der war übrigens, glaube ich, schon ein paar Mal nachts hier … aber immer, wenn er kommt, scheucht mich Mum aus dem Zimmer.“
„Weißt du, Tutti, ich hatte wieder diesen grässlichen Albtraum von dem Drachen, der sich anschleicht. Erst war ich starr vor Angst, doch diesmal habe ich es geschafft, aufzustehen und seinen Schritten nachzugehen. Entsetzt sah ich ihn im Schlafzimmer der Eltern über Dad gebeugt. Zuerst nahm ich nur einen Schatten wahr, später erkannte ich, dass es ein Mann war, wohl ein Arzt … Ich hab’ mich so erschrocken …“
„Ach, Gwenny, du hast einfach als Kind zu viele Drachen- und Rittergeschichten gelesen. Dr. Rupfle ist kein Drache oder schwarzer Ritter, im Gegenteil, Vater geht’s ja nach seinem Besuch immer gut. Er ist also eher der weiße Ritter, schon seinem ganzen Aussehen nach: ein aschblonder Lancelot mit Augen so stahlblau wie ein Winterhimmel am Morgen, schütterem Haar und einem gepflegten Kaiser-Wilhelm-Bart. Und wenn du schon deiner Sagenwelt so verhaftet bist, Schwesterherz, du weißt ja: Du bist Gwenddydd, die mächtige Zauberin, Merlins Schwester, und kannst den Bann brechen. Und sag nicht immer ‚Tutti‘ zu mir …“ Wie immer protestierte Lorenz gegen seinen Kosenamen, der ihm geblieben ist, seit Gwenddydd ihn bei ihren ersten Sprechversuchen so genannt hatte. Schließlich lachte Lorenz und umarmte sie, die für ihn immer noch die kleine Schwester war, das Küken der Familie.
Endlich ging die Türe auf und die Eltern kamen herein, der Vater noch etwas blass um die Nase, die Mutter bemüht, sich die Müdigkeit nicht anmerken zu lassen.
„Daddy, wie geht es dir? Was war das heute Nacht?“ Besorgt lief Gwenddydd auf ihren Vater zu.
„Alles ist gut, Darling, eine kleine Unpässlichkeit, ich bin wohl das Feiern nicht mehr gewohnt“, Hubert von Herkomer zwinkerte seiner Tochter zu, „aber keine Angst, bis Samstag bin ich wieder ganz der Alte. Ich werde mir doch den Ball mit meiner kleinen Zauberfee nicht entgehen lassen.“
Rose kam herein und brachte eine Kanne frisch aufgebrühten Tee und eine Schale angemachten Porridge.
„Oh danke, Rose, niemand macht den Porridge so exzellent wie Sie, was täte ich nur ohne Sie … der wird meinen Magen gleich wieder einrichten …“
Rose lächelte geschmeichelt: „Das freut mich, Herr Professor und recht guten Appetit! Sie müssen wieder ein wenig zunehmen, Sie sind ja ganz von Kräften gekommen.“
„Mach’ ich, Rose, danke.“ Hubert von Herkomer lächelte, goss noch ein wenig Sahne über den Haferbrei, streute etwas Zimt darüber und begann, ihn langsam und genießerisch zu löffeln. Auch Margaret bediente sich am Frühstücksbuffet und schenkte sich eine Tasse English breakfast tea ein, ihren Lieblingstee am Morgen. Schweigend saßen sie am Frühstückstisch und nichts erinnerte mehr an die fröhliche Stimmung des Vortages. Schließlich erhob sich Gwenddydd. „Bonny muss mal raus, Daddy, darf ich gehen?“
„Natürlich, Kind, lauf nur, der Hund braucht Erziehung, und sei nur ein wenig streng mit ihm … geh ruhig mit, Tutti.“ Der Vater machte eine erlaubende Handbewegung, nickte Lorenz zu, und die Geschwister verließen das Esszimmer. Bonny tapste zufrieden hinterdrein.
„Ja, strenge Erziehung … Mein Lieber … ich weiß nicht, ob du unsere Tochter nicht zu sehr verwöhnst. Du versuchst, alles Schwere von ihr fernzuhalten, ich weiß nicht, ob das richtig und gut für sie ist …“ Margaret von Herkomer seufzte und blickte ihren Kindern ein wenig besorgt nach, als sie mit Bonny in den Park liefen.
„Ach was, der Ernst des Lebens kommt noch früh genug auf sie zu. Lass sie doch noch ein wenig die Unbeschwertheit der Jugend genießen …
Übrigens, was meinst du, sollten wir nicht vielleicht diesen Dr. Rupfle mit Gemahlin auch zu unserem Festdinner und Ball am Samstag einladen? Es könnte doch nicht schaden, sich mit ihm gut zu stellen …“ Fragend schaute Hubert seine Frau an.
„Ich weiß nicht, er ist mir nicht eben sympathisch, immer wenn ich ihn sehe, habe ich unwillkürlich das Bild eines Geiers vor mir …“ Margaret zog die Stirn in Falten.
„Ach, Maggie, hast du vielleicht auch wie Gwenny zu viele Schauermärchen gelesen? Das kommt nur daher, weil er sich beim Operieren immer vornüberbeugen muss. Das macht den Hals lang, und daher kommt sein kleiner Buckel. Na ja, und vielleicht auch von seinen nicht gerade bescheidenen Honoraren …“ Hubert lachte und nahm seine Frau in den Arm.
„Nun, mag sein, wie du meinst.“ Ganz waren ihre Bedenken nicht zerstreut und ihr Lächeln wirkte aufgesetzt.
Hubert stand auf, ging in den Salon und nahm eine der gedruckten Einladungskarten aus dem Sekretär. Er kritzelte ein paar Zeilen darauf und bat Babette, sie Dr. Rupfle zu überbringen.
Neun Uhr am Abend
11. Oktober 1913
„Jetzt schau dir nur unsere beiden Kinder an! Wie erwachsen sie doch geworden sind! Und erst unsere Kleine – wie sie den Männern den Kopf verdreht! Sie sieht aber auch allerliebst aus, und, das muss ich einfach sagen, sie ist die Schönste hier im Saal!“ Hubert von Herkomer stand mit seiner Frau Margaret an der Bar des Zederbräu-Saals und blickte voller Stolz auf Gwenddydd und Lorenz, die im Walzerschritt über das Parkett wirbelten. „Abgesehen natürlich von ihrer Frau Mutter …“ Galant küsste er seiner Frau die Hand.
„Ach, du ewiger Charmeur … ja, aber sie ist wirklich eine bildschöne junge Lady geworden, und das Kleid steht ihr ganz wunderbar, sieh nur, wie die kleine Schleppe sich bauscht, wenn sie sich im Tanz dreht, und der goldene Spitzenüberwurf umschmeichelt sie wie ein Schleier …“ Auch Lady Margaret lächelte und blickte stolz auf ihre Tochter, die nach der Eröffnung des Balls mit ihrem Vater kaum einmal zur Ruhe kam. Groß und schlank gewachsen, dabei gut proportioniert, überragte sie die meisten Landsberger Damen um einen halben Kopf. Ihre samtig schwarzen Haare waren elegant hochgesteckt und hoben sich apart von dem mit Brillanten verzierten Goldreif um den Kopf ab. Sie erregte Aufsehen und spürte amüsiert die verstohlen bewundernden Blicke der Männer und die leicht neidischen Blicke der Damen. Ihre Erscheinung hatte etwas Fremdländisches, Dunkles, ja Geheimnisvolles.
Doch mit Einsetzen der Musik war der Bann schnell gebrochen und ihr Tanzbüchlein füllte sich zusehends. Jetzt kam sie, erhitzt vom Tanz, in Begleitung des Bürgermeisters Dr. Strasser zu ihren Eltern an die Bar. Rote Wangen zierten ihr sonst so zart blasses Gesicht und ihre dunklen Augen strahlten. „Wunderbar Daddy, eine Londoner Kapelle könnte nicht schwungvoller spielen, und ja, auch die Landsberger können tanzen …“
„Na ja, Kind, schließlich haben wir auch das Münchner Salonorchester engagiert.“ Der Vater nahm seine Tochter am Arm und wollte gerade mit ihr auf ihren Tisch zusteuern, da trat seitwärts ein Paar auf sie zu.
„Herzlichen Dank auch für Ihre geschätzte Einladung, Herr Professor, die wir gerne angenommen haben.“
Die Stimme kannte sie doch – der Drache! Gwenddydd erschrak, als sie die Gestalt des Dr. Rupfle erblickte und sich unmittelbar seinem Blick ausgesetzt sah. Unwillkürlich fuhr sie zusammen. Neben ihm stand eine schmächtige blonde Frau, die ihm gerade bis zur Schulter reichte. Lady Margaret hatte plötzlich das ungute Gefühl, als baue sich eine Spannung auf. Sie wandte sich an die Arztgattin und bemühte sich um einen leichten Ton: „Gern geschehen. Wie geht es Ihrer Jüngsten? Ich habe gehört, man darf zum Familiennachwuchs gratulieren!?“
„Oh ja. Danke schön, sehr freundlich. Nun, es ist allerdings leider wieder nur ein Mädchen geworden, und mein Mann hatte sich doch nach drei Mädchen so sehr einen Sohn und Stammhalter gewünscht …“ Die Stimme der kleinen Frau klang so zart, wie sie aussah.
„Aber ich bitte Sie, gnädige Frau, verehrter Herr Doktor, sehen Sie doch nur, welche Freude, ja welcher Reichtum es ist, eine Tochter zu haben! Keine Sekunde habe ich es bedauert, dass mein jüngster Spross ein Mädchen wurde.“ Hubert von Herkomer drückte Gwenddydds Arm.
„Nun, Sie haben ja auch schon einen Sohn, im Gegensatz zu mir.“ Dr. Rupfles Blick verdüsterte sich, schweifte zur Tanzfläche und blieb auf Lorenz haften.
„Ja, ich habe sogar noch einen Sohn, Siegfried, meinen Erstgeborenen. Diesmal konnte er nicht mitkommen, er muss sich zu Hause um unsere neue Filmproduktion kümmern. Dennoch, glauben Sie mir, ich möchte keinen Augenblick der nunmehr 20 Jahre mit meiner Tochter missen.“
Gwenddydd war es unbehaglich zumute und unmerklich zupfte sie am Arm ihres Vaters.
„Darf ich mir erlauben, gnädiges Fräulein, Sie um einen Tanz zu bitten? Ich hoffe, in Ihrem Büchlein ist noch etwas frei.“ Mit einem höflichen Lächeln wandte sich Dr. Rupfle Gwenddydd zu.
In diesem Moment ertönte ein Tusch. Der Kapellmeister klopfte mit seinem Dirigentenstab an das Pult und rief in den Tanzsaal: „Meine Herrschaften, verehrte Damen und Herren, bitte alles aufstellen zur Münchner Française!“ Und bevor Gwenddydd sich recht versah, zog Dr. Rupfle sie zu den bereits aufgereihten Paaren. Formvollendet verbeugte er sich vor ihr, und nichts war an seiner Haltung auszusetzen. Dennoch fühlte sie sich unwohl. Seine Augen musterten sie so durchdringend, dass sie sich nackt fühlte, und ihr schien, als fasste er sie enger als nötig.
„Es tut mir aufrichtig leid, gnädiges Fräulein, wenn ich Sie neulich nachts erschreckt habe, das war nicht meine Absicht. Darf ich auf Vergebung hoffen?“
„Nun, dazu besteht kein Anlass, ich war nur etwas aus dem Schlaf geschreckt … und schließlich die Sorge um meinen Vater … Ich bin normalerweise nicht von ängstlicher Natur“, erwiderte sie, und ihre Stimme kam ihr selbst etwas gepresst vor.
„Sie tanzen ganz wunderbar, gnädiges Fräulein, und wenn ich das sagen darf, Ihre Robe ist exquisit, man sieht sofort die Pariser Eleganz. Sie steht Ihnen ganz ausgezeichnet und ist Ihrer Schönheit wahrhaft angemessen. Wir haben übrigens in Deutschland ein Märchen namens Schneewittchen, ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Genauso wie Sie habe ich mir stets diese Prinzessin vorgestellt, von der es hieß, sie sei die Schönste im ganzen Land: Haut wie Alabaster, Haar so schwarz wie Ebenholz, ein Duft von Veilchen und Narzissen und Lippen so rot wie Blut …“
Obwohl sie Komplimente gewöhnt und diesen nicht abgeneigt war, errötete Gwenddydd und war erleichtert, dass der Platzwechsel sie einer Antwort enthob. So ein eingebildeter Galan, und wie geschraubt er spricht … Er macht mir irgendwie Angst, vielleicht ist es aber auch nur sein Blick oder der kleine Buckel, was mich abstößt …, dachte sie. Seine stahlblauen Augen hatten etwas Durchdringendes. Sie fühlte sich erdrückt, entkleidet. Obwohl er etwas kleiner gewachsen war als sie und die hohe Stirn schon auf eine beginnende Glatze verwies, machte er in seinem Frack durchaus eine elegante Figur. Sein Griff war fest, er führte sie sicher und elegant übers Parkett, ein guter Tänzer, zweifelsohne. Sie spürte seine Hand auf ihrem nackten Rücken, und jetzt wäre sie froh gewesen, ihr Rückendekolleté wäre nicht ganz so großzügig ausgefallen.
Die Tanzformation der Damenkette gab ihr erneut die Möglichkeit, sich von ihm zu lösen. Doch wie üblich mündete die Française abschließend in einen Walzer, und Gwenddydd blieb nichts anderes übrig, als mit ihm im Walzerschritt über das Parkett zu fliegen. Er tanzte vorzüglich, das musste sie zugeben, und sie wusste, dass sie beide ein schönes Bild abgaben. Dennoch fühlte sie sich erlöst, als der Tanz zu Ende war. Galant verneigte Dr. Rupfle sich vor ihr und geleitete sie zum Tisch ihrer Eltern.
„Ich bringe Ihnen das Fräulein Tochter zurück.“ Er verbeugte sich vor Hubert von Herkomer. „Darf ich mich nach dem werten Befinden erkundigen?“
„Danke der Nachfrage.“ Der Professor war unangenehm berührt und wechselte rasch das Thema. „Heute wollen wir noch einmal ausgiebig feiern, denn bald heißt es Abschied nehmen und es geht nach Hause in unser kühles England.“
„Oh, schon? Falls Sie übrigens für die Reise noch einer Stärkung bedürfen – stets gerne zu Diensten …“ Mit einem tiefen Diener verabschiedete sich Dr. Rupfle, bedankte sich bei Gwenddydd noch einmal für den Tanz und küsste den Damen nonchalant die Hand.
Vielleicht tue ich ihm unrecht und es ist immer noch dieser dumme Albtraum, den ich mit ihm in Verbindung bringe. Ich kann gar nichts an ihm oder seinem Benehmen aussetzen, im Gegenteil, vielleicht ist er ja doch der weiße Ritter … und schließlich hat er Daddy geholfen, dachte Gwenddydd und schenkte ihm ihr bezauberndstes Lächeln.
Josef Rupfle verbeugte sich nochmals, zwirbelte zum wiederholten Male seinen Kaiser-Wilhelm-Bart und verschwand rasch im Gewühle des Saals.
IN DER SPÖTTINGER VILLA
Zehn Uhr am Morgen
12. Oktober 1913
„Warum wolltest du denn gestern so schnell nach Hause? Es war doch ganz nett, und die Herkomers waren so freundlich, kein bisschen arrogant. Und du hast nicht ein einziges Mal mit mir getanzt …“ Anna Rupfle schmollte, als sie sich nach dem Versorgen der Kinder endlich an den Frühstückstisch setzen und mit ihrem Mann ein spätes Sonntagsfrühstück einnehmen konnte. Die Jüngste stillte sie noch. Jetzt hatte sie die vier kleinen Mädchen in die Obhut der Kinderfrau gegeben und man hörte ihr Lachen und Gebrabbel von den Kinderzimmern im hinteren Teil der Beletage.
„Du weißt ja, ich bin nicht der große Tänzer.“ Josef Rupfle schaute kaum auf aus seinem Fachjournal, das er beim Frühstück las.
„Na ja, aber mit der Herkomer-Tochter hast du ausgiebig und offenbar mit Hingabe getanzt …“, beklagte sich Anna, und ihre Stimme klang vorwurfsvoll.
„Unsinn, das war rein geschäftlich, schließlich ist ihr Vater mein bester und zahlungskräftigster Patient. Das hat schon Eindruck gemacht auf die Herren und Damen Honoratioren oder solche, die es zu sein meinen, als er mich als seinen Hausarzt vorstellte! Solche Kontakte muss man pflegen. Hätten wir mehr Patienten seiner Kategorie, wären unsere finanziellen Sorgen erheblich geringer. Der Haushalt, die Kinder, das Personal, die Praxis mit der neuen Klinik – all das verschlingt eine Unmenge Geld, und die Villa ist schließlich auch noch mit Hypotheken belastet. Doch das interessiert dich ja nicht, alles dreht sich bei dir immer nur um die Kinder. Von meiner Arbeit verstehst du nichts und willst auch nichts davon wissen.“
„Immerhin hat mein Vater eine beträchtliche Summe zum Kauf der Villa beigesteuert … und dass er uns alle mit den feinsten Stoffen aus seiner Schneiderei einkleidet, darfst du auch nicht vergessen. Gerade die Wäsche und Kleidung für die Mädchen würden einen guten Teil deines Salärs aufzehren.“ Annas Stimme klang zaghaft, sie machte ein betretenes Gesicht. Stumm trank sie ihren Kaffee und zwischen den Eheleuten breitete sich ein spannungsgeladenes Schweigen aus.
„Ja, ja, ich weiß, du musst es mir nicht immer wieder aufs Butterbrot schmieren.“ Dr. Rupfle faltete geräuschvoll seine Zeitung zusammen und erhob sich. „Ich bin jetzt oben in der Praxis.“
„Aber Josef, heute, am Sonntag? Ich dachte, wir könnten heute nach dem Mittagessen alle zusammen ein wenig am Lech entlang spazieren gehen. Die Sonne scheint noch so warm, die langen, dunklen Wintertage kommen noch früh genug …“
„Meinetwegen, aber bis zum Mittag habe ich noch zu tun.“ Er nahm einen Stapel Zeitschriften unter den Arm und zog sich in das obere Stockwerk zurück. Hier hatte er sich neben dem Ordinationszimmer ein Büro eingerichtet, in Gedanken nannte er es sein „Herrenzimmer“. Er liebte diesen Rückzugsort. Ein wuchtiger Schreibtisch mit einem bequemen Ledersessel war so angeordnet, dass er von hier aus auf den Lech und die Silhouette der Stadt blicken konnte. Zwei Regalwände hinter ihm waren deckenhoch mit Büchern und Fachliteratur bestückt und gaben ihm ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit. Auf der eleganten Sitzgruppe, bestehend aus Sofa und zwei Ledersesseln, empfing er gerne seine Privatpatienten. Ein Ölgemälde des Prinzregenten darüber strahlte Gediegenheit und Seriosität aus. Für angenehme Wärme sorgte ein Kohleofen.
Als er die Villa vor zwei Jahren einigermaßen günstig erwerben konnte, wohl, weil sie auf der schwäbischen Seite der Stadt lag, der Katharinenvorstadt, begann er, hier neben seinen Praxisräumen einige Klinikzimmer für seine Augenoperationen einzurichten. Das waren gewaltige Investitionen, die viel Geld verschlangen, und obwohl die Schwiegereltern sie großzügig unterstützten, war das Geld immer knapp und die Schulden drückten auf sein Gemüt. Er selbst kam aus kleinen Verhältnissen, sein Vater war Metzgermeister in einem kleinen Dorf am Bodensee, da konnte er wenig Unterstützung erwarten. Dass er überhaupt hatte studieren können, war allein der Fürsprache des Dorfpfarrers und der großzügigen Förderung eines Onkels aus dem Stadtmagistrat zu verdanken. Sie hatten früh die Intelligenz und auch den Ehrgeiz des jungen Josef erkannt. Die Lateinschule in Kempten hatte er mit Bravour gemeistert und in München bereits mit 25 Jahren promoviert. Die Assistenzarztzeit und Facharztausbildung folgten, und schließlich war er 1906 mit seiner jungen Frau von Mannheim hierher nach Landsberg am Lech gezogen. In der altbayerischen Stadt galt er als „Zuagroaster“ und trotz Zulassung als praktischer Arzt und Facharzt für Augenheilkunde musste er sich seine Reputation hart erkämpfen. Da kam so ein Patient wie Hubert von Herkomer, ein begüterter englischer Malerfürst mit schwacher Gesundheit, gerade recht. Asthma und ein von Kindheit bestehendes Magenleiden machten ihm schwer zu schaffen, und seit man ihm in England einen Großteil des Magens wegen eines Karzinoms entfernt hatte, benötigte er immer wieder starke und stärkste Schmerzmittel.
Dr. Rupfle ging zum Fenster und öffnete es.
Die milchige Herbstsonne schien ins Zimmer und er atmete tief die frisch-feuchte Luft ein. Herbstwind rüttelte an den alten Birken und ließ kleine Blättchen wie flirrenden Goldregen herabrieseln. Durch die Bäume hindurch schimmerte das goldgelb gedeckte Dach des Mutterturms. Der Blick auf das Lechwehr und den in Kaskaden darüber springenden Fluss mit den malerischen Häusern am gegenüberliegenden Ufer der Landsberger Altstadt stimmten ihn wie immer versöhnlich. Er liebte diesen Ausblick und dieses Haus. Schon immer hatte er die Villa mit dem großen Gartengrundstück bewundert: Das zweigeschossige Gebäude mit seinem weit vorspringenden Walmdach, dem Erker, dem hohen Souterrain, der imposanten Außentreppe mit dem hohen Turm darüber und dem Zierfachwerk besaß eine gleichermaßen malerische wie herrschaftliche Ausstrahlung. Anfänglich hatten er und seine Frau mit den drei kleinen Kindern und einer gerade eröffneten Praxis recht beengt gewohnt, und als er erfuhr, dass die Villa zum Verkauf stand, hatte er alle Hebel in Bewegung gesetzt, sie zu erwerben. Doch womöglich hatte er sich damit übernommen.
Er schloss seufzend das Fenster und zwirbelte seinen Kaiser-Wilhelm-Bart. Mit seinen 43 Jahren fühlte er sich im besten Mannesalter und im Zenit seiner Laufbahn. Er hatte es allen bewiesen: Aus kleinbürgerlichen Verhältnissen hatte er sich hochgearbeitet. Und jetzt verfügte er auch noch über eine kleine, aber feine angeschlossene Klinik für diverse Augenoperationen.
Er konnte zufrieden sein. Aber war er es auch? War das schon alles in seinem Leben gewesen und ging es von nun an bergab? Wieder entfuhr ihm ein Seufzer.
Zugegeben, seine Frau Anna war eine gute Partie, ein zartes, junges Mädchen, wohlerzogen, Tochter eines Schneidermeisters mit großem Betrieb, keine unbeachtliche Mitgift, obendrein noch hübsch und gut gebaut. Es war ein wenig makaber, aber sie hatten sich bei der Beerdigung einer gemeinsamen entfernten Verwandten kennen- und lieben gelernt. Ihre sanften Blauaugen und das lockige Blondhaar zogen ihn an. Eine lange Brautzeit folgte, bis er endlich eine Familie ernähren und um ihre Hand anhalten konnte.
Sieben Jahre waren sie nun verheiratet. Aber jetzt – wo ist sie geblieben, seine Elfe, seine blonde Fee? Ein Muttertier ist sie geworden mit hängenden Brüsten, den Schwangerschaften und Stillzeiten geschuldet. Und wie hatten ihn diese Brüste früher entzückt: Runden, festen Äpfelchen gleich hatten sie im Nu all seine Sinne entflammt. Fünf Mal hatte sie geboren: Das erste Kind, ein Sohn, war im Alter von vier Monaten den plötzlichen Kindstod gestorben. Danach folgten vier weitere Geburten, immer Mädchen, das jüngste Kind war erst ein paar Monate alt und wieder ein Mädchen. Anna war trotz Kinderfrau rund um die Uhr mit den Kleinen beschäftigt. Sie waren der Mittelpunkt ihres Lebens, und ob er darin noch eine größere Rolle spielte, wusste er nicht.
Und, ja, er musste sich eingestehen, dass er mit so kleinen Kindern nicht viel anfangen konnte. Die Großen spielten mit ihren Puppen, die zwei anderen waren im Kleinkind- und Säuglingsalter. Wieder seufzte er: vier Mädchen – zugegeben, eine große Enttäuschung. Er hatte sich sehnlichst einen Sohn gewünscht. Der Herkomer hat gut reden, dachte er, seine Tochter wäre sein Reichtum, klang es ihm noch im Ohr. Kein Wunder, wenn man schon zwei Söhne hat und Reichtum und Ruhm sich die Hand geben. Er wusste, dass Hubert von Herkomer als deutsch-englischer Malerfürst und Porträtist der feinen Gesellschaft Europas mit zu den reichsten Männern des Kontinents gehörte. Wer in der europäischen Gesellschaft auf sich hielt, bestand auf einem von Hubert von Herkomer gemalten Porträt.
„Schluss jetzt mit trüben Gedanken“, maßregelte er sich selbst. Er setzte sich in seinen Ledersessel, lehnte sich zurück und nahm den Stapel der noch nicht gelesenen Fachzeitschriften zur Hand. Genießerisch zündete er sich eine Zigarre an und schlug das Bayerische Ärzteblatt auf. Er versuchte, sich zu konzentrieren und aufmerksam die Fachartikel, Berichte vom Deutschen Ärztetag, Fakultätsnachrichten und die neuesten Erkenntnisse der pharmazeutischen Industrie zu lesen.
Doch wie von Zauberhand schob sich immer wieder das Gesicht der jungen Gwenddydd Herkomer dazwischen. Ihm war, als spüre er noch die nackte Haut ihres Rückens unter seiner Hand, als er sie beim Tanz führte, und als atme er noch ihren zarten Duft, der sie bei jeder ihrer Bewegungen umgab. Was für eine bildschöne, geheimnisvolle junge Frau! Eine seltsam faszinierende Wirkung ging von ihr aus. Kindfrau oder Femme fatale? Schneewittchen oder Zauberin? Und er sah ihr Lächeln wieder, das sie ihm zum Abschied schenkte, blickte in ihre dunklen Augen, die ihn beim Abschied plötzlich freundlich ansahen – und die Zeilen des Ärzteblattes verschwammen endgültig vor seinen Augen.
Magisch zog es ihn hinab in die Ereignisse des vergangenen Abends und er tauchte erneut in seinen Zauber ein: Noch einmal tanzte er mit Schneewittchen, hielt ihre biegsame Gestalt in seinen Armen, nahm ihren Atem, ihren Duft wahr und vermeinte, ihre Gegenwart mit allen Sinnen zu spüren. Er fühlte sich jung und lebendig wie seit Langem nicht mehr und empfand ein Begehren, das er längst glaubte, hinter sich gelassen zu haben.
Beinahe war er erleichtert, als der Gong aus dem Esszimmer im Erdgeschoss und der Ruf seiner Frau ihn aus seinen Träumen rissen. Seufzend stand er auf, legte die Journale weg, verließ sein Herrenzimmer und stieg die Stufen zum Esszimmer hinab.
Und der Duft des sonntäglichen Bratens ließ ihn endgültig in die häusliche Gegenwart zurückkehren.
IN ENGLAND
Vier Uhr am Nachmittag
2. November 1913
Nebel lag wie dicke Watte über der Stadt, als der Zug in Victoria Station einfuhr. Schien bei der Überfahrt nach Dover über den Ärmelkanal noch zaghaft die Sonne und ließ die weißen Kreidefelsen wie zur Begrüßung aufleuchten, legte sich kurz danach Nebel über das Land.
Hubert und Maggie von Herkomer waren in ihrem komfortablen Zugabteil der 1. Klasse eingenickt, Lorenz war in eine Fachzeitung über Maschinenbau vertieft und nur Gwenddydd mit Bonny auf dem Schoß versuchte immer wieder, einen Blick auf die englische Landschaft zu erhaschen. Diesmal war ihr der Abschied von der Sommerfrische in Landsberg am Lech besonders schwergefallen. Ein herrlicher Sommer war es gewesen, mit wunderbaren Festen und Ausflügen, und noch nie hatte der Vater so viel Zeit mit der Familie verbracht wie diesmal. Sinnend blickte sie auf ihren Vater, der neben ihr saß. Zum ersten Mal nahm sie wahr, dass der strahlende Held ihrer Kindheit alt wurde. Nachdenklich betrachtete sie sein Gesicht, das im dämmrigen Nachmittagslicht des Zuges fahl und müde wirkte. Behutsam berührte sie seine schmalgliedrigen, doch auch abgearbeiteten Künstlerhände und lehnte schließlich den Kopf leicht an seine Schulter. Der Duft seines Rasierwassers, ein Bukett aus Zedernholz und Moschus, stieg ihr in die Nase – dieser Duft, den sie seit Kindertagen mit ihrem Vater verband. Ihr Blick glitt von ihm über den Bruder zur Mutter. Meine Familie, dachte sie, wie ich sie liebe! Ein warmes, inniges Gefühl stieg in ihr auf. „Küken“, so nannte ihr Vater sie oft, und wenn sie auch meist gegen diesen Spitznamen rebellierte, im Moment fühlte sie sich tatsächlich geborgen wie ein Küken im warmen Nest.
War es die traute, ja intime Atmosphäre des Zugabteils, die Stille im Waggon oder das schemenhafte Vorbeiziehen der umliegenden Landschaft – sie wusste es nicht, aber ihr war plötzlich, als sei sie aus der Zeit gefallen. Ein tiefes Gefühl von Glück und Geborgenheit durchströmte sie. Zeit und Raum schienen sich aufzulösen, so als atme dieser Augenblick Ewigkeit – und er brannte sich ihr in Kopf und Herz ein wie eine dreidimensionale Fotografie.
Der langanhaltende Pfiff der Lokomotive riss sie aus ihren Träumen und holte sie in die Gegenwart zurück. Der Zug näherte sich London und die Familie erwachte zum Leben. Geschäftiges Aufstehen, Ankleiden und der Griff nach dem Handgepäck beendeten im Handumdrehen die geruhsame Bahnfahrt. Das große Gepäck reiste separat im Gepäckwagen.
Allmählich freute sich Gwenddydd auf zu Hause, auf ihr Heim in Bushey, ein malerisches Dorf, 17 Meilen nordwestlich von London, auf die Freundinnen, den Park mit dem neuen Rosengarten, das Schloss Lululaund, in dem die Familie repräsentierte und der Vater seine berühmten Porträts malte. Eine weite Reise lag hinter ihnen, von München über Karlsruhe nach Frankreich, Metz, Reims bis nach Calais. Von dort hatten sie die Fähre nach Dover genommen, bevor sie mit der North Western Railway nach London weiterfuhren.
Jetzt endlich kamen sie an. Zischend und dampfend fuhr der Zug in Victoria Station ein. Die Abteile der 1. Klasse lagen im vorderen Teil des Zuges, gleich hinter dem Speisewagen. Die Türen öffneten sich und nach und nach quälte sich die Familie Herkomer mit steifen Gliedern vom langen Sitzen aus dem Abteil. Der Nebel war nun sogar bis in das Bahnhofsgelände eingezogen und dämpfte das Stimmengewirr und das laute Rufen nach den Gepäckträgern auf den Bahnsteigen.
„Siegfried“, Hubert von Herkomer sah seinen ältesten Sohn sofort, winkte und ging freudestrahlend auf ihn zu, „wie schön, dass du uns abholst.“
„Natürlich, Dad, ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Ist alles in Ordnung, geht es euch gut?“
„Ja, ja, ein wenig müde sind wir von der Reise, aber alles hat bestens geklappt. Jetzt freuen wir uns, wieder zu Hause zu sein.“
Mittlerweile waren die Familie und auch ihre Köchin Rose, die im Abteil der 2. Klasse fuhr, ausgestiegen und alle versammelten sich auf dem Bahnsteig. Gwenddydd hielt ihr Hundekörbchen mit Bonny fest an sich gedrückt.
„Sieh an, ein neues Familienmitglied, wie reizend, welcome in merry old England …“ Siegfried lachte, streichelte das Hundekind und umarmte seine Halbschwester. Er stammte aus der ersten Ehe seines Vaters und war knapp 20 Jahre älter als Gwenddydd, doch die Geschwister verstanden sich gut, und Gwenddydd liebte ihre beiden großen Brüder.
„Ja, siehst du, jetzt bin ich nicht mehr die Jüngste in der Familie …“, lachte auch Gwenddydd.
„So, und jetzt kommt alle mit, nach Bushey fahren wir bequem mit dem Automobil. Das Gepäck reist uns nach.“ Siegfried hatte bereits zwei Träger organisiert, die jetzt die zahlreichen Koffer und Taschen auf ihre Wagen luden und sich darum kümmerten, dass sie ordnungsgemäß per Eisenbahn weitertransportiert würden.