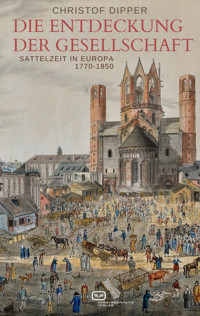
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vergangenheitsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist "Gesellschaft?" Christof Dipper beschreibt und analysiert die Entdeckung dessen, was wir als "Gesellschaft" verstehen. In den 80 Jahren zwischen 1770 und 1850 überschritt die deutsche Gesellschaft eine Schwelle und veränderte sich drastisch. Vielfach ist diese als "Sattelzeit" (Reinhart Koselleck) beschriebene Übergangsphase skizziert worden. Doch Christof Dipper schlägt mit seiner Studie einen besonderen Weg ein: Was wussten die Zeitgenossen davon, d.h. was konnten sie über die gesellschaftliche Transition lesen und wie entstand ihr Gefühl, Teil einer "Gesellschaft" zu sein? Dipper beschreibt, wie sich damals das Wissen über gesellschaftliche Vorgänge entwickelt hat. Zeitgenössische Wahrnehmungen zwischen 1770 und 1848 werden im zweiten Teil des Buches dokumentiert. Den Schluss bildet der Versuch, diese gesellschaftliche Schwelle zu erklären und die von ihr geprägte Übergangsgesellschaft aus heutiger Sicht zu beleuchten. Eine exzellente Studie – für das Verständnis des Werdens und der Basis unserer modernen Gesellschaft unerlässlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christof Dipper
Die Entdeckung der Gesellschaft
Drei Perspektiven(1770–1850)
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-86408-311-2
eISBN: 978-3-86408-313-6
Korrektorat: Tobias Keil
Coverabb.: GDKE RLP, Landesmuseum Mainz, Foto: U. Rudischer
Grafisches Gesamtkonzept, Titelgestaltung, Satz und Layout:Stefan Berndt – www.fototypo.de
© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin / 2023
www.vergangenheitsverlag.de
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Inhalt
Einleitung
I.Die Entdeckung der Gesellschaft.Zur Wissensgeschichte eines modernen Begriffs
1. Einleitung
2. Die Metaphysik der ‚Gesellschaft‘ in der deutschen Spätaufklärung
3. Der Tatsachenblick im westlichen Europa
4. Französische Ursprünge der Soziologie
5. Erste Abschiede vom metaphysischen Gesellschaftsbild in Deutschland
6. Zwischenbilanz
7. Drei Wege aus der alteuropäischen Gesellschaftsidee
a. Jahrhundertanfang: Entdeckung ohne gesellschaftliche Relevanz
b. Jahrhundertmitte: Soziale Frage und soziologischer Gesellschaftsbegriff
c. Nach der Revolution: Der lange Weg vom Wissen zur Wissenschaft
8. Rück- und Ausblick
II.Die Gesellschaft zwischen 1770 und 1848 in zeitgenössischer Sicht
Vorbemerkung
1. Probleme der Beschreibung
2. Der Zeitraum und seine Binnengliederung
3. Forschungsstand
4. Bevölkerungswissen
5. Die Ausgangslage 1770 bis 1780/90
6. Nach der Revolution (1810-1825)
7. Die Hungry Forties (1835-1847)
8. Rückblicke und Ausblick auf 1848
9. Die Beobachtungen der Zeitgenossen im Vergleich
III.Übergangsgesellschaft. Die ländliche Sozialordnung in Mitteleuropa um 1800
1. Einleitung
2. Bevölkerungsbewegung
Tabelle 1: BevölkerungsentwicklungMitteleuropas 1700 – 1820
3. Antworten aus dem Bereich der Landwirtschaft
4. Antworten aus dem Bereich Gewerbe und Nebenerwerb
5. Die neue Gesellschaftsstruktur in Zahlen
Tabelle 2: Erwerbstätigkeit nachWirtschaftssektoren um 1800
6. Reaktionen der Betroffenen
7. Antworten der Obrigkeiten
8. Weiterführende Überlegungen
Graphiken
Namensregister
Sachregister
Geografisches Register
Reinhart Koselleck zum 24. April 2023
Einleitung
In dieser kurzen Einleitung sollen lediglich Buchtitel und Vorgehensweise erklärt werden. Inhaltliche Hinführungen stehen jeweils am Beginn der drei Kapitel.
Warum, so fragt sich wohl mancher Leser, ist im Titel von ‚Sattelzeit‘ die Rede? Verweist dieser Begriff nicht auf einen geistesgeschichtlichen und ganz besonders auf einen begriffsgeschichtlich hochrelevanten Vorgang, den man am besten mit Selbstreflexivität umschreiben kann? Nun, Koselleck, der Schöpfer dieses Begriffs, zögerte zwar auf Befragen im Jahre 1996, „ob sich die Sattelzeit aus ihrer Selbstreflexivität in einen objektiven Kriterienkatalog überführen läßt“, sprach aber im selben Atemzug davon, dass es sich ganz generell um eine „Schwellenzeit“ handle, die das Jahrhundert von 1750 bis 1850 kennzeichne und für Deutschland „ziemlich objektivierbar[e]“ Sachverhalte aufweise, worunter auch „die Auflösung der Ständegesellschaft“ falle.1 Die ‚Schwelle‘ beschränkt sich also für den Erfinder des Begriffs ‚Sattelzeit‘ nicht auf begriffsgeschichtliche Umbrüche. Es ist folglich legitim, von einer sozialgeschichtlichen Sattelzeit zu sprechen, erst recht dann, wenn der Blick nicht nur von oben bzw. außen auf diesen Vorgang gerichtet wird, sondern wenn dabei in erster Linie die Zeitgenossen zu Wort kommen.
Damit ist schon angedeutet: Dieses Buch möchte nicht in erster Linie argumentieren, sondern den Zeitgenossen zuhören, und zwar umfassend und systematisch. Ein solches Buch fehlt bislang, wenn ich recht sehe, im deutschen Sprachraum, und das aus mehreren Gründen. Als erster sei ein ‚technischer‘ genannt. Bis vor kurzem war es außerordentlich mühsam, in hinreichender Zahl Bücher durchzuarbeiten, die in der fraglichen Zeit erschienen (und später nicht wieder aufgelegt worden) sind. Kaum eine Bibliothek besitzt sie alle, und nur eine oder allenfalls zwei in Deutschland die Mehrzahl davon. Seit aber vor einigen Jahren eine Reihe deutscher Bibliotheken groß angelegte Digitalisierungsprogramme aufgelegt haben – gerade rechtzeitig vor dem Lockdown während der Corona-Pandemie –, ist es sehr einfach geworden, Bücher, Zeitschriften und selbst manche Zeitungen auf den heimischen Bildschirm zu holen. Dieses Buch profitierte enorm von diesen Programmen, denn es beruht zum allergrößten Teil auf der Auswertung digitalisierten Materials.
Ein zweiter, ganz anders gearteter Grund hat mit dem Aufstieg der Sozialgeschichte und ihrem Selbstverständnis zu tun, eine kritische Deutung der deutschen Geschichte im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu liefern. Das frühe 19. Jahrhundert und erst recht die Spätaufklärung bieten für diesen Zweck wenig Reiz und fristen darum bis heute eher ein Schattendasein. Vor allem die Aufklärung wird von der Geschichtswissenschaft nach wie vor stark vernachlässigt – kein Vergleich zu ihrer Rolle in der Literaturgeschichte – und selbst die zu einer eigenen Disziplin aufgestiegene Frühe Neuzeit befasst sich zumeist mit anderem. Soweit sie sozialgeschichtlich interessiert ist, geht es ihr vorwiegend um ländliche Unruhen in dem, was (durch Übernahme marxistischen Vokabulars) heutigentags als „Spätfeudalismus“ bezeichnet wird.
Damit verbunden ist ein weiterer Grund, nämlich die Sorge, des Rückfalls in den Historismus bezichtigt zu werden, wenn man das Hauptgewicht auf die Aussagen aus der Zeit legt. Zwar ist seit dem linguistic turn der Historismusverdacht – Historismus verstanden als Verstehensorientiertheit, Theoriefeindlichkeit, blutleere Ideengeschichte, Gegenwartsverweigerung – nicht mehr so rasch zur Hand, aber Koselleck sah sich noch mit der von ihm entwickelten Begriffsgeschichte von den Anhängern der sich als kritisch verstehenden Sozialgeschichte lange dem Vorwurf ausgesetzt, er betreibe nichts anderes als „Schrumpfformen des Historismus“,2 während er selbst von einem „reflektierten Historismus“ sprach.3 Dieses Buch praktiziert eine modern verstandene Ideengeschichte, die Erkenntnisse als gesellschaftliche Gestaltungskraft versteht. In den ersten beiden Kapiteln geht es vor allem um Wahrnehmungsweisen, Selbstdeutungen und Sinnstiftungsmuster bzw. um deren Wandel im Laufe der Jahrzehnte. Die Aussagen unserer Autoren werden deshalb nicht in ein Theoriegerüst eingeordnet, sondern sollen sozusagen ‚für sich selbst‘ sprechen, natürlich nur im Rahmen dessen, was ihnen hier vom Verfasser zugestanden wird. Im Kern geht es um Wissensgeschichte und Sinnstiftungsmuster.
Das ist im dritten Kapitel ganz anders. Hier dominiert der moderne Forscherblick, d.h. die Perspektive von außen und oben und die Auseinandersetzung mit den Angeboten von Historikern und Ökonomen zur Zusammensetzung bzw. Veränderung der Bevölkerung um 1800. Die Ständegesellschaft begann sich damals am oberen wie am unteren Ende aufzulösen; das meiste davon spielte sich an der Basis der sozialen Pyramide ab, auf ihr liegt daher der Schwerpunkt. Allerdings beschränkt sich dieses Kapitel nicht auf statistische Erhebungen, sondern lässt auch hier die Zeitgenossen zu Wort kommen, ihre Reaktionen und Hoffnungen, sowie die Antworten der Obrigkeiten. Die Vermutung drängt sich auf, dass die Ungleichheit nie größer war als in der Zeit um 1800, jedenfalls wenn wir Pikettys Berechnungen Glauben schenken. Etwas davon verspürten fraglos viele Zeitgenossen.
Eine Zusammenfassung fehlt ebenso wie der Versuch einer Bilanz. Schließlich lassen sich drei unterschiedliche Perspektiven nicht auf eine Formel bringen. Deshalb hat jedes Kapitel am Ende abschließende Überlegungen, teilweise auch vergleichende Einschätzungen.
Diese Einleitung soll nicht enden ohne ein Wort des Dankes an den allzufrüh verstorbenen Freund und Kollegen Diethelm Klippel. Er, der große Kenner der Aufklärung, hat noch wenige Wochen vor seinem Tod am 5. Februar 2022 das erste Kapitel kritisch gesichtet und mit Anmerkungen und Anregungen versehen; ich bin ihnen gerne gefolgt. Die Verantwortung für dieses wie für die beiden anderen Kapitel liegt natürlich beim Verfasser. Dr. Alexander Schug vom Berliner Vergangenheitsverlag danke ich sehr für seine prompte Zusage, mein Manuskript zu drucken; die Herstellung des Buches war in jeder Hinsicht rekordverdächtig. Auch dafür großen Dank.
1 Im 1996 geführten Interview des Verfassers unter dem Titel: Begriffsgeschichte, Sozialgeschichte, begriffene Geschichte, in: Neue Politische Literatur 43 (1998), S. 187-205, hier S. 195.
2 Helmut Berding, Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte, in: Historische Zeitschrift, 223 (1976), S. 98–110, hier S. 107.
3 Interview (Anm. 1), S. 188.
I.
Die Entdeckung der Gesellschaft. Zur Wissensgeschichte eines modernen Begriffs
1. Einleitung
„There is no such thing as society”, stellte Margaret Thatcher 1987 kategorisch fest, und schob nach: “There are individual men and women and there are families”.1 Dieser Satz wurde legendär, denn er bestritt eine bis dahin nicht ernsthaft hinterfragte Gewissheit der Moderne, dass nämlich alle Menschen in Gruppen leben, die unterschiedliche Merkmale aufweisen und sich dadurch abgrenzen bzw., aus anderer Perspektive, Zusammenhalt finden – Gesellschaften eben. Wäre Thatcher zweihundert Jahre früher geboren, hätte sie mit ihrer Behauptung dagegen kaum Aufsehen erregt. Anders als heute sprach damals niemand von ‚Gesellschaft‘ als sozialer Grundtatsache, die jeden erfasst. „Das blose bey einander seyn“ mache „noch keine Gesellschafft“, versicherte 1735 das maßgebliche Lexikon deutscher Sprache. Dazu gehöre nämlich „eine würkliche Vereinbarung der Kräfte vieler zu Erlangung eines gemeinschaftlichen Zweckes“.2
Dieser Beitrag erschließt nicht die ganzen zweihundertfünfzig Jahre von 1730 bis 1980. Er fragt nur, seit wann man im Deutschen von ‚Gesellschaft‘ im modernen Sinne spricht und bricht dann ab. Es geht ihm, kurz gesagt, um den Wandel von ‚Gesellschaft‘ als einem aus ‚societas‘ eingedeutschten Zentralbegriff der abendländischen Naturrechtslehre, der alles Vertrag war, zur Entdeckung sozialer Formationen, die eben nicht vertraglich zu fassen waren, und damit zur Entdeckung von ‚Gesellschaft‘ überhaupt. Soziale und politische Umbrüche, die als Krisen wahrgenommen wurden, dienten dabei, wo nicht als Auslöser, so als mächtige Katalysatoren, und es verwundert darum nicht, dass Frankeich immer wieder eine Schlüsselrolle spielte. Es handelt sich also um eine Wissens- und Wissenschaftsgeschichte zwischen 1750 und 1880, die, kein Wunder, sämtliche Koselleck’schen Kriterien der sattelzeitlichen Veränderungen der Semantik erfüllt.3
Laut Zedler kam es also auf den Zweck an und so fielen unter das Rubrum ‚Gesellschaft‘ so unterschiedliche Dinge wie Familie, Gemeinde, Zunft und Handelskompanien, ja teilweise sogar Kirche. Der umfassendste solcher Zusammenschlüsse war natürlich der Staat, der in aristotelischer Tradition als ‚societas civilis‘ bzw. auf Deutsch als ‚bürgerliche Gesellschaft‘ bezeichnet zu werden pflegte, die folglich ihrerseits, wie es im preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794 hieß, „aus mehrern kleinern, durch Natur oder Gesetz oder durch beide zugleich verbundenen Gesellschaften und Ständen“ bestehe.4
Man sprach also im Deutschen durchaus auch früher von ‚Gesellschaft‘, und zwar ausgesprochen häufig, aber gemeint war dabei meist der Staat, für den es vor 1800 keinen eigenen theoriefähigen Begriff gab5 – schon weil, anders als im Westen Europas weder das Reich noch die Reichsstände Staaten im modernen Sinne waren, aber für die dominante Naturrechtslehre genauso wie das französische Königreich eine ‚societas civilis‘ oder eben ‚bürgerliche Gesellschaft‘ darstellten. Staat und Gesellschaft waren hier nicht geschieden, denn in den Ständen bildete sich nicht nur die gesamte soziale Ordnung ab, sondern sie nahmen zugleich an der Herrschaft teil – jedenfalls der Idee nach, während in Wirklichkeit mindestens die mächtigsten Landesherren sich von dieser Mitherrschaft mehr oder weniger befreit hatten und die Regierten in eine einheitliche Untertanengesellschaft zu verwandeln bemüht waren. Das war die Logik des Absolutismus, zu dem Jean Bodin bereits 1576 den Grund gelegt hatte – damals, um den religiösen Bürgerkrieg zu beenden.6
Bei dieser traditionalen Ordnung blieb es bekanntlich nicht. Die Geschichtswissenschaft spricht seit rund hundert Jahren vom Fundamentalprozess der Trennung von Staat und Gesellschaft, der, was Deutschland betrifft, auf der sachlichen Ebene seit der Französischen Revolution7 bzw. den preußischen Reformen8 zu beobachten sei, während der semantische auf Hegel zulaufe.9 Obwohl sehr verbreitet, hält letzteres ernsthafter Überprüfung nicht stand. Nicht nur war Hegel nicht der erste, der zwischen Staat und Gesellschaft getrennt hat, er verstand auch unter ‚Gesellschaft‘ etwas anderes, weniger modernes als manche seiner Zeitgenossen.
Im Folgenden geht es kaum um die unstrittige Sachgeschichte der Trennung, sondern um die den modernen Gesellschaftsbegriff schließlich hervorbringenden Diskurse.10 Das geht erstens nicht ohne einen Blick auf das westliche Ausland und zweitens empfiehlt sich auch Aufmerksamkeit für den sogenannten ‚Tatsachenblick‘, d.h. der Schulung des Auges für soziale Sachverhalte. Und weil diese beiden Erzählstränge nicht geradlinig auf den modernen Gesellschaftsbegriff zulaufen – denn er wurde in Deutschland mindestens zweimal ‚erfunden‘–, müssen wirtschafts-, sozial- und wissenschaftsgeschichtliche Details ebenfalls ihren Platz in der Erzählung finden. Mit letzteren sei gleich begonnen.
2. Die Metaphysik der ‚Gesellschaft‘ in der deutschen Spätaufklärung
Anders als in den west- und südeuropäischen Ländern waren im Heiligen Römischen Reich die Universitäten in der Aufklärung lebendig und darum geistig führend geblieben. Das heißt freilich auch, dass der dort gelehrte Stoff staatsbezogen blieb, denn die Absolventen strebten den Fürstendienst oder andere obrigkeitliche Tätigkeiten (d.h. bei Kirchen, Städten oder Ständen) an. Das hatte jedoch seinen Preis. Erstens spielte in den Rechtsfakultäten damals die Naturrechtslehre, die Hauptträgerin der Gesellschaftstheorie, die einem realitätsgerechten Blick auf die Gesellschaft wenig förderlich war, eine bedeutende Rolle. Nämliches gilt, zweitens, für die Kameralistik, die den von den englischen Klassikern vertretenen Gedanken der Harmonie von Eigen- und Gemeinnutz ablehnte und Adam Smith sehr selektiv las, wodurch sie den Einzug der Politischen Ökonomie in die deutsche Universitätslehre verzögerte.11 Und drittens sah sich die ab 1750 aufblühende „Universitätsstatistik“ lange Zeit „weniger der Zahl als dem Wort verpflichtet“.12 Sie fand sich deswegen um 1800 einer Diskussion um ihre Wissenschaftlichkeit ausgesetzt. Siegerin war die schon seit Leibniz als hilfreiches Instrument der Regierenden empfohlene „Tabellenstatistik“, während die aus England kommende, hierzulande etwa von Süßmilch13 praktizierte „politische Arithmetik“ – nur sie hatte einen genauen Blick für die gesellschaftlichen Verhältnisse – noch ziemlich lange auf Anerkennung warten musste. Die Universitätsphilosophie schließlich widersetzte sich im Interesse der moralischen und ästhetischen Urteilskraft am längsten dem der Empirie verpflichteten Newtonianismus14 und hielt an der hergebrachten Metaphysik fest.15 So existierten in den beiden einschlägigen Fakultäten – denn Staatswirtschaftliche Fakultäten gab es nur in Tübingen (ab 1817) und München (ab 1826) – ernstliche Hindernisse auf dem Weg zu einer empirisch gehaltvollen Gesellschaftslehre.
Im späten 18. Jahrhundert herrschte darum im deutschen Kulturraum ein beziehungsloses Nebeneinander von Ordnungsmustern und Wirklichkeit, von Statik und Dynamik. Die alteuropäische Politiklehre der ‚societas civilis‘ stand unvermittelt neben der andern Regeln gehorchenden absolutistischen Staatsräson, die alteuropäische Ökonomik des ‚Ganzen Hauses‘ neben einer sich auf Bedürfnisse umgestaltenden Marktwirtschaft und die Lehre von der ständischen Gesellschaft neben einer sich am Fuße der gesellschaftlichen Pyramide etablierenden Klassengesellschaft, die von den meisten Zeitgenossen übersehen wurde.16
3. Der Tatsachenblick im westlichen Europa
Im westlichen Europa war der Tatsachenblick stärker ausgeprägt. Das hatte mindestens drei Ursachen, die zugleich den Statusverlust der traditionsorientierten Universitäten dort erklären helfen. Zum einen hatten alle Staaten Besitzungen in Übersee und der Kontakt mit den dortigen ‚Naturvölkern‘ machte jeden Gedanken an daselbst vorfindliche ‚bürgerliche Gesellschaften‘ gegenstandslos.17 Aber auch für das mit Hochachtung begegnete China verbot sich die europäische Formel, gäben doch seine Gesetze und Kulte zu erkennen, „que la Chine n’est qu‘une grande famille“.18 Das mit Abstand wichtigste Werk zum Außenverhältnis Europas, Abbé Raynals mehrbändige und in jeder Neuauflage erweiterte und aktualisierte Geschichte der beyden Indien, sprach jedenfalls mit größter Selbstverständlichkeit von „société“ sowohl im Sinne von Staat wie auch von sozialer Gesamtheit, und das Bemerkenswerte ist nun, dass die deutschen Übersetzer sich darauf einließen und „Gesellschaft“ benutzten,19 obwohl das damals weder in Lehrbüchern noch in Schriften des aufgeklärten mainstream üblich war.
Ein weiterer Grund für die in Westeuropa anders verlaufende Entwicklung hing eng damit zusammen. Hier gab es nicht nur den weitgespannten, seegestützten Handel, an dem gleichsam die ‚Naturgesetze‘ des Wirtschaftsaustauschs einschließlich der ihm vorgelagerten Erzeugung gewerblicher Güter studiert werden konnten. Sondern hier erlaubte auch die Agrarverfassung, den Boden zum kapitalistischen Wirtschafts- bzw. zum Spekulationsobjekt zu machen. Für die schottische Moralphilosophie und die französischen Physiokraten stand darum nicht mehr eine Wirtschaftsordnung zur Debatte, in der dem Staat eine die Harmonie verbürgende und entsprechend umfassende Zuständigkeit aufgegeben war, sondern diese Harmonie verdankte sich dem von Fachleuten eingerichteten „ordre naturel“ bzw. dem freien Spiel der Kräfte, der ungehinderten Suche nach Eigennutz, der sprichwörtlichen ‚invisible hand‘.20 Es interessierte also vorwiegend ‚die Gesellschaft‘ und das war manchen deutschen Übersetzern offensichtlich fremd. Wenn etwa Adam Smith von Wirtschaftsfaktoren wie „the annual produce of the land and labour of the society“ sprach, übersetzte der Popularphilosoph Garve noch 1799 das mit „der Arbeit jeder bürgerlichen Gesellschaft“, während Wichmann zwanzig Jahre früher das korrekt als „Gesellschaft“ wiedergegeben hatte.21 Aber derselbe Wichmann tat sich an anderer Stelle schwer. Wo nämlich der französische Physiokrat Le Trosne die ganze Naturrechtslehre mit ihrer komplexen Kasuistik, d.h. ihrem hergebrachten logisch-deduktiven Beweisverfahren, als eine „supposition absolument gratuite“ verwarf und rundheraus feststellte: „Enfin la société est fondée sur le fait“, traf Wichmann klar daneben mit seiner Formulierung: „Kurz, das gesellschaftliche Leben gründet sich auf die That“.22 Eine Freud’sche Fehlleistung, möchte man fast sagen, denn aus dem Folgesatz wird klar, dass es nicht um eine Tat, sondern um eine Tatsache geht: „L’homme est non seulement destiné à la société, mais il est né dans son sein“.23
Der dritte Grund, weshalb ‚die Gesellschaft‘ in Westeuropa früher in den Blick geriet als im deutschen Kulturraum, hängt mit dem zusammen, was man mit Wolfgang Bonß als „Einübung des Tatsachenblicks“ bezeichnen kann. Ganz beiläufig beschrieb Adam Ferguson in seiner vielgelesenen History of Civil Society seine Einstellung gegenüber wissenschaftlichen Problemen: „We are more concerned in its reality and its consequences, than we are in its origins or manor of formation”.24 Empirie ist bekanntlich ein „gesellschaftlich produziertes kognitives Muster“25 und insofern natürlich zeitbedingt. Seine bis heute gängige Lesart wurde Bonß zufolge vor allem von den englischen Vertretern der Politischen Arithmetik geprägt mit der Folge, dass allmählich philosophisches Wissen aus dem Empirieverständnis ausgeschlossen und nur noch „die soziale Wirklichkeit in den Kategorien von Maß und Zahl“ anerkannt wurde.26 Tatsächlich hatte schon 1676 William Petty, nach Marx der Vater der englischen Nationalökonomie, versichert, dass er sich für seine Political Arithmetic nicht auf „superlative Words and intellectual Arguments“ habe verlassen wollen, sondern ausschließlich auf „Terms of Number, Weight, or Measure […] and to consider only such Causes, as have visible Foundations in Nature“, um nicht von Dingen abhängig zu sein, „that depend upon the mutable Minds, Opinions, Appetites, and Passions of Particular Men“.27 Dass Zahlen wichtiger seien als Metaphysik, hatten zwar bereits Francis Bacon und Thomas Hobbes betont, aber Pettys erst posthum, nämlich 1690 erschienenes Plädoyer erlangte wohl auch deshalb große Wirkung, weil kurz zuvor, 1687, Newtons Gravitationsgesetz erschienen war. Dieses revolutionierte nicht nur das physikalische Weltbild, sondern machte alsbald die Physik für lange Zeit zur leitenden Wissenschaft überhaupt, wertete damit zahlenbasiertes Argumentieren jenseits der Mathematik auf und führte im folgenden Jahrhundert zu Versuchen, die gesamte Wirklichkeit als universell geltenden Regeln unterworfen zu betrachten, d.h. zahlenbasiert zu verstehen.28
Um Missverständnissen vorzubeugen, darf der Hinweis nicht fehlen, dass die Politische Arithmetik ausschließlich demographische Tabellen lieferte. Auch solche statistischen Kategorien hatten natürlich „wirklichkeitsschaffende“ Dimensionen, indem sie sich dazu eigneten, die hergebrachte ständische Welt zu unterlaufen und gewissermaßen hinter deren Rücken ab den 1780er Jahren in den Augen aufgeklärter Beamter die Vorstellung einer einheitlichen Untertanengesellschaft aufkommen zu lassen.29Aber diese Statistiken waren dennoch weit davon entfernt, die „soziale Wirklichkeit“ im heutigen Sinne, von der Bonß sprach, abzubilden. Von der Politischen Arithmetik führte jedenfalls in Deutschland kein Weg zur Gesellschaftswissenschaft, denn von einer eher beiläufigen Bemerkung Schlözers abgesehen,30 gab keiner ihrer Vertreter zu erkennen, dass es jenseits von Familie und Staat soziale Formationen gab, die der Untersuchung wert wären. Noch blieb der Gesellschaftsbegriff auf Beständigkeit angelegt, seine Dynamisierung ließ auf sich warten.
4. Französische Ursprünge der Soziologie
Auch wenn die soziale Reichweite der hier nur angedeuteten Weltbilder nicht überschätzt werden darf, entwickelte die französische, von politisch-administrativer Verantwortung freie Aufklärung radikale gesellschaftliche Vorstellungen, die fünfzig Jahre später von Tocqueville geradezu als Ursache der Revolution gebrandmarkt werden sollten: „Au-dessus de la société réelle, dont la constitution était encore réelle, confuse et irrégulière […] il se bâtissait ainsi peu à peu une société imaginaire, dans laquelle tout paraissait simple et coordonné, uniforme, équitable et conforme à la raison“.31 In der Tat demonstrierte die Revolution die Änderbarkeit der Gesellschaft, aber das war nicht die Folge aufgeklärter Sprachpolitik, sondern der Menschen- und Bürgerrechte und der von ihnen ausgelösten Ereigniskatarakte. Es verwundert daher nicht, dass spätestens ab 1789 die Frage einer Umgestaltung von ‚Gesellschaft‘ und Staat auch auf wissenschaftlicher Grundlage und eben nicht nur im Gefolge scheinbar selbstläufiger Prozesse oder revolutionärer Gewaltakte auf der Tagesordnung stand.
Auf Einzelheiten muss hier verzichtet werden. Es sei darum lediglich auf Autoren wie Sieyes,32 Condorcet,33 Lacretelle34 oder Destutt de Tracy35 verwiesen, die sich ab 1788/89 in verschiedenen Vereinen organisierten,36 um der „Wissenschaft der Gesellschaft“, von der nun in Frankreich alle sprachen, eine Plattform zu bieten, und die Einrichtung entsprechender Lehranstalten verlangten.
Der hier durchgängig beanspruchte Wissenschaftscharakter verdient eine etwas ausholende Erklärung, weil er von den im deutschen Kulturraum damals gültigen Vorstellungen abwich. Für Frankreich waren in diesem Zusammenhang zwei Dinge von Bedeutung. Erstens hatte die 1666 von Colbert gegründete Académie des Sciences „in bis heute spürbarer Weise den Begriff ‚science‘ für einen Katalog der Wissenschaften festgelegt, und zwar die Naturwissenschaften“.37 Mathematik galt als wichtigster Ausweis von Wissenschaftlichkeit, so dass die Wahrheitsfrage lange Zeit unerörtert bleiben konnte. Zweitens bekam in der französischen Aufklärung der öffentliche Nutzen besonderes Gewicht, wodurch die hergebrachte Grenze zwischen „science“ und „art“ beseitigt wurde, wie man an Titel und Inhalt der ab 1751 erscheinenden Encyclopédie sehen kann.38 Es überrascht darum nicht, wenn Spätaufklärer wie Sieyes und Condorcet das Wesen ihrer gesellschaftspolitischen Reformvorschläge 1780/90 mit Begriffen wie „art social“, „mécanique sociale“ oder gar „mathématique sociale“ versahen und als Techniken einer dringend notwendigen „science sociale“ bezeichneten, die wie die Naturwissenschaften durch rigide Tatsachenbeobachtung auf einer sicheren Grundlage stehen müsse.39 Die aristotelische ‚Politik‘, im zeitgenössischen Verständnis eine Klugheitslehre, war hier verabschiedet, denn als Zweck der Gesellschaft galt nicht mehr das gute Leben, sondern die Bedürfnisbefriedigung, weshalb politische Ökonomie und soziale ‚Mechanik‘ eine zentrale Rolle spielten.
Verwirklicht werden konnte dieses Programm erst nach der Revolution. Zur institutionalisierten Wissenschaft erhob es die 1795 gegründete Société des Idéologues40 mit Hilfe der im selben Jahr ins Leben gerufenen Académie des sciences morales et politiques.41 Die „science sociale“ hatte damit tatsächlich denselben Rang erreicht wie die Naturwissenschaften, sie war nach Lacretelle gar „la science par excellence“,42 die sämtliche sozialen Disziplinen im weitesten Sinne vereinte.
Nicht zufällig also wuchsen in diesem Klima die Gründerfiguren der Soziologie heran. Saint-Simon hielt 1813die systematische Entwicklung einer Methode zu Deutung und Steuerung der eben erst im Entstehen begriffenen modernen Gesellschaft für seine wichtigste Aufgabe, um die von ihm als „science politique“ bezeichnete neue Wissenschaft weiter abzusichern.43 Deren Entwicklungsgesetz verkündeten dann nach seinem Tod im Jahre 1825 seine Schüler, wo es gleich in der ersten Vorlesung über die „sciences“ mit Bedauern hieß, dass die Theorie seit langem zugunsten der Praxis vernachlässigt werde, was vor allem auf die 1803 erfolgte Abschaffung der Académie des sciences morales et politiques zurückgehe. „Prononçons, […] que c’est dans l’absence d’une unité de vue sociale qu’il faut rechercher la cause du mal, et dans la découverte de cette unité qu’on trouvera le remède“.44 Für Auguste Comte war dann aber das Theorieproblem gelöst. Seine „science sociale“ sei nicht-metaphysisch, d.h. „positiv“, und stehe damit im Gegensatz zu den verachteten „sciences conjecturales“.45 Nach der 1832 erfolgten Wiedereinrichtung der Académie des sciences morales et politiques lieferte er dann auch eine griffige disziplinäre Bezeichnung: „sociologie“.46 Sie habe nicht nur eine analytische Rolle, sondern auch eine lenkende, nämlich im Sinne von Annäherung an die naturgegebene Entwicklung zum Fortschritt. So prägte der von Saint-Simon und Comte repräsentierte Positivismus, unterstützt von Adolphe Quetelet, der mit rein mathematisch-statistischen Methoden die Gesellschaft steuern zu können versprach,47 für Jahrzehnte das Gesicht der französischen Wissenschaft, der den vernunftgestützten Verfassungsexperimenten von 1789ff. und dem spätestens von Napoleon geschaffenen dirigistischen Wissenschaftsklima besser entsprach als die Bildungsmodelle ihrer Nachbarn.
5. Erste Abschiede vom metaphysischen Gesellschaftsbild in Deutschland
Deshalb, und weil damals weder in England bzw. Schottland noch im Heiligen Römischen Reich eine vergleichbare politische und gesellschaftliche Krise herrschte, blieb der Einfluss der französischen Soziologie und der von ihr geschaffenen Wissenschaftssprache im Ausland zunächst beschränkt. Immerhin findet sich nun hier und da ein Vokabular, das an die französische Moderne anschließt, jedoch verharrten bei genauerem Zusehen die Autoren im Hergebrachten. So begegnet uns etwa 1797 das Wort „Gesellschaftspolitik“, aber sein Urheber, der Kant-Schüler und angehende Philosophieprofessor Wilhelm Traugott Krug, deklinierte sie in der traditionellen logisch-deduktiven Manier durch, d.h. er spaltete sie auf in die „allgemeine“, die für das Zusammenleben „Rathschläge der Klugheit“ erteile, und die „besondre“, die ihrerseits in das Regelwerk des ‚Ganzen Hauses‘ und in die „Staatspolitik“ zerfalle.48 Diese Kasuistik lässt nicht erkennen, dass Teile der Gesellschaft sich damals von der ständischen Ordnung – absichtlich oder gezwungenermaßen – emanzipierten und neuartige Verhältnisse schufen. Auch die 1793 gedruckte Polemik Fichtes gegen den absoluten Staat sieht nur auf den ersten Blick modern aus. Er betonte mit Nachdruck den „Unterschied zwischen Gesellschaft und Staat“, der leider allgemein verkannt werde. Das habe „eine Verwirrung der Begriffe“ zur Folge. „Das Wort ‚Gesellschaft‘ nemlich ist die Quelle des leidigen Missverständnisses“, da es nur gewöhnliche Vertragsverhältnisse oder den Sozialvertrag meine. Es „schleicht sich dadurch über wichtige Erörterungen weg: wie es mit Menschen beschaffen sey, die um, neben, zwischen einander leben, ohne in irgend einem Vertrage, geschweige denn im Bürgervertrage zu stehen“. Das war nur scheinbar die Gesellschaft im modernen Sinne, denn Fichte polemisierte gegen den Staat und benützte dafür das ungewöhnliche Argument, dass „der Naturzustand des Menschen [nicht] durch den bürgerlichen Vertrag aufgehoben“ werde.49 Bei seiner Gesellschaft handelte es sich also um ein gedankliches Konstrukt, die empirische Gesellschaft interessierte Fichte hier nicht im Geringsten; sein gesamter Text ist eine einzige Polemik gegen Empirie, Erfahrung, Geschichte.
Das Beispiel Fichtes zeigt trotzdem, dass die jüngere, die Freiheitsrechte der Bürger betonende Naturrechtslehre vielleicht einen in Deutschland eher gangbaren Weg zu einer Theorie der Gesellschaft hätte bilden können, wenn sie diesem Thema mehr Aufmerksamkeit gewidmet hätte. Das beste Beispiel dafür ist Samuel Simon Witte, Rechtsprofessor an der kurzlebigen Universität Bützow und später in Rostock, der 1782 in einer Preisschrift zum damals vieldiskutierten Thema Luxus eine den Staat dominierende Eigentümer- und Marktgesellschaft entwarf. „Der wesentliche Zweck dieser Gesellschaft besteht in der Befriedigung der individuellen Bedürfnisse durch die freye wechselseitige Vertauschung der Kraftproducte oder den bürgerlichen Verkehr“.50 Witte, der wohl als erster in Deutschland zwischen Staat und Gesellschaft unterschied bzw. trennte,51 ging es freilich weniger um diese als um die Wirtschaft, für die er ein zukunftsweisendes, nachfrageorientiertes Modell entwarf. Doch geriet sein Buch nach kurzer Diskussion in völlige Vergessenheit, weil sein Titel keinerlei Hinweis auf die hier entfaltete These einer modernen Gesellschaft enthält und wohl auch, weil sein Verfasser sich alsbald mehr für die Ursprünge von Pyramiden und Keilschrift interessierte.
6. Zwischenbilanz
An dieser Stelle scheint eine kurze Zwischenbilanz angebracht. Die hier vorgestellten drei sprachlich-kulturellen Großräume wiesen erhebliche Unterschiede auf. Den Westeuropäern gemeinsam waren die Kontakte mit der außereuropäischen Welt, der entwickelte Kapitalismus in Gewerbe und Landwirtschaft und die Randstellung der Universitäten. Während aber in England und Schottland Moralphilosophen und Grundbesitzer einen neuen Blick auf die gesellschaftlichen Tatsachen entwickelten, um Krone und Unterhaus von Eingriffen in die Wirtschaft abzuhalten, arbeiteten sich die französischen Spätaufklärer – im täglichen Leben vorzugsweise Literaten und Mitglieder diverser Akademien, aber nicht im Staatsdienst – am reformunfähigen Absolutismus ab und begründeten nach dem Ende des Ancien Régime eine naturwissenschaftlich geprägte Wissenschaft der Gesellschaft, die eine Wiederholung revolutionärer Krisen ausschließen sollte.
Im Deutschen Reich herrschte dagegen ein von der Aufklärung unterstützter Reformabsolutismus über eine noch weitgehend traditionell ausgerichtete Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung von erheblicher Stabilität. Die öffentliche Meinung prägten Autoren, die ihrer Ausbildung nach meist Juristen und Theologen waren, von Beruf jedoch Beamte, Professoren, Hauslehrer oder freie Schriftsteller.52 Ihr Thema war der Staat, in damaliger Sprache die „bürgerliche Gesellschaft“, in der zugleich die Stände enthalten waren. Die ständische Gesellschaft galt schon per definitionem als stabil, denn man hielt sie allgemein als gottgewollt bzw. in der Sprache der späten Aufklärung als ‚natürlich‘,53 und außerdem wachte über sie das Recht, das jedem Stand seinen Platz in ihr zuwies und garantierte. An empirischen Untersuchungen bestand deshalb so gut wie kein Bedarf, so dass Beiträge zur ‚wirklichen‘ Gesellschaft wie erratische Blöcke in der literarischen Landschaft herumliegen und auf ihre Finder warten. Die „zweckrationale Wahrnehmung der sozialen Welt“54 geschah dagegen in Gestalt von Tabellen und bediente kaum den akademischen Diskurs, sondern eher die zahlreichen Zweige der ‚Policey‘.
Den wichtigsten Anstoß zur Dynamisierung des Gesellschaftsbildes lieferte natürlich die Französische Revolution, denn mit dem politischen Totalumsturz verband sich bekanntlich auch ein „Bruch des gesellschaftlichen Bewusstseins“. Seine realhistorische Bedeutung pflegt jedoch seit jeher überschätzt zu werden. Und so scheint selbst in Frankreich „société“ nicht sogleich dynamisiert worden zu sein, oder anders gesagt: Was sich gesellschaftlich dynamisierte, wurde vorzugsweise unter Termini wie „égalité“, „droits de l’homme“, „liberté“ und dergleichen abgehandelt55 – alles Sujets, die viel umstandsloser den Blick auf die neue Wirklichkeit freigaben als der traditionsbelastete Gesellschaftsbegriff.
Obwohl es an Augenzeugenschaft deutscher Gebildeter mit der Französischen Revolution wahrlich nicht mangelte, sucht man zeitgenössische Aussagen zur gesellschaftlichen Umgestaltung vergeblich. Erstens fehlte dafür das trainierte Auge, der ‚Tatsachenblick‘, und zweitens verstellte die Fülle außergewöhnlicher politischer und militärischer Ereignisse die Sicht auf das Soziale. Und wo diese dann doch zur Sprache kam,56 handelte es sich sogar beim wichtigsten deutschen Augenzeugen nicht um die Beschreibung der Wirklichkeit, sondern um eine Privatutopie.57 Obwohl aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, spricht deshalb alles dafür, dass die Dynamisierung der Gesellschaft im Nachbarland zunächst nicht zur Kenntnis genommen wurde.
Wenn die Dinge im deutschen Sprachraum dennoch in Bewegung kamen, hat das demnach wohl einen anderen Grund. In aller Kürze kann man sagen, dass das allmähliche Verschwinden von ‚Gesellschaft‘ im Sinne eines zweckbestimmten Zusammenschlusses von Menschen als Folge der Anfänge des modernen Staates und seines Versprechens gedeutet werden kann, nun selber anstelle der ‚Gesellschaften‘ für diese Ziele zu sorgen. Krünitz zählte in seiner Oekonomischen Encyklopädie 1779 vier „Gesellschaften“ auf, denen jeder Mensch angehöre und die „bey allen Völkern“ anzutreffen seien, weshalb man sie auch „natürliche Gesellschaften“ nenne: Erstens „die eheliche oder die zwischen Mann und Weib, von Gott selbst gestiftet“, zweitens „die häusliche oder zwischen Aeltern und Kindern“, ferner die „dritte Art der Gesellschaft […], welche zwischen Herren und Knechten oder zwischen einem Haus-Vater und einer Haus-Mutter und ihrem Gesinde besteht“, also das sogenannte ‚Ganze Haus‘, und schließlich „die bürgerliche Gesellschaft“,58 die keineswegs mit dem Staat im modernen Sinne gleichzusetzen ist. Alle diese „Gesellschaften“ erfuhren seit dem späten 18. Jahrhundert durch obrigkeitliche Eingriffe anfangs im Rahmen der Policey-Gesetzgebung,59 später dann in Gestalt mehr oder minder umfangreicher Spezialgesetze60 Schritt für Schritt bzw. im linksrheinischen Deutschland 1804 mit der Einführung des Code Civil schlagartig das, was Soziologen heute als Funktionsentlastung beschreiben, damals jedoch vielfach als Entmächtigung wahrgenommen wurde. So wurde Platz für die Umdeutung von ‚Gesellschaft‘ zur sozialen Gesamtheit und näherhin zu ihrer besonderen Beschaffenheit, d.h. zur berufsständischen oder zur Klassengesellschaft. Diese Umdeutung geschah in Deutschland, von Ausnahmen abgesehen, ziemlich langsam, jedenfalls langsamer als im benachbarten Frankreich, wo seit der berühmten Nacht des 4. August 1789 die ständisch vielfach abgestufte Gesellschaft mindestens auf dem Papier beseitigt war,61 während sich die Engländer, wie der Hannoveraner Beamte Ernst Brandes schrieb, schon länger keine Standesschranken mehr gefallen lassen mussten.62 Und weil dieser Prozess nur in dem Maße vorankam, wie der Staat mit der wachsenden gesellschaftlichen Dynamik konfrontiert wurde, lag es nahe, dass es die sich gleichzeitig etablierenden Staatswissenschaften waren, die sich mit der Deutung dieses Vorgangs befassten und folglich den modernen Gesellschaftsbegriff entwarfen. Sie spielen daher weiter unten eine maßgebliche, den heutigen Beobachter wohl überraschende Rolle.
7. Drei Wege aus der alteuropäischen Gesellschaftsidee
a. Jahrhundertanfang: Entdeckung ohne gesellschaftliche Relevanz
In Deutschland gibt es herkömmlicherweise je nach Perspektive zwei Anfänge moderner Gesellschaftstheorie: in den 1840ern im Zeichen der vom Pauperismus und den Anfängen der Arbeiterbewegung verursachten Krise und endgültig dann um 1900 als Universitätsdisziplin im Zeichen der von Hochkapitalismus, Demokratisierungsprozessen und der Krise des Historismus verursachten neuartigen Ungewissheiten, auf die die hergebrachten Wissenschaften und der in ihnen groß gewordene Gelehrtentyp keine Antwort mehr wussten. Aber es gibt noch einen dritten Anfang, und zwar den allerersten, beschränkt auf den Berliner freien Schriftsteller Friedrich Buchholz, dem seit 1805 die von ihm entworfene „Wissenschaft der Gesellschaft“63 gleichsam wie Pallas Athene dem Zeus aus der Stirn entsprungen zu sein scheint. Er hatte in Deutschland weder Vorläufer noch Nachfolger und ist, obwohl zu Lebzeiten ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, weithin vergessen. „Auch ein Anfang der Soziologie“, überschrieb darum Hans Gerth seine biographische Skizze.64
Bei Buchholz stand am Beginn die Krise als Zeitdiagnose. Das war 1810 nicht originell, umso origineller aber sein Rezept zu ihrer Überwindung: „Der größte Theil der europäischen Welt befindet sich in einer Krisis, deren Dauer sich mit keiner Bestimmtheit angeben läßt. Ist von dem Charakter derselben die Rede, so läßt sich dieser vielleicht nicht besser bezeichnen, als so, daß man sagt: er bestehe in dem Gefühl der Unvollkommenheit des gesellschaftlichen Gesetzes, so wie dieses bisher gewaltet hat. Es käme also zur Beendigung jener Krisis vorzüglich auf eine Verbesserung des gesellschaftlichen Gesetzes an. Und dies wäre demnach das Problem, das gegenwärtig gelöset werden müßte.“65 Soziologie als Orientierungswissen der noch weithin unbekannten Gesellschaft und damit zugleich Stabilisatorin der Staaten – alles Aussagen, lange bevor er die französischen Soziologen rezipierte.
Dass das keine einfache Angelegenheit sein konnte, lag für Buchholz auf der Hand. Schließlich ging es bei ihm nicht mehr, wie seit Aristoteles‘ Zeiten, um Sollen, sondern um Sein. Buchholz bezeichnete sich daher als „Naturforscher in Beziehung auf gesellschaftliche Erscheinungen“66 – wohl eine Reverenz an den damals zu großer Berühmtheit gelangenden Alexander von Humboldt – und kritisierte das „Unvermögen, gesellschaftliche Erscheinungen richtig aufzufassen und darzustellen“. Für die Französische Revolution habe man „erst die Ökonomisten, dann die Enzyklopädisten oder Philosophen zu Urhebern derselben gemacht“ und schließlich die „Freimaurer […] als die Urenkel der Tempelritter. […] Es braucht kaum bemerkt zu werden, wie lächerlich und läppisch alle diese Hypothesen sind“.67
Für den Soziologen Buchholz verhielten sich die Dinge vergleichsweise einfach. Gedeihliche Verhältnisse im Staat gebe es nur, wenn Politik, Recht und Verfassung den sich ändernden gesellschaftlichen Verhältnissen Rechnung tragen, und das war nicht nur im Frankreich des Ancien Régime nicht der Fall, wie er ausführlich im ersten Band seiner Geschichte Napoleons darlegte, sondern auch die Jakobiner erlagen trotz ihres Vernunftkultes noch dem „Metaphysizismus“68 und scheiterten deshalb. Die „gesellschaftlichen Elemente“ könnten auf Dauer nicht mit einem Machtspruch ruhiggestellt werden, sonst komme es zum „nothwendigen Kampf“. „Die Regierung ist in solch einem Falle kraftlos – nicht etwa, weil sie so oder so zusammengesetzt ist –, sondern weil es an den Bedingungen einer freien und sittlichen Einwirkung für sie gebricht“.69 Das war, völlig unvermittelt, d.h. gleichsam aus heiterem Himmel, die unerhörte Feststellung, dass der auf Dauer angelegte ‚alteuropäische‘ Gesellschaftsbegriff ausgedient habe, weil alles in Bewegung sei.
Was diese Erkenntnis jedoch erschwerte, ist Buchholz‘ höchst bemerkenswerte Einsicht eines Zusammenhangs zwischen wachsender gesellschaftlicher Komplexität und abnehmender Chance, diese zu erkennen. „Es gehört zu den Eigenthümlichkeiten der menschlichen Gesellschaft, daß sie das Bewußtsein ihrer selbst in eben dem Grade verliert, in welchem die Zahl der gesellschaftlichen Verrichtungen zunimmt.“ Die Arbeitsteilung hat also nicht nur Vorzüge, denn sie führe auch dazu, dass die Menschen „das gesellschaftliche Getriebe nicht [mehr] übersehen können“. Aus diesem Dilemma entkomme man nur durch einen „Unterricht, wodurch alle Mitglieder der Gesellschaft über den Zusammenhang belehrt werden, in welchem sie untereinander stehen; ein Unterricht, der bisher nie gegeben worden ist“. Den machte er sich zur Aufgabe, und so kam es, dass sich Buchholz kaum für die konkrete Zusammensetzung der Gesellschaft und ihre einzelnen Teile interessierte, sondern als Antwort auf die Umbrüche seiner Zeit eine in erster Linie politische Soziologie entwarf. „Was ich die Wissenschaft der Gesellschaft nennen möchte, schrieb er 1810, würde sehr viel dazu beitragen, den Staaten eine Sicherheit und Festigkeit zu geben, die sie bisher nicht erhalten konnten, weil das, was ihrer Entstehung und Fortbildung zum Grunde lag, so wenig erkannt wurde“.70 Sie sei darum „die notwendigste aller Wissenschaften“,71 schrieb er noch eineinhalb Jahrzehnte später und war damit noch immer ein Solitär.
Buchholz‘ Auffassung der Gesellschaft als Ganzes kann man nur als modern bezeichnen, denn diese war frei von allen traditionell-moralischen Zügen: Sie sei eine von der Natur grundsätzlich ermöglichte, aber von Menschen konkret zu gestaltende Einrichtung, die folglich auch von den Menschen zugrunde gerichtet werden könne. Entsprechend scharf urteilte er 1809 über die preußische Beamtenschaft.72Die „Abhängigkeit der Vergesellschafteten von einander [ist] die erste Grundlage der Gesellschaft“.73 Alles hängt also von der menschlichen Einsicht in diesen Grundtatbestand ab, um deren Aufklärung sich Buchholz‘ Werk großenteils dreht. Die wichtigsten Maßregeln für das gesamtgesellschaftliche Wohlergehen sind wirtschaftspolitischer Art, da „Gesellschaft, Arbeit und Geld“ so eng zusammengehören, dass ihre „Verwandtschaft“ geradezu „in die Augen springt“.74 Mit seiner politischen Arithmetik zielt er auf den Nachweis, “daß, wenn eine Gesellschaft bestehen und sich kräftig entwickeln will, sie vor allen Dingen dahin zu trachten hat, daß in Beziehung auf sie der Sachwerth des Geldes in einem richtigen Verhältnisse zu dem Geldwerthe der Sachen stehe“.75 Das ganze Buch läuft darauf hinaus, dass letztlich von einem allen Interessen gerecht werdenden Preis-Leistungs-Verhältnis das Wohl der ganzen Gesellschaft abhängt.76 Es sind also wirtschaftliche Notwendigkeiten, die die Menschen zusammenzwingen, und diese sorgen zugleich für ein prinzipiell unbegrenztes Wachstum!77 Damit hätte sich auch die populäre Malthus’sche Theorie erledigt, die seit 1807 in deutscher Sprache zu lesen war – wenn denn Buchholz mehr rezipiert worden wäre.
Die Gesellschaft galt ihm als historisch bedingt, denn einen „vorgesellschaftlichen Zustand des Menschen hat es nie gegeben“.78 Neuerdings sei sie arbeitsteilig angelegt, und weil Geld das geeignetste „Ausgleichungsmittel“ zur Organisation der Arbeitsteilung ist, sei an die Stelle der Tausch- die Marktgesellschaft getreten, in der seit den „drei letzten Jahrhunderten“ die „zahlreiche Classe der Kaufleute, Manufakturisten, Gelehrten, Künstler und Handwerker […] eine so ausgezeichnete Rolle spielt“.79Zusammen mit den Bauern bilden diese Berufsgruppen „die arbeitende Klasse“,80 wie Buchholz an anderer Stelle auf sehr bemerkenswerte Weise und Jahrzehnte früher als Friedrich Engels formulierte, um den Gegensatz zwischen normalen Bürgern und Privilegierten auf den Begriff zu bringen.
Über Buchholz‘ bemerkenswerte Leistungen wäre noch manches zu sagen: über seine zahllosen speziellen Soziologien, seine Wissenssoziologie, Ideologiekritik, sozialgeschichtliche Deutung der Französischen Revolution, seine Vertrautheit mit der englischen politischen Arithmetik,81 seine Übersetzungstätigkeiten – er übersetzte Auszüge von Saint-Simon und das erste Werk Auguste Comtes82 –, seine Beschäftigung mit Robert Owen, doch ist hier nicht der Ort dazu.83 Seine, freilich folgenlose, Bedeutung besteht darin, dass die Soziologie bei ihm „nicht nur gelegentlich auftauchende Reflexion“ war,84 sondern Zug um Zug perfektionierte Grundierung seiner Schriften. Sein wichtigstes Credo war die gesellschaftliche Bedingtheit von Kunst, Religion, Recht, wirtschaftlicher Entwicklung und politischer Verfassung.85
Buchholz klagte 1815 darüber, dass die „Facultäts-Wissenschaften unglücklicherweise […] den Bedürfnissen der Gesellschaft wenig entsprechen“, glaubte aber doch behaupten zu können, „daß es in der gegenwärtigen Zeit nicht an Köpfen fehlt, deren ganzes Streben dahin gerichtet ist, die Wissenschaft dem Gesellschaftszustande, wie er wirklich ist, näher zu bringen und anzupassen“.86 Wen er damit gemeint hat, bleibt sein Geheimnis. ‚Man‘ sprach in Deutschland noch lange nicht von Gesellschaft, wie er sie verstand. Das gilt selbst für Hegel, dem Robert von Mohl 1851 zu Recht vorwarf, er habe sich für sie nicht wirklich interessiert.87
Hegel hatte kein Krisenempfinden und war auch nicht vom Ehrgeiz erfüllt, die real existierende Gesellschaft zu beschreiben. Ihm ging es um eine Soziallehre, die im Einklang mit seiner Geschichtsphilosophie stand, und er löste sich auch nicht von der hergebrachten Terminologie. So sprach er von Ständen – es seien drei, aber nun nicht mehr politische, sondern soziale88 – und hielt auch am Begriff der ‚bürgerlichen Gesellschaft‘ fest, die er allerdings – das war angesichts seiner Bekanntheit ein ungeheuer folgenreicher Kunstgriff – strikt von Familie und Staat trennte. Das „System der Bedürfnisse“ kenne nur „Menschen“, die bei der „Vervielfältigung“ der Güter „keine Grenzen“ erführen, weshalb es „zu einem Unterschiede der Stände“ (d.h. zur Spaltung in Reiche und Arme) mit entsprechenden Konflikten komme, die den Staat nötig machten. Die ‚bürgerliche Gesellschaft‘ bestehe je nach Perspektive aus ‚bourgeois‘ oder ‚citoyens‘ und hebe so den Widerspruch zwischen Familie und Staat auf.89
b. Jahrhundertmitte: Soziale Frage und soziologischer Gesellschaftsbegriff
Mit seiner Vorstellung einer prinzipiell möglichen Überwindung der Konflikte durch Optimierung der Gesellschaft steht Hegel in einer alten sozialphilosophischen Tradition, die in Gestalt des Marxismus bis heute andauert. Die Pauperismuskrise der 1840er Jahre, in der nach Meinung einer rasch wachsenden Zahl von Zeitgenossen der bislang bloß hungrige ‚Pöbel‘ sich dank engagierter ‚Sozialisten‘ in ein seiner Lage bewusst gewordenes ‚Proletariat‘ verwandelte,90 hat dann – allerdings mit der wichtigen Ausnahme des Liberalismus, der auf die neue Lage mit „Ratlosigkeit“ reagiert hat,91 – die hergebrachte Sicht auf die Gesellschaft erfolgreich herausgefordert. Seit langem gilt daher: Das deutliche Bewusstsein, dass die sich in der Industrialisierung herausbildende Klassengesellschaft eine völlig neue Tatsache in der Geschichte der Menschheit war, bildete, wo nicht den Entstehungszusammenhang, so doch vielerorts den Durchbruch der Soziologie. Und weil diese Klassengesellschaft eine eigengesetzliche Logik aufwies und sich dadurch, anders als die ständische Ordnung, vom Staat emanzipierte bzw. ihn herausforderte, war (wie schon bei Buchholz) das Verhältnis von gesellschaftlicher Bewegung und staatlicher Verfasstheit „das eigentliche Grundthema der klassischen Systeme der europäischen Soziologie“.92
So kam es zum wissens- und damit begriffsgeschichtlichen Durchbruch, in dem auch die Frage, was eine ‚Tatsache‘ ist, wieder auf die Tagesordnung kam.93 In Anlehnung an Newtons Physik wurde sie nun selber zur Quelle der Erkenntnis, gab es sie doch scheinbar unabhängig vom menschlichen Verstand in der Wirklichkeit, und der Wissenschaftler musste sie ‚bloß‘ auffinden. „Nur in der Wirklichkeit ist die Wahrheit“, schrieb 1843 der nach Zürich geflohene Publizist Wilhelm Schulz, und fügte hinzu: „Schon hat das tausendfach bewegte Leben selbst in den Thatsachen und Zuständen unserer Zeit eine Staatslehre geschaffen, die den Bedürfnissen der Zeit gemäß ist“.94 Hier kündigte sich der Positivismus an, dem sich die französische Sozialwissenschaft schon seit den Zeiten Condorcets und Saint-Simons verschrieben hatte und der inzwischen in Deutschland bekannt war. Trotzdem blieb offen, was genau eine soziale ‚Tatsache‘ war, ob schon das Ergebnis genauer Beobachtung darunter gerechnet werden durfte oder nur Maß und Zahl. Während letzteres von Ökonomen bevorzugt wurde – die Statistik „verwandelt […] unsere menschlichen Beobachtungen erst in wirkliche Thatsachen“, so 1866 Bruno Hildebrand95 –, verließen sich Staats- und Kulturwissenschaftler vorzugsweise auf ihre Beobachtungskunst. „Der einzig richtige Weg“ zum Studium der Gesellschaft sei „die Beobachtung dieser Wirklichkeit des menschlichen Zusammenlebens“, versicherte Mohl 1851.96 Das blieb nicht ohne Kritik, auch wenn der berüchtigte Methodenstreit noch in weiter Ferne war. Immerhin konstruierte Wilhelm Heinrich Riehl 1864 eine Hierarchie der Glaubwürdigkeit sozialer Behauptungen, wenn er seinen Vortrag vor der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mit der Feststellung beendete: „Zuerst kamen die neuen Tatsachen, dann der neue Begriff; dieser aber überholte die Tatsachen, eben weil er ein Idealbegriff ist“. Im 18. Jahrhundert hätten „vorzugsweise Philosophen und Historiker bei uns das Aufkeimen der Gesellschaftslehre“ betrieben, deshalb tue jetzt die „logische Schärfe“ der Nationalökonomen der Sache gut, denn sie stellt „bestechende Schwindeleien sozialer Schwarmgeister“ bloß.97 Für sich selbst nahm er jedoch in Anspruch, ohne Rückgriff auf seine „wissenschaftliche Erkenntniß von der Idee der Gesellschaft“ seine „auf Wanderungen“ und „mit liebevoller Hingabe an Art und Sitte“ erlangten Einsichten zu einer „Wissenschaft vom Volke“ zusammenfassen zu können mit dem Ziel „einer conservativen Social-Politik“.98
Es müssen hier nicht alle Namen genannt werden, da es nicht auf Vollständigkeit ankommt, sondern auf epistemischen bzw. semantischen Wandel. Marx, das wurde schon angedeutet, trug dazu eher nichts bei. Zwar eröffnete er der Geschichtswissenschaft eine neue Perspektive, indem er 1848 die Weltgeschichte als Abfolge unterschiedlicher Gesellschaftsformationen – von der Urüber die Sklavenhalter- und die Feudal- zur bürgerlichen Gesellschaft – interpretierte,99 aber als ausgesprochen fatal sollte sich Marx‘ Festhalten am Begriff der ‚bürgerlichen Gesellschaft‘ erweisen. Denn weil er dem Staat keine eigene Sphäre zubilligte,100 kam die ‚bürgerliche Gesellschaft‘ „repolitisiert“101 gleichsam zur Hintertür wieder in den Sozialdiskurs und unterlief Hegels Trennung. Schließlich war auch seine Vorstellung von der Zweiklassengesellschaft eine derart zugespitzte Beschreibung der Wirklichkeit,102 dass sie kaum das subjektive Empfinden der Zeitgenossen traf. Seine Anhänger mussten deshalb entsprechend geschult werden. Raymond Aron bilanzierte treffend, dass Marx „bis zu seinem Lebensende ein Philosoph geblieben ist“.103
Lorenz Stein ist zwar bis zum Lebensende Jurist geblieben, aber als er als junger Mann 1841 mit einem Stipendium für eineinhalb Jahre nach Paris ging, um das französische Recht zu studieren, wurde er für rund zehn Jahre zum Soziologen und lieferte bahnbrechende Einsichten, die nicht nur Marx beeinflussten. Denn er machte dort unvermittelt Bekanntschaft mit einer gärenden Gesellschaft und darauf reagierenden Theorien und Bewegungen, was ihn enorm faszinierte. Und da Stein überzeugt war, dass diese Entwicklung schon bald Deutschland erreichen werde, machte er sich daran, seine Landsleute 1842 mit dem Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs bekannt zu machen und nach einer Antwort auf die Herausforderung zu suchen. Dafür müsse man eine „Wissenschaft der Gesellschaft“ entwerfen, denn „es ist die Gesellschaft, in deren Begriff die Lösung jener Aufgabe liegt“.104 Steins Deutung der zeitgenössischen Gesellschaft ist ausgesprochen innovativ und lässt einen genauen Blick auf die ‚Tatsachen‘ erkennen – viel genauer als jemals zuvor in deutscher Sprache –, und ist daher ein längeres Zitat wert. Ausgangspunkt ist seine Feststellung, dass das Maschinenwesen die sozialen Verhältnisse grundlegend verändert habe. Anders als in Landwirtschaft und Handwerk werde hier „die Arbeit […] zur Waare, und der Preis dieser Waare wird bestimmt durch […] die Masse des Angebots und der Nachfrage“. Die Bevölkerungszunahme verschaffe dem „Capital […] daher die Möglichkeit, […] diesen Preis so weit herabzudrücken, als dies überhaupt geschehen kann. […] Das Capital, und durch dasselbe die Capitalisten haben es mithin in ihren Händen, durch die Bestimmung des Arbeitslohnes das ganze Leben dieser Fabrikarbeiter zu beherrschen. Und auf diese Weise schließt sich an die Entstehung der Maschinenarbeit ein Unterschied zwischen Capital und Arbeit“. „Diese Thatsache macht aus den Arbeitern und den Capitalisten zwei Stände“, die sich unversöhnt gegenüber stünden. „Und damit ist Dasjenige entstanden, was die Grundlage der gesellschaftlichen Bewegungen unserer Zeit bildet – noch nicht das Proletariat, aber allerdings der Körper des Proletariats, dem nunmehr eine andere, nahe liegende Entwicklung den Geist eingehaucht hat, der dasselbe heute beseelt.“105
Die moderne ‚Gesellschaft‘ ist also etwas anderes als ‚Volk‘, nämlich der Organismus sozialer Interessenbeziehungen, wie sie sich aus der wirtschaftlichen Verteilung der Güter und der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit ergeben mit der Folge, dass die enorm angewachsene materielle Ungleichheit im Maschinenzeitalter „die höhern Classen“ in die Lage versetze, „die Staatsgewalt zu einem Mittel für ihre eigenen gesellschaftlichen Zwecke“ zu machen.106 Materielles und politisches Ungleichgewicht hatten derart zugenommen, dass es von den ‚Ideen von 1789‘ nicht mehr befriedet werden konnte; es wurde deshalb von Autoren wie Proudhon, der 1840 die Aufsehen erregende Parole „Eigentum ist Diebstahl“ ausgegeben hatte,107 moralisiert und politisiert.
In Steins Augen lieferte Proudhon kein brauchbares politisches Rezept. Für andere Autoren galt das ebenso. Auch die Paulskirche, von der Stein als Beobachter nochmals nach Paris entsandt wurde und wo er den Juni-Aufstand miterlebte, vermochte neben der Verfassungsfrage nicht auch noch die soziale zu beantworten. Daher forderte Stein 1850 als Lehre aus den jüngsten Ereignissen das „Königtum der socialen Reform“, d.h. eine unparteiische Instanz oberhalb der widerstreitenden Klassen,108 wobei er der Verwaltung maßgebliche Bedeutung zusprach.109 Das war eine sehr deutsche Lösung.110 Allerdings wäre es in Steins Augen eine irrige Vorstellung von der „Wissenschaft der Gesellschaft“ gewesen, wenn sie sich lediglich mit dem Proletariat befasste. „Es ist durchaus falsch, jene einzelnen Gestaltungen der Gesellschaft als den eigentlichen Inhalt derselben zu betrachten und eben deßhalb falsch, die wahre Natur jener Zustände bloß aus denjenigen Elementen erkennen zu wollen, die in ihnen vorzugsweise thätig sind. Der Begriff der Gesellschaft ergibt vielmehr, daß die Gesellschaft selbst ein wesentliches und machtvolles Element der ganzen Weltgeschichte ist, und daß mithin die Wissenschaft der Gesellschaft erst die Erkenntniß eines jeden Gesammtzustandes von dem Ursprung der Gemeinschaft bis zur fernsten Zukunft erfüllt. Und erst dadurch verdient sie den Namen und die Ehre einer Wissenschaft“.111 Diese Einsicht zwinge zu einer neuen Ordnung der Disziplinen, indem diese Wissenschaft sich mit der Volkswirtschaftslehre und Rechts- sowie allgemeiner Geschichte vereine und so jene ‚gesammte Staatswissenschaft‘ bilde, wie sie Robert von Mohl bereits 1844 mit seiner Zeitschriftengründung gleichen Namens vorgeprägt hatte.112
Steins Plädoyer offenbart eine Eigenheit des deutschen Kulturraums, nämlich den Umstand, dass hierzulande die ‚Wissenschaft der Gesellschaft‘ erst ab den späten 1840er Jahren Anerkennung fand, während dieser Schritt, wie erinnerlich, in Frankreich noch vor der Jahrhundertwende vollzogen worden war. Das hängt mit der anhaltenden Bedeutung der Universitäten hierzulande zusammen, die gewissermaßen ohne Einmischung von außen bestimmen konnten, was Wissenschaft kennzeichnet. Zwar war der Praxisbezug auch in Deutschland noch in der Aufklärung stark, doch schadete ihm die Aussage Kants, derzufolge „eine jede Lehre“ nur dann als Wissenschaft gelten könne, „wenn sie ein System, d.i. ein nach Principien geordnetes Ganze der Erkenntniß“ sei.113 Zu dieser bis ins 20. Jahrhundert gültigen Forderung nach Systematizität trat die nach Objektivität mit der Folge, dass ab 1790 die Gleichsetzung von ‚Wissen‘ und ‚Wissenschaft‘ „im Hochdeutschen zu veralten“ begann und „am häufigsten“ nun der Wahrheitsanspruch geltend gemacht wurde,114 so dass auch ‚Kunst‘ und ‚Wissenschaft‘ auseinandertraten. Objektivität verlangte eine Methode, und zwar eine disziplinspezifische, so dass die hergebrachte logisch-deduktive Darlegung allenfalls noch in der ihren Wissenschaftscharakter allmählich verlierenden Naturrechtslehre praktiziert wurde. Schon vor Schleiermachers berühmt gewordener Formel hatte darum die Wissenschaft sich von ihrer Zweckbindung zu lösen begonnen. Das ließ sich zwar im Falle der naturwissenschaftlichen nicht und bei den juristischen115 und theologischen Disziplinen nur in Grenzen halten, kennzeichnete aber bei den in der Philosophischen Fakultät angesiedelten und im Zuge ihrer Wendung zur Erforschung der Vergangenheit Wissenschaftscharakter annehmenden Disziplinen umso stärker das Selbstverständnis. Empirisch zu ermittelnde Sachverhalte hatten es darum zunehmend schwer. Als sehr wirksam erwies sich Hegels dezidierte Absage an die „Erfahrungswissenschaften“, während er die Philosophie zur „begreifenden Erkenntnis des absoluten Geistes“ sublimierte, der sich sein „Reich […] in seinem eigenen Elemente erbaut“.116
Unter diesen Bedingungen nimmt es nicht wunder, dass die nach französischen Beispiel vereinzelt erhobene Forderung nach einer empirisch basierten „Wissenschaft der Gesellschaft“ zunächst von außerhalb der Universitäten kam, also von Nichtwissenschaftlern. Manche von ihnen wie Buchholz, Comte und Mill hatten keine abgeschlossene akademische Bildung. Der Rittergutsbesitzer Moritz von Lavergne-Peguilhen, der 1838, also noch vor Comte,117 das Wort „Gesellschaftswissenschaft“ in einen Buchtitel aufnahm, war sogar Autodidakt.118 Über ein Echo im akademischen Bereich ist nichts bekannt. Das war natürlich auch eine Antwort.
Es war darum, wie oben bereits festgestellt, erst die in den 1840er Jahren ihren Gipfel erreichende Massenarmut mit ihren nicht länger zu übersehenden Miseren, die zur ‚misère de la philosophie‘119 führten und einzelnen Vertretern der Wissenschaft den Blick für die sozialen ‚Tatsachen‘ öffnete. Stein prognostizierte seinen Landsleuten, dass auch bei ihnen Verhältnisse wie in Frankreich zu erwarten seien, falls nicht eine neu zu schaffende Disziplin sich der bisher von der Wissenschaft vernachlässigten Themen Eigentum, Unterricht des Volkes, Industrie und Handel, „bürgerliche Ehre“, Stände und Klassen annehme. Die „Wissenschaft des Staats“ wisse darauf ebensowenig eine Antwort wie Rechtsphilosophie und Volkswirtschaftslehre, es müsse eine „Wissenschaft der Gesellschaft“ geschaffen werden, die „dieses wirkliche Ganze“, wie er die Gesellschaft nannte, „zu einem Ganzen in der Anschauung erhebt“.120
Ein großes – und noch lange währendes – Problem war, dass eine wissenschaftliche Terminologie sozialer Sachverhalte und Befunde nur in Ansätzen existierte.121 Das wird besonders gut sichtbar bei den zehn Jahre nach Steins Erstlingswerk von Robert von Mohl unternommenen Anstrengungen, die „Gesellschafts-Wissenschaft“ aus Teilen des Privat- und Staatsrechts, der Volkswirtschaftslehre und Politik zusammenzusetzen und von Geschichte und Statistik gesellschaftsspezifische Beiträge zu verlangen.122 Damit sollte den Ansprüchen der Universitätsdisziplinen an Objektivität, Systematizität – Mohl entwarf alsbald (und las jahrzehntelang) eine Encyklopädie der Staatswissenschaften, die seine Gesellschaftswissenschaft enthielt – und Methode Genüge geleistet und so das Neue anerkannt werden. Eine vollkommen eigenständige Disziplin war das nicht, die ‚Wissenschaft der Gesellschaft‘ wurde zu einem Teilfach der ‚allgemeinen Staatslehre‘.123 Das hatte freilich seinen Preis. Auch nur annähernd so treffende soziologische Beobachtungen wie bei Friedrich Buchholz Jahrzehnte früher finden sich nirgendwo, sie hätten dort auch keinen Platz gefunden.
Mohl hat also die methodologische Grundlegung einer eigenständigen Gesellschaftswissenschaft wesentlich vorangetrieben, aber die Existenz einer sozialen Gesamtheit namens Gesellschaft sicher nicht entdeckt,124 auch wenn seine Definition ausgesprochen modern ist. Zum Thema kam er erst in den späten 1840er Jahren und wohl besonders in der 48er-Revolution – er war in der Paulskirche Justizminister –, als die „Gesellschaftsfrage […] zu einer Gefahr geworden“ war,125 denn in den 1830ern hatte ihm das Elend der Fabrikarbeiter noch keinen Anlass zu einer Gesellschaftstheorie gegeben.126
„Seit etwa fünfzig Jahren“, so Mohl dann aber 1851, trete „uns etwas völlig Neues entgegen“, das „mit wachsender Schnelligkeit zur höchsten Bedeutung geworden ist“, weil die hergebrachte Lehre vom Staat das „selbständige Volksleben“ immer weniger ignorieren, aber auch nicht angemessen bearbeiten könne. „Das Wort ‚Gesellschaft‘ hat ertönt“, weil angesichts der dramatischen Notlagen das Thema ‚Freiheit‘ seinen Primat an die Sicherheit, d.h. an die Frage der Umgestaltung der Gesellschaft habe abtreten müssen.127
Gesellschaft zu definieren sei schwierig, weil sie ganz unterschiedliche Formen und Gegenstände aufweise und in die Sphären der Individuen und des Staates hinübergreife. Mohl war einer der ersten, der eine genauere Definition unternahm. Seine umständliche, weitschweifige Beschreibung verrät das Fehlen uns heute selbstverständlicher Fachtermini, sie ist aber vergleichsweise originell beim Versuch, den nach damaliger Ansicht zwischen Individuen und Staat angesiedelten, aber eben von Individuen belebten Bereich genauer zu erfassen. Er sprach von „Gemeinschaftlichkeit der Lebensweise“, von „Lebenskreisen“, von „natürlichen Genossenschaften“. Diese wiesen sechs gemeinsame Merkmale auf: (1.) dauerhafte Zusammengehörigkeit, deren Ursache dafür (2.) von erheblicher Bedeutung sein müsse; ferner ist (3.) die „allgemeine Verbreitung eine nothwendige Bedingung“; man könne (4.) auch in verschiedenen solcher „Genossenschaften“ gleichzeitig sein; (5.) politisch-administrative Grenzen spielten keine Rolle und es handle sich (6.) auch nicht um förmliche Organisationen, sondern um „Interessen-Genossenschaften“. Da diese Merkmale weder für die einzelnen Menschen noch für den Staat Geltung besäßen, sei „somit erwiesen, dass diese Interessen-Genossenschaften ein eigenthümliches, weder mit den Persönlichkeitszuständen, noch mit der staatlichen Einheit zu verwechselndes und zu verbindendes Verhältniss sind. In diesem Falle ist dann aber auch nöthig, dass ihnen eine eigene Bezeichnung werde. Man hat hierzu das Wort Gesellschaft gewählt“.128 – Gemessen am damaligen Kenntnisstand ist das ein ambitionierter makrosoziologischer Beschreibungsversuch. Zentral ist für Mohl das Interesse, es sei das entscheidende Movens der gesellschaftlichen Zustände und ihrer unendlichen Vielgestaltigkeit.
Dass die Gesellschaft wissenschaftlich erforscht werden müsse, verstand sich für Mohl von selbst, denn nur dann könne man wissen, „wo und auf welche Weise den so drohenden Gefahren des itzigen Zustandes begegnet werden kann und muss“.129 Seine entsprechenden Vorstellungen, wie die „Gesellschaftswissenschaften“ – der gelegentlich benutzte Plural ist ein Novum – beschaffen sein sollten, wirken auf den heutigen Leser etwas befremdlich, denn sie sind natürlich völlig frei von dem uns vertrauten soziologischen Jargon und verraten stattdessen den Juristen, der die zu entwerfende Disziplin „schablonenhaft“130 in die drei Fächer „Allgemeine Gesellschaftslehre“, „Dogmatische“ und „Geschichtliche Gesellschaftswissenschaften“ unterteilt. Während letztere die Geschichte und Statistik der Gesellschaft umfassen und erstere ihr Wesen, bilden in der ‚dogmatischen‘ Abteilung Rechts-, Sitten- und Zweckmäßigkeitslehre den Gegenstand und mithin das, was zumindest teilweise heute ‚soziales Handeln‘ genannt wird. Einzelheiten dazu können hier übergangen werden, weil Mohl keine inhaltlichen Aussagen macht, sondern systematische, d.h. überwiegend mit Abgrenzungen zur Rechts-, Staats- und Polizeiwissenschaft beschäftigt ist. Umso wichtiger wäre zu wissen, was er in seinen Vorlesungen zum Thema ‚Gesellschaft‘ tatsächlich geboten hat. In seiner jahrzehntelang gehaltenen Vorlesung Encyklopädie der Staatswissenschaften finden sich keine neuen Gedanken, vielmehr handelte es sich in der Hauptsache um den hergebrachten Stoff.131 Er las ja auch Allgemeines Staatsrecht sowie Politik, denn er bildete angehende Juristen aus.132 Seine späteren Veröffentlichungen lassen bemerkenswerterweise keine Bezüge zur Gesellschaftswissenschaft mehr erkennen.
Lässt sich die Schwelle, die die 1840er Jahre unzweifelhaft darstellen, auch auf anderen Feldern als der Wissenschaft erkennen? Sprach man etwa nun im Deutschen häufiger von ‚Gesellschaft‘? Vom gesprochenen Deutsch gibt es naturgemäß so gut wie keine Überlieferung. Immerhin kann man mit Hilfe des Deutschen Textarchivs aus unterschiedlichsten Quellen zwischen 1750 und 1900 die Häufigkeit des Gebrauchs von ‚Wissenschaft der Gesellschaft‘, ‚sozialer Frage‘, ‚Soziologie‘, und ‚Gesellschaft‘





























