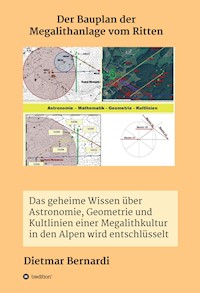2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Dieser Forschungsbericht beschreibt das Vorgehen und die Ergebnisse einer kulturastronomischen Untersuchung in einem ausgewählten kleinen Gebiet am Ritten in Südtirol, besonders in der Umgebung von wichtigen prähistorischen Siedlungsplätzen. Die Kulturastronomie ist in Südtirol ein noch unbekanntes Forschungsgebiet im Grenzbereich von Archäologie und Astronomie, die sich mit der vorgeschichtlichen Himmelskunde des Menschen befasst. Dabei geht es um das Aufzeigen der Einbindung des Menschen in die periodischen Abläufe am Tages- und Nachthimmel, die astronomischen Einflüsse auf menschliche Verhaltensweisen, die vermutete astronomische Funktion prähistorischer und archaischer Objekte, wie die Ausrichtung von Gräbern, die Kreisgrabenanlagen, die neolithischen und megalithischen Denkmäler, und um die Kontinuität archaischer Sonnenbeobachtungstechniken in historischer Zeit. Ein früherer Begriff für Kulturastronomie ist auch noch Archäoastronomie. Eine geteilte Sonne ist ein Sonnenphänomen, bei dem die Sonne links und rechts eines sehr steilen Berges gleichzeitig hervorscheint. Besonders die astronomische Regelmäßigkeit und Wiederkehr dieses Sonnenphänomens, zusammen mit der geeigneten natürlichen Landschaftsformation mit Nutzungsmöglichkeit für eine Jahressonnenuhr, und die Festlegung eines Jahreskalenders waren für die Menschen in der Prähistorie von großer Bedeutung. Dieses Sonnenphänomen einer geteilten Sonne, das ca. 1 Minute nach dem Sonnenaufgang in der tiefen Kerbe am Horizont zwischen den Felsspitzen Santner und Euringer in der Prähistorie zu sehen war und auch heute noch zu sehen ist, ist sehr selten und spektakulär in seiner Lichterscheinung. Dieses Sonnenphänomen, das ungefähr 1 Minute lang zu sehen ist, soll nun hier näher beschrieben werden. Es ist nur zwei Mal im Jahr vom Ritten aus an bestimmten Tagen bei gutem Wetter zu sehen. Dadurch ist die Häufung prähistorischer Fundstellen am Ost- und Südostabhang des Rittens astronomisch erklärbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mein Motiv
Mir ist bekannt, dass die Experten der Kulturastronomie (Archäoastronomie) nur mit mathematischen Programmen die Gestirnsbahnen von Sonne, Mond und Sternen am Himmel simulieren und so feststellen, ob diese Gestirnsbahnen markante Geländehorizontpunkte schneiden und sich diese Himmelsereignisse regelmäßig wiederholen. Kein Mensch dieser Fachleute stellt sich hin und beobachtet solche Himmelsereignisse selbst mit eigenen Augen.
Da ich aber nicht über diese notwendigen mathematischen Programme verfüge, bleibt mir nichts anderes übrig, genau wie die Menschen in der Prähistorie selbst zu beobachten und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich bestimme so die Zeit im Jahresablauf, genau wie es die Menschen in der Steinzeit oder Bronzezeit machten. Ich kann durch diese archaische Sonnenbeobachtungstechnik und der dafür besonders geeigneten Landschaftsformation in Südtirol auch heute noch einen Kalender entwickeln. Genauso machten es auch die Menschen in der Prähistorie auf dem Ritten in Südtirol. Das zu beweisen war mein Motiv für diese Arbeit. Ich bleibe daher ein Amateur in der Kulturastronomie.
Mein Motto
VERZWEIFLE NICHT, WENN DU KEIN PROFI BIST. EIN AMATEUR HAT DIE ARCHE GEBAUT, PROFIS DIE TITANIC.
Dietmar Bernardi
Die Entdeckung der geteilten Sonne vom Ritten
Eine kulturastronomische Entdeckungsgeschichte und ihre Ergebnisse
Zeitbestimmung durch archaische Sonnenbeobachtungstechnik
© 2018 Dietmar Bernardi
Umschlag, Illustration: Dietmar Bernardi
Verlag & Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7469-5736-4
(Paperback)
978-3-7469-5737-1
(Hardcover)
978-3-7469-5738-8
(e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bildnachweise:
Source: Microsoft Office Word 16, 192 Seiten, 266 Abbildungen, 123 Farbseiten, 11 Tabellen Fotos: Dietmar Bernardi, wenn nichts anderes angegeben ist.
Abdruckgenehmigung für fremde Bilder:
United Soft Media Verlag, München, vom 12.07.2006 nur für einen kulturastronomischen Forschungsbericht Abb.: 208, 209, 214
Landesarchiv Autonome Provinz Bozen – Südtirol:
Abb.: 16, Südtiroler Landesarchiv, Bozen, Genehmigung für Veröffentlichung erteilt.
Landeskartografie Autonome Provinz Bozen Südtirol, Abteilung Informationstechnik, früher übergeordnete Raumordnung:
Abb.: 02, 10, 20, 85, 92, 98, 99, 137, 141, 142, 170, 174, 205, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 241
Geologischer Dienst Autonome Provinz Bozen Südtirol, Abteilung Geologie und Baustoffprüfung:
Abb.: 08, 21, 22, 43, 70, 71, 73, 76, 77, 80, 93, 94, 96, 97, 103, 104, 105,106, 136, 138, 172, 195, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 250
Westfälische Volkssternwarte und Planetarium Recklinghausen:
Dr. Burkhard Steinrücken Abb.: 60, 68, 130, 139
GPS-Software: TTQV4 von Touratech AG, Lizenz vom 11.01.2006
Freundschaftlich überlassene Bilder / Zeichnungen:
Gianni Bodini
Abb.: 181, 182, 183, 184, 185, 186
Georg Brunner
Abb.: 263
Therese Coray-Lauer
Abb.: 215, 216
Georg Coray-Lauer
Abb.: 217, 218, 219, 220, 223, 224
Hermann Ramoner
Abb.: 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 165
Martin Ruepp
Abb.: A in der Zusammenfassung
Martin Ruepp
Abb.: 196, 197, 198, 199, 200, 201
Dr. Gilla Simon
Abb.: 262
Prof. Dr. Kurosch Thuro
Abb.: 261
Richard Walker
Abb.: 127, 128, 129
Elmar Weiss
Abb.: 81
Dr. Helen Wider
Abb.: 221, 222
Dr. Georg Zotti
Abb.: 140
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zusammenfassung
1. Übersicht
1.1 Die Lage
1.2 Wichtige archäologische Fundstellen auf dem Ritten
1.3 Die Landschaft zwischen Wolfsgruben und Lichtenstern
1.3.1 Die archäologische Fundstelle Wallnereck
1.3.2 Das Roarer Windspiel mit dem großen Menhir ME01
1.3.3 Die archäologische Fundstelle Collnoartl oder Oartlkopf
1.3.4 Die archäologische Fundstelle Mitterstieler See
1.3.5 Die Trockenmauern zwischen Wallnereck und Roarer Windspiel
1.4 Die archäologische Fundstelle Piperbühel
1.5 Weitere Bilder vom Schlern - fotografiert an ausgewählten Standorten
1.6 Bisherige Befunde und Aktivitäten der Archäologen
1.6.1 Neuere archäologische Aktivitäten auf dem Ritten
1.6.2 Erste kulturastronomische Hinweise
1.6.3 Hinweise zur Gletschermumie "Icemann" - „Ötzi“ genannt
2. Basiswissen Astronomie
2.1 Die Rotation der Erde um sich selbst
2.2 Der Umlauf der Erde um die Sonne
2.3 Die elliptischen Bahnen der Erde um die Sonne
2.4 Die Präzession
2.5 Die Schiefe der Ekliptik
2.6 Horizontastronomie und Kalender
2.7 Schattenstabmessungen in der Geschichte und in unserer Zeit
2.8 Der Schattenstab – Gnomon Modell
2.8.1 Die Gnomonische Projektion
2.9 Nutzung spezieller Geländeformationen in der frühen Astronomie
2.10 7000 Jahre Himmelsbeobachtung in der Schweiz - Ein Auszug
3. Kultlinien und Rituale
3.1 Die Bedeutung prähistorischer Kultlinien / Kultachsen
3.2 Die Hauptkultlinien des Menhirs ME01 von Wolfsgruben
3.2.1 Die Hauptkultlinie Richtung Sommer-Sonnenwende
3.2.2 Die Hauptkultlinie zum Sonnenereignis zwischen Santner-Euringer
3.2.3 Die Hauptkultlinie Richtung Winter-Sonnenwende
3.3 Kernaussage zur Menhiranlage mit dem großen Menhir ME01 in Wolfsgruben
4. Messungen und Simulationen
4.1 Das Geografische Informationssystem
4.2 Das Geografische Informationssystem für archäologische Objekte (Menhire)
4.3 Die Digitale Karten vom Ritten
4.4 Die Lage der Menhire
4.5 Die Höhe der Menhire
4.6 Export der angezeigten Kartenbilder in eine Datei
4.7 Karten vom Amt für Informatik und Digitalisierung
4.8 Karten vom Amt für Geologie und Baustoffprüfung, Geologischer Dienst
4.9 Der breitblättrige Rohrkolben (Typha latifolia) als Schattenwerfer
4.10 Hinweise zu den Astronomischen Tabellen im Anhang A
4.11 Die Messgeräte
4.12 Messungen mit den Messgeräten
4.13 Berechnungen mit dem Berechnungstool von Richard Walker
5. Astronomie - Kulturastronomie - Archäologie auf dem Ritten
5.1 Astronomie
5.2 Archäologie
5.3 Kulturastronomie - Wallnereck
5.4 Eine Deutung der Herkunft des Namen „Lichtenstern“
5.5 Neue kulturastronomische Interpretation für den Ritten
5.6 Astronomie zum Sonnenaufgang vom Wallnereck am 27. März 2010
5.7 Vergleich der Sonnenaufgänge vom Wallnereck - Frühjahr und Herbst
5.8 Astronomie für das Jahr 2012 vom Wallnereck
5.9 Kulturastronomie - Roarer Windspiel - Peillinie zum Santner und Euringer
5.10 Weitere Beobachtungen
5.10.1 Beobachtungen vom Roarer Windspiel im Frühjahr 2012
5.10.2 Beobachtungen vom Roarer Windspiel im Herbst 2012
5.10.3 Vergleich der Ergebnisse vom Frühjahr und Herbst 2012
5.10.4 Beobachtung im Frühjahr 2013 beim Aufsteller Hof
5.10.5 Beobachtung im Herbst 2013 beim Beobachtungspunkt P07neu
5.10.6 Beobachtungen im Frühjahr 2014 durch Martin Ruepp
5.10.7 Beobachtungen im Frühjahr 2018 durch Martin Ruepp
5.11 Neue vereinfachte Zeitbestimmung der Sichtbarkeit der geteilten Sonne
5.12 Kulturastronomie – Collnoartl oder Oartlkopf
5.13 Kulturastronomie – Mitterstieler See
5.14 Kulturastronomie – Piperbühel
5.14.1 Zeichnung des Sonnenaufganges vom Piperbühel
5.14.2 Simulation des Sonnenaufgangs vom Piperbühel 2007
5.14.3 Sonnenaufgänge am Piperbühel zur heutigen Tagundnachtgleiche
5.14.4 Simulation der Sonnenfinsternis von 1961 vom Piperbühel
5.15 Eine geteilte Sonne auch an anderen Orten
5.15.1 Die geteilte Sonne vom Piz Ner, von Valendas in der Schweiz aus
5.15.2 Die geteilte Sonne vom Matterhorn, italienisch Monte Cervino
6. Die Kalenderanlage mit dem vermutetem Hügelgrab von Wolfsgruben
6.1 Stichpunkte zu modernen Geophysikalischen Prospektionsmethoden
6.2 Verbreitung der Ganggräber in Europa
6.3 Die Luftbildanalyse des Hügelgrabes ergibt eine kultastronomische Anlage
6.4. Die Bilder des Hügels beim Plattner Hof – heute Bienenmuseum
7. Bilder weiterer Menhire auf dem Ritten
7.1 Menhire zwischen Lichtenstern und Wolfsgruben
7.2 Menhire im Bereich Klobenstein
8. Exkurs 1 - Megalithik-Tagung 2006 in Falera, Schweiz
9. Exkurs 2 - Vergleich der tiefen Felsspalte mit anderen Felsenlöchern
10. Exkurs 3 - Die andere Eisacktalseite – Völs - Seis am Schlern
11. Danksagung
Anhang A - Tabellen – Berechnungen und Messungen zu den Schernspitzen
T10 – Astronomische Tabelle Roarer Windsspiel – Menhir ME 01
T11 – Astronomische Tabelle Piperbühel
T12 – Astronomische Tabelle Wallnereck
T13 – Astronomische Tabelle Mitterstieler See – Aussicht
T14 – Astronomische Tabelle Collnoartl - Oartlkopf
Anhang B - Tabellen – Koordinaten der Menhire und Messpunkte
K20_Koordinaten 1 - Tabelle im Format UTM32
K21_Koordinaten 1 - Tabelle im Format WGS84 – DD° MM' SS.S''
K22_Koordinaten 1 - Tabelle im Format WGS84 - DD.DDDD°
K23_Koordinaten 2 - Tabelle im Format UTM32
K24_Koordinaten 2 - Tabelle im Format WGS84 – DD° MM' SS.S''
K25_Koordinaten 2 - Tabelle im Format WGS84 - DD.DDDD°
Anhang C - Bibliographie - Literaturverzeichnis
Anhang D - Bibliographie - Internetadressen
Biographie des Autors Dietmar Bernardi
Vorwort
Auf einer Webseite der Abteilung Denkmalpflege der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol 1 steht zum Parameter „Bodendenkmalpflege“ im Internet folgender Satz:
„Die Archäologie ist eine wissenschaftliche Disziplin“.
Aber die angrenzende Kulturastronomie wird nicht erwähnt.
Dieser Forschungsbericht beschreibt das Vorgehen und die Ergebnisse einer kulturastronomischen Untersuchung in einem ausgewählten kleinen Gebiet am Ritten in Südtirol, besonders in der Umgebung von wichtigen prähistorischen Siedlungsplätzen.
Die Kulturastronomie ist in Südtirol ein noch unbekanntes Forschungsgebiet im Grenzbereich von Archäologie und Astronomie, die sich mit der vorgeschichtlichen Himmelskunde des Menschen befasst. Dabei geht es um das Aufzeigen der Einbindung des Menschen in die periodischen Abläufe am Tages- und Nachthimmel, die astronomischen Einflüsse auf menschliche Verhaltensweisen, die vermutete astronomische Funktion prähistorischer und archaischer Objekte, wie die Ausrichtung von Gräbern, die Kreisgrabenanlagen, die neolithischen und megalithischen Denkmäler, und um die Kontinuität archaischer Sonnenbeobachtungstechniken in historischer Zeit. Ein früherer Begriff für Kulturastronomie ist auch noch Archäoastronomie.
Der Verfasser möchte hiermit darüber informieren, dass im Untersuchungsgebiet vom Roarer Windspiels in Wolfsgruben bis zum Wallnereck in Lichtenstern ein besonderes schutzwürdiges Areal vorhanden ist, das noch Reste eines europäischen astronomischen Erbes darstellt. Diese Menhiranlage ist wegen ihrer Genauigkeit einmalig im alpinen Raum. Sie hat wegen ihrer Lage und Größe Astronomie geschichtliche und damit auch kulturgeschichtliche Bedeutung.
Eine geteilte Sonne ist ein Sonnenphänomen, bei dem die Sonne links und rechts eines sehr steilen Berges gleichzeitig hervorscheint. Besonders die astronomische Regelmäßigkeit und Wiederkehr dieses Sonnenphänomens zusammen mit der geeigneten natürlichen Landschaftsformation mit Nutzungsmöglichkeit für eine Jahressonnenuhr und die Festlegung eines Jahreskalenders waren für die Menschen in der Prähistorie von großer Bedeutung gewesen.
Dieses Sonnenphänomen einer geteilten Sonne, das ca. 1 Minute nach dem Sonnenaufgang in der tiefen Kerbe am Horizont zwischen den Felsspitzen Santner und Euringer in der Prähistorie zu sehen war und auch heute noch zu sehen ist, ist sehr selten und spektakulär in seiner Lichterscheinung. Dieses Sonnenphänomen, das ungefähr 1 Minuten lang zu sehen ist, soll nun hier näher beschrieben werden. Es ist nur zwei Mal im Jahr vom Ritten aus an bestimmten Tagen bei gutem Wetter zu sehen. Dadurch ist die Häufung prähistorischer Fundstellen am Ost- und Südostabhang des Rittens astronomisch erklärbar. 2
Eine Entscheidung über den Schutzbedarf dieses Areals ist notwendig. Es ist Aufgabe der Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen in Südtirol, die verschiedenen Interessensgebiete der Bevölkerung am Ritten, der Denkmalschützer, Naturschützer, Grundeigentümer, Archäologen, Astronomen und weitere Naturwissenschaftler sowie die Arbeitsgebiete Tourismus, Gastronomie und Verkehr gegeneinander abzuwägen und eine langfristige Perspektive für den Schutz dieses Gebietes sicherzustellen. Dabei muss die Erhaltung des Gleichgewichts der verschiedenen Bewohner, wie Bauern, Handwerker, Erholungssuchende und in der Gastronomie Beschäftigte oberstes Ziel sein.
Darüber hinaus ist es notwendig, dieses Gebiet nicht nur archäologisch, sondern auch weiter naturwissenschaftlich zu erforschen, zu dokumentieren und die Ergebnisse anschaulich aufzubereiten. Da sich hier aber um eine ganze Anlage mit prähistorischen Bauten handelt, ist nur ein Informationszentrum oder Museum mit Freigelände vor Ort geeignet, die Zusammenhänge didaktisch so zu erläutern, damit die Besucher aus nah und fern diese vergangene alpine Hochkultur auch verstehen können.
Die Forschungsergebnisse in diesem Bericht basieren auf heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Naturkunde und Naturgesetze stehen im Mittelpunkt. Jeder kann sie nachprüfen, wenn er die entsprechenden Kenntnisse hat. Die astronomischen Naturgesetze werden besprochen und erläutert. So wird der Leser in die Lage versetzt, durch eigene Beobachtung in der Natur naturkundliche Gesetzmäßigkeiten im Bereich der Astronomie zu beobachten und zu erkennen. Gemeint ist die Dauer der Jahreslänge, die für die Festsetzung eines Kalenders notwendig ist. Die Bestimmung der Zeit war schon immer ein wichtiges Instrument und Ziel vergangener Kulturen.
Die vermessungstechnischen und die astronomischen Angaben sind mit geeigneter Software überprüft und simuliert worden. Die Leser, natürlich auch die Leserinnen, sollten keine Scheu vor der Anwendung der Mathematik und Informatik haben. Freude an den Naturwissenschaften und Technik wären vorteilhaft. Eine gute Beobachtungsgabe, logisches Denken und ein räumliches Vorstellungsvermögen erleichtern das Verständnis dieser Dokumentation.
Es werden keine Mystik und Mythen im Sinne der Religions-, Kultur-, Sozial-, Geschichts-, Literaturwissenschaft, der Theologie und der Philosophie besprochen, auch wenn einzelne Hinweise zu Sagen erfolgen. Die gezeigten Landkarten stammen von der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol, Amt für Informatik und Digitalisierung und vom Geologischen Dienst der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol.
Dieser Forschungsbericht ist eine ergänzende Fortschreibung früherer Berichte im Internet zu diesem Thema.
Dietmar Bernardi
2. überarbeitete Ausgabe München / Wolfsgruben, 2018
1 2018-04-25: http://www.provinz.bz.it/denkmalpflege/themen/bodendenkmalpflege.asp
2 Inga Hosp: Ritten - Land und Leute am Berg, Tappeinen Verlag, Lana (BZ), 2005, S. 10,
Der Heimatforscher Josef Rampold stellt fest: „Keine andere Gegend des Eisacktales ist so dicht mit Urzeitsiedlungen übersät wie der Süd- und Ostabhang des Rittens“.
Zusammenfassung
In Kap. 1 wird zunächst ein Überblick über das Gebiet Ritten in Südtirol gegeben. Dabei werden die wichtigsten archäologischen Fundstellen besprochen und ihre Bedeutung mit Bilder geschildert. Die vergangenen Aktivitäten der verschiedenen Archäologen werden beschrieben und erste Hinweise zur Kulturastronomie und zu einer astronomischen Sichtweise erläutert.
In Kap. 2 wird das notwendige Basiswissen zur Astronomie behandelt. Dabei werden nur die notwendigen Begriffe und Zusammenhänge erläutert, die für das Verständnis dieser Dokumentation notwendig sind. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Horizontastronomie. Die Bedeutung und Anwendung eines Schattenstabes – griechisch Gnomon – wird hier gezeigt.
In Kap. 3 werden die Hauptkultlinien - auch Kultachsen genannt - erläutert. Dabei werden genau die Kultlinien gezeigt, die vom großen Menhir in Wolfsgruben ausgehen.
In Kap. 4 werden die Messungen und Simulationen mit geeigneter Software und bestimmten Messgeräten gezeigt. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass eigens für die Erforschung der Megalithanlage auf dem Ritten ein Geographisches Informationssystem für archäologische Objekte entwickelt wurde, z.B. für Menhire. Durch Nutzung der digitalen Karten vom Amt für Informatik und Digitalisierung zusammen mit einem auf GPS aufgebauten System zur Routingplanung können verschieden georeferenzierten Karten mit Messpunkten erstellt werden.
In Kap. 5 sind die ganzen astronomischen Beobachtungen und Messungen von Sonnenaufgängen an den verschiedenen archäologischen Fundpunkten auf dem Ritten zusammengefasst. Es werden die astronomischen Zusammenhänge der Sonnenaufgänge im Frühjahr und im Herbst bezogen auf die Tagundnachtgleiche von diesen prähistorischen Siedlungsplätzen dargestellt. Ergänzt werden diese Sonnenaufgänge durch Bilder von Simulationen mit geeigneter Software. Weiter wird von geteilten Sonnen auch an anderen Orten in den Alpen berichtet.
In Kap. 6 wird die Kalenderanlage mit dem vermuteten Hügelgrab in Wolfsgruben gezeigt. Moderne Geophysikalische Prospektionsmethoden und eine Luftbildanalyse begründen die Annahme, dass hier wichtige archäologische Funde gemacht werden können, wenn die astronomischen Zusammenhänge beachtet werden.
In Kap. 7 werden Bilder von weiteren Menhiren zwischen Wolfsgruben und Lichtenstern gezeigt. Ergänzt wird dieses Kapitel durch Bilder von Menhiren mit unbekannter Funktion in der Nähe des Hauptortes Klobenstein der Gemeinde Ritten.
In Kap. 8 wird ein Exkurs zu einer wichtigen megalithischen Tagung 2006 in der Schweiz beschrieben.
In Kap. 9 wird ein Exkurs mit einem Vergleich der tiefen Felsspalte zu anderen Felsenlöchern beschrieben.
In Kap. 10 wird ein Exkurs zur anderen Eisacktalseite – Völs und Seis beschrieben.
In Kap. 11 wird allen, die zum Gelingen dieser Dokumentation beigetragen haben, gedankt.
Im Anhang werden verschiedene Astronomische Tabellen und Koordinaten der Messobjekte aufgeführt. Weiter sind im Anhang C eine Bibliographie mit einem Literaturverzeichnis und im Anhang D eine Bibliographie mit Internetadressen aufgeführt. Eine Biographie des Autors bildet den Abschuss.
Diese Dokumentation hat das Ziel, ortskundige und an der frühen Astronomie interessierte Menschen auf diese Menhiranlage auf dem Ritten in Südtirol aufmerksam zu machen. Für die Überprüfung dieser hier gemachten lokalen Aussagen sind keine besonderen mathematisch-astronomischen oder archäologischen Kenntnisse notwendig.
Ausgangspunkt für diese Untersuchung waren im Jahre 2004 Hinweise eines Archäologen, dass sowohl in den Orten Lichtenstern - italienisch Stella - und in Wolfsgruben - italienisch Costalovara - auf dem Berg Ritten in Südtirol prähistorische Kuppen Siedlungen und Brandopferplätze anzutreffen sind, die astronomisch genutzt werden konnten. Dort sind Menhire so aufgestellt, dass sie in einer Reihe stehen und astronomisch auf die Tagundnachtgleiche ausgerichtet sind.
Durch ein Bild der aufgehenden Sonne in einem Buch über den Ritten von Inga Hosp 3 wurde diese kulturastronomische Untersuchung intensiviert, nachdem der Archäologe Mag. Werner Holzner 4 eine erste rein archäologische Interpretation der Menhiranlage von Wolfsgruben im Entwurf angefertigt hatte. Nach 14 Jahren kulturastronomischer Untersuchung auf dem Ritten, kann die geteilte Sonne mehrfach bestätigt werden.
Abb. A: Die geteilte Sonne vom Ritten. Aufgenommen am 2018-04-02 um 07:29. Die Lage des Standortes P07neu befindet sich im Wald in der Nähe des über den Felsenabhang hinab geworfenen Menhirs ME19, direkt auf der Peillinie vom großen Menhir ME01 zu den Schlernspitzen.
Foto: Martin Ruepp
Abb. B: Blick auf die geteilte Sonne vom Ritten nach dem Sonnenaufgang am 2012-04-01 um 07:28 Uhr MESZ direkt vom „Roarer Windspiel“ aus. Die Felsspitze Euringer verdeckt gerade für 1 Minute die Sonne.
Foto: Dietmar Bernardi.
Diese besonderen Beobachtungsstellen waren sicherlich schon den örtlichen Schamanen in der Steinzeit bekannt. Es ist anzunehmen, dass auch noch weitere Schamanen außerhalb der heutigen politischen Grenzen Südtirols diese einmaligen Beobachtungsstellen kannten.
Diese natürliche Landschaftsformation auf dem Ritten mit dem Blick zum Horizont auf den Berg Schlern mit seinen Felstürmen Santner und Euringer ist für präzise astronomische Beobachtung dermaßen gut geeignet, weil eine Beobachtung dieser Sonnenaufgänge, besonders der geteilten Sonne, mit nur zweimaliger Wiederholung im Jahresablauf möglich ist. Dieses Sonnenphänomen ist auch für eine zeitliche Vorhersage dieser Sonnenaufgänge geeignet. Ein Jahreskalender konnte dadurch festgelegt werden.
Eine Messung des Azimut Winkels und des Höhenwinkels der Sonnenaufgangspunkte müsste von Geometern mit Theodoliten nur noch verfeinert werden, damit genauere astronomische Aussagen gemacht werden können. Das Azimut Winkel ist die Kompassrichtung einer Peilung oder einer Visur. Nord hat Azimut Null, Ost 90, Süd 180 und West 270 Grad. Die Höhe (Elevation) des anvisierten Punktes über dem Horizont wird durch den Höhenwinkel bestimmt.
Damit soll ortskundigen Lesern aus Südtirol einerseits der kulturastronomische Hintergrund dieser Menhiranlage erklärt werden. Andererseits sollen Experten der Kulturastronomie und Astronomen, die sich mit der Geschichte der Astronomie beschäftigen, auf diese Menhiranlage aufmerksam gemacht werden, die noch in keiner Fachliteratur bisher beschrieben wurde. Diese Experten sollen dazu angeregt werden, mit genaueren Messmethoden diese Menhiranlage zu überprüfen, zu vermessen und die Aussagen zu bestätigen oder sie zu widerlegen.
Wer aber bereits Grundkenntnisse der Himmelsbewegungen hat, kann sehr gut verstehen, warum die frühen Astronomen genau diese Landschaftsformation auf dem Ritten für astronomische Beobachtungen sehr gut ausnutzen konnten.
Solche Kenntnisse der archaischen Beobachtungstechnik der Sonne werden heute besonders an der Westfälischen Volkssternwarte und Planetarium Recklinghausen im Ruhrgebiet unter Leitung von Dr. Burkhard Steinrücken den Besuchern der Sternwarte erklärt. Unterstützt wird diese archaische Beobachtungstechnik durch ein künstliches Horizontobservatorium und eine Horizontalsonnenuhr mit Obelisk. Diese frühen astronomischen Kenntnisse werden auch im Internet dieser Sternwarte angeboten.5 6 7 8 9Dabei wird das Sachgebiet Kulturastronomie (Archäoastronomie) auf der kulturastronomischen Projektseite der Westfälischen Volkssternwarte und Planetarium Recklinghausen wie folgt beschrieben:
„Die Kulturastronomie befasst sich mit dem astronomischen Wissen untergegangener schriftloser Kulturen. Dabei stützt sie sich vorrangig auf bauliche Überreste, Bodendenkmäler und ausgewählte archäologischer Funde, aber auch auf Sagen, Mythen und ethnografische Evidenzen, sowie auf schriftliche Quellen aus historischer Zeit, die über noch schriftlose Kulturen berichten.“
Daher wird in diesem kulturastronomischen Bericht auf eine ausführliche Beschreibung aller Aspekte der Kulturastronomie (Archäostronomie) und der Etnoastronomie verzichtet.
Diese Menhiranlage in Wolfsgruben ist bis heute ein noch nicht beschriebenes kulturastronomisches Objekt der frühen Astronomie und stellt Reste eines astronomischen Erbes dar, das noch weiter zu erforschen und zu schützen ist. Diese Menhiranlage hat möglicherweise wegen ihrer Lage, Genauigkeit und Größe kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung. Gemeint ist die Geschichte der Astronomie. Mit Hilfe von Bildern, die an ganz gezielt ausgewählten Standorten auf dem Ritten gemacht wurden, soll die astronomische Nutzung dieser Landschaftsformation erklärt werden.
In der Frühgeschichte hatten die Menschen um Wolfsgruben und Lichtenstern ihre Siedlungen genau an den prähistorischen Fundstellen Wallnereck, Roarer Windspiel, Collnoartl, Mitterstieler See und Piperbühel errichtet, von denen sie den Sonnenaufgang in dem tiefen Spalt zwischen den Schlernkerben am Horizont beobachten konnten. Auch die geteilte Sonne konnten die Menschen in der Prähistorie genau beobachten und einen Jahres-Sonnenkalender entwickeln. Die Vielzahl prähistorischer Stätten auf dem Ritten haben als verbindende Gemeinsamkeit den Blick in die Schlernkerbe Santner-Euringer am Horizont, wo zuerst das Sonnenereignis der „festsitzenden“ Sonne genau zu beobachten war. Nach 1 Minute ca. war die geteilte Sonne zu sehen. Das war nicht nur aus religiösen Gründen sehr wichtig, sondern auch aus praktischen astronomischen Gründen:
Es konnte damit ein Kalender entwickelt werden, in dem die Zeit im Jahresablauf genau festgelegt wurde. Wer die Zeit bestimmen konnte, der hatte Macht über die Menschen. Diese Sichtbarkeit des Sonnenaufganges zu regelmäßigen wiederkehrenden astronomischen Zeiten war und ist nur zwischen dem Wallnereck und dem Mitterstieler See möglich. Genau dort wo heute der Menhir ME01 von Wolfsgruben steht beträgt der Azimut 89° - 90°. Das deutet auf die Tagundnachtgleiche in prähistorischer Zeit hin.
Dieser Menhir ME01 mit seiner Menhiranlage sollte daher zum Kulturdenkmal in der Kategorie Astronomie erhoben werden.
In der kulturastronomischen Literatur ist schon einmal eine ähnliche Stelle beschrieben worden, die aus den gleichen Strukturelementen zusammengesetzt ist, wie diese Menhiranlage in Wolfsgruben auf dem Ritten.
Der bekannte Archäoastronom Prof. Dr. Wolfhard Schlosser 10 berichtet aus dem Hindukusch-Pamir-Gebiet (heute Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan) über einen Ort Balanguru, wo auch lokale Sonnenkalender mit Hilfe einer Felsspalte am Horizont und einem Baum auf der anderen Talseite festgelegt wurden. Prof. Dr. W. Schlosser greift dabei auf Literatur von Wolfgang Lentz 11 zurück. Wolfgang Lentz hat bei seiner deutsch-russischen Hindukusch Expedition 1935 diese Felsspalte und den Baum gesehen. Da es aber abends war, als er die Stelle passierte, gibt es leider kein Bild und auch keine Zeichnung davon.
Auszug aus dem Buch von Wolfgang Lenz:
„Jedes Dorf hatte neben den überall gebräuchlichen Hochkulturkalendern noch seine eigene Weise, wichtige Termine wie Aussaat, Ernte, Auf- und Abtrieb des Viehs zu den Almen und auch Feste durch sog. Kalendermacher zu bestimmen.
Bei aller örtlichen Verschiedenheit erfolgten diese Festsetzungen grundsätzlich nach den beiden Methoden, die von der vergleichenden Völkerkunde auf der ganzen Erde und in allen Epochen der Geschichte nachgewiesen worden sind: Horizontvisuren und Markierungen des Laufs eines Schattenwerfers (Gnomon)“.
3