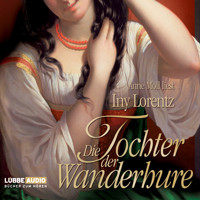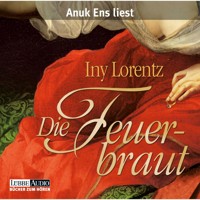9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderapothekerin-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die spannende Geschichte um die mutige Wanderapothekerin Klara aus Thüringen geht weiter: Im dritten Teil der erfolgreichen historischen Roman-Reihe von Bestseller-Duo Iny Lorentz muss sich die sympathische Heldin, inzwischen Mutter von drei Kindern, gegen eine gefährliche Intrige am Hofe des Reichsgrafen im Thüringer Wald behaupten. Ein opulenter historischer Roman, typisch Iny Lorentz: dramatischer Schicksalsroman, spannender Krimi und bewegender Historienroman in einem Thüringen, 1723: In Schwarzburg-Friedrichsthal erwartet jeder das baldige Ableben des kindlichen Reichsgrafen Friedrich. Aus purer Verzweiflung lässt seine Großmutter die Wanderapothekerin Klara aus Königsee entführen und verlangt von ihr, den Jungen gesund zu pflegen. Da Klara und ihre Familie mit Strafe und Vertreibung bedroht werden, wenn sie sich weigert oder keinen Erfolg hat, nimmt sie sich des Neunjährigen an. Schnell stellt Klara fest, dass sie in ein Schlangennest geraten ist, in dem etliche Leute aus Thüringen ein Interesse am Tod des jungen Friedrich haben. Es wird ein Kampf mit einem dickköpfigen Jungen, gegen eine tückische Krankheit, unwillige Bedienstete und gegen tödliche Intrigen, die das ganze Reich in Thüringen bedrohen. Die historische Familiensaga von Iny Lorentz, aus deren Feder auch die verfilmte Bestseller-Reihe "Die Wanderhure" stammt, gibt nicht nur einen unterhaltsamen und überraschenden Einblick in die Geschichte Thüringens des 18. Jahrhunderts, er liest sich wie ein spannender Krimi, den man nicht mehr aus Hand legen möchte. »Eine gelungene Fortsetzung des zweiten Teils. Spannend und einfühlsam, dramatisch [...].« himmelsblume.com Historisches Wissen gepaart mit Spannung und guter Unterhaltung – Lesen Sie auch die anderen historischen Romane von Iny Lorentz! Alle Bände der Familiensaga um die Wanderapothekerin aus Thüringen: - Band 1: Die Wanderapothekerin - Band 2: Die Liebe der Wanderapothekerin - Band 3: Die Entführung der Wanderapothekerin - Band 4: Die Tochter der Wanderapothekerin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Ähnliche
Iny Lorentz
Die Entführung der Wanderapothekerin
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Thüringen, 1723: In Schwarzburg-Friedrichsthal erwartet jeder das baldige Ableben des kindlichen Reichsgrafen Friedrich. Aus purer Verzweiflung lässt seine Großmutter die Wanderapothekerin Klara entführen und verlangt von ihr, den Jungen gesund zu pflegen. Da Klara und ihre Familie mit Strafe und Vertreibung bedroht werden, wenn sie sich weigert oder keinen Erfolg hat, nimmt sie sich des Neunjährigen an.
Schnell stellt Klara fest, dass sie in ein Schlangennest geraten
ist, in dem etliche Leute ein Interesse am Tod des jungen Friedrich haben. Es wird ein Kampf mit einem dickköpfigen Jungen, gegen unwillige Bedienstete und tödliche Intrigen.
Der dritte Teil der neuen historischen Erfolgsserie der Bestseller-Autorin Iny Lorentz!
Inhaltsübersicht
Erster Teil
Wer Wind sät
1.
Klara sah ihre Freundin Martha erfreut, aber auch mit leichtem Zweifel an. »Stimmt es wirklich?«, fragte sie. »Bist du tatsächlich guter Hoffnung?«
»Die Hebamme behauptet es. Mein Mond ist schon drei Mal ausgeblieben, und so alt, in die Wechseljahre zu kommen, bin ich nun doch noch nicht«, antwortete Martha burschikos.
»Natürlich nicht. Du bist jung genug, um noch ein Dutzend Kinder zu bekommen.« Klara zog sie an sich und umarmte sie. »Ich freue mich so für dich.«
»Ich bin auch froh, denn es zeigt, dass ich kein dürrer Weidenbaum bin, wie die Verwandten meines ersten Mannes immer behauptet haben.«
Nun klang Martha bissig, denn die beiden Vettern und die Base ihres ermordeten Ehemanns hatten alles getan, um ihr möglichst wenig für das Land, das mit ihrem Geld gekauft worden war, zahlen zu müssen. Es hatte eines länger als zwei Jahre dauernden Gerichtsprozesses bedurft, um die unberechtigten Forderungen der Kircher-Verwandtschaft abzuwehren.
»Ohne dich, deinen Mann Tobias und meinen Rumold wäre es diesem Gesindel gelungen, mich um alles zu bringen und aus dem Land verweisen zu lassen«, setzte Martha leise hinzu.
Klara gab ihrer Freundin einen leichten Nasenstüber. »Du sollst nicht an schlechte Dinge denken, sondern an das Leben, das in dir wächst.«
»Das tu ich ja auch. Und ich freue mich so sehr!«, erwiderte Martha in einem Tonfall, der nicht so recht zu diesen Worten passte. Sie fasste Klaras Hand. »Was, meinst du, wird Tobias dazu sagen, wenn er, der doch vor kurzem die dreißig überschritten hat, noch einmal ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommt?«
Klara lachte hellauf. »Wenn das deine einzige Sorge ist, kann ich dich beruhigen. Freuen wird er sich, denn er hat sich immer ein Geschwisterchen gewünscht, doch Gott hat dies seinem Vater und seiner Mutter verwehrt.«
Ihre Worte waren nicht geeignet, die Schwangere zu beruhigen. Magdalena Just war bereits vor geraumer Zeit verstorben, und Rumold Just hatte sie erst Jahre später zur zweiten Frau genommen. Doch Magdalenas Verwandte hetzten gegen sie, und sie fühlte sich in diesem wohlhabenden Haushalt immer noch beklommen. Sie hatte sogar zu kämpfen, um nicht unter die Fuchtel ihres Hausmädchens zu geraten.
»Ich weiß nicht so recht …«, begann sie, wurde aber von Klara unterbrochen.
»Lass dir dein Herz doch nicht schwer werden! Dich hat nur eine Laune befallen, wie schwangere Frauen sie gelegentlich überkommt. Ich war während meiner drei Schwangerschaften auch immer wieder den Tränen nahe und musste mir hinterher sagen, dass es nur eine Grille war, die ich besser hätte verscheuchen sollen.«
»Ich bin so froh, dich zu haben!«, rief Martha seufzend und ließ Klaras Hand los, um ihre Hände gegen die eigene Brust zu pressen. »Es ist mein erstes Kind, und ich weiß nicht, was ich damit machen soll.«
Es klang so drollig, dass Klara erneut auflachte. »Erst einmal lässt du es in deinem Bauch, bis es beschließt, herauszukommen.«
Nun musste auch Martha lachen, schüttelte dann aber den Kopf. »Dir kann wohl nichts die Laune verderben?«
»Oh doch, da gibt es schon so einiges«, antwortete Klara mit einem Blick auf das Rathaus, das durch eine Lücke der gegenüberliegenden Häuserreihen zu sehen war.
»Was meinst du?«, wollte Martha wissen.
»Als unsere Buckelapotheker heute Morgen ihre Pässe abholen wollten, hieß es, die Stempelsteuer dafür sei erhöht worden, und da sie sich weigerten, den Aufpreis zu zahlen, wurden sie wieder nach Hause geschickt. Jetzt bin ich auf dem Weg zu Frahm, um ihm die Leviten zu lesen!« Trotz ihrer kämpferischen Bemerkung klang Klara nicht gerade zuversichtlich. »Es ist eine Schande, wie Fürst Friedrich Anton immer wieder die Steuern und Abgaben erhöhen lässt. Selbst wir spüren es in unserem Beutel, obwohl wir hart arbeiten und wirklich gut verdienen«, setzte sie erregt hinzu.
Martha nickte bedrückt. »Rumold schimpft auch darüber, wenn auch nur im stillen Kämmerlein. Er sagte, die Beamten in Rudolstadt hätten ihre Zuträger, die ihre Nachbarn denun… denun…«
»Denunzieren«, half Klara ihr aus.
»Ja, ich glaube, so heißt es«, erklärte Martha. »Rumold sagt, er würde diesen Leuten gerne einmal in der Nacht begegnen, aber mit einem Knüppel in der Hand.«
»Das sollte er nicht zu laut sagen«, warnte Klara ihre Freundin.
Tatsächlich presste der Fürst seine Untertanen für seine stattliche Hofhaltung aus, und doch gab es immer noch Menschen, die dies nicht nur hinnahmen, sondern ihre Nachbarn, die darüber schimpften, sogar an die Behörden verrieten. Wer einmal ins Visier der Hofschranzen und ihrer Kreaturen geraten war, wurde seines Lebens nicht mehr froh. Doch auch das durfte man nicht offen sagen, denn die Herrschaften waren rasch dabei, jemanden einzusperren und nur gegen die Bezahlung einer saftigen Geldstrafe wieder freizulassen.
»Ich muss jetzt weiter zu Frahm, komme jedoch später noch mal bei euch vorbei, dann können wir in Ruhe darüber reden.«
Klara umarmte Martha noch einmal und setzte ihren Weg fort. Dieser führte nicht direkt zum Rathaus, sondern zu einem Gebäude dahinter. Als sie darauf zuging, sah sie mehrere Buckelapotheker vor der Tür stehen, die für andere Laboranten auf die Reise gingen. Die Männer waren aufgebracht und schimpften. Einer drohte in Richtung des Gebäudes mit der Faust.
»Sollen wir uns alles gefallen lassen?«, fragte er zornig. »Schon im letzten Jahr mussten wir für unsere Pässe mehr bezahlen als im Jahr zuvor, und jetzt will der Fürst noch mehr haben. Wo sollen wir es denn hernehmen? Uns etwa aus den Rippen schneiden? Der Verdienst wird nicht größer, und unsere Familien wollen auch leben!«
»Jetzt beruhige dich, Zacharias!«, mahnte ihn ein Zweiter. »Wir können doch nichts machen. Wenn wir die Stempelsteuer nicht bezahlen, bekommen wir keine Pässe und können nicht auf unsere Strecken gehen. Dann haben wir gar nichts mehr!«
Ein weiterer Buckelapotheker schüttelte den Kopf. »Das mag schon sein, dennoch finde ich, Zacharias hat recht. Warum sollen ausgerechnet wir bluten, nur damit die Herrschaften in Rudolstadt es sich noch besser gehen lassen können?«
»Leut, das ist Aufruhr!«, rief jener Buckelapotheker, der zur Ruhe aufgerufen hatte. »Seine Gnaden, Friedrich Anton, ist nun einmal unser Fürst, und wir sind seine Untertanen. Das heißt, er befiehlt, und wir tun, was er sagt.«
»Das ist feige!«, schnauzte Zacharias ihn an. »Der Fürst kann nicht alles machen, was er will. Wir haben auch Rechte, die es zu verteidigen gilt.«
»Wenn du im Karzer sitzt, kannst du diese Rechte ja einfordern«, höhnte der andere.
»Du, wenn du meinst, dann …« Zacharias kam auf den Mann zu und packte ihn bei den Schultern.
Eine Rauferei war das Letzte, in das Klara hineingeraten wollte. Sie drückte sich daher an den streitenden Männern vorbei und betrat das Gebäude, in dem die Pässe für die Buckelapotheker ausgegeben wurden.
Brüser, der Amtsdiener, sah sie hereinkommen, blieb aber sitzen, ohne sie nach ihrem Begehr zu fragen. Dabei wusste sie nur zu gut, dass er alles, was er in der Stadt aufschnappte, an seinen Vorgesetzten Frahm weitertrug.
Elender Speichellecker, dachte sie, während sie auf die Tür der Amtsstube zutrat.
»Du kannst nicht einfach in Herrn Assessor Frahms Zimmer hineinplatzen, sondern musst dich anmelden lassen«, rief der Amtsdiener empört.
»Und warum sitzt du dann noch auf deinem Stuhl? Schließlich ist das deine Aufgabe!«
Brüser hob mahnend den rechten Zeigefinger. »Das heißt Euren Stuhl und Eure Aufgabe! Immerhin bin ich ein Beamter Seiner Gnaden, des Fürsten, und du hast mich ehrerbietig anzusprechen.«
Klara warf ihm einen empörten Blick zu. Im Grunde war der Amtsdiener nicht mehr als ein Knecht, der rennen musste, wenn sein Vorgesetzter es so wollte. Brüser hatte im Winter Holz in den Öfen nachzulegen, wurde geschickt, um vom Wirt Bier zu holen, damit die Beamten ihren Durst löschen konnten, und verdiente dabei weniger als die meisten Buckelapotheker. Nur Bauernknechte wurden noch kärglicher entlohnt, es sei denn, sie waren für die Pferde verantwortlich.
»Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe?«, fragte Brüser scharf, als Klara erneut auf die Tür zutrat, hinter der die Amtsstube Waldemar Frahms lag.
»Doch, Euer Gnaden, und nun meldet mich endlich an! Sonst platze ich direkt in die Kammer des hohen Herrn.«
Es lag genug Spott in Klaras Stimme, dass Brüser ihn auch wahrnahm. Auch deswegen wollte er die Laborantenfrau noch länger warten lassen. Doch dann fiel sein Blick durch das Fenster auf die wütenden Buckelapotheker, die noch immer draußen standen. Es würde Klara Just nur einen Ruf kosten, und die Kerle kämen herein. Der Erste, an dem sie ihren Ärger auslassen würden, war er, während Frahm und die anderen Beamten in ihren Stuben mit den festen Türen bleiben und diese versperren konnten.
»Einmal wirst du an den Falschen geraten!«, drohte er Klara, erhob sich schwerfällig und klopfte an die Tür des für die Pässe der Buckelapotheker zuständigen Assessors Frahm.
»Herein!«, klang es schneidig zurück.
Brüser öffnete die Tür einen Spalt weit und steckte den Kopf hinein. »Klara Just, Weib des Tobias Just, wünscht Euch zu sprechen, Herr Assessor.«
Klara spürte förmlich den Schleim, der dem Amtsdiener nun von den Lippen troff. Mit einer verächtlichen Geste schob sie ihn beiseite und trat ein.
Der Mann hinter dem großen Schreibtisch war noch jung und hatte ihres Wissens diesen Posten nur aufgrund der Protektion seines Vetters Wilhelm Frahm erhalten, der als Geheimrat in Rudolstadt saß und dort bei den ganz hohen Herren recht angesehen war.
»Guten Tag«, grüßte sie knapp.
Waldemar Frahm sah ärgerlich auf. »Ich bin es gewohnt, ehrerbietig angesprochen zu werden!«
»Das wollen hier anscheinend alle bis zum letzten Knecht.« Klaras Ärger überwog mittlerweile ihre Vorsicht.
Brüser wollte darauf antworten, doch da machte Frahm eine Handbewegung, als wolle er eine Fliege verscheuchen.
»Er kann gehen«, sagte er und sprach den Amtsdiener dabei wie jeden x-beliebigen Untertanen des Fürsten an. Anschließend wandte er sich Klara zu. »Du bringst gewiss das Geld, das eure Buckelapotheker nicht zahlen wollten.«
Klara musterte Frahm mit einem eisigen Blick. »Ich komme, um offiziell Beschwerde gegen die Erhöhung der Steuer einzulegen. Die Pässe für unsere Wanderapotheker wurden bereits im letzten Jahr um ein Viertel teurer und sollen nun noch mehr kosten. So geht es einfach nicht!«
»Wer sagt das? Du oder dein Mann?«, fragte Frahm spöttisch.
»Das sagt jeder hier in Königsee und darüber hinaus. Wir sind arbeitsame Menschen und zahlen unsere Abgaben, ohne zu klagen, solange sie gerecht sind. Doch das sind sie schon seit Jahren nicht. Der Fürst verlangt immer mehr Geld, um seine Hofhaltung zu vergrößern, doch wo soll es herkommen? Es gibt in ganz Schwarzburg-Rudolstadt keinen Dukatenesel, der nur den Schwanz heben muss, damit hinten die Goldmünzen herausfallen.«
Klara hatte ihren Ehemann Tobias nur mit Mühe davon abhalten können, persönlich herzukommen, da dieser mit Gewissheit einige Bemerkungen gemacht hätte, die ihm den Zorn des Beamten und womöglich sogar eine Geldstrafe eingebracht hätten. Nun aber spürte sie die gleiche Empörung über die immer drückender werdende Steuerlast, so dass sie kaum noch in der Lage war, ihrer Zunge Zügel anzulegen.
»Seine Hoheit verlangt nur das, was ihm zusteht«, antwortete Frahm von oben herab. »Er ist der Fürst und hat zu bestimmen. Selbst wenn er von euch das letzte Hemd verlangen würde, müsstet ihr es hergeben.«
»Viel fehlt nicht mehr daran!«
Am liebsten wäre Klara noch deutlicher geworden, wollte aber eine Klage vor Gericht und eine Geldstrafe vermeiden. Daher versuchte sie es mit Vernunft.
»Herr Frahm …«
»Sehr geehrter Herr Assessor Frahm heißt das«, fiel der Beamte ihr ins Wort.
»Also gut. Sehr geehrter Herr Assessor Frahm, Ihr müsst doch selbst sehen, dass es auf diese Weise nicht weitergehen kann. Wegen der erhöhten Steuern werden die Waren auf den Märkten immer teurer, und viele können sich kaum mehr das Nötigste leisten. Wenn das so weitergeht, werden die Menschen bald hungern und das Geld immer weniger wert sein. Dies wird auch der Fürst dann schmerzlich erkennen müssen. Will er die Steuern so weit erhöhen, bis uns gar nichts mehr bleibt und wir nicht einmal mehr die Ingredienzien für unsere Arzneimittel erstehen können? Die Einfuhrsteuern für jene ergänzenden Mittel, die unsere Arzneien wirkungsvoller machen, wurden im letzten Jahr auch schon um das Doppelte erhöht.«
Klara verstummte einen Augenblick und stemmte sich mit beiden Armen auf die Tischkante. »Wie will der Fürst in ein paar Jahren die Steuern einziehen, wenn kein Mensch mehr das Geld hat, um sie aufbringen zu können? Will er den Untertanen dann Haus und Hof nehmen und sie als Bettler aus dem Land treiben?«
»Weib, was du da sagst, ist Aufruhr!«, fuhr Frahm sie an. »Seine Gnaden, der Fürst, achtet stets auf das Wohl seiner Untertanen!«
»Nur merken wir sehr wenig davon«, antwortete Klara erbittert.
Dabei wusste sie, dass Tobias und ihr nichts anderes übrigbleiben würde, als die geforderte Stempelsteuer zu zahlen. Ohne die erforderlichen Pässe konnten sie ihre Buckelapotheker nicht losschicken. Aber nur, wenn diese auf ihren gewohnten Strecken unterwegs waren und die Arzneien an den Mann brachten, kam Geld ins Haus. Doch es war kaum hinnehmbar, dass von Jahr zu Jahr immer weniger vom Gewinn blieb.
»Diesmal werden wir die Steuer noch begleichen. Doch wenn sie für nächstes Jahr wieder erhöht wird, müsst Ihr damit rechnen, dass der eine oder andere Laborant sein Gewerbe aufgeben muss.«
Es war eine schwächliche Drohung, und Frahm nahm sie nicht ernst. Zufrieden lächelnd schlug er sein Rechnungsbuch auf und nannte die Summe, die sie zu bezahlen hatte. Tobias Just war nicht der erste Laborant aus Königsee, den er zur Räson gebracht hatte. Auch der Rest würde klein beigeben und sich der Autorität des Landesherrn beugen müssen, den er hier in dieser Stadt vertrat.
2.
Klara schäumte noch immer vor Wut, als sie nach Hause kam. Kaum in die Küche getreten, schleuderte sie ihr Schultertuch auf einen Stuhl und schenkte sich einen Becher Milch ein. Die Köchin Kuni war gerade dabei, Mehlklöße zu formen, hielt aber nun inne.
»Der hohe Herr hat sich also nicht erweichen lassen, weniger Steuern zu verlangen?«, fragte sie.
»Was heißt hier hoher Herr? Waldemar Frahm ist auch nur ein kleiner Popanz der fürstlichen Verwaltung! Es ist eine Schande, dass er sich hier aufspielen darf, als wäre er der Fürst höchstpersönlich«, erwiderte Klara schnaubend.
Sie stellte ihren Becher etwas zu laut auf die Tischplatte und sah sich um. »Wo ist Tobias, und wo sind Martin und Lena?«
»Herr Tobias ist in den Löwen zur Versammlung der Laboranten gegangen. Man hat ihm vorhin erst Bescheid gegeben, daher konnte er es dir nicht sagen. Die Kinder sind draußen im Garten. Ich habe Martin gesagt, er soll auf die kleine Hilde achtgeben. Nicht, dass ihr die Sonne ins Gesicht scheint und ihre Augen Schaden nehmen.«
Kuni wandte sich wieder ihren Klößen zu. Auch wenn es Ärger wegen der Steuern gab, so wollten Klara und ihre Familie dennoch zu Mittag essen.
»Ich schaue nach den Kleinen.« Seufzend verließ Klara die Küche und trat in den Garten.
Dieser war ihr Stolz. Sie pflegte ihn sorgfältig und zog dort etliche Kräuter, die nicht nur für Kuni und die Küche, sondern auch für die Heilmittel wichtig waren, die ihr Mann herstellte. Ihre Kinder entdeckte sie unter dem Pflaumenbaum, der mit weißen Blüten prangte.
Trotz seiner acht Jahre nahm Martin seine Aufgabe als Hüter der kleinen Schwester ernst. Er hatte Hildchen in ihrem Korb in den Schatten gestellt und verscheuchte die Fliegen, die sich auf ihr Gesicht setzen wollten. Die fünfjährige Lena saß daneben und kaute auf einer Brotrinde. Als sie die Mutter sah, sprang sie auf und eilte ihr entgegen.
»Du bist wieder da, Mama!«
»Das bin ich«, antwortete Klara, deren Missmut angesichts ihrer Kinder verflog. Sie hob Lena auf den Arm und streichelte dann Martins Schopf. »Ihr seid heute sehr brav. So mag ich es!«
»Gibt es dafür eine Belohnung?«, fragte Martin in der Hoffnung, die Mutter könnte Kuni einen Kuchen backen oder wenigstens einen Topf Pflaumenkompott von der letzten Ernte öffnen lassen.
»Brav sollte man sein, ohne auf Belohnung zu hoffen«, mahnte Klara ihren Sohn, beschloss jedoch, Kuni zu bitten, am Abend ein paar Pfannkuchen zu backen, die mit Honig oder Mus bestrichen ausgezeichnet schmeckten.
Martin zog einen Flunsch, sah dann aber das Zwinkern in den Augen der Mutter und wusste, dass er und Lena doch darauf hoffen durften, belohnt zu werden.
»Tante Martha war heute noch nicht da«, berichtete er ein wenig enttäuscht, da diese ihm meist etwas mitbrachte, im Sommer oft einen Apfel oder eine Birne und im Winter ein Schmalzgebäck oder eine Brezel.
»Sie wird schon noch kommen«, tröstete Klara ihn und fand gleichzeitig, dass sie mit ihrem Gang zum Gerichtsgebäude bereits zu viel Zeit verloren hatte. Dabei gab es sehr viel im Haus und im Garten zu tun. Zudem musste sie nach den zum Trocknen auf dem Dachboden aufgehängten Kräutern sehen und jene, die bereits verwendet werden sollten, in den Keller bringen und helfen, sie weiterzuverarbeiten.
3.
Um nicht von den fürstlichen Behörden behindert zu werden, hatten die Königseer Laboranten ihre Zusammenkunft heimlich vorbereitet und trafen sich scheinbar zufällig im Gasthaus zum Löwen. Es waren Männer, deren Wort in der Stadt etwas galt. Umso mehr erbitterte es sie, dass sie mittlerweile sogar vor den untersten Chargen der fürstlichen Verwaltung ihren Bückling machen mussten.
Klaras Ehemann Tobias bestellte sich einen Krug Bier und hörte zu, als der Laborant Hofmann das Wort ergriff.
»So kann es nicht weitergehen!«, erklärte dieser. »Wir haben all die Jahre treu zu unserem Herrscherhaus gestanden und auf das Wohl des jeweiligen Landesherrn getrunken. Solange das Haus Schwarzburg-Rudolstadt noch reichsgräflich war, ging auch alles gut. Doch seit unser Herr sich Fürst heißen darf, sind die Ausgaben für seine Hofhaltung in den Himmel geschossen. Alle möglichen Leute wurden nach Rudolstadt gerufen, um seinen Hofstaat zu vergrößern. Auch sind ihm die Schlösser seiner Vorfahren nicht mehr gut genug, und er will neue bauen lassen – und das alles auf unsere Kosten!«
»Gut gesprochen!«, stimmte einer der anderen Laboranten Hofmann zu.
»So ist es!«, rief ein weiterer.
Auch Tobias nickte und überlegte, ob er ebenfalls das Wort ergreifen sollte. Bevor er sich dazu durchgerungen hatte, begann bereits ein anderer zu reden.
»Ich sage euch, wir müssen etwas tun! Entweder schicken wir eine Petition an Seine Gnaden oder vielleicht, besser noch, eine Abordnung. Unsere Abgesandten sollen ihm eindringlich erklären, dass es so nicht weitergehen kann. Er ist der Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt und nicht der König der Franzosen oder der Kaiser in Wien. Die haben das Geld, groß Hof zu halten und Schlösser zu bauen, aber unser Friedrich Anton hat es nicht.«
»Das ist wahr!« Einer der Versammelten klopfte zum Zeichen, dass er damit einverstanden wäre, auf den Tisch, und viele taten es ihm nach.
»Wir sind uns also einig, dass wir etwas unternehmen müssen!«, rief der Sprecher. »Was wollt ihr? Eine Bittschrift, die einer von uns dem Fürsten überreichen soll, oder gehen wir zu mehreren nach Rudolstadt?«
»Ich bin für die Petition. Wenn eine ganze Gruppe geht, sähe es nach Aufruhr aus«, wandte Tobias’ Nachbar Lensing ein.
Tobias war unsicher. Die neuen Steuern schnitten ihnen ins Fleisch, und so fragte er sich, ob eine Bittschrift das nötige Gewicht haben würde. Wenn allerdings zu viele von ihnen vor den Fürsten traten, konnte dieser es als Brüskierung ansehen und sich ihren Forderungen von vorneherein verschließen.
»Ich bin dafür, dass wir beim Fürsten eine schriftliche Eingabe machen, uns aber gleichzeitig der Klage anschließen, die Herr Bulisius im Namen der Bürger von Rudolstadt beim Reichskammergericht in Wetzlar gegen den Fürsten erhoben hat«, sagte er schließlich.
»Wird das Seine Gnaden nicht mehr erzürnen, als wenn eine Gruppe von uns in aller Bescheidenheit vor ihn hintritt und ihn bittet, die hohen Steuern zu senken?«, fragte einer.
»Außerdem kostet das Prozessieren in Wetzlar Geld«, merkte Lensing an.
»Ich kann nur Vorschläge machen! Eine Beteiligung an dem Prozess würde dem Fürsten zeigen, wie ernst es uns mit unseren Forderungen ist, ohne dass wir dabei gegen das Gesetz verstoßen. Der Weg zum Wetzlarer Gericht steht uns uneingeschränkt offen, denn wir sind weder Leibeigene noch als Landstörzer verurteilt.«
Tobias’ Appell brachte einige der Laboranten zum Nachdenken. Wenn sie hier im Land etwas unternahmen, konnte es leicht als Tumult aufgefasst und mit Gewalt unterdrückt werden. Eine Klage vor Gericht hingegen musste Fürst Friedrich Anton hinnehmen.
»Auf jeden Fall dürfen wir uns nicht Bange machen lassen. Wir greifen nicht die Autorität unseres Fürsten an, sondern stemmen uns nur gegen die Willkür seiner Beamten«, erklärte Hofmann.
Wie andere Laboranten hatte auch er mit dem Hut in der Hand vor Waldemar Frahm stehen und dessen Beschimpfungen hinnehmen müssen.
»Wir lassen uns nicht Bange machen. Und nun will ich einen zweiten Krug Bier!« Dieser Aufruf läutete das Ende der Versammlung ein. Einige Laboranten verließen den Löwen und kehrten nach Hause zurück, andere rückten zusammen und unterhielten sich weiter.
Tobias entschied sich dafür, nach Hause zu gehen. Immerhin war Klara bei Frahm gewesen, und er wollte wissen, wie der Beamte sie empfangen hatte.
4.
Auf dem Heimweg kam Tobias an dem Häuschen vorbei, das sein Vater gekauft hatte, um dort mit seiner zweiten Frau Martha einen neuen Hausstand zu gründen. Bei der Versammlung hatte er Rumold vermisst, obwohl sie beide gemeinsam die Geschäfte führten. Kurzentschlossen trat er ein und sah sich Martha gegenüber. Sie war ein ansehnliches Ding mit blonden Haaren und einem hübschen, rundlichen Gesicht, gerade mal dreißig Jahre alt und damit fast fünfundzwanzig Jahre jünger als sein Vater.
»Guten Tag, Martha! Wo ist Vater?«, fragte er.
»Rumold sitzt in der Küche und schneidet Zwiebeln. Mir sind die Tränen derart aus den Augen getreten, dass ich nicht weitermachen konnte«, sagte Martha und senkte den Kopf.
Tobias war etwas älter als sie, und nun würde sie ihm einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester verschaffen. Obwohl Klara versucht hatte, sie zu beruhigen, fühlte sie sich verunsichert.
»Darf ich in die Küche, oder stört dies meinen Vater in seiner männlichen Eitelkeit?«, fragte Tobias belustigt.
»Komm herein, du Lümmel, und erzähle mir, was es bei der Versammlung gegeben hat!«, schallte es brummig aus der Küche heraus.
Tobias fand seinen Vater am Tisch sitzend vor, wo er mit grimmiger Miene einer Zwiebel zu Leibe rückte.
»Kannst du mir sagen, weshalb Gott, unser Herr, dieses Gemüse so geschaffen hat, dass derjenige, der es essen will, schlimmer heulen muss als bei der Beisetzung eines lieben Verwandten?«, rief er stöhnend und gab Martha einen Wink. »Schenkst du Tobias bitte einen Becher Hagebuttenwein ein, und mir auch!«
Während Martha eilte, um das Gewünschte zu holen, sah ihr Mann Tobias fragend an. »Und wer von den Laboranten hat am meisten das Maul aufgerissen?«
»Es ging alles sehr gesittet zu. Hofmann und ein paar andere waren dafür, energischer gegenüber dem Fürsten aufzutreten, während einige wie Lensing dagegen waren. Aber sag, weshalb bist du nicht zur Versammlung gekommen? Dein Rat wäre allen willkommen gewesen«, fragte Tobias.
Sein Vater lachte leise. »Allen gewiss nicht! Die Duckmäuser unter den Laboranten hätten sich an meinen Worten gestört. Sagte doch Lensing letztens, dass es uns Laboranten im Gegensatz zu anderen noch gutginge, weil Seine Gnaden auf uns und unseren Verdienst angewiesen sei. Ohne uns Laboranten und unsere Buckelapotheker müsste Seine Hoheit, Friedrich Anton, ebenfalls den Gürtel enger schnallen.«
Tobias dachte an den wohlbeleibten Fürsten auf dem Thron in Rudolstadt und verzog das Gesicht. »Schaden würde es dem hohen Herrn nicht. Allein, was er an einem Tag verschlingt, kostet mehr, als eine ganze Familie im Jahr an Nahrung verbraucht.«
»Der Fürst weiß halt zu leben! Bald wird die Gicht es ihm danken«, antwortete sein Vater grimmig lächelnd. »Aber sag, was wollen sie tun?«
Tobias zuckte mit den Achseln. »Ganz einig sind sie sich noch nicht, aber es sieht aus, als wollten sie dem Fürsten eine Bittschrift überreichen. Ich habe vorgeschlagen, sich an der Klage des Herrn Bulisius in Wetzlar zu beteiligen, doch einige zieren sich noch.«
»Ich glaube auch nicht, dass dies etwas bringen würde. Die Herren Richter stammen doch alle aus besseren Kreisen und werden niemals gegen einen so hohen Herrn wie den Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt entscheiden«, erwiderte sein Vater mit einer verächtlichen Geste.
»Mir geht es nicht ums Gewinnen, sondern darum, ein Symbol zu setzen. Der Fürst soll sehen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen«, erwiderte Tobias energisch.
»Wenn ihm die Leute zu aufmüpfig werden, holt er die Preußen zu Hilfe, und die wissen, wie man Untertanen zur Räson bringt! Aber lass uns von Angenehmerem reden. Und du siehst zu, ob du die faule Grete findest, damit sie die Zwiebeln fertig schneidet. Ich kann nicht mit meinem Sohn reden und gleichzeitig heulen.«
Die beiden letzten Sätze galten seiner Frau, die eben mit dem Hagebuttenwein hereinkam.
»Wo steckt eure Magd eigentlich?«, fragte Tobias.
»Martha hat sie zum Markt geschickt, weil sie etwas vergessen hatte. Jetzt trödelt dieses Ding, dass es Gott erbarmen möge. Ich wollte, wir könnten mit euch tauschen und eure Liese für ein paar Wochen hierherholen, während die Grete bei euch arbeiten muss. Klara würde ihr schon beibringen, was es heißt, bei der Arbeit säumig zu sein.« Rumold klang so bissig, dass Martha die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte.
»Ich hätte wohl besser noch einmal selbst gehen sollen. Mir waren aber die Beine zu schwer, und da habe ich Grete geschickt. Ich …«
»Das war doch kein Vorwurf an dich!«, unterbrach ihr Mann sie. »Du bist ein sanftes, gutmütiges Ding, und das nützt diese Kröte aus. Mir aber gefällst du so, wie du bist!«
»Wirklich?« Martha klang so, als könne sie immer noch nicht begreifen, dass ein so gesetzter und angesehener Mann wie Tobias’ Vater sich in sie hatte verlieben können.
»Wenn ich es doch sage«, antwortete dieser. »Aber ich sehe, Grete kommt zurück. Wisst ihr was? Sie soll die Küchenarbeit ganz übernehmen. Wir beide schließen uns Tobias an und gehen nach Hause … äh, in sein Haus!«
»Es ist auch dein Haus! Ihr könntet jederzeit zurückkommen«, sagte Tobias.
»Ach was!«, sagte sein Vater abwinkend. »Jung und Alt, das geht auf Dauer nicht gut. Hier habe ich mein eigenes, kleines Nest, das ich mit Martha teilen kann, und bin mein eigener Herr.«
»Das wärst du drüben auch.«
»Lass es gut sein, Tobias. So, wie es ist, ist es am besten. Wir kommen gut miteinander aus, und damit sollten wir zufrieden sein. Ah, da bist du, Grete! Du kannst die Zwiebeln fertig schneiden und das Essen kochen. Martha und ich müssen mit Tobias gehen.«
Bei Martha wäre die Magd mit Ausflüchten gekommen, doch bei Rumold Just wagte sie dies nicht. Stattdessen griff sie mit verkniffener Miene nach dem Messer und zog eine Zwiebel zu sich heran.
Tobias und sein Vater leerten die Becher mit dem Hagebuttenwein und wandten sich zur Tür. Da Martha zögerte, drehte sich ihr Mann zu ihr um. »Komm jetzt!« Rumold wollte nicht, dass seine Frau zurückblieb, da Grete ihr sonst gewiss wieder die unangenehmere Arbeit aufgehalst hätte. In der Hinsicht hätte er Martha ein größeres Selbstvertrauen gewünscht. Der Mensch konnte jedoch nicht alles haben, und so musste er ihr eben helfen, sich gegen die Magd durchzusetzen.
5.
Klara hatte gerade den Korb mit der kleinen Hilde in die Küche gestellt und war dabei, ihr Hemd zu öffnen, um den Säugling zu stillen. Da hörte sie, wie die Haustür ging, und drehte sich mit dem Rücken zur Tür.
»Es sind Herr Just, Tobias und Martha. Ich schicke sie in die Stube, bis du fertig bist«, bot Kuni ihr an.
»Bei meinem Schwiegervater und Tobias kannst du das tun, aber Martha soll hereinkommen«, antwortete Klara und streichelte mit den Fingern sanft über Hildes Köpfchen.
Kuni nickte und trat in die Küchentür. »Ihr könnt euch in die Stube setzen! Ich bringe euch gleich einen Becher Schlehenwein«, sagte sie zu den beiden Männern.
»Zwei Becher wären mir lieber«, antwortete Rumold grinsend. »Einen müssten Tobias und ich uns teilen, und da bleibt für jeden nicht viel.«
Die Köchin schüttelte in komischer Verzweiflung den Kopf. »Als wenn ich nicht jedem von euch einen Becher geben würde!«
»Du darfst Vaters Worte nicht auf die Goldwaage legen. Seine junge Frau lässt ihn immer jünger und übermütiger werden«, warf Tobias lachend ein.
»Gut, dass du nicht ›kindischer‹ gesagt hast! Ich hätte dir sonst den Hosenboden strammgezogen.« Rumold musste ebenfalls lachen und trat ein. Tobias folgte ihm, während Martha unsicher stehen blieb.
»Du darfst in die Küche«, erklärte Kuni ihr und ging weiter, um den Schlehenwein zu holen.
Martha gesellte sich zu Klara und sah zu, wie diese die Kleine nährte. Ihre Miene wurde weich, und sie streckte mit zuckenden Lippen die Rechte nach dem Säugling aus. »Wenn ich daran denke, dass ich in weniger als sieben Monaten ebenfalls so etwas Liebes in den Armen halten darf …«, sagte sie leise.
»Hast du es meinem Schwiegervater schon gesagt?«, wollte Klara wissen.
Martha schüttelte den Kopf. »Nein! Oh Gott, das habe ich mich noch nicht getraut. Was wird er dazu sagen?«
»Er wird stolz darauf sein, weil er sich mit seinen Jahren noch einmal als Mann hat beweisen können. Das Gefühl wird ihm auch helfen, das Geschrei des Kleinen zu ertragen.«
»Warum sollte ein Kind so schreien? Hildchen tut es doch auch nicht«, wandte Martha ein.
»Warte nur ab, bis ihr die Zähne wachsen. Dann wirst du anders reden«, sagte Klara lachend und sah dann, dass die Kleine satt war und nur noch schmatzend auf der Brustwarze herumkaute.
»Das lässt du jetzt lieber sein!«, sagte Klara und entzog ihr die Brust. Sofort zeigte der Säugling eine ärgerliche Miene und stieß einen Protestruf aus.
»Hier hast du!« Kuni brachte einen in Honigwasser getauchten Leinenschnuller und steckte ihn Hilde in den Mund. Die Kleine wollte ihn schon wieder ausspucken. Da jedoch die Mutter keine Anstalten machte, sie wieder an die Brust zu legen, behielt sie ihn im Mund und ließ sich wieder in ihre Wiege legen.
Klara schloss ihr Hemd und das Mieder und gesellte sich mit Martha zu ihrem Mann und ihrem Schwiegervater. Tobias kam sofort auf sie zu und fasste sie bei den Schultern.
»Was hat dieser Kerl gesagt?«, fragte er gespannt.
»Frahm hat erklärt, wenn der Fürst es verlangt, müssten wir ihm auch das letzte Hemd überlassen!« Klara fauchte, da sie diese Bemerkung für eine Unverschämtheit hielt.
»Da soll doch der Blitz dreinschlagen!«, fuhr Tobias auf. »Dem hätte ich für ein paar Pfennige die Leviten gelesen.«
»Und wärest einige Taler als Strafe für die Beleidigung eines Beamten Seiner Hoheit losgeworden«, erklärte sein Vater grimmig.
»Sehr verbindlich war meine Antwort auch nicht«, gab Klara zu. »Ich sagte Frahm, dass der Fürst es bald merken würde, wenn seine Untertanen die immer höheren Steuern nicht mehr zahlen können. Ich war kaum freundlicher, als du es gewesen wärst!«
»Trotzdem war es besser, dass du hingegangen bist. Ein Weib wagen sie nicht so leicht einzusperren wie einen Mann, zumal du dich um ein nur wenige Wochen altes Kind zu kümmern hast.« Rumold lächelte Klara zu, denn er war stolz auf seine energische Schwiegertochter.
Für Klara war es ein guter Anstoß, um das Thema zu wechseln. »Willst du es deinem Mann nicht jetzt sagen?«, fragte sie Martha.
Ihre Freundin senkte den Kopf. »Ich … ich weiß nicht, wie …«
Es klang so kleinlaut, dass Rumold erstaunt den Kopf hob. »Hast du etwa Geheimnisse vor mir?«
»Eines, das nicht mehr lange verborgen bleiben wird«, erklärte Klara lächelnd. »Martha ist nämlich guter Hoffnung. Du wirst in einigen Monaten noch einmal Vater werden!«
»Was sagst du da?« Einen Augenblick lang sah Rumold so aus, als hätte ihn der Blitz gestreift, während Martha in Tränen ausbrach.
»Eigentlich solltest du bei dieser Nachricht mehr Freude zeigen«, wies Klara ihren Schwiegervater zurecht.
Rumold schluckte und schloss Martha in die Arme. »Stimmt das?«, fragte er sie um einiges sanfter.
Martha nickte mit ängstlicher Miene. »Die Hebamme sagt, ich wäre im dritten Monat. Ich …«
»… freue mich für dich!«, unterbrach Tobias sie. »Ich habe mir immer einen Bruder oder eine Schwester gewünscht. Jetzt bekomme ich sie doch noch.«
»Dann wird das Kleine Onkel oder Tante – und das mit einem Neffen und zwei Nichten, die älter sind.« Der Gedanke amüsierte Tobias. Da er aber sah, dass Martha die Worte falsch aufzufassen schien, nahm auch er sie in die Arme.
»Das ist die beste Nachricht seit langem! Die sollen uns auch der Fürst und seine Speichellecker nicht verderben.«
»Der Fürst hat dann einen Untertanen mehr, dem er irgendwann Steuern abknöpfen kann«, meinte Rumold bärbeißig und fragte sich, ob er mit weit über fünfzig Jahren nicht zu alt war, um noch einmal Vater zu werden. Dann aber spottete er über sich selbst. Er hatte sich mit Martha nun einmal eine junge Frau ins Haus geholt. Zwar war sie in ihrer ersten Ehe kinderlos geblieben, dennoch hätte er damit rechnen müssen, dass sie noch schwanger werden könnte.
»Ich freue mich auch!«, setzte er mit einem eifrigen Nicken hinzu.
»Damit hat Martha den Verwandten ihres ersten Ehemanns ihren Wert als Frau bewiesen! Diese können jetzt nicht mehr so tun, als würde ihnen das Ganze ohnehin zufallen, weil sie keine Kinder bekommen kann.« Tobias klang zufrieden, denn der Prozess gegen die Kircher-Sippe war erbittert gewesen. Wäre er verlorengegangen, hätte es sie viel Geld gekostet. Doch auch so war ein Teil des erstrittenen Geldes an die Rechtsanwälte und die fürstliche Kasse gegangen.
»Der Streit mit den Kirchers ist Vergangenheit«, erklärte Klara, um Marthas Gedanken von jener Zeit abzulenken, in der sie als Hermann Kirchers Schwiegertochter dessen Nachstellungen ausgeliefert gewesen war.
»Das ist er, fürwahr!«, stimmte ihr Tobias zu. »Daher freut es mich auch so sehr für Vater. Ihr wisst, wie die Verwandten meiner Mutter gehetzt haben, als er Martha geheiratet hat. Sie taten fast so, als würde er damit das schlimmste Verbrechen begehen. Ich musste Tante Helene zuletzt aus dem Haus weisen, weil sie nicht aufhören konnte, sich das Maul darüber zu zerreißen.«
»Ja, das war schlimm!« Rumold schüttelte sich kurz und zog Martha in die Arme. »Wenn es nach Helene und den anderen gegangen wäre, müsste ich jetzt als Greis hinter dem Ofen sitzen und mit meinen Enkeln spielen. Letzteres tue ich zwar gerne, doch als Greis fühle ich mich nicht.«
»Du bist mir also nicht böse?«, fragte Martha zaghaft.
»Was heißt hier böse? Ich bin so glücklich, wie ein Mann es nur sein kann, dessen junge, hübsche Frau dabei ist, Mutter zu werden.« Rumold bedachte Martha mit einem so liebevollen Blick, dass sie sich selig an ihn schmiegte.
»Wir sollten heute Abend ein wenig feiern. Kommt zu uns, und wir stoßen mit einer guten Flasche Wein an. Eine weitere sollten wir aber für die Taufe aufheben«, schlug Rumold vor, und niemand hatte an diesem Vorschlag etwas auszusetzen.
6.
Als Martha und Rumold nach Hause zurückkehrten, trafen sie ihre Magd mit einer Nachbarin schwatzend vor der Haustür an.
»Hast du alles erledigt, was dir geheißen wurde?«, fragte Rumold und erntete ein heftiges Nicken.
»Aber ja!«
Ohne weiter auf Grete zu achten, traten Martha und Rumold ein und öffneten die Küchentür. Rumold schnupperte kurz. »Das riecht doch angebrannt!«
Sofort stürzte Martha zu den Töpfen, um das Essen zu retten. Ihr wurde jedoch von dem Geruch übel, und sie eilte in den Garten, um sich dort zu übergeben.
»Grete, was soll das?«, rief Rumold zornig. »Sieh, was du angerichtet hast! Das Mittagessen ist angebrannt, und das allein durch deine Schuld.«
Die Frau schlurfte herein, spähte an ihm vorbei zu den stinkenden Töpfen und wehrte den Vorwurf mit beiden Händen ab. »Das muss eben erst passiert sein. Dafür kann ich nichts!«
»Meine Frau hat dir befohlen, zu kochen. Also hättest du hierbleiben und auf die Töpfe achtgeben müssen. Stattdessen hast du draußen mit der Nachbarin geschwatzt, und wir müssen nun alles den Schweinen vorschütten.« Rumold klang scharf, doch da zog Grete die Töpfe vom Feuer weg und blickte kurz hinein.
»Das kann man schon noch essen«, sagte sie und nahm sich vor, selbst etwas Brot und eine Wurst aus dem Vorratskeller zu verspeisen.
Da packte Rumold sie am Genick und drückte ihren Kopf auf den größten Topf nieder. »Das kann man noch essen, sagst du? Das wirst du uns zeigen. Nimm einen Löffel und fang an!«
Grete starrte auf den halbverkohlten Inhalt des Topfes und versuchte vergebens, sich seinem Griff zu entwinden.
»Iss!«, befahl er.
Nun griff Grete doch nach einem Löffel, fuhr damit in den Topf und holte eine kleine Menge heraus. Kaum hatte das Zeug ihre Lippen berührt, spuckte sie es wieder aus.
»Ich kann nicht!«, jammerte sie.
»Aber meine Frau und ich sollen das Zeug essen, du ungutes Ding! Ich sollte dich zur Tür hinausjagen und mir eine neue Magd suchen.« Noch während Rumold sprach, dachte er, dass dies wohl das Beste wäre.
Da sank Grete vor ihm auf die Knie und hob flehend die Hände. »Nein, bitte, tut das nicht! Wo soll ich denn hingehen? Ich habe niemanden, der mich aufnimmt.«
Da sie als faul und unzuverlässig bekannt war, würde sie in Königsee und darüber hinaus keine neue Stellung finden und vielleicht sogar als Bettlerin durch die Lande ziehen müssen. Dieser Gedanke erschreckte Grete so, dass sie zu heulen begann.
»Jagt mich nicht fort! Es wird nie wieder vorkommen! Ich werde alles tun, damit Frau Martha und Ihr mit mir zufrieden seid.«
Rumold zögerte. Eigentlich hatte die Magd eine Strafe verdient, doch Martha war guter Hoffnung, und er konnte ihr nicht die ganze Arbeit im Haushalt aufhalsen, bis er eine neue Magd gefunden hatte.
»Also gut! Ich will noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen«, sagte er grimmig. »Mein Weib ist schwanger und kann nicht mehr so viel arbeiten. Also bessere dich, sonst muss ich meinen Entschluss bereuen.«
Die Herrin würde ein Kind bekommen? Für Grete war dies eine entsetzliche Nachricht. Bisher hatte sie Martha den Hauptteil der Hausarbeit aufhalsen können. Nun würde das nicht mehr möglich sein. Und es würde noch schlimmer kommen, denn sobald das Kind da war, würde sie auch noch mithelfen müssen, es zu versorgen. Trotzdem erschien es ihr besser, in diesem Haus zu bleiben, als über die Landstraßen zu ziehen.
»Ich verspreche Euch, dass Ihr mit mir zufrieden sein werdet«, beteuerte sie und küsste Rumold sogar die Hand.
Danach ging sie daran, den verkohlten Inhalt der Töpfe in den Eimer zu kratzen, in dem die Abfälle für das Schwein gesammelt wurden.
»Wir werden heute zu Mittag Brot und ein wenig Speck essen und erst zu Abend kochen. Da sollte es etwas mehr sein, denn ich habe meinen Sohn und meine Schwiegertochter eingeladen«, sagte Rumold und ging hinaus, um nach Martha zu sehen.
Grete blieb in der Küche zurück und fand, dass das Leben ungerecht zu ihr war. Wie hatte das Mittagessen in den wenigen Minuten, in denen sie draußen mit der Nachbarin gesprochen hatte, anbrennen können? Dazu trug die Ehefrau ihres Dienstherrn ein Kind. Wenn Martha es geboren hatte, würde sie nicht mehr als Fremde gelten, die Rumold Just aus Gnade und Barmherzigkeit geehelicht hatte, sondern als anerkannte Untertanin Seiner Hoheit, Fürst Friedrich Anton.
Dann hatte eine Magd ihr zu gehorchen, wenn sie nicht mit dem Stock bestraft werden wollte. Da Grete Martha hatte fühlen lassen, wie wenig sie hier galt, bekam sie Angst, diese könnte es ihr in Zukunft heimzahlen. Daher brauchte sie jemanden, der ihr helfen konnte. Einen Augenblick fühlte sie sich hilflos, bis ihr ein Mann in den Sinn kam, vor dem selbst Rumold Just brav den Hut ziehen musste.
7.
Es dämmerte bereits, als Klara und Tobias das Haus ihres Vaters und Schwiegervaters betraten. Klara trug Hilde auf dem Arm, da sie sie noch einmal stillen wollte, bevor sie nach Hause zurückkehrten. Zwar schlief die Kleine friedlich, dennoch bereitete ihr Anblick Grete Unbehagen. Schon bald würde es auch hier einen Säugling geben, und sie würde dessen Geschrei ertragen und die übelriechenden Windeln waschen müssen.
»Da seid ihr ja!«, grüßte Rumold Sohn und Schwiegertochter und wies auf die Tür der guten Stube, die ihm für diesen Anlass als geeignet erschien.
»Wie geht es dir?«, fragte Klara Martha besorgt, da diese ihr arg blass erschien.
»Ihr ist Mittag sehr übel geworden, weil Grete das Essen hat anbrennen lassen«, berichtete ihr Schwiegervater.
Martha senkte den Kopf. »Der Geruch war so schlimm!«
»Eine Frau in guter Hoffnung ist empfindlich«, tröstete Klara sie. »Was meinst du, wie oft mir während meiner Schwangerschaften übel geworden ist! Da brauchte es nicht einmal einen schlechten Geruch. Aber du hast hoffentlich am Abend etwas gegessen?«
»Wir wollen jetzt essen. Ihr habt hoffentlich noch ein wenig Hunger mitgebracht?« Rumolds Frage galt dem Sohn und der Schwiegertochter. Beide nickten, um ihn nicht zu enttäuschen.
»Dann ist es gut«, fand Rumold und forderte die beiden Frauen auf, in die Stube zu treten. »Ich muss noch kurz etwas mit Tobias besprechen«, setzte er hinzu.
Klara fasste Martha unter und ließ sich von ihr in die Stube führen.
Unterdessen zog Rumold seinen Sohn ans andere Ende des Flures. »Martha soll nicht hören, was ich dir zu sagen habe. Es würde ihr das Herz schwer machen«, sagte er leise.
Sein Sohn sah ihn überrascht an. »Gibt es schlechte Neuigkeiten?«
»Nein, nein!«, versuchte sein Vater, ihn zu beruhigen. »Es ist nur so: Ich bin nicht mehr der Jüngste, und wenn Martha unser Kind geboren hat, wird es etliche Jahre dauern, bis es erwachsen ist. Ob Gott mir noch so viele Jahre schenken wird, weiß ich nicht. Darum habe ich eine Bitte an dich: Sollte ich vorher sterben, nimm dich meiner Frau und des Kleinen an!«
»Das ist doch selbstverständlich«, antwortete Tobias und fasste nach den Händen seines Vaters. »Mehr aber wünsche ich mir, dass du noch lange lebst und den Bräutigam für deine Tochter oder die Braut für deinen Sohn selbst aussuchen kannst.«
»Schön wäre es!«, antwortete Rumold, obwohl er wusste, dass er in diesem Fall bereits auf die achtzig zugehen würde. Er klopfte seinem Sohn auf die Schulter. »Komm, gesellen wir uns zu unseren Frauen! Sie denken sonst noch, wir hätten über etwas Weltbewegendes gesprochen.«
Tobias lachte leise und folgte ihm in die gute Stube. Klara und Martha saßen bereits auf der Bank und hatten sich jeweils ein Kissen untergeschoben.
»Da sieht man, dass der Hintern einer Frau doch empfindlicher ist als der eines Mannes. Wir brauchen so etwas nicht!«
Mit diesen Worten ließ Tobias sich nieder, während sein Vater die Schüssel entgegennahm, die Grete ihnen reichte, und anschließend die Teller füllte.
»Mag es euch bekommen, denn wenn es das tut, bekommt es auch mir«, sagte er und sprach das Tischgebet.
Während des Essens herrschte Schweigen. Doch kaum waren die Teller wieder vom Tisch, holte Rumold Just eine Weinflasche und schlug ihr mit einer Feile den Hals ab. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass keine Glassplitter zurückgeblieben waren, goss er vier Becher voll.
»Lasst uns auf den heutigen Tag anstoßen und die Frahms dieser Welt eine Weile vergessen«, sagte er und reichte den Gästen die Becher.
»Solange sie guter Hoffnung ist, sollte Martha Wein und anderen geistigen Getränken nur in sehr geringen Maßen zusprechen«, mahnte Klara und setzte hinzu, dass dies auch für die Zeit gelte, in der das Kind gestillt wurde.
»Doktor Halbers berichtete einmal, er habe eine Mutter erlebt, die sich mehr von Branntwein als von Brot ernährt hat. Das Kind, das ihre Milch trank, sei dadurch ebenfalls ständig betrunken gewesen«, setzte sie hinzu.
»Wirklich?« So ganz konnte Martha es nicht glauben.
Sie sagte sich aber, dass Klara, was Geburt und das Aufwachsen von Kindern betraf, mehr Erfahrung besaß als sie, und beschloss, sich ihre Ratschläge zu Herzen zu nehmen.
Die vier stießen miteinander an und unterhielten sich. Rumold war guter Stimmung und erzählte aus seiner Jugendzeit. »Damals war Schwarzburg-Rudolstadt noch eine freie Reichsgrafschaft und Albert Anton, der Großvater des jetzigen Fürsten, unser Landesherr. Zu jener Zeit war die Hofhaltung in Rudolstadt um vieles bescheidener, und als Kaiser Josef ihn in den Reichsfürstenstand erhob, gab Albert Anton wenig darauf, sondern lebte so weiter wie bisher. Obwohl der große Krieg erst vierzig Jahre her war, hatten wir es damals besser als jetzt.«
Da ihm klarwurde, dass er durch den Vergleich jener Zeit mit der jetzigen bitter zu werden drohte, wechselte er das Thema. Während er eine lustige Begebenheit erzählte, musterte er seine Frau und seine Schwiegertochter. Die beiden waren gerade einmal zwei Jahre auseinander und beide recht hübsch. Während Martha mit ihren weichen Gesichtszügen und den verträumten Augen ein wenig hilflos wirkte, sah man Klara an, dass sie energisch werden konnte. Ihr Haar war etwas dunkler als noch vor einem guten Jahrzehnt, als sie allen Mahnungen zum Trotz die Strecke ihres ermordeten Vaters als Buckelapothekerin hatte bewältigen wollen. Obwohl sie drei Kinder geboren hatte, war sie immer noch schlank. Ihre hellen Augen blitzten unter fein geschwungenen Brauen, die Nase war nicht zu breit und nicht zu lang und ihr Mund gerade richtig.
Rumold fand, dass sein Sohn es mit dieser Frau gut getroffen hatte. Doch mit seiner Martha war er ebenfalls zufrieden. Er lächelte seinem hübschen Eheweib zu und berichtete in humorvollem Ton, wie Klara einst von ihm gefordert hatte, die Nachfolge ihres Vaters als Buckelapotheker anzutreten.
»Damals habe ich mir gedacht, dass sie mit zunehmendem Alter ein arger Weibsteufel werden würde. Aber jetzt bin ich froh, dass ich mich geirrt habe«, sagte er gerade noch rasch genug, um einer bissigen Bemerkung von Klara zuvorzukommen.
»Sie ist das beste Weib, das ich habe finden können«, erklärte sein Sohn. »Wenn ich daran denke, wie geschickt sie den Mörder ihres Vaters entlarvt hat! Später, als wir bereits verheiratet waren, hätte mich die Jungfer Engstler, ohne mit der Wimper zu zucken, in Rübenheim hinrichten lassen, wäre es Klara nicht gelungen, mich aus dem Kerker zu befreien. Daher sollten wir nicht über die heutige Zeit jammern. Wir hatten auch früher unsere Sorgen.«
»Das ist wohl wahr«, stimmte Klara ihm zu und lehnte sich an ihn.
»Habt ihr in letzter Zeit einmal etwas von Herrn von Tengenreuth gehört?«, fragte Martha.
Klara schüttelte den Kopf. »Er schreibt uns einmal im Jahr und schickt ein Geschenk für Lena, da er und seine Frau …«
»Seine frühere Todfeindin!«, warf Martha schaudernd ein.
»… die Patenschaft für sie übernommen haben«, beendete Klara den Satz, ohne auf die Bemerkung ihrer Freundin einzugehen.
»Viel ist von der Feindschaft nicht geblieben. Immerhin hat die Dame ihrem Gemahl pflichtschuldig zwei Söhne geboren«, berichtete Tobias.
»Heuer hat Herr von Tengenreuth unserer Lena ein Stück echter Seide schicken lassen. Wir wagen es aber nicht, sie zu verwenden, da uns sonst die Beamten der Fürsten auf den Hals kommen und Steuern dafür verlangen würden.«
Obwohl Klara im munteren Plauderton sprach, war nicht zu überhören, wie sehr es sie kränkte, ihre Tochter nicht so ausstaffieren zu können, wie es ihr möglich wäre.
»Ich finde es auch ungerecht, dass ein Kind, das von einem Edelmann Seide zum Geschenk erhält, diese nicht als Kleid tragen darf«, sagte Martha seufzend.
»So ist nun einmal die Zeit. Sprechen wir von angenehmeren Dingen!« Rumold lenkte das Gespräch wieder auf die Vergangenheit, als Klara die Gnade des damaligen Fürsten Ludwig Friedrich erworben hatte und als Buckelapothekerin hatte ausziehen dürfen.
Damals hatte Klara Martha kennengelernt, und die beiden erzählten nun, wie sie den fränkischen Reichsgrafen Benno von Güssberg überlistet hatten.
»Er wollte uns als Hexen verbrennen lassen und hat uns deswegen in Bamberg als solche angeklagt. Es ist ihm aber nicht gut bekommen!«, rief Martha lachend.
»Wir hatten allerdings großes Glück«, gab Klara zu. »Ich habe später erst erfahren, dass Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn in seinem Herrschaftsbereich Hexen streng verfolgen ließ. Wäre Benno von Güssberg klüger vorgegangen, hätte es uns schlecht ergehen können.«
»Er ist es aber nicht!«, trumpfte Martha auf, die Güssberg und dessen Handlanger in denkbar schlechter Erinnerung hatte.
»Freuen wir uns, dass uns solche Abenteuer in Zukunft erspart bleiben«, meinte Tobias und fragte seinen Vater, ob er ein weiteres Glas Wein haben könne.
Für einen Augenblick erstarb das Gespräch, und im nächsten Augenblick spitzte Klara die Ohren. Irgendetwas stimmte nicht! Sie winkte den anderen mit der Hand, still zu sein, und lauschte angestrengt.
Ein leises Geräusch war von draußen zu vernehmen, so als würde etwas an der Wand entlangstreifen. Klara stand vorsichtig auf und schlich zum Fenster.
Die Vorhänge waren bereits zugezogen. Sie ergriff einen mit der Linken und legte die Rechte auf die Verriegelung des Fensters. Mit einem Ruck zog sie den Vorhang zurück und riss das Fenster auf. In der Dunkelheit konnte sie zwar niemanden sehen, hörte aber einen leisen Fluch und kurz darauf rennende Schritte.
»So ein Lump! Wenn der mir in die Finger gerät, kann er was erleben«, wetterte Rumold.
»Dafür müsstest du wissen, wer es war. Ich habe ihn nicht erkannt, sondern kann nur sagen, dass es sich um einen Mann gehandelt hat.«
»Was mag der gewollt haben?«, fragte Martha. »Ein Dieb war es nicht, denn der konnte trotz der zugezogenen Vorhänge sehen, dass in der Kammer Licht gebrannt hat.«
»Der Kerl wollte wahrscheinlich lauschen!«, sagte Tobias erregt.
»Sind wir hier im Fürstentum schon so weit gekommen, dass Denunzianten ihre Ohren an die Fensterscheiben legen?«
Während Rumold vor Zorn rot anlief, verzog Klara spöttisch das Gesicht. »Wenn der Mann erfahren wollte, was wir über den Fürsten sagen, so hatte er wenig Erfolg. Wir haben diesen nur selten und gewiss nicht despektierlich erwähnt.«
»Der Kerl kann uns alles Mögliche nachsagen«, prophezeite Tobias düster. »Wenn er uns verleumdet, wird es uns nicht leichtfallen, uns von seinen Anschuldigungen reinzuwaschen.«
»Der Teufel soll ihn holen!« Rumold ballte kurz die Fäuste, schloss dann das Fenster wieder und zog den Vorhang zu. Danach wandte er sich den anderen zu. »Auf jeden Fall müssen wir in Zukunft darauf achtgeben, was wir sagen, damit uns kein Strick daraus gedreht werden kann. Ausgerechnet an einem Tag wie heute, an dem man sich doch eigentlich freuen sollte, musste das passieren.«
»Die Freude sollten wir uns nicht nehmen lassen«, erwiderte Klara. »Trotzdem stellt sich die Frage, weshalb dieser Kerl uns ausgerechnet heute belauschen wollte? Bin ich Waldemar Frahm etwas zu sehr auf die Zehen getreten?«
»Er kann auch meinetwegen gekommen sein. Immerhin habe ich heute an der Versammlung im Löwen teilgenommen. Ich werde morgen die anderen fragen, ob ihnen ebenfalls etwas aufgefallen ist. Doch nun lasst uns von etwas anderem reden als von Spitzeln und Denunzianten.« Tobias nahm wieder Platz und trank einen Schluck Wein.
Da Klara spürte, wie sehr sich ihr Mann trotz seiner Worte ärgerte, setzte sie sich neben ihn und fasste nach seiner freien Hand. »Wer er auch immer gewesen sein mag – wir lassen uns von niemandem ins Bockshorn jagen!«
»Das ganz gewiss nicht!«, antwortete Tobias und fand, dass er es mit Klara nicht besser hätte treffen können.
Auch sein Vater machte sich Gedanken und starrte den Vorhang böse an. »Über eines sollten sich der Fürst und seine Kamarilla im Klaren sein: Wer Wind sät, kann leicht Sturm ernten!«
»Das«, sagte Tobias mit einem gezwungenen Lächeln, »hätte der Spitzel nicht hören dürfen.«
»Es ist aber die Wahrheit! Wir sind Menschen und keine Tiere, die man mit der Peitsche drangsalieren kann. Und nun auf Marthas Wohl und auf das Kind, das sie mir schenken wird.«
»Darauf trinken wir!«, antwortete Klara und betete, dass der Sturm, den ihr Schwiegervater prophezeit hatte, ausbleiben möge.
Zweiter Teil
Die Sorgen der Gräfin
1.
Etliche Meilen vom Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt entfernt erstreckte sich ein von dichtem Wald umgebenes Tal, das etwa eine Meile lang war und bis zu einer halben Meile breit. In diesem Tal gab es keine Stadt, sondern nur einen Marktort und mehrere Dörfer. Etwa in der Mitte stand ein für diese Gegend viel zu aufwendig gestaltetes Schloss. Dieses war der Sitz einer Seitenlinie des Hauses Schwarzburg-Rudolstadt.
Der Stammvater Friedrich war ein illegitimer Sohn des Schwarzburger Reichsgrafen Ludwig Günter und mehr als zwanzig Jahre älter gewesen als dessen ehelich geborener Sohn und Nachfolger Albert Anton. In den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges hatte Friedrich so viel Ruhm erworben, dass er von Kaiser Ferdinand III. dieses Tal zur Belohnung als reichsfreies Eigentum erhielt. Während die benachbarten Herrschaften durch die Kriegswirren verarmt und herabgekommen waren, hatte Friedrich im Krieg genug Beute gemacht, um ein stattliches Schloss errichten zu lassen. Eine nach Wien geschickte Summe von nicht unbeträchtlicher Höhe sorgte zudem dafür, dass der Kaiser ihm gestattete, den Namen Schwarzburg-Friedrichsthal zu tragen, und ihn in den Reichsgrafenstand erhob.
Seine Braut hatte Friedrich von Schwarzburg-Friedrichsthal danach ausgesucht, welche eheliche Verbindung ihm am meisten nützen könnte, und durch Verträge mit den umliegenden Fürstentümern dafür gesorgt, dass sein kleines Ländchen vor den Begehrlichkeiten anderer gesichert war.
Seitdem waren viele Jahre vergangen. Schwarzburg-Friedrichsthal bestand immer noch als reichsfreie Herrschaft, und mit dem neunjährigen Friedrich saß der Vierte seines Namens auf dem Thron. Allerdings führte ein Regentschaftsrat, der aus seiner Mutter, seiner Großmutter und zwei adeligen Herren bestand, die Herrschaft für den jungen Reichsgrafen.
An diesem Tag schritt Henrietta Augusta, die Großmutter Friedrichs IV., durch den Spiegelsaal des Schlosses, ohne ihr vielfach gespiegeltes Konterfei auch nur zu bemerken. Ihre Miene war ernst, und sie zerknüllte unbewusst das seidene Taschentuch in ihrer Hand. Als sie aus einem Nebenraum Stimmen hörte, blieb sie stehen.
»… ist der Knabe noch einmal mit dem Leben davongekommen«, sagte jemand, der nicht gerade erfreut wirkte.
»Schwächlich, wie er ist, wird er über kurz als lang ohnehin in die Ewigkeit eingehen«, antwortete eine Frau, die Henrietta Augusta als eine der Hofdamen ihrer Schwiegertochter erkannte.
So eine Schlange!, dachte sie erzürnt. Nach außen hin tat Geraldina von Trenzen so, als gäbe sie alles, damit Friedrich IV. gesund wurde, doch hinter verschlossenen Türen redete sie, als erwarte sie sein schnelles Ableben.
»Es wäre zu wünschen, wenn dieser Fall bald eintreten würde«, sagte der Mann.
Die Stimme kannte Henrietta Augusta nicht. Sie erwog schon, das Zimmer zu betreten und Frau von Trenzen und ihren Gesprächspartner zur Rede zu stellen. Dann aber sagte sie sich, dass es klüger war, weiter zu lauschen.
»Der alte Drache wacht mit Argusaugen über den Jungen, doch seine Mutter hat auf meine Anregung hin den von Euch empfohlenen Arzt Stratmann nach Friedrichsthal kommen lassen. Dieser hat festgestellt und auch sehr deutlich gesagt, dass der kleine Reichsgraf nicht mehr lange zu leben hat«, erklärte Geraldina von Trenzen eifrig.
Der Mann lachte zufrieden. »Zum Glück ist der Bengel noch viel zu jung, um mit einer rasch herbeigeschafften Braut einen Erben zeugen zu können. Bevor es dazu kommt, wird er seinen Platz in der Gruft finden. Wichtiger ist, was danach mit der Reichsgrafschaft geschieht. Kennt Ihr die Erbverträge, die mit anderen Herrscherhäusern geschlossen worden sind?«
»Bedauerlicherweise nicht«, erwiderte Geraldina von Trenzen. »Ich bezweifle sogar, dass die Mutter des Knaben sie alle kennt. Etliche dieser Urkunden hält nämlich der Drache Henrietta Augusta unter Verschluss. Als mein Gemahl, der immerhin ein Mitglied des Regentschaftsrates ist, sie darauf angesprochen hat, erhielt er zur Antwort, solange Seine Erlaucht am Leben sei, wäre es nicht notwendig, sich Gedanken über einen möglichen anderen Erben zu machen.«
Der Mann zischte verärgert, lachte dann aber höhnisch auf, bevor er antwortete. »Wahrscheinlich weiß ich mehr als Herr von Trenzen. Es heißt nämlich, der Schwiegervater des verstorbenen Reichsgrafen habe darauf bestanden, dass Friedrichsthal bei einem möglichen Aussterben der Linie an seine Tochter beziehungsweise deren spätere Nachkommen fallen soll. Dies ist auch der Grund, weshalb von verschiedener Seite um Anna Sybilla geworben wird.«
»Ich bin mir sicher, dass die alte Reichsgräfin alles daransetzen wird, dies zu verhindern«, gab Geraldina von Trenzen zu bedenken.
Ihr Gesprächspartner stieß einen verächtlichen Laut aus. »Die Frau ist alt genug, um bald das Zeitliche zu segnen. Ich glaube nicht, dass sie den Tod ihres Enkels lange überleben wird.«
Du hegst ja fromme Wünsche, fuhr es Henrietta Augusta durch den Kopf. Zwar hatte sie das sechzigste Lebensjahr bereits überschritten, hoffte aber, noch so lange zu leben, bis das Haus Schwarzburg-Friedrichsthal auf mehr als nur auf den zwei zugegebenermaßen schwachen Beinen ihres Enkels stand.
Nun wollte sie doch wissen, wer der Fremde war, der mit Geraldina von Trenzen sprach. Doch gerade, als sie auf das Nebenzimmer zuging, hörte sie dort eine Tür schlagen und begriff, dass sie zu lange gewartet hatte. Sie trat dennoch ein, musste aber feststellen, dass sich niemand mehr in diesem Zimmer aufhielt. Zwei weitere Türen führten von dort in andere Gemächer und eine in den Park. Sie öffnete sowohl die eine wie auch die andere Tür, doch die Räume waren leer und im Park niemand außer einem Gärtner zu sehen.
In einem Wutanfall schleuderte sie ihr Taschentuch auf den Boden. Da ihr das Bücken schwerfiel, wartete sie einen Augenblick und rief dann nach einem Diener.
»Hebe Er das Taschentuch auf! Es ist mir entfallen«, befahl Henrietta Augusta dem herbeigeeilten Diener und wies auf das Tuch.
Der Diener war eine Handbreit kleiner als sie, aber kräftig gebaut. Mit unbewegter Miene verbeugte er sich, bückte sich und griff nach dem Tuch. Dabei musterte er es und sah danach die alte Reichsgräfin an.
»Verzeiht, Euer Erlaucht, aber das Taschentuch ist völlig zerknittert und gehört in die Wäsche. Wenn Ihr erlaubt, werde ich Euch ein anderes bringen.«
»Ich erlaube es Ihm!«, antwortete Henrietta Augusta, die sich immer noch ärgerte, weil es ihr nicht gelungen war, herauszufinden, mit wem Geraldina von Trenzen gesprochen hatte.
Rasch verließ der Diener den Raum und kehrte kurz darauf mit einem Samtkissen zurück, auf dem ein frisches Seidentaschentuch lag.
»Mit Verlaub, Euer Erlaucht, hier ist ein frischer Nasenputzer«, sagte er und reichte ihr das Kissen mit einer Verbeugung.
Die Großmutter des jungen Reichsgrafen nahm es an sich, da fiel ihr noch etwas ein.
»Halt, Manfred! Kann Er mir berichten, wer letztens das Schloss betreten hat?«