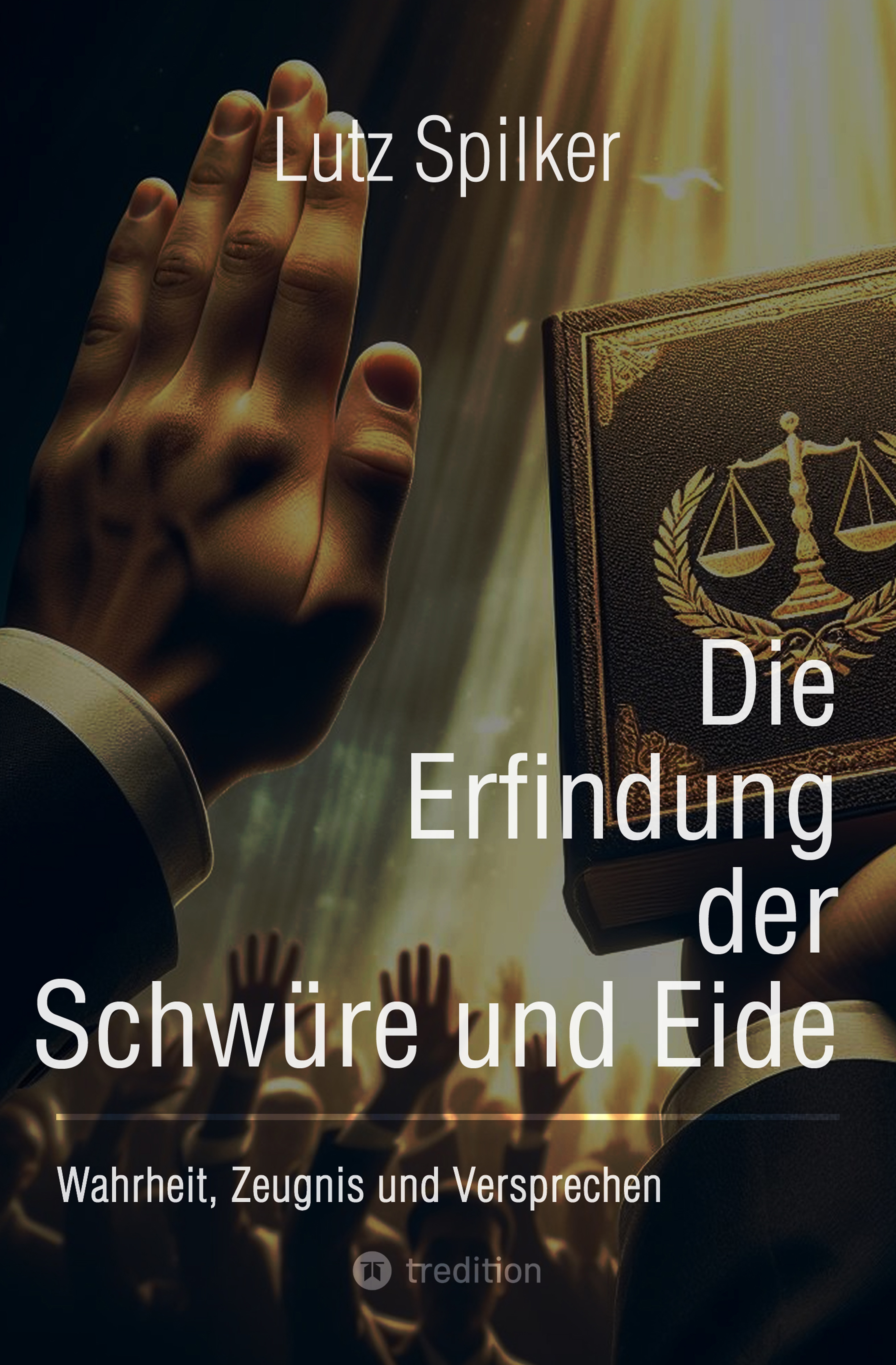
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit Anbeginn der Zivilisation haben Menschen feierliche Schwüre und Eide geleistet, um Wahrhaftigkeit, Treue und Verpflichtungen zu bekräftigen. Doch wie haben sich diese Praktiken entwickelt? Welche Rolle spielten Religion und Gesellschaft dabei, und welche Bedeutung haben sie in der heutigen Zeit? In ›Die Erfindung der Schwüre und Eide‹ beleuchtet der Autor die faszinierende Geschichte dieser uralten Traditionen. Von den ersten rituellen Schwüren im alten Mesopotamien und Ägypten über die religiösen Eide des Judentums, Christentums und Islams bis hin zu den politischen und rechtlichen Gelübden in der modernen Welt – dieses Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Evolution und Bedeutung des Schwörens. Erfahren Sie, wie Schwüre im antiken Griechenland und Rom als unverzichtbare Elemente in sozialen, politischen und militärischen Kontexten fungierten. Entdecken Sie die Macht der Kirche im Mittelalter, die Eide zur Sicherung von Loyalität und Glauben fest in die Gesellschaft integrierte. Verstehen Sie die ethischen und moralischen Implikationen, die der Missbrauch von Eiden, bekannt als Meineid, mit sich bringt. Dieses Buch ist eine Einladung, die tief verwurzelten Traditionen und die fortwährende Relevanz von Schwüren und Eiden zu erkunden. Es zeigt auf, wie diese Praktiken unsere Gesellschaften geprägt haben und weiterhin eine zentrale Rolle spielen, sei es in Gerichtssälen, politischen Zeremonien oder persönlichen Versprechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Eine Betrachtung
von
Lutz Spilker
DIE ERFINDUNG DER SCHWÜRE UND EIDE
WAHRHEIT, ZEUGNIS UND VERSPRECHEN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Softcover ISBN: 978-3-384-26217-2
Ebook ISBN: 978-3-384-26218-9
© 2024 by Lutz Spilker
https://www.webbstar.de
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen denNutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).
Sämtliche Orte, Namen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind daher rein zufällig, jedoch keinesfalls beabsichtigt.
Das Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder auszugsweise, sind ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Autors oder des Verlages untersagt. Alle Rechte vorbehalten.
Inhalt
Inhalt 5
Vorwort 11
Schwur 11
Eid 12
Einführung: Der Ursprung des Schwörens - Überblick und Bedeutung von Schwüren und Eiden 17
Schwüre im alten Mesopotamien - Die ersten dokumentierten Schwüre und ihre gesellschaftliche Rolle 21
Ägyptische Schwüre und göttliche Verpflichtungen - Schwüre im Kontext des ägyptischen Pantheons und der Pharaonen 25
Die Rolle von Schwüren im antiken Griechenland - Religiöse und gesellschaftliche Schwüre bei den alten Griechen 29
Römische Eide und das Imperium - Militärische und politische Schwüre im Römischen Reich 33
Biblische Schwüre im Judentum - Schwüre und Eide im Alten Testament 38
Christliche Eide im Mittelalter - Der Einfluss der Kirche auf die Praxis des Schwörens 42
Schwüre und Eide in der islamischen Tradition - Vorschriften und Bedeutungen im Koran und der Scharia 47
Mittelalterliche Rituale und Feudalismus - Schwüre zwischen Vasallen und Lehnsherren 52
Der Eid des Hippokrates und medizinische Ethik - Historische und moderne Perspektiven 57
Schwüre in der Renaissance und Reformation - Veränderungen und Kritik an der Praxis des Schwörens 63
Humanismus und die Wiederbelebung antiker Ideale 63
Religiöse Erneuerung und Kritik an kirchlichen Praktiken 64
Politische und gesellschaftliche Auswirkungen 65
Schwüre und die Wissenschaft 66
Schwüre in der frühen Neuzeit - Entwicklung in europäischen Staaten 69
Politische Stabilität und Loyalitätseide 69
Religiöse Eide und der Einfluss der Aufklärung 70
Schwüre und die Wissenschaft 71
Juristische Eide und die Entwicklung des Rechtswesens 72
Der Eid in der amerikanischen Revolution - Die Bedeutung von Eiden in der Gründungszeit der USA 75
Eide als Mittel zur Sicherung der Loyalität 75
Der Unabhängigkeitseid und die Verfassung 76
Eide in der Armee und im öffentlichen Dienst 77
Die Bedeutung religiöser und moralischer Überzeugungen 77
Die Kritik an Eiden und die Prinzipien der Aufklärung 78
Politische Eide und Verfassungen - Eide in modernen Staaten und ihre rechtliche Relevanz 80
Die Natur des politischen Eides 80
Der Verfassungseid in verschiedenen Ländern 81
Eide und die Sicherung der Rechtsstaatlichkeit 81
Die ethische Dimension politischer Eide 82
Herausforderungen und Kritik 82
Eide im globalen Kontext 83
Militärische Eide im 19. und 20. Jahrhundert - Schwüre von Soldaten und Offizieren 85
Die napoleonischen Kriege und der Wandel der Treue 85
Der preußische Militärdienst und der Eid auf den Kaiser 86
Der Erste Weltkrieg und die neuen Herausforderungen 86
Der Zweite Weltkrieg und die ideologischen Schwüre 86
Der Kalte Krieg und die neue Bedeutung des militärischen Eides 87
Der militärische Eid und die moderne Welt 88
Juristische Schwüre und der Gerichtssaal - Eide von Zeugen und Juroren 89
Historische Ursprünge juristischer Eide 89
Die Rolle von Zeugen 90
Die Verantwortung der Juroren 91
Juristische Eide in verschiedenen Rechtssystemen 91
Der Meineid: Ethische und rechtliche Implikationen - Beispiele und Konsequenzen des Schwurbruchs 94
Historische Beispiele des Meineids 94
Ethische Implikationen des Meineids 95
Rechtliche Konsequenzen des Meineids 95
Der Meineid in der modernen Zeit 96
Schwüre und Eide in multireligiösen Gesellschaften - Anpassungen und Alternativen in einer pluralistischen Welt 99
Die Herausforderung der Vielfalt 99
Anpassungen und alternative Formen 100
Rechtliche und gesellschaftliche Implikationen 101
Praktische Beispiele und Modelle 101
Moderne religiöse Schwüre - Fortbestand und Wandel religiöser Schwüre heute 104
Der Fortbestand traditioneller Schwüre 104
Wandel und Anpassung an moderne Werte 105
Religiöse Schwüre im interreligiösen Dialog 106
Die Bedeutung religiöser Schwüre in der modernen Gesellschaft 107
Herausforderungen und Kontroversen 107
Persönliche Schwüre und Rituale - Schwüre im Alltag und in zwischenmenschlichen Beziehungen 110
Der Schwur als Vertrauensbasis 110
Ehegelübde und romantische Versprechen 111
Freundschaftsgelübde und Bruderschaften 111
Rituale und Symbolik in persönlichen Schwüren 113
Ethische Implikationen und die Verantwortung von Schwüren 114
Persönliche Schwüre im digitalen Zeitalter 114
Der Schwur im digitalen Zeitalter - Die Bedeutung von Eiden und Schwüren in einer zunehmend digitalen Welt 116
Ethische Betrachtungen und der Einfluss von Schwüren - Die moralische Dimension und die Rolle von Eiden in der modernen Ethik 121
Ein ethisches Fundament 121
Die Rolle von Schwüren in der modernen Gesellschaft 122
Ethische Herausforderungen und der Meineid 123
Schwüre und die pluralistische Gesellschaft 123
Die Zukunft der Schwüre in der Ethik 124
Zukünftige Entwicklungen: Schwüre und Eide in einer globalisierten Welt - Schwüre im Kontext der Globalisierung 126
Die Rolle der Kultur in einer globalisierten Welt 126
Technologische Innovationen und digitale Schwüre 127
Ethische Überlegungen und globale Normen 128
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 129
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen - Reflexion über die Bedeutung und den Fortbestand von Schwüren und Eiden 131
Die Ursprünge und ihre Entwicklung 131
Religiöse und gesellschaftliche Bedeutungen 132
Moderne Entwicklungen und Herausforderungen 133
Die moralische Dimension und die Zukunft 133
Über den Autor 136
In dieser Reihe sind bisher erschienen 137
Jede Kanone, die gebaut wird, jedes Kriegsschiff, das vom Stapel gelassen wird, jede abgefeuerte Rakete bedeutet letztlich einen Diebstahl an denen, die hungern und nichts zu essen bekommen, denen, die frieren und keine Kleidung haben. Eine Welt unter Waffen verpulvert nicht nur Geld allein. Sie verpulvert auch den Schweiß ihrer
Arbeiter, den Geist ihrer Wissenschaftler und die
Hoffnung ihrer Kinder.
Dwight D. EisenhowerDwight David ›Ike‹ Eisenhower (* 14. Oktober 1890 in Denison, Texas, als David Dwight Eisenhower; † 28. März 1969 in Washington, D.C.) war ein US-amerikanischer General of the Army und während des Zweiten Weltkriegs Supreme Commander der Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force (SHAEF) in Europa. Als Politiker der Republikanischen Partei war Eisenhower von 1953 bis 1961 der 34. Präsident der Vereinigten Staaten.
Vorwort
Die Etymologie der Begriffe ›Schwur‹ und ›Eid‹ bietet interessante Einblicke in die sprachlichen und kulturellen Entwicklungen, die zur Entstehung dieser wichtigen Konzepte geführt haben.
Schwur
Der Begriff ›Schwur‹ stammt aus dem Althochdeutschen ›swuor‹ und ist verwandt mit dem altsächsischen ›swar‹ und dem altenglischen ›swearu‹. Diese Begriffe gehen letztlich auf die indogermanische Wurzel ›*swer-‹ zurück, die ›schwören‹ oder ›einen Eid ablegen‹ bedeutet. Die genaue Bedeutungsentwicklung lässt sich wie folgt skizzieren:
Indogermanische Wurzel ›*swer-‹: Die indogermanische Wurzel bedeutete ursprünglich ›schwören‹ oder ›einen heiligen Eid ablegen‹. Sie ist die Quelle für verwandte Begriffe in mehreren indogermanischen Sprachen.
Althochdeutsch ›swuor‹: Im Althochdeutschen entwickelte sich daraus das Wort ›swuor‹, das die gleiche Bedeutung beibehielt und die Handlung des Schwörens bezeichnete.
Mittelhochdeutsch ›swuor‹: Dieser Begriff blieb im Mittelhochdeutschen weitgehend unverändert und wurde in der Literatur und in Rechtsdokumenten häufig verwendet.
Neuhochdeutsch ›Schwur‹: Im Neuhochdeutschen wurde daraus schließlich ›Schwur‹, der bis heute die gleiche Bedeutung hat: ein feierliches, oft religiös oder rechtlich bindendes Versprechen.
Eid
Der Begriff ›Eid‹ hat eine etwas andere Herkunft und Entwicklung:
Indogermanische Wurzel ›*oitos-‹: Die Wurzel des Wortes ›Eid‹ geht auf die indogermanische Wurzel ›*oitos-‹ zurück, die ›Schwur‹ oder ›Gelübde‹ bedeutete.
Diese Wurzel hat sich in verschiedenen indogermanischen Sprachen unterschiedlich entwickelt.
Althochdeutsch ›eid‹: Im Althochdeutschen entwickelte sich daraus das Wort ›eid‹, das einen feierlichen Schwur oder ein Gelübde bezeichnete. Der Begriff war eng mit rechtlichen und religiösen Kontexten verknüpft.
Mittelhochdeutsch ›eit‹: Im Mittelhochdeutschen lautete das Wort ›eit‹, was weiterhin einen rechtlichen oder feierlichen Schwur bezeichnete.
Neuhochdeutsch ›Eid‹: Im Neuhochdeutschen wurde daraus ›Eid‹, der bis heute dieselbe Bedeutung trägt: ein rechtlich oder religiös bindendes Versprechen, das oft vor Zeugen abgelegt wird.
Gemeinsame Wurzeln und Bedeutungen
Beide Begriffe haben also tief verwurzelte Bedeutungen, die mit der Handlung des Schwörens, des Versprechens und des Einhaltens von Gelübden verknüpft sind. Beide entstammen indogermanischen Wurzeln, die durch die Jahrhunderte in den germanischen Sprachen weiterentwickelt wurden. Während ›Schwur‹ eher die Handlung des Schwörens betont, bezeichnet ›Eid‹ das Versprechen selbst, das durch den Schwur geleistet wird. Beide Begriffe sind fest im kulturellen und rechtlichen Gefüge verankert und spielen eine wichtige Rolle in der sozialen und religiösen Ordnung.
Die Entwicklung dieser Begriffe spiegelt nicht nur sprachliche Veränderungen wider, sondern auch die kulturelle Bedeutung des Schwörens und Gelobens in den germanischen und später deutschsprachigen Gesellschaften. Sie zeigen, wie tief verwurzelt die Praxis des Schwörens ist und wie sie sich über Jahrtausende hinweg entwickelt und verändert hat, um den Bedürfnissen und Werten der jeweiligen Zeit gerecht zu werden.
♦♦♦
Das Schwören und die Verwendung religiöser Texte wie der Bibel sind tief in der Geschichte verankert und spiegeln die komplexe Beziehung zwischen Religion, Gesellschaft und Recht wider. Seit den frühesten Zivilisationen haben Menschen Schwüre geleistet, um die Wahrheit zu sichern, Verträge zu bestätigen und ihre Verpflichtungen feierlich zu bekräftigen. Diese Praxis, die sowohl in religiösen als auch in weltlichen Kontexten anzutreffen ist, hat sich über Jahrtausende hinweg entwickelt und bleibt bis heute ein bedeutsames Element in vielen Kulturen und Gesellschaften.
In der Antike wurden Schwüre häufig im Namen der Götter geleistet, um die göttliche Autorität als Zeugen für die Echtheit und Ernsthaftigkeit der Aussage oder des Versprechens heranzuziehen. In Mesopotamien und dem alten Ägypten waren solche Schwüre fest in religiösen und rechtlichen Traditionen verankert. Auch im antiken Griechenland und Rom spielten Schwüre eine zentrale Rolle in sozialen, politischen und militärischen Kontexten.





























