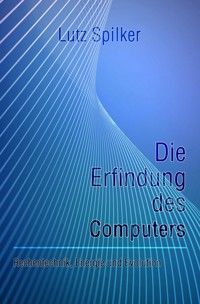
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Computer ist aus der Gegenwart nicht wegzudenken – und doch ist seine Geschichte weniger selbstverständlich, als es scheint. Dieses Buch zeichnet den Weg eines Werkzeugs nach, das aus dem Bedürfnis entstand, Zahlen zu ordnen, Daten zu speichern und Gedanken in eine Form zu bringen, die Maschinen verstehen. Von den ersten mechanischen Rechenhilfen bis zu den digitalen Architekturen der Gegenwart entfaltet sich ein Panorama aus Ideen, Materialien und Konzepten. Im Zentrum steht nicht nur die technische Entwicklung, sondern auch die Frage, welche kulturellen, ökonomischen und intellektuellen Strömungen den Computer möglich gemacht haben – und welche Vorstellungen von Wissen, Ordnung und Effizienz sich in ihm spiegeln. Jenseits der reinen Chronologie öffnet das Buch den Blick für die symbolische Tiefe des Gegenstands: Was sagt eine Maschine, die in Einsen und Nullen denkt, über die Menschen, die sie bauen? Warum entstehen bestimmte Technologien zu bestimmten Zeitpunkten – und warum bleiben andere ungedacht? ›Die Erfindung des Computers‹ ist eine Spurensuche in Schichten: von der Mechanik zur Elektronik, von der Theorie zur Praxis, von der Idee zur allgegenwärtigen Realität. Wer diesen Spuren folgt, entdeckt nicht nur eine technische Erfolgsgeschichte, sondern auch ein Stück Kulturgeschichte – und ein Werkzeug, das uns vielleicht mehr verändert hat, als wir es je bemerkt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Erfindung
des Computers
•
Rechentechnik, Energie und Evolution
Eine Betrachtung
von
Lutz Spilker
DIE ERFINDUNG DES COMPUTERS
RECHENTECHNIK, ENERGIE UND EVOLUTION
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © Copyright by Lutz Spilker
Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker
Verlag:
Lutz Spilker
Römerstraße 54
56130 Bad Ems
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den
Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der
Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhalt
Inhalt
Das Prinzip der Erfindung
Vorwort
Mechanische Wurzeln – Rechenmaschinen vor der Elektronik
Der geheimnisvolle Mechanismus von Antikythera
Vom Abakus zur frühen Mechanik
Blaise Pascal und die Pascaline
Gottfried Wilhelm Leibniz und das Staffelwalzenprinzip
Von Zahnrädern zu Symbolen
Lochkarten und Steuerung – Die Idee der programmierbaren Maschine
Von der Textilhalle zur Rechenmaschine
Herman Hollerith – Statistik auf Lochkarten
Ein Medium zwischen Mechanik und Information
Weitreichende Folgen
Der gedankliche Sprung
Von Hollerith zu Babbage – die leisen Anfänge des maschinellen Denkens
Von Kurbeln, Zahlen und Pixeln – Die stille Revolution des Rechnens
Charles Babbage und die Analytical Engine – Der Traum von der universellen Maschine
Die Idee einer universellen Maschine
Inspiration aus dem Webstuhl
Mechanik als Grenze – und als Beweis der Idee
Ada Lovelace – die gedankliche Mitarchitektin
Das Vermächtnis der Analytical Engine
Ada Lovelace – Der erste Algorithmus
Die Übersetzung, die mehr wurde
Das Prinzip des Programms
Mathematik als Sprache der Maschine
Über Zahlen hinaus
Der erste Algorithmus als gedanklicher Meilenstein
Ein bleibender Eindruck
Die stille Größe einer Idee
Ada Lovelace – Rechenkunst im Zeitalter der Dampfmaschinen
Relaistechnik und elektromechanische Rechner
Von der Zuse Z3 zu den Bell Labs → Glossar
Alan Turing und die formale Maschine
Der Colossus – Geheimoperation in Bletchley Park
Der ENIAC – Der erste voll elektronische Universalrechner
Von Röhren zu Transistoren
Die stille Geburt einer Revolution
Vom Labor in die Rechenzentren
Die Miniaturisierung beginnt
Vom Symbol der Nachkriegszeit zum Motor der Moderne
Die Geburt der Programmiersprachen
Von Assembly zu FORTRAN und COBOL → Glossar
Der integrierte Schaltkreis
Mainframes – Die Rechenzentren der Wirtschaft
Einsatzgebiete – Das Rückgrat komplexer Abläufe
Die gesellschaftliche Bedeutung – Kontrolle, Vertrauen, Wandel
Unersetzlich trotz Wandel
Der Mikroprozessor – Computer im Taschenformat
Vom Intel 4004 zu komplexen CPUs → Glossar
Der Anfang: Intel 4004
Der Schritt zu mehr Leistung: Intel 8008 und 8080
Die 16-Bit-Ära und die Geburt einer Architektur
Vom Einzelchip zur Mehrkernmaschine
Der Einfluss auf unsere Welt
Vom Werkzeug zum ständigen Begleiter
Heimcomputer und Hobbyistenbewegung
Vom Altair 8800 bis zum Commodore 64 → Glossar
Der Altair 8800 – Funkenflug in einer blechernen Box
Treffen der Tüftler – Die Geburtsstunde einer Industrie
Commodore 64 – Der Volkscomputer
Vom Tüftlergerät zum Alltagsgegenstand
Die bleibende Spur
Graphische Benutzeroberflächen
Von Xerox PARC zu Apple Macintosh und Windows → Glossar
Ein Bildschirm, der mehr als Buchstaben kann
Die verpasste Gelegenheit
Ein Besuch, der Geschichte schreibt
Lisa – ein teurer Vorläufer
Der Macintosh – Revolution im kompakten Gehäuse
Microsoft und der lange Weg zu Windows
Der Kulturwandel am Schreibtisch
Rückblick und Ausblick
Computer im Bildungswesen
Erste Lernprogramme und ihre pädagogische Wirkung
Von der Tafel zum Bildschirm
Pädagogischer Aufbruch – Chancen und Skepsis
Die Sprache der Maschine lernen
Zwischen Experiment und Alltag
Pädagogische Wirkung – erste Erkenntnisse
Der Weg in die Breite
Vernetzte Rechner – Das ARPANET
IBM PC – Wie ein grauer Kasten die Welt eroberte → Glossar
Der Startschuss für den PC-Markt
Microsoft und das Betriebssystem
Die Geburt der Software-Industrie
IBM verliert die Kontrolle
Der PC in den Haushalten
Eine neue Wirtschaft
Das Erbe des IBM PC
Laptops und mobile Arbeitswelten
Die Verschmelzung von Rechenleistung und Mobilität
→ Glossar
Die Anfänge – Tragbarkeit als technische Zumutung
Der Durchbruch der kompakten Bauformen
Mobilität als Arbeitsprinzip
Die wachsende Rechenleistung – kein Kompromiss mehr
Der Laptop als Werkzeug der globalen Vernetzung
Design, Ergonomie und neue Nutzergruppen
Die endgültige Verschmelzung – Mobilität ohne Grenzen
Der kulturelle Stellenwert der mobilen Rechenleistung
Ausblick – Von Laptops zu neuen Formen der Mobilität
Open-Source-Bewegung und Linux
Die frühen Jahre – wenn Software noch frei war
Der Wandel – wenn der Quellcode verschwindet
Linux – ein Betriebssystem aus der Gemeinschaft
Die Dynamik der gemeinschaftlichen Entwicklung
Qualität durch Offenheit
Von der Nische zum Fundament der IT
Die Philosophie hinter dem Code
Die globale Werkstatt der Softwareentwicklung
Ein Blick in die Zukunft
Multimedia-Revolution
Der Beginn: Erste Experimente mit digitalem Ton
Bilder in Pixeln – der Aufstieg der digitalen Grafik
Bewegtbilder – von der Filmrolle zum Datenstrom
Die Integration – alles auf einem Gerät
Auswirkungen auf Kultur und Gesellschaft
Ein Blick zurück – und nach vorn
Das Internet als universelle Plattform
Die ersten Schritte in Richtung Dynamik
JavaScript und der Weg zur direkten Interaktion
Die Datenbank als Herzstück der neuen Dienste
Der Schritt zu echten Webanwendungen
Soziale Plattformen und der Nutzer als Mitgestalter
Neue Maßstäbe in Design und Benutzerfreundlichkeit
Ein Internet, das lebt
Cloud Computing und verteilte Rechenleistung
Supercomputer und wissenschaftliche Durchbrüche
Rechenleistung im Dienste von Simulation und Forschung → Glossar
Quantencomputer – Die nächste Architektur
Grundlagen, Chancen und Herausforderungen → Glossar
Die Hürden auf dem Weg
Auf der Schwelle
Ein Blick in die Zukunft
Von der Regel zur Selbstlernfähigkeit
Die Entwicklung von Expertensystemen zu neuronalen Netzen
Von Tasten und Zeigern zu Worten und Gesten
Die Entwicklung der Mensch-Maschine-Schnittstellen
Die Tastatur – Sprache in mechanischer Form
Die Maus – der Zeiger ins Unbekannte
Der Wunsch nach natürlicherer Kommunikation
Die Geste – Steuerung durch Bewegung
Der Wandel in der Rolle des Benutzers
Ausblick – Verschmelzung der Sinne
Computersicherheit und Cyberkriminalität
Angriffe, Schutzmechanismen und globale Risiken → Glossar
Die stille Bedrohung im Hintergrund
Werkzeuge der Angreifer
Verteidigung in der digitalen Welt
Globale Dimensionen und politische Brisanz
Die wachsende Angriffsfläche
Ein Blick in die Zukunft der Sicherheit
Sicherheit als Daueraufgabe
Ethische und gesellschaftliche Fragen
Privatsphäre, Arbeitsplatzwandel und digitale Spaltung
→ Glossar
Die schwindende Privatsphäre
Der Wandel der Arbeitswelt
Die digitale Spaltung
Ein Balanceakt für die Zukunft
Visionen der Computerzukunft
Der Computer als unsichtbarer Begleiter
Das Zeitalter der selbstlernenden Systeme
Globale Vernetzung in neuer Dimension
Computer als Mittler zwischen Mensch und Umwelt
Die ethische Dimension zukünftiger Computer
Eine Zukunft ohne endgültige Form
Ausblicke in den Alltag von morgen
2057 – Die unsichtbare Übersetzerin
2068 – Die Stadt als Computer
2082 – Medizin in Echtzeit
2090 – Die stille Präsenz
Glossar
ENIAC
Der ENIAC – Frontansicht in Worten
Ein Blick in den Maschinenraum der zweiten Generation
Im Rechenzentrum der 1960er-Jahre
Im Herz der Verwaltung – COBOL im Einsatz
Vom Germanium zum Silizium
Der Mikroprozessor – Computer im Taschenformat
Der Anfang: Intel 4004
Der Schritt zu mehr Leistung: Intel 8008 und 8080
Die 16-Bit-Ära und die Geburt einer Architektur
Vom Einzelchip zur Mehrkernmaschine
Der Einfluss auf unsere Welt
Heimcomputer und Hobbyistenbewegung
Der Altair 8800 – Funkenflug aus der Bastelstube
Die Clubabende – Treffpunkt der Visionäre
Der Alltag mit dem Heimcomputer
Der Commodore 64 – Wohnzimmerrevolution
Musiker und die neue Schnittstelle
Vom Bastelobjekt zum Alltagspartner
Technische Vertiefung
Rendering-Strategien und GUI-Toolkits
Die Klonszene – Ein Standard kopiert die Welt
Lizenzstreitigkeiten und strategische Fehlentscheidungen
Ökonomische Folgen und die Globalisierung der Produktion
Langfristige Wirkung auf die Software-Industrie
Technische Meilensteine auf dem Weg zu interaktiven Diensten
Historische Beispiele und Meilensteine der Supercomputerforschung
Vom Wettbewerb zur Inspiration
Supercomputer vs. Quantencomputer
Von Bootsektorviren zu staatlich gesteuerten Cyberwaffen
Vom Ärgernis zur geopolitischen Bedrohung
Ethische und gesellschaftliche Fragen
Privatsphäre, Arbeitsplatzwandel und digitale Spaltung
Privatsphäre – vom Schutzraum zum offenen Fenster
Arbeitsplatzwandel – die doppelte Kante des Fortschritts
Digitale Spaltung – das unsichtbare Gefälle
Ein Blick in die Zukunft
Über den Autor
In dieser Reihe sind bisher erschienen
Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch,
ist nicht so groß wie die Gefahr,
dass der Mensch so wird wie der Computer.
Konrad Zuse
Konrad Ernst Otto Zuse (* 22. Juni 1910 in Deutsch-Wilmersdorf, heute zu Berlin; † 18. Dezember 1995 in Hünfeld) war ein deutscher Bauingenieur, Erfinder und Unternehmer (Zuse KG). Mit seiner Entwicklung der Z3 im Jahre 1941 baute Zuse den ersten
funktionstüchtigen, vollautomatischen, programmgesteuerten und frei
programmierbaren, in binärer Gleitkommarechnung arbeitenden Rechner und somit den ersten funktionsfähigen Computer der Welt.
Das Prinzip der Erfindung
Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.
Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.
Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.
Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.
Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.
Eine Erfindung ist keine Entdeckung.
Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.
Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.
Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.
Vorwort
Es gibt Erfindungen, deren Wirkung so tief in den Alltag eingesickert ist, dass ihr Ursprung beinahe unsichtbar geworden ist. Der Computer gehört zweifellos zu ihnen. Er ist Werkzeug, Medium, Archiv, Bühne, Labor – und oft alles zugleich. Doch hinter der glatten Oberfläche von Tastatur und Bildschirm liegt eine lange Geschichte, die nicht mit dem ersten Mikrochip begann, sondern in einer Zeit, in der Rechnen noch Handarbeit war, Wissen auf Tontafeln stand und Zahlen in den Köpfen von Gelehrten und Händlern lebten.
Dieses Buch geht der Frage nach, wie aus dem Bedürfnis zu zählen, zu ordnen und zu berechnen ein technisches System entstand, das heute ganze Wirklichkeiten modellieren kann. Es spürt den Linien nach, die von den babylonischen Zahlentabellen über mechanische Zahnräder bis zu binären Schaltkreisen führen. Dabei wird sichtbar, dass der Computer nicht nur eine Maschine ist, sondern auch ein kulturelles Artefakt – ein Spiegel jener Logiken, Denkgewohnheiten und Machtstrukturen, die ihn hervorgebracht haben.
Jede Epoche hat ihre eigenen Vorstellungen davon, was Rechnen bedeutet und wozu es dient. In den frühen Hochkulturen war es eine Fähigkeit der Verwaltung, in der Antike auch eine Form philosophischer Welterklärung, in der Industrialisierung ein Mittel der Beschleunigung. Heute wird der Computer oft als universales Werkzeug gesehen – doch universell ist nur sein Anspruch, nicht seine Geschichte.
Wer die Erfindung des Computers verstehen will, muss mehr sehen als eine Abfolge technischer Durchbrüche. Er muss die Frage stellen, warum bestimmte Ideen zu bestimmten Zeiten entstehen konnten – und warum manche Möglichkeiten lange ungedacht blieben. Die Spurensuche in diesem Buch beginnt daher nicht bei der Siliziumscheibe, sondern bei den Symbolen, die Menschen erfanden, um die Welt zu fassen, und bei den Maschinen, die sie bauten, um diese Symbole zu bewegen.
Der Computer ist ein Knotenpunkt: aus Mathematik und Mechanik, aus Logik und Sprache, aus ökonomischen Interessen und intellektuellen Experimenten. Wer an diesem Knoten zieht, löst nicht einfach eine Schnur, sondern entdeckt ein ganzes Gewebe – und vielleicht auch, dass wir selbst längst Teil dieses Geflechts geworden sind.
Mechanische Wurzeln – Rechenmaschinen vor der Elektronik
Von der Antikythera-Mechanik bis zu den Rechenmaschinen von Pascal und Leibniz
Bevor die Siliziumchips die Rechenarbeit der Welt übernahmen und Bildschirme zu unseren alltäglichen Fenstern in die Informationswelt wurden, existierte eine lange, oft übersehene Vorgeschichte des Rechnens. Diese Geschichte beginnt nicht mit Stromkreisen oder Binärcodes, sondern mit Zahnrädern, Hebeln und Gewichten – und mit dem Bedürfnis des Menschen, Ordnung in Zahlen und Naturphänomene zu bringen.
Der geheimnisvolle Mechanismus von Antikythera
Im Jahr 1901 entdeckten Schwammtaucher vor der kleinen griechischen Insel Antikythera das Wrack eines antiken Schiffes. Zwischen Korallen, Amphoren und Bronzestatuen fand sich ein unscheinbares, verkrustetes Objekt, das erst Jahrzehnte später seine wahre Natur offenbarte: ein komplexes System aus fein verzahnten Rädern, Achsen und Skalen – heute bekannt als der Mechanismus von Antikythera.
Etwa um 100 v. Chr. gebaut, war dieses Gerät ein astronomischer Rechner. Mit einer Handkurbel konnte man die Bewegung der Sonne, des Mondes und vermutlich auch der damals bekannten Planeten nachbilden, Finsternisse vorhersagen und Kalenderzyklen berechnen. Nichts Vergleichbares war in der antiken Welt bekannt – und für viele Jahrhunderte danach auch nicht. Der Mechanismus demonstrierte ein Prinzip, das für spätere Rechenmaschinen grundlegend werden sollte: die mechanische Umsetzung abstrakter mathematischer Beziehungen. Zahnräder ersetzten Stift und Papyrus, um wiederkehrende Berechnungen präzise und reproduzierbar auszuführen.
Sein plötzlicher Verlust aus der historischen Überlieferung wirft eine Frage auf, die sich wie ein roter Faden durch die Technikgeschichte zieht: Wie viele solcher Erfindungen sind in Vergessenheit geraten, bevor sie eine nachhaltige Wirkung entfalten konnten?
Vom Abakus zur frühen Mechanik
Zwischen der Antike und der Frühen Neuzeit liegt ein weiter Bogen, in dem das Rechnen zwar nie verschwand, aber weitgehend auf einfache Hilfsmittel wie den Abakus oder Rechentafeln beschränkt blieb. Diese Werkzeuge beschleunigten die Arbeit von Händlern, Astronomen und Baumeistern, verlangten aber stets einen menschlichen Kopf, der die logischen Schritte ausführt.
Die Vorstellung, dass eine Maschine ganze Rechenoperationen selbständig erledigen könnte, tauchte erst in der Renaissance wieder deutlich auf. Die wachsenden Anforderungen von Handel, Navigation und Wissenschaft verlangten präzisere Methoden. Tabellenwerke halfen, doch sie waren fehleranfällig und aufwendig zu erstellen. Es musste etwas entstehen, das die mühsame Handarbeit durch ein mechanisches Verfahren ersetzt.
Blaise Pascal und die Pascaline
Der französische Gelehrte Blaise Pascal fand in den 1640er-Jahren eine persönliche Motivation für eine solche Erfindung: Sein Vater war als Steuereinnehmer in Rouen tätig und verbrachte unzählige Stunden mit komplizierten Berechnungen. Pascal, selbst noch keine dreißig Jahre alt, konstruierte eine Maschine, die Additionen und Subtraktionen mechanisch ausführen konnte – die Pascaline.
Das Prinzip war so einfach wie genial: Zahnräder mit abgestuften Zähnen, verbunden über eine Reihe von Achsen, ermöglichten es, dass eine vollständige Umdrehung eines Rades automatisch eine Einheit auf dem nächsthöheren Rad weitergab – ähnlich wie beim Zählen mit Zehnerübertrag. Die Maschine bestand aus einem Gehäuse mit einer Reihe von Sichtfenstern, hinter denen die Ziffern angezeigt wurden. Eingaben erfolgten durch das Drehen kleiner Rädchen an der Vorderseite.
Die Pascaline war nicht nur ein technisches Meisterstück, sondern auch ein Vorbote der Automatisierung: Ein festgelegter mechanischer Ablauf ersetzte menschliche Rechenarbeit, und das Ergebnis war eindeutig, reproduzierbar und frei von Flüchtigkeitsfehlern. Obwohl die Maschine nie in großer Stückzahl gefertigt wurde – zu aufwendig war die Herstellung –, markierte sie einen Wendepunkt. Erstmals war das Konzept eines denkenden Werkzeugs greifbar geworden.
Gottfried Wilhelm Leibniz und das Staffelwalzenprinzip
Nur wenige Jahrzehnte später führte ein weiterer bedeutender Kopf die Idee entscheidend weiter: Gottfried Wilhelm Leibniz, Philosoph, Mathematiker und Universalgelehrter. Leibniz war überzeugt, dass jede geistige Tätigkeit in elementare Schritte zerlegt und, zumindest theoretisch, von einer Maschine ausgeführt werden könne. Seine Staffelwalze war die praktische Umsetzung dieses Gedankens im Bereich des Rechnens.
Während Pascals Maschine im Wesentlichen nur addieren und subtrahieren konnte, erlaubte Leibniz’ Konstruktion auch Multiplikationen und Divisionen – durch wiederholte Additionen bzw. Subtraktionen, gesteuert durch eine spezielle Walze mit gestaffelten Zähnen. Der Mechanismus war elegant, aber technisch anspruchsvoll. Er benötigte präzise gefertigte Metallteile, die in der damaligen Zeit nur schwer in der notwendigen Qualität herzustellen waren.
Leibniz sah in seiner Rechenmaschine nicht bloß ein praktisches Hilfsmittel, sondern ein Werkzeug für die Erweiterung menschlicher Fähigkeiten. Er schrieb, dass es würdig für Fürsten sei, solche Geräte zu fördern, um Wissenschaft und Verwaltung zu entlasten. Doch auch seine Maschine blieb in der Praxis eine seltene Kostbarkeit, eher Demonstrationsobjekt als Alltagswerkzeug.
Von Zahnrädern zu Symbolen
Betrachtet man die Linie von der Antikythera-Mechanik über die Pascaline bis zu Leibniz’ Staffelwalze, zeigt sich ein gemeinsames Prinzip: Rechenarbeit wird durch eine physische Struktur repräsentiert. Jede Zahnradbewegung entspricht einem Schritt einer mathematischen Operation. Diese Geräte waren nicht programmierbar im modernen Sinn, aber sie machten sichtbar, dass logische Abläufe in festen Bahnen verlaufen können – und dass eine Maschine diese Bahnen zuverlässig abarbeiten kann.
Die mechanischen Wurzeln des Computers liegen damit nicht nur in der Verbesserung von Rechenmethoden, sondern auch in einer kulturellen Verschiebung: Der Gedanke, dass Geistestätigkeit in ein technisches System übertragbar ist, war ein leiser, aber folgenreicher Paradigmenwechsel.
Was in Bronze, Holz und Stahl begann, sollte Jahrhunderte später im unsichtbaren Fluss von Elektronen und im abstrakten Raum der Software weitergeführt werden. Doch die Grundidee – dass eine Maschine ein Problem nicht nur schneller, sondern nach festgelegten Regeln und ohne Ermüdung lösen kann – war hier schon geboren.
Lochkarten und Steuerung – Die Idee der programmierbaren Maschine
Joseph Marie Jacquards Webstuhl und Herman Holleriths Datenverarbeitung
Es gibt technische Erfindungen, die zunächst so unscheinbar wirken, dass ihre wahre Tragweite erst im Rückblick erkennbar wird. Die Lochkarte gehört zweifellos dazu. Was als Hilfsmittel in der Textilproduktion begann, wurde später zu einer Schlüsseltechnologie in der Geschichte des Computers – und dies lange bevor jemand an Elektronenröhren oder Transistoren dachte. Die Idee, dass ein festes Muster von Löchern eine Maschine steuern könnte, verband zwei sehr unterschiedliche Welten: das Weben von Stoffen und die Verarbeitung von Daten.
Jacquards Webstuhl – Gewebe aus Fäden und Informationen
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts stand die Textilindustrie vor einer Herausforderung, die kaum technischer, sondern vielmehr organisatorischer Natur schien: Komplexe Stoffmuster, besonders Brokate mit sich wiederholenden Ornamenten, verlangten von den Webern höchste Präzision und Geduld. Jede Musteränderung erforderte eine mühsame manuelle Anpassung der Kettfäden, was den Produktionsprozess verlangsamte und verteuerte.
Der französische Mechaniker Joseph Marie Jacquard griff ein Konzept auf, das bereits von früheren Tüftlern in Ansätzen erprobt worden war, und entwickelte es zur praktischen Reife. Sein 1805 vorgestellter Webstuhl arbeitete mit Lochkarten, die aus festem Karton bestanden und in einer Kette miteinander verbunden waren. Jede Karte repräsentierte eine Reihe des Webmusters: Dort, wo ein Loch gestanzt war, hob der Mechanismus den entsprechenden Kettfaden an; blieb die Stelle geschlossen, blieb der Faden unten.
Das Entscheidende war nicht nur die technische Eleganz, sondern der Gedanke der Programmierung: Das Muster war nicht mehr fest in der Maschine eingebaut, sondern konnte durch den Austausch der Lochkarten beliebig verändert werden. Die Maschine folgte einem Satz von Anweisungen, der außerhalb ihrer selbst existierte – ein Prinzip, das später die Grundlage für Software werden sollte.
Für die Weber bedeutete dies eine tiefgreifende Veränderung. Was früher Wochen an manueller Arbeit erforderte, konnte nun in Bruchteilen der Zeit umgesetzt werden. Muster ließen sich präzise wiederholen, ohne dass ein geübtes Auge ständig überwachen musste.
Von der Textilhalle zur Rechenmaschine
Die Lochkarte erwies sich als ein Medium mit erstaunlicher Flexibilität. Sie war robust genug, um den mechanischen Belastungen standzuhalten, einfach zu vervielfältigen und doch leicht austauschbar. Die Tatsache, dass sie Informationen in Form von physisch ab- oder anwesendem Material kodierte, machte sie unabhängig von Sprache und Schrift.
Über Jahrzehnte blieb ihr Einsatz auf die Textilindustrie und verwandte Bereiche beschränkt. Doch das Prinzip hatte längst das Potenzial, weit über Webstühle hinaus angewendet zu werden. Die Idee, Maschinen mithilfe externer Anweisungen flexibel zu steuern, fand ihren Weg in andere technische Disziplinen – und schließlich in die Datenverarbeitung.
Herman Hollerith – Statistik auf Lochkarten
Ende des 19. Jahrhunderts wuchs in den Vereinigten Staaten ein Problem heran, das eher administrativer Natur war: die Volkszählung. Je größer das Land und seine Bevölkerung wurden, desto länger dauerte es, die gesammelten Daten zu erfassen, zu sortieren und auszuwerten. Nach der Zählung von 1880 benötigte das ›Bureau of the Census‹ fast ein Jahrzehnt, um alle Zahlen vollständig zu verarbeiten.
Der junge Ingenieur Herman Hollerith, der zuvor im Census-Bureau gearbeitet hatte, erkannte, dass sich die Erfassung und Auswertung der Bevölkerungsdaten mechanisieren ließe. Er entwarf ein System, das Informationen – etwa Alter, Geschlecht, Beruf oder Herkunft einer Person – als Lochmuster auf einer stabilen Karte speicherte. Jede Position auf der Karte entsprach einer bestimmten Informationseinheit.
Seine Erfindung bestand nicht nur aus den Karten, sondern auch aus einer elektromechanischen Auswertungsmaschine. Diese besaß Kontakte, die durch die Löcher hindurch elektrische Verbindungen herstellten. So konnte das Gerät zählen, wie oft eine bestimmte Kombination vorkam. Zusätzlich entwickelte Hollerith Sortiermaschinen, mit denen Karten nach frei wählbaren Kriterien geordnet werden konnten.
Die Volkszählung von 1890 wurde mit diesem System durchgeführt – und der Zeitgewinn war dramatisch. Statt wie zuvor sieben bis acht Jahre dauerte die Auswertung weniger als drei. Holleriths Maschinen waren nicht nur schneller, sie reduzierten auch menschliche Fehler und ermöglichten eine bis dahin unerreichte Flexibilität bei der statistischen Auswertung.
Ein Medium zwischen Mechanik und Information
Sowohl Jacquards als auch Holleriths Systeme nutzten die Lochkarte als Träger von Anweisungen oder Daten. Doch der Unterschied in der Anwendung ist aufschlussreich:
Beim Jacquard-Webstuhl steuerte die Lochkarte unmittelbar mechanische Bewegungen – ein Loch oder Nicht-Loch entschied, ob ein Faden gehoben oder gesenkt wurde.
Bei Holleriths Maschine diente die Lochkarte nicht zur Steuerung einer mechanischen Aktion, sondern zur Speicherung und Auswertung von Information, die erst durch die Maschine interpretiert wurde.
Beide Anwendungen zeigen, dass die Lochkarte im Kern ein Speichermedium war – allerdings nicht für Texte oder Bilder, sondern für binäre Entscheidungen: ja oder nein, Loch oder kein Loch. Dieses Prinzip entspricht dem, was später als digitale Codierung bezeichnet werden sollte, lange bevor der Begriff selbst existierte.
Weitreichende Folgen
Holleriths Erfolg führte 1896 zur Gründung der ›Tabulating Machine Company‹, die sich später mit anderen Firmen zusammenschloss und schließlich in den 1920er-Jahren den Namen International Business Machines annahm – kurz: IBM. Diese Verbindung von mechanischer Präzision und datenverarbeitender Effizienz wurde ein wesentlicher Pfeiler der modernen Wirtschaft.
Doch noch bevor elektronische Computer erfunden wurden, hatte die Lochkarte bereits eine lange Karriere hinter sich. Sie blieb bis weit ins 20. Jahrhundert hinein das wichtigste Medium für maschinenlesbare Daten – von der wissenschaftlichen Berechnung über betriebliche Buchhaltung bis zur Steuerung von Industrieanlagen.
Der gedankliche Sprung
Die Verbindung zwischen Jacquards Webstuhl und Holleriths Auswertungsmaschinen ist mehr als nur eine technische Linie. Sie zeigt, dass sich das Prinzip der Programmierbarkeit in unterschiedlichen Kontexten durchsetzen kann, sobald es einmal formuliert ist. Im Webstuhl lag der Fokus auf der automatisierten Ausführung von Handgriffen, bei Hollerith auf der automatisierten Auswertung von Fakten.
Gemeinsam war beiden Systemen, dass der Ablauf nicht mehr fest in den mechanischen Aufbau eingeschrieben war. Die Maschine war gewissermaßen allgemeiner geworden – sie konnte unterschiedliche Aufgaben erfüllen, solange man ihr die passenden Karten gab. Dies war der erste Schritt zu jener universellen Maschine, die im 20. Jahrhundert als Computer Realität werden sollte.
Von Hollerith zu Babbage – die leisen Anfänge des maschinellen Denkens
Als um die Wende zum 20. Jahrhundert die Industrialisierung ihre zweite Blüte erlebte, traf eine eher unscheinbare Innovation den Nerv der Zeit: die Hollerith-Maschine. Was wie ein schwerer, hölzerner Schreibtisch mit metallenen Hebeln und Kabelverbindungen aussah, war in Wahrheit ein Recheninstrument – präziser: ein ›Datenverarbeiter‹, der seine Informationen aus gestanzten Kartonkarten bezog. Jede Lochung, exakt nach einem Schema gesetzt, entsprach einer Information: Geschlecht, Alter, Beruf, Herkunft, Gesundheitsstatus. Mit jedem Hebeldruck wurden elektrische Kontakte geschlossen oder unterbrochen, Zählwerke rotierten, Summen wurden fortgeschrieben.
Der eigentliche Zauber lag nicht im Messen oder Rechnen – das konnte schon ein Rechenschieber –, sondern im Sortieren und Auswerten großer Datenmengen in einer Geschwindigkeit, die menschliche Schreiber schlicht überforderte.
Herman Hollerith, ein amerikanischer Ingenieur mit deutschen Wurzeln, hatte dieses Prinzip entwickelt, um die Volkszählung der USA im Jahr 1890 zu bewältigen. Statt monatelang Tausende handgeschriebene Listen durchzugehen, fütterte man seine Maschine mit Lochkarten – und verkürzte die Auswertung von Jahren auf Monate. Dieser Erfolg trug Holleriths Firma später in den Zusammenschluss, der unter dem Namen IBM Weltruhm erlangen sollte.
Doch während Hollerith noch mit Kabeln und Hebeln hantierte, lag im Hintergrund bereits eine andere Idee in der Luft – älter, visionärer und technisch seiner Zeit weit voraus: die von Charles Babbage. Der englische Mathematiker hatte schon im frühen 19. Jahrhundert über mechanische Rechenmaschinen nachgedacht, die nicht nur Zahlen addieren, sondern folgenbasierte Befehle ausführen konnten. Seine ›Analytical Engine‹ blieb unvollendet, doch in ihren Konzepten tauchten Elemente auf, die später zur DNA moderner Computer gehören sollten: Speicher, Rechenwerk, Steuerwerk, Ein- und Ausgabegeräte – und sogar die Trennung von Daten und Programmen.
Babbage hatte nie eine funktionierende Maschine fertiggestellt, aber seine Pläne waren präzise genug, um heutigen Ingenieuren als Blaupause zu dienen. Seine Gedankengänge verbanden Mechanik mit Logik und – beinahe prophetisch – mit einer abstrakten Form von Informationsverarbeitung. In gewisser Weise stand er am Anfang eines Pfades, den Hollerith mit seiner praktischen Lochkartenmaschine betrat: der Weg von der mechanischen Rechenhilfe zum universellen ›Datenverarbeiter‹.
So lässt sich der Übergang der Technikgeschichte nicht in plötzlichen Umbrüchen fassen, sondern eher als langsames Anziehen einer Schraube: hier eine Verbesserung der Zählmechanik, dort eine neue Idee zur Steuerung von Prozessen. Holleriths Maschine und Babbages Vision traten nie gemeinsam auf, doch zusammen bilden sie eine Brücke – von der reinen Zahl zur Information, von der handgeführten Kurbel zum automatisierten Gedanken.
Von Kurbeln, Zahlen und Pixeln – Die stille Revolution des Rechnens





























