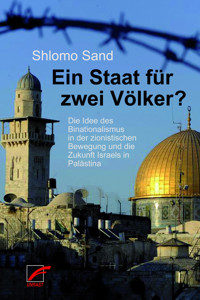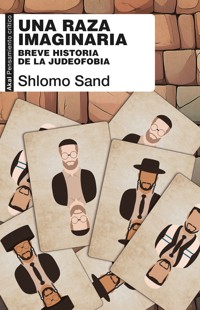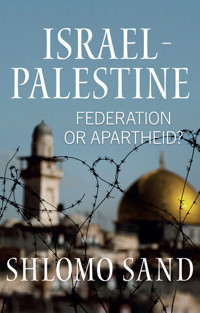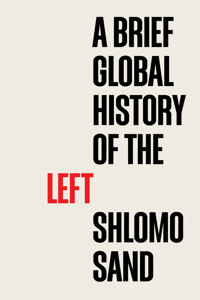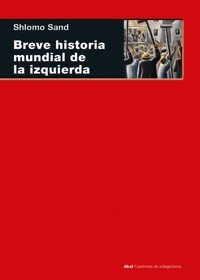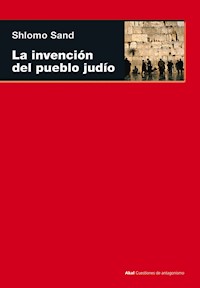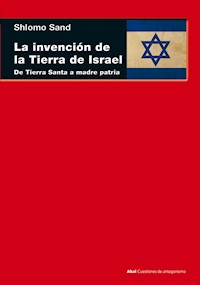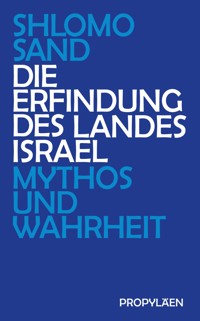
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gehört Israel den Juden? Was bedeutet überhaupt Israel? Wer hat dort gelebt, wer erhebt Ansprüche auf das Land, wie kam es zur Staatsgründung Israels? Shlomo Sand, einer der schärfsten Kritiker der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern, stellt den Gründungsmythos seines Landes radikal in Frage. Überzeugend weist er nach, dass entgegen der israelischen Unabhängigkeitserklärung und heutiger Regierungspropaganda die Juden nie danach gestrebt haben, in ihr "angestammtes Land" zurückzukehren, und dass auch heute ihre Mehrheit nicht in Israel lebt oder leben will. Es gibt kein "historisches Anrecht" der Juden auf das Land Israel, so Sand. Diese Idee sei ein Erbe des unseligen Nationalismus des 19. Jahrhunderts, begierig aufgegriffen von den Zionisten jener Zeit. In kolonialistischer Manier hätten sie die Juden zur Landnahme in Palästina und zur Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aufgerufen, die dann nach der Staatsgründung 1948 konsequent umgesetzt wurde. Nachdrücklich fordert Sand die israelische Gesellschaft auf, sich von den Mythen des Zionismus zu verabschieden und die historischen Tatsachen anzuerkennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel Matai ve’ekh humtzea Erez Israel? bei Kinneret Zmora-Bitan
Propyläen ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbHwww.propylaeen-verlag.de
ISBN 978-3-8437-0342-0
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
© Shlomo Sand 2012 © der deutschsprachigen Ausgabe by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012 Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Jan Martin Ogiermann Satz und eBook: LVD GmbH, Berlin
Zur Erinnerung an die Bewohner von Al-Scheich Muwannis, die einst von dem Ort entwurzelt wurden, an dem ich heute lebe und arbeite.
Dank
Ich möchte aus tiefstem Herzen allen Freunden und Bekannten danken, die, auf die eine oder andere Weise, geholfen haben, diese Studie zu vollenden: Alexander Eterman, Dr. Eran Elhaik, Dr. Yehonatan Alsheh, Dr. Nitza Erel, Michel Bilis, Yoseph Barnea, Noa Greenberg, Prof. Israel Gershoni, Dr. Yael Dagan, Richard Desserame, Asaad Zoabi, Yuval Laor, Dr. Gerardo Leibner, Mahmoud Mosa, Ran Menahemi, Linda Nezri, Stavit Sinai, Anna Sergeyenkova, Bianka Speidi, Boas Evron, Prof. Christophe Prochasson und Dr. Nia Perivolaropoulou.
Meiner Frau Varda und meinen beiden Töchtern Edith und Liel schulde ich mehr, als ich mit Worten auszudrücken vermag.
Prof. Jean Boutier, Dr. Yves Doazan und Dr. Arundhati Virmani, alle drei von der Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (E. H. E. S. S.) in Marseille, bin ich zutiefst dankbar für ihre Gastfreundschaft und die überwältigende Herzlichkeit, die sie mir gegenüber an den Tag gelegt haben.
Ebenso bin ich Markus Lemke, der dieses Buch ins Deutsche übertragen hat, und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Propyläen sowie insbesondere Jan Martin Ogiermann unendlich dankbar, die sich mit großer Gründlichkeit dieses Textes angenommen und nach Kräften versucht haben, Fehler auszumerzen, Fältchen zu glätten und alles dafür zu tun, um am Ende ein gut lesbares, schlüssiges Buch vorzulegen.
Auch möchte ich sowohl all denen meiner Studenten danken, die immer wieder aufs Neue meine historische Phantasie herausgefordert haben, als auch jenen, die gezwungen waren, geduldig meinen Ergüssen zu lauschen, und es kaum erwarten konnten, ich möge endlich den Mund halten.
All jenen, die Kritik an meinem letzten Buch geübt und es verrissen haben und mich im Gegenzug gereizt, geleitet und befruchtet haben, die vorliegende Studie zu verfassen, schulde ich mehr, als sie sich vorstellen können oder mögen. Der zentrale Vorwurf aller Kritikaster lautete, dass alles, was ich vorgelegt habe, zum einen hinlänglich bekannt und längst von ihnen selbst dargestellt worden sei, und zum andern schlicht falsch und unzutreffend. Ich muss gestehen, dass dies zumindest der halben Wahrheit entspricht: Alles, was zu einem bestimmten Zeitpunkt bekannt war, um hernach verdrängt, marginalisiert oder unter den Teppich gekehrt zu werden, ist in dem von mir rekonstruierten kritischen Narrativ von zentraler Bedeutung und damit zwangsläufig politisch inkorrekt und historisch anstößig geworden. Es bleibt mir nur zu hoffen, dass diese Arbeit – und wenn auch nicht im selben Umfang – das Gleiche zu leisten vermag.
Sämtliche Irrtümer, Fehler, Ungenauigkeiten, unnötigen Überspitzungen und extremen Ansichten habe allein ich zuwege gebracht, so dass ausschließlich ich für diese verantwortlich zu machen bin. Alle zuvor genannten Personen trifft nicht die geringste Schuld daran.
Tel Aviv – Marseille – Tel Aviv, 2012
Einleitung: Ein gewöhnlicher Mord, die Sehnsucht nach Erlösung und der Name eines Landes
Der Zionismus und sein Kind, der israelische Staat, die im Zuge einer militärischen Eroberung, als Verwirklichung eines territorialen Messianismus, zur Klagemauer gelangt sind, werden diese Mauer oder die eroberten Teile des Landes Israel niemals mehr aufgeben können, ohne den Kern ihrer historiographischen Auffassung vom Judentum aufzugeben … Der säkulare Messias kann sich nicht zurückziehen. Er kann nur sterben.
Baruch Kurzweil, 1970
Es ist völlig unlogisch, die jüdischen Bindungen an Israel, das Land der Vorväter … mit dem Wunsch gleichzusetzen, alle Juden in einem modernen Territorialstaat zu vereinen, der im geschichtlichen Heiligen Land liegt.
Eric J. Hobsbawm, Nationen und Nationalismus
Die Erinnerungsfetzen, die wie geheimnisvolle Vögel über meinem hier vorgelegten Werk kreisen, hängen mit meinem Leben als junger Mann und dem ersten von den Kriegen Israels zusammen, an dem ich teilgenommen habe. Mir ist wichtig, sie diesem Buch voranzustellen, um – der Offenheit und Aufrichtigkeit willen – den emotionalen Hintergrund meines intellektuellen Verhältnisses zu all den Mythen um nationalen Boden, Gräber der Ahnen und große behauene Steine freizulegen.
1. Erinnerungen aus dem Land der Väter
Am 5. Juni 1967 überschritt ich auf dem Radarhügel (Dschebel ar-Radar) in den Jerusalemer Bergen die israelisch-jordanische Grenze. Ich war damals ein junger Soldat und, wie viele andere, einberufen worden, mein Land zu verteidigen. Der Abend senkte sich bereits herab, schweigend und zögernd schritten wir über den zerschnittenen Stacheldraht. Diejenigen, die vor uns gingen, wurden von Minen in Stücke gerissen, ihr Fleisch wurde nach allen Seiten verstreut. Ich zitterte vor Angst, ich klapperte wie wild mit den Zähnen, und kalter Schweiß ließ mein Armeehemd am Körper kleben. Doch in meinem verstörten, überreizten Kopf konnte ich, während mein Körper sich vorwärts bewegte wie eine mechanische Puppe, nicht aufhören, daran zu denken, dass ich gerade zum ersten Mal ins Ausland kam. Ich war zwar mit zwei Jahren nach Israel gekommen, doch da ich in einem Armenviertel von Jaffa aufgewachsen war und von Jugend an hatte arbeiten müssen, waren alle Träume, das Land einmal zu verlassen und die Welt zu bereisen, Träume geblieben.
Sehr schnell musste ich erkennen, dass meine erste »Auslandsreise« kein abenteuerlicher Vergnügungstrip werden würde, denn meine Kameraden und ich wurden sogleich in die Kämpfe um Jerusalem geschickt. Meine Enttäuschung wuchs noch, als mir klarwurde, dass unser Grenzübertritt von den anderen nicht als Schritt ins Ausland angesehen wurde. Nicht wenige der Soldaten um mich herum betrachteten sich selbst schlicht als Heimkehrer, die die Grenzen des israelischen Staates überquerten, um nach »Erez Israel« zu gelangen, ins Land Israel. Schließlich war unser Stammvater Abraham zwischen Hebron und Betlehem umhergezogen und nicht zwischen Tel Aviv und Netanja. Und König David hatte jenes Jerusalem erobert und besungen, das östlich der Waffenstillstandslinie lag, nicht aber die moderne, pulsierende israelische Metropole im Westen. »Wieso Ausland? Das ist doch das wahre Land deiner Väter«, bekam ich schon damals von den Soldaten zu hören, die an meiner Seite in den schweren Kämpfen um das arabische Viertel Abu Tor in Jerusalem vorrückten.
Meine Kameraden glaubten, sie beträten einen Ort, der immer schon der ihre gewesen war. Ich hingegen hatte das Gefühl, einen Ort verlassen zu haben, der der meine war, weil ich dort fast mein ganzes Leben verbracht hatte, und ich fürchtete, nie wieder dorthin zurückzukehren, da ich die Kämpfe vielleicht nicht überleben würde. Doch das Glück war mir wohlgesinnt, und mit einiger Mühe blieb ich am Leben. Doch meine Sorge, nie mehr an den Ort zurückzukehren, den ich verlassen hatte, sollte sich letztendlich auf eine Art und Weise bewahrheiten, die ich mir damals noch nicht vorstellen konnte.
Am Tag nach den Kämpfen um Abu Tor führte man uns, die wir nicht verwundet worden waren, in die Altstadt, um die Klagemauer zu sehen. Mit entsicherter Waffe marschierten wir angespannt durch die schweigenden Straßen. Ab und an sahen wir verängstigte Gesichter aus den Fenstern lugen. Wenig später erreichten wir eine relativ schmale Gasse, an der sich eine hohe Mauer aus behauenen Steinquadern erhob. Damals waren die Häuser des alten Mughrabi-Viertels noch nicht abgerissen worden, um Raum für den riesigen Vorplatz zu schaffen, der alle Besucher der »Disco-Mauer« oder der »Diskothek von Gottes Gegenwart«, wie Jeshajahu Leibowitz diesen sonderbaren Ort zu bezeichnen pflegte, aufnehmen kann. Wir waren vollkommen erschöpft, unsere verdreckten Uniformen starrten vom Blut der Verwundeten und Toten. Mehr als alles andere beschäftigte uns, einen Ort zum Urinieren zu finden, da wir weder in einem geöffneten Café noch in den Häusern der unter Schock stehenden Anwohner Rast machen konnten. Aus Achtung vor den Religiösen unter uns pinkelten wir an die Wände der Häuser auf der anderen Seite der Gasse und vermieden so die »Entweihung« der äußeren Stützmauer des Plateaus, auf dem der »Bösewicht« Herodes und seine mit Rom treu verbündeten Nachfahren den Tempel errichtet hatten, um ihre despotische Herrschaft mittels gewaltiger Steinquader zu verherrlichen.
Tatsächlich flößte mir die schiere Größe der behauenen Felsblöcke Ehrfurcht ein. Ich erinnere mich, dass ich mich sehr klein und schwach bei ihrem Anblick gefühlt habe, offenbar auch wegen der Enge der Gasse, die ihre Größe noch unterstrich, und auch aus Angst vor den arabischen Anwohnern, die noch nicht ahnten, dass sie schon sehr bald aus ihrem Viertel vertrieben werden würden. Zu jenem Zeitpunkt wusste ich nicht viel über König Herodes und die Klagemauer. Ich hatte sie bislang bloß auf alten Postkarten gesehen, die in unseren Schulbüchern reproduziert waren, und kannte niemanden, der das Bestreben gehabt hätte, zu ihr zu gelangen. Auch wäre mir damals nicht in den Sinn gekommen, dass diese Mauer niemals Teil des Tempels gewesen war und die meiste Zeit nach dessen Zerstörung – im Gegensatz zum Tempelberg etwa, dessen Betreten strenggläubigen Juden wegen der Unreinheit der Toten untersagt ist – nicht als heilige Stätte gegolten hatte.1 Aber all jene säkularen Kulturschaffenden und Erinnerungspolitiker, die sich schon bald daranmachten, mit Hilfe triumphaler Erinnerungsalben eine neue Tradition zu erschaffen und zu überhöhen, kannten kein Zaudern bei ihrem nationalen Sturmangriff auf die Geschichte. Bewusst wählten sie die inszenierte Aufnahme dreier Soldaten – der »Aschkenase« in der Mitte hat seinen Helm abgenommen und steht barhäuptig, als betete er in einer Kirche –, deren Augen von der zweitausendjährigen Sehnsucht nach der geheiligten Mauer erfüllt sind und deren Herzen angesichts der »Befreiung« des Lands der Väter übergehen.
Fortan wurden wir nicht müde, mit großer Inbrunst »Jerusalem aus Gold« anzustimmen. Naomi Schemers ebenso sehnsüchtige wie annexionistische Hymne, die erst kurz vor Beginn der Kämpfe entstanden war, trug höchst effektiv dazu bei, die Eroberung Ostjerusalems als selbstverständliche Verwirklichung eines historischen Anrechts erscheinen zu lassen. Jeder, der in jenen schweißtreibenden Junitagen des Jahres 1967 in das arabische Jerusalem einmarschierte, hätte wissen müssen, dass der Text des Liedes, der so viel zur psychologischen Vorbereitung auf den Krieg beigesteuert hatte – »Die Brunnen sind leer von Wasser, der Marktplatz wie ausgestorben, der Tempelberg dunkel und verlassen, dort in der Altstadt …« – nichts mit der Realität zu tun hatte.2 Doch nur wenige, wenn überhaupt, haben schon damals verstanden, wie gefährlich und sogar antijüdisch diese Zeilen waren. Zugegeben – sind die Besiegten derart schwach, halten sich die singenden Sieger nicht mit Kleinigkeiten auf. Die sprachlosen Verlierer hatten sich uns nicht einfach nur gebeugt, sie verschwanden geradezu vor der Kulisse der heiligen, ewigen jüdischen Stadt, als hätte es sie nie gegeben.
Nach dem Ende der Kämpfe wurde ich zusammen mit zehn meiner Kameraden zur Bewachung des jordanischen Hotels Intercontinental abkommandiert, das später in jüdischen Besitz übergehen sollte und heute Seven Arches heißt. Der luxuriöse Hotelkomplex thront auf dem Gipfel des Ölbergs, in unmittelbarer Nachbarschaft zum alten jüdischen Friedhof. Als ich mit meinem Vater, der damals in Tel Aviv wohnte, telefonierte und ihm erzählte, ich befände mich auf dem Ölberg, rief er mir die alte Geschichte in Erinnerung, die in unserer Familie kursierte, die ich aber aus Mangel an Interesse vollkommen vergessen hatte.
Kurz vor seinem Tod hatte mein Urgroßvater beschlossen, seine Heimatstadt Lodz zu verlassen und nach Jerusalem zu reisen. Zionist war er nicht im Entferntesten, dafür aber ein gottesfürchtiger, die Gebote wahrender Chasside, weshalb er neben seinem Schiffsfahrschein auch seinen Grabstein mit auf die Reise nahm. Denn das Bestreben eines jeden guten Juden war nicht, in Zion zu leben, sondern auf dem Ölberg begraben zu werden. Einem Midrasch aus dem 11. Jahrhundert zufolge wird die Auferstehung der Toten auf dieser Erhebung Jerusalems beginnen, vis-à-vis zum Berg Moriah, auf dem einstmals der Tempel stand. Der alte Gutenberg, so hieß mein Ururgroßvater, verkaufte all seinen Besitz, investierte sein gesamtes Vermögen in die Reise und hinterließ seinen Kindern nicht einen Groschen. Er muss ein ziemlich egoistischer Zeitgenosse gewesen sein, einer von denen, die sich in einer Warteschlange immer nach vorne drängen, weshalb es ihn auch danach verlangte, unter den Ersten zu sein, die beim Kommen des Messias von den Toten auferstünden. Er hoffte wohl einfach, seine Erlösung würde die Auferstehung aller anderen Familienmitglieder befördern, und so wurde ihm die Gnade zuteil, als Erster aus der Familie in der Erde Zions ewige Ruhe zu finden.
Mein Vater schlug vor, ich sollte nach dem Grab meines Urgroßvaters suchen. Doch ungeachtet meiner spontanen Neugier ließen mich die sengende Sommerhitze und die deprimierende Müdigkeit nach den Kämpfen Abstand von der Idee nehmen. Zudem machte das Gerücht die Runde, die alten Grabplatten seien für den Bau des jordanischen Hotels oder zumindest für die Pflasterung der Zufahrt verwendet worden. Ich erinnere mich, dass ich in jener Nacht nach dem Telefongespräch mit meinem Vater auf dem Bett saß, mich an die Zimmerwand lehnte und mir vorstellte, sie sei aus dem Grabstein meines Urgroßvaters gemauert. Von den hervorragenden Weinen aus der Hotelbar ordentlich beschwipst, konnte ich nicht anders, als über die absurden Kapriolen der Geschichte nachzusinnen. Doch meine traurige Lage – als bewaffneter Wächter stand ich israelisch-jüdischen Plünderern gegenüber, die den Inhalt des Hotels wie selbstverständlich für die »Befreier« Jerusalems beanspruchten – überzeugte mich, dass die Auferstehung der Toten noch in weiter Ferne läge.
Zwei Monate nach meiner Begegnung mit der Klagemauer und dem Ölberg drang ich tiefer nach »Erez Israel« vor und machte dabei eine Erfahrung, die für mein weiteres Leben außerordentlich prägend war. Bei meinem ersten Reservedienst nach dem Krieg wurde ich in einer alten Polizeistation am Ortseingang von Jericho stationiert, der ersten Stadt in der Geschichte der Menschheit, die einer alten Sage zufolge kraft eines Trompetenstoßes eingenommen worden war. Leider sollte mir dort ein traumatisches Erlebnis widerfahren, das sich vollkommen von dem der beiden Kundschafter unterschied, die damals im Haus von Rahab, der örtlichen Hure, Unterschlupf fanden, so man der biblischen Erzählung denn Glauben schenkt. Bei meinem Eintreffen erzählten mir andere Soldaten, in den Tagen zuvor seien palästinensische Flüchtlinge des »Sechstagekrieges«, die versucht hatten, in ihre Häuser zurückzukehren, systematisch erschossen worden. Jene, die den Jordan bei Tage überquert hatten, seien festgenommen worden und würden nach ein, zwei Tagen zurück auf die andere Seite des Flusses geschickt. Meine Aufgabe bestünde darin, die Insassen unseres improvisierten Gefängnisses zu bewachen.
In einer Freitagnacht im September 1967 – ich erinnere mich genau, weil es der Vorabend meines Geburtstags war – blieben wir einfachen Reservisten uns selbst überlassen, da die Offiziere auf eine Spritztour nach Jerusalem gefahren waren. Ein alter Palästinenser, der mit einer großen Menge von Dollarscheinen auf der Straße festgenommen worden war, wurde in den Verhörraum gebracht. Ich stand vor der Polizeistation Wache, als ich plötzlich furchtbare Schreie hörte. Ich hastete ins Gebäude, stieg auf eine Kiste und verfolgte durch ein kleines Oberlicht das entsetzliche Schauspiel. Der alte Mann saß gefesselt auf einem Stuhl, während meine lieben Kameraden ihn am ganzen Körper schlugen und brennende Zigaretten auf seinen Armen ausdrückten. Ich stolperte von der Kiste, übergab mich und kehrte verstört und am ganzen Leib zitternd auf meinen Posten zurück. Kurz darauf fuhr ein Pritschenwagen mit der Leiche des »reichen« Greises auf der Ladefläche davon. Meine Kameraden riefen mir zu, sie führen zum Jordan, um sie loszuwerden.
Ich weiß nicht, ob der misshandelte Leichnam am Ende genau dort ins Wasser geworfen wurde, wo einst die »Kinder Israels« den Jordan überquert hatten, auf ihrem Weg in das ihnen direkt von Gott verliehene Land. Ebenso wenig ist anzunehmen, dass es sich um den Ort handelte, an dem der heilige Johannes seinerzeit die ersten »wahren Kinder Israels« taufte, eine Stätte, die der christlichen Tradition zufolge südlich von Jericho liegt. Wie auch immer, ich habe nie verstanden, warum der alte Palästinenser gefoltert und umgebracht wurde, schließlich gab es damals noch keinen Terror, wagte es noch niemand, Widerstand zu leisten. War es des Geldes wegen? Oder sollten es die Langweile und Tristesse eines Freitagabends ohne anderweitige Vergnügen gewesen sein, die zu den Misshandlungen und dem gewöhnlichen Mord führten?
Erst später ist mir aufgegangen, welche Bedeutung meine »Jerichoer Taufe« als Wasserscheide in meinem Leben haben sollte. Ich hatte die Misshandlungen und die blinde Gewalt nicht verhindern können, weil ich Angst gehabt und vollkommen den Kopf verloren hatte. Ich weiß nicht, ob ich die Tat überhaupt hätte unterbinden können, aber die Tatsache, dass ich es nicht einmal versucht habe, hat mich zutiefst deprimiert und mich jahrelang verfolgt. Allem Anschein nach wohnt mir dieser Mord bis zum heutigen Tage inne, da ich über ihn schreibe. Er hat mich auch gelehrt, dass eine Situation von absoluter Machtfülle nicht nur zerstörerische Niedertracht hervorbringen kann, wie schon Lord Acton wusste, sondern auch ein Gefühl unerträglichen Herrentums, einer Herrschaft über andere Menschen und letztlich auch über einen Ort. Ich bin sicher, dass meine machtlosen Vorfahren, die im Ansiedlungsrayon der Juden im zaristischen Russland lebten, sich nicht hätten ausmalen können, was ihre Nachfahren dereinst im Heiligen Land vollführen würden.
Bei meinem nächsten Reservedienst wurde ich genau zu der Zeit abermals ins Jordantal geschickt, als man dort mit Begeisterung daranging, die ersten Siedlungen des Nachal3 zu errichten. Am zweiten Tag meines Aufenthalts im Jordantal nahm ich im Morgengrauen an einem nebulösen Appell teil, der von General Rechavam Se’evi, bekannt auch unter dem Namen Gandhi, abgehalten wurde. Se’evi war kurz zuvor zum Befehlshaber des Zentralabschnitts ernannt worden. Bald würde er von seinem Freund Moshe Dayan eine lebendige Löwin als Geschenk erhalten, jene Raubkatze, die bald zum Symbol für die Allgegenwart der israelischen Armee im Westjordanland werden sollte. Der General, ein echter Sabre,4 baute sich in einer Art und Weise vor uns auf, die eines General Patton nicht unwürdig gewesen wäre,5 und hielt eine kurze Rede. Deren genauen Wortlaut habe ich nicht mehr in Erinnerung, da ich wohl noch ein bisschen verschlafen war, aber niemals werde ich den Augenblick vergessen, als Se’evi mit großer Geste auf die hinter uns aufragenden Berge Transjordaniens wies und uns mit viel Pathos befahl, dies immer im Gedächtnis zu behalten: Auch diese Berge befänden sich in Erez Israel, auch dort in Gilad und Baschan hätten unsere Vorväter gelebt.
Einige der umstehenden Soldaten nickten zustimmend, andere grinsten, doch die allermeisten wollten nur so schnell wie möglich zurück in ihre Zelte, um noch eine Mütze Schlaf zu bekommen. Der Spaßmacher der Truppe meinte, unser General sei zweifelsohne ein direkter Nachfahre der Vorväter, die vor dreitausend Jahren östlich des Flusses gelebt hätten, und als Dankesgeste gegenüber unserem verehrten Befehlshaber schlug er vor, sogleich aufzubrechen, um das von den trotteligen Gojim besetzte Gebiet zu befreien. Mir jedoch fehlte es offenbar an Humor. Die kurze Ansprache des Generals sollte wie ein Katalysator auf die Entwicklung meines skeptischen Verhältnisses zu dem System kollektiver Erinnerung wirken, in dessen Licht ich als Schüler erzogen worden war. Ich wusste schon damals, dass nach der – vielleicht verqueren – biblischen Logik Se’evi nicht im Irrtum war. Als ehemaliger Held der Palmach6 und künftiger Minister in etlichen israelischen Regierungen war Se’evi in seiner brennenden Leidenschaft für die Vergrößerung des Vaterlandes schon immer ehrlich und konsequent gewesen. Seine moralische Blindheit gegenüber jenen, die bis dahin auf dem »Erbbesitz der Väter« gelebt hatten, und seine Gleichgültigkeit für deren Präsenz sollten schon bald zum Allgemeingut werden.
Die Wahrheit ist, dass ich mich dem kleinen Fleckchen Erde, auf dem ich aufgewachsen war, sehr wohl verbunden fühlte. Seine städtischen Landschaften hatten mich geprägt, dort hatte ich zum ersten Mal Liebe empfunden. Auch wenn ich niemals wirklich Zionist gewesen war, hatte man mich dazu erzogen, in unserem Staat auch eine Zufluchtsstätte für all jene Entwurzelten und Verfolgten zu sehen, die nirgendwo anders hatten hingehen können. Die Entwicklung bis 1948 hatte ich, im Gefolge des Historikers Isaac Deutscher, stets als den verzweifelten Sprung eines Menschen aus einem lichterloh brennenden Haus betrachtet, ein Sprung, der mit der Landung auf einem zufällig vorbeikommenden Passanten endet, der dabei schwer verletzt wird.7 Doch zum damaligen Zeitpunkt hätte ich mir die tiefgreifenden Veränderungen niemals vorstellen können, die dieses Land infolge des militärischen Sieges und der territorialen Erweiterung erfahren würde – Veränderungen, die in keiner Weise mit jüdischem Leid und Verfolgung zusammenhingen und in keiner Weise darüber zu rechtfertigen gewesen wären. Die langfristigen Ergebnisse dieses Pyrrhussiegs haben im Gegenteil die pessimistische und bittere Hypothese bestätigt, die Geschichte sei fast immer Schauplatz eines Rollenwechsels zwischen Opfern und Henkern, ein Schauspiel über entwurzelte Verfolgte, die zu Verfolgern und Herrschern über die Heimat eines anderen werden.
Sicherlich war die veränderte Wahrnehmung des nationalen Raumes wesentlich für die Gestaltungsprozesse der israelischen Kultur nach 1967, auch wenn sie vielleicht nicht von alles entscheidender Bedeutung war. Bereits seit 1948 wohnte einer mentalen Tiefenschicht des israelischen Bewusstseins eine Art Verdruss über die schmalen Hüften und die geringe Fläche des israelischen Staatsgebietes inne. Diese Unzufriedenheit trat zum Beispiel im Krieg von 1956 offen zutage, als der israelische Regierungschef ernsthaft darüber nachdachte, nach einem militärischen Sieg die Sinaihalbinsel und den Gazastreifen zu annektieren.
Trotz dieser bedeutsamen, aber nur kurzlebigen Episode erscheint die Vermutung nicht irrig, dass der Mythos vom Land der Väter, der mit der Staatsgründung einen Teil seiner Kraft verloren hatte, erst im Gefolge des »Sechstagekriegs« mit Macht ins Zentrum der öffentlichen Sphäre zurückkehrte. In den Augen vieler jüdischer Israelis schien jede Kritik an der Eroberung von Ostjerusalem, Hebron und Betlehem die Legitimität der einige Jahrzehnte zuvor erfolgten Einnahme von Jaffa, Haifa und Akko erschüttern zu können – Orte, die im Mosaik des zionistischen Verhältnisses zur mythologischen Vergangenheit relativ unbedeutend waren. Denn hatte man das Prinzip eines »historischen Anrechts auf Rückkehr in die Heimat« erst einmal akzeptiert, fiel es schwer, die Verwirklichung dieses Anrechts ausgerechnet in Bezug auf das Herzstück der »alten Heimat« in Abrede zu stellen. Hatten meine Kameraden nicht recht gehabt, als sie meinten, keine Grenze überschritten zu haben? Hatten wir nicht gerade zu diesem Zweck in unseren säkularen Schulen die Bibel in einem eigenständigen, pädagogisch-historischen Fach behandelt?
Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass die vormalige Waffenstillstandslinie – die Grüne Linie – schon bald von den durch das israelische Bildungsministerium herausgegebenen Karten verschwinden würde, dass sich die Auffassung künftiger Generationen von den Grenzen ihres Vaterlandes so fundamental von den meinen unterscheiden würde. Ich wusste einfach nicht, dass mein Staat seit seiner Gründung nie feste Grenzen gehabt hatte, sondern flexible, modulare Grenzregionen, die immer die Option einer territorialen Expansion sicherstellten.
Infolge meiner politisch-humanistischen Naivität hätte ich mir zum Beispiel nicht träumen lassen, dass Israel es jemals wagen würde, Ostjerusalem zu annektieren und den Vorgang damit zu begründen, Jerusalem sei »eine Stadt, in der man zusammenkommen soll« (Psalm 120,3), um gleichzeitig und bis auf den heutigen Tag einem gewaltsam annektierten Drittel der Einwohnerschaft gleiche Bürgerrechte zu verweigern. Auch hätte ich mir nicht vorstellen können, eines Tages Zeuge der Ermordung eines israelischen Regierungschefs zu werden, nur weil ein mörderischer Patriot meinte, dieser sei drauf und dran, einen Rückzug aus »Judäa und Samaria«8 zu veranlassen. Ebenso wenig hätte ich mir später ausmalen mögen, in einem schlafwandelnden Staat zu leben, dessen erst mit 20 Jahren eingewanderter Außenminister während seiner gesamten Amtszeit seinen Wohnsitz außerhalb der souveränen Staatsgrenzen hat.
Zugleich konnte ich damals noch nicht wissen, dass es Israel gelingen würde, über Jahrzehnte eine derart große, jeder Selbstbestimmung beraubte palästinensische Bevölkerung zu beherrschen, während die intellektuellen Eliten des Landes unterdessen mehrheitlich ihren Frieden mit diesen Zuständen machten. Einige namhafte Historiker unter ihnen, meine späteren Kollegen, bezeichnen die unter Besatzung lebende Bevölkerung weiterhin und ganz selbstverständlich als »Araber des Landes Israel«.9 Auch hätte ich mir wohl in meinen wildesten Phantasien nicht vorstellen können, dass die Herrschaft über diese einheimische Bevölkerung nicht unter den Bedingungen einer diskriminierenden Einbürgerung stattfinden würde, also in Form einer Militärverwaltung, einer zionistisch-sozialistischen Enteignung und Judaisierung weiter Flächen, wie es im guten alten Israel in den Grenzen von 1948 der Fall gewesen war. Stattdessen erfolgten eine umfassende Aberkennung von Freiheiten aller Art und die Ausbeutung sämtlicher natürlicher Ressourcen des »geliebten Landes« zugunsten der Pioniere und Siedler des »jüdischen Volkes«. Niemals hätte ich mir auch nur im Entferntesten vorstellen können, dass es Israel gelingen würde, mehr als eine halbe Million Menschen in die neueroberten Gebiete zu verpflanzen, sie dort anzusiedeln, eingezäunt und vollkommen separiert von einer lokalen Bevölkerung, der grundlegendste Menschenrechte verweigert werden. Damit streicht der Staat den kolonialistischen, ethnozentrischen und segregierenden Charakter heraus, der das gesamte nationale Projekt seit seinen Anfängen auszeichnet. Kurzum, ich wusste damals nicht, dass ich die meiste Zeit meines Lebens Seite an Seite mit einem ausgeklügelten und einzigartigen militärischen Apartheidsystem leben würde, mit dem sich die »zivilisierte« Welt, unter anderem aus schlechtem Gewissen, arrangieren musste und das sie wohl oder übel sogar unterstützt.
Als junger Mann hätte ich mir die verzweifelten Intifadas nicht träumen lassen, ebenso wenig wie die brachiale Unterdrückung der Aufstände, weder den grausamen Terror noch den Gegenterror. Und vor allem habe ich seinerzeit die Macht der zionistischen Idee vom »Land Israel« nicht begriffen, die so viel stärker war als die fragile, sich erst allmählich entwickelnde israelische Alltagskultur. Lange Zeit habe ich die simple Tatsache nicht realisiert, dass der erzwungene Verzicht auf große Teile des Landes der Väter im Jahre 1948 lediglich ein vorübergehender war. Noch war ich kein Historiker, der sich der Erforschung kultureller und politischer Ideen widmete, und wusste daher nichts von der Funktion und dem Gewicht moderner Mythologien von der Heimaterde, geschweige denn von jenen, die dank des Rauschs militärischer Stärke und durch eine nationalisierte Religion zur Blüte gelangen.
2. Anrechte auf das Land der Väter
Im Jahre 2008 habe ich auf Hebräisch meine Studie Die Erfindung des jüdischen Volkes veröffentlicht, die als theoretische Untersuchung darauf zielt, den metahistorischen Mythos von der Existenz eines exilierten, wandernden jüdischen Volkes zu dekonstruieren. Das Buch wurde in zwanzig Sprachen übersetzt; eine ganze Phalanx feindseliger zionistischer Kritiker antwortete darauf. In einer Rezension schrieb etwa der bekannte britische Historiker Simon Schama, mein Buch sei »(in dem Versuch) gescheitert, das Band der Erinnerung zwischen dem Land der Väter und der jüdischen Erfahrung aufzuheben«.10 Ich muss gestehen, dass ich über diese Anmerkung zunächst überrascht war. Doch als zahlreiche weitere Artikel und Kommentare wiederholten und auswalzten, meine Absicht sei es im Grunde gewesen, das Anrecht der Juden auf ihre angestammte Heimat zu unterminieren, verstand ich, dass Schamas Standpunkt symptomatisch für den Gegenangriff auf meine Studie war.
Beim Verfassen des Buches wäre mir nicht eingefallen, dass sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts derart viele Kritiker fänden, die, um die zionistische Kolonisierung und die Errichtung des israelischen Staates zu rechtfertigen, mit dem Land der Väter, mit historischen Anrechten oder einer zweitausendjährigen nationalen Sehnsucht argumentieren. Ich war sicher, dass die Mehrheit aller ernstgemeinten, rechtfertigenden Argumentationen zugunsten der Existenz Israels in seiner gegenwärtigen Form auf dem tragischen Prozess basieren würde, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts einsetzte und in dessen Verlauf Europa sich seiner Juden entledigte, während sich die Vereinigten Staaten ab einem bestimmten Zeitpunkt abschotteten.11 Und ich begann zu verstehen, dass meine bisherige Arbeit in mehrfacher Hinsicht unausgewogen war. Die vorliegende Studie ist daher nicht zuletzt dazu bestimmt, eine bescheidene Ergänzung zu liefern, die versucht, manche Aspekte genauer zu fassen und Fehlendes hinzuzufügen.
Doch ich sollte zunächst einmal klarstellen: Meine vorherige Studie befasste sich nicht explizit mit der Beziehung zu einem Territorium oder den Vorrechten auf ein solches, auch wenn sie notwendigerweise Erkenntnisse lieferte, die sich direkt auf derartige Fragen beziehen. Ich habe Die Erfindung des jüdischen Volkes vor allem deshalb geschrieben, um mit Hilfe von historischem und historiographischem Material die ethnozentrische, ahistorische und essentialistische Auffassung ins Wanken zu bringen, die der gegenwärtigen wie der überkommenen Definition von Judentum und jüdischer Identität zugrunde liegt. Es ist allgemein bekannt, dass die Juden keine reine Rasse sind, und doch tendieren vor allem Judenfeinde und Zionisten noch immer dazu, an der irrigen und irreführenden Perspektive festzuhalten, die Mehrheit aller Juden gehöre einem antiken Volksstamm an, einer ewigen »Ethnie«, die Aufnahme unter den Völkern gefunden hatte und in einer schicksalhaften Stunde, als diese Völker Anstalten machten, sich ihrer zu entledigen, ins Land seiner Väter zurückkehrte.
Zugegeben, nach Jahrhunderten, in denen man sich selbst als »auserwähltes Volk« betrachtet hatte (eine Selbstwahrnehmung, die den Überlebenswillen und die Widerstandskraft der Juden gegen Erniedrigung und Verfolgung durch die Jahrhunderte bewahrt und gestärkt hatte), und nach beinahe zweitausend Jahren, in denen die christliche Zivilisation beharrlich daran festgehalten hatte, die Juden als direkte, aus Jerusalem eingewanderte Abkömmlinge der Mörder von Gottes Sohn zu betrachten, vor allem jedoch, nachdem der moderne Antisemitismus die alte Judenfeindschaft neu aufpoliert und Juden als Angehörige einer fremden, Seuchen verbreitenden Rasse definiert hatte – nach all dem war es nicht gerade einfach, die »ethnische« Entfremdung zu dekonstruieren, die den Juden von der europäischen Kultur aufgeprägt worden war.12
Dennoch entschied ich mich, meiner vorangegangenen Studie folgende Arbeitshypothese zugrunde zu legen: Eine Gruppe von Menschen unterschiedlicher Herkunft, der nicht ein einziger kulturell-säkularer, alle ihre Mitglieder einender Inhalt zu eigen ist, der man, bis auf den heutigen Tag, allein durch Konversion beitreten kann, nicht aber durch Aneignung einer Sprache oder einer Alltagskultur, kann nach allen geltenden Maßstäben nicht als Volk oder »ethnische Gruppe« gelten (ein Begriff, der zu wissenschaftlicher Blüte gelangt ist, nachdem der Begriff »Rasse« aus naheliegenden Gründen obsolet geworden war).
Wenn Bezeichnungen wie »das französische Volk«, »das amerikanische Volk«, »das vietnamesische Volk« oder sogar »das israelische Volk« konsequent und sinnvoll verwendet würden, wäre es genauso sonderbar, von »dem jüdischen Volk« zu sprechen wie von »dem buddhistischen Volk«, »dem evangelischen Volk« oder »dem bahaiischen Volk«. Das gemeinsame Schicksal von Anhängern einer Glaubensgemeinschaft und eine gewisse Solidarität unter ihnen machen diese noch nicht zu einem gemeinschaftlichen Volk oder zu einer nationalen Solidargemeinschaft. Auch wenn die Menschheit ein Nach- und Nebeneinander höchst komplexer Daseinsformen darstellt, die sich jedem Versuch widersetzen, sie in mathematische Formeln zu fassen, haben wir uns nach Kräften um eine möglichst präzise Terminologie zu bemühen: Spätestens mit dem Beginn der Moderne sollte jedes Volk eine alle seine Angehörigen verbindende Volkskultur haben (die von einer gemeinsamen Umgangssprache bis hin zu Essen und Musik reicht). Die Juden jedoch haben, bei aller Eigenart, im Laufe der gesamten Geschichte bis heute immer »nur« eine vielgestaltige Religionskultur besessen (die von einer nicht gesprochenen Sakralsprache bis hin zu Kult und Riten reicht).
Viele meiner Kritiker – die allermeisten von ihnen sind nicht ganz zufällig selbst geschworene Säkulare – halten indessen unbeirrt daran fest, das historische Judentum und seine heute lebenden Nachkommen als Volk zu definieren, zwar nicht länger als auserwähltes, auf jeden Fall aber als außerordentliches, einzigartiges und in keiner Weise mit den anderen Völkern vergleichbares. Nicht zuletzt deshalb war es notwendig, den breiten Massen das mythologische Image eines Volkes zu vermitteln, das angeblich im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung (u. Z.) gewaltsam aus seinem Land vertrieben worden war, während sich die gebildeten Eliten die ganze Zeit über bewusst waren, dass eine solche Exilierung in Wahrheit niemals stattgefunden hatte, weshalb auch nicht ein einziges wissenschaftliches Standardwerk über diese gewaltsame Vertreibung des »jüdischen Volkes« aus seinem Land zu finden ist.13
Parallel zu dieser höchst effektiven Verbreitung eines konstituierenden historischen Mythos waren außerdem folgende Schritte notwendig: A) Scheinbar unbeabsichtigt in Vergessenheit geraten zu lassen, dass das Judentum mindestens ab dem 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung (v. u. Z.) und bis zum 8. nachchristlichen Jahrhundert eine dynamische und missionierende Religion war. B) Die Vielzahl der zum Judentum übergetretenen Königreiche zu ignorieren, die im Verlauf der Geschichte in verschiedenen Regionen aufblühten.14 C) Aus dem kollektiven Gedächtnis die gewaltige Anzahl von Menschen zu tilgen, die zum Judentum übergetreten waren und die Grundlage der allermeisten jüdischen Gemeinden auf der Welt bildeten. D) Die freimütigen Äußerungen der Vordenker des Zionismus – an ihrer Spitze der Staatsgründer David Ben-Gurion höchstpersönlich15 – zu unterschlagen, die sehr wohl wussten, dass eine Verbannung des Volkes niemals stattgefunden hatte, weshalb sie in den einheimischen Fellachen authentische Nachfahren der alten Hebräer sahen.
Derselben ethnozentrischen Tendenz folgend, haben sich besonders verzweifelte und gefährliche Geister daran gemacht, nach einer genetischen Identität aller Nachkommen von Juden auf der ganzen Welt zu suchen, einer von den Bevölkerungen, unter denen sie leben, biologisch eindeutig unterscheidbaren Identität. Pseudowissenschaftler haben mit beängstigender Nachlässigkeit damit begonnen, bruchstückhafte Befunde zusammenzutragen, um vorgefertigte Thesen von der Existenz einer alten Rasse zu bestätigen. Nach dem Scheitern des »wissenschaftlichen« Antisemitismus und seines widerwärtigen Versuchs, die jüdische Eigenart im Blut oder in der Physiognomie zu finden, kam die perverse nationale Hoffnung in die Welt, die DNA könnte vielleicht den unumstößlichen Beweis für die Existenz einer jüdischen »Ethnie« mit einheitlicher Herkunft liefern, die sich vom »Land Israel« über die ganze Welt ausbreitete.16
Das ausschlaggebende, wenn auch beileibe nicht einzige Motiv für diese halsstarrige Einstellung, das mir zum Zeitpunkt der Niederschrift meiner vorherigen Studie nur teilweise klar war, ist einfach zu benennen: Dem ungeschriebenen Konsens jeder zivilisierten Weltauffassung zufolge genießt jedes Volk ein Anrecht auf das gemeinschaftliche Eigentum an einem klar abgegrenzten Territorium, auf dem es lebt und von dem es sich ernährt. Religionsgemeinschaften aller Art hingegen, deren Mitglieder unterschiedlichster Herkunft sind und verstreut über verschiedene Erdteile leben, wurde ein solches Eigentumsrecht bisher nicht zugestanden.
Diese fundamentale, rechtlich-historische Logik war mir aus folgendem Grunde nicht selbstverständlich: Von frühester Jugend an und noch als junger Mann habe ich, als ein mustergültiges Produkt des israelischen Bildungswesens, ohne den Anflug eines Zweifels an die Existenz eines mehr oder weniger ewigen jüdischen Volkes geglaubt. So wie ich irrigerweise sicher war, dass die hebräische Bibel ein Geschichtswerk und der Auszug aus Ägypten eine Tatsache wäre, so war ich in meiner damaligen Unwissenheit auch überzeugt, das »jüdische Volk« wäre nach der Zerstörung des Tempels gewaltsam seiner Heimat entrissen worden, wie es auch in der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel feierlich festgehalten ist.
Gleichzeitig jedoch, auch dank der mir von meinem Vater vermittelten universalen Werte, die nicht zuletzt auf einer Sensibilität für historische Gerechtigkeit gründeten, konnte ich mir nicht vorstellen, dass »mein exiliertes Volk« ein exklusives nationales Besitzrecht auf ein Territorium besaß, auf dem es »zweitausend Jahre« nicht gelebt hatte, während der Bevölkerung, die seit vielen Jahrhunderten in ebendiesem Land ansässig war, ein solches Privileg abgesprochen wurde. Denn schon definitorisch gründet jedes Recht auf einem Wertesystem, auf dessen Grundlage seine Anerkennung durch andere eingefordert werden kann. In meinen Augen hätte allein die Zustimmung der einheimischen Bevölkerung zu einer »jüdischen Heimkehr« einem wie auch immer beschaffenen historischen Recht Gültigkeit und Legitimation verleihen können. In meiner jugendlichen Naivität dachte ich, ein Land gehöre vor allem seinen Bewohnern, also denjenigen, die darauf ihren festen Wohnsitz haben und auf seiner Erde sterben, nicht aber jenen, die darüber herrschen oder versuchen, sich seiner aus der Ferne zu bemächtigen.
Als zum Beispiel Lord Arthur James Balfour, der damalige britische Außenminister, im Jahre 1917 Lord Lionel Walter Rothschild eine nationale Heimstätte für die Juden versprach, wäre er, so »großherzig« er auch war, niemals auf den Gedanken verfallen, ihnen sein Geburtsland Schottland zur Ansiedlung anzubieten. Denn um es klar zu sagen: Dieser moderne Kyros ist immer konsequent in seiner Einstellung gegenüber den Juden geblieben. So setzte er sich etwa 1905 als britischer Premier vehement für ein restriktives Einwanderungsgesetz ein, das hauptsächlich dazu bestimmt war, jüdische Flüchtlinge, Opfer der Pogrome in Osteuropa, an der Einreise nach Großbritannien zu hindern.17 Dennoch wurde die Erklärung dieses ebenso kolonialistischen wie bibelfesten Protestanten in der zionistischen Geschichtsschreibung, neben der Heiligen Schrift selbstverständlich, als letztgültige politisch-moralische Legitimation des Anrechts der Juden auf »Erez Israel« begriffen.
Wie dem auch sei – würden wir versuchen, die Welt so zu organisieren, wie sie vor Tausenden oder Hunderten von Jahren einmal gewesen war, würden wir dem gesamten System internationaler Beziehungen eine gehörige Dosis Gewalt und Wahnsinn einimpfen. Wer würde etwa ernsthaft erwägen, schon morgen die Forderung von Arabern zu unterstützen, sich auf der iberischen Halbinsel anzusiedeln und dort einen muslimischen Staat zu errichten, weil ihre Vorväter nach der Reconquista von dort vertrieben worden waren? Und warum sollten dann nicht auch die Nachfahren der Puritaner in Scharen ins Land ihrer Ahnen zurückkehren, um dort das himmlische Königreich zu errichten? Und würde irgendjemand, so er denn liberal genug ist, die indianischen Ansprüche auf Manhattan unterstützen, inklusive einer Vertreibung aller Weißen und Schwarzen von dort? Oder sollten wir – zu guter Letzt – uns für eine Rückkehr der Serben in das Kosovo und ihre erneute Inbesitznahme des Landes einsetzen, eingedenk der heroischen Schlacht auf dem Amselfeld im Jahre 1389 oder weil orthodoxe, einen serbischen Dialekt sprechende Christen vor etwa zweihundert Jahren die Mehrheit der Bevölkerung stellten? Mit Leichtigkeit lässt sich so eine ganze Reihe absurder Realisierungen »althergebrachter historischer Rechte« ausmalen, die uns tief in die Abgründe der Geschichte stießen und allgemeines Chaos über die Menschheit brächten.
Die Idee vom »historischen Recht der Juden auf das gelobte Land« habe ich niemals als selbstverständlich akzeptiert. Als ich während meines Studiums die chronologische Einteilung der Menschheitsgeschichte seit der Erfindung der Schrift kennenlernte, kam mir die »jüdische Heimkehr« nach mehr als 1800 Jahren wie ein absurder Zeitsprung ohne jede chronologisch-rationale Verhältnismäßigkeit vor. Für mich unterschied sie sich grundsätzlich nicht vom Mythos der Besiedlung durch Christen – der puritanischen in Nordamerika und der Buren in Südafrika –, die das von ihnen besetzte Land als das biblische, den wahren Kindern Israels von Gott verheißene Kanaan ansahen.18
Ich kam zu dem Schluss, dass die »jüdische Heimkehr« vor allem eine wirkungsvolle Erfindung gewesen war, die ein neues Kolonisierungswerk rechtfertigen sollte und auf das Wohlwollen der westlichen Welt zielte, vor allem auf das der christlich-protestantischen, der sogar die Urheberschaft dieser Idee zukommt. Doch schon die nationale Logik eines solchen Projekts impliziert bereits die Verdrängung einer schwachen, indigenen Bevölkerung. Denn Zionisten kamen nicht nach Jaffa wie verfolgte Juden nach London oder New York, will sagen: um in Gemeinschaftlichkeit und Symbiose mit ihren alteingesessenen Nachbarn zusammenzuleben. Von Anfang an strebten sie danach, in Palästina einen souveränen jüdischen Staat auf einem Territorium zu errichten, dessen Bevölkerung in ihrer absoluten Mehrheit arabisch war.19 Es war definitiv unmöglich, ein nationales Siedlungswerk dieser Art zu vollenden, ohne am Ende einen beträchtlichen Teil der einheimischen Bevölkerung verdrängt zu haben.
Heute, nach vielen Jahren des historischen Studiums, denke ich nicht mehr, dass irgendwann einmal ein jüdisches Volk existierte, das gewaltsam aus seinem Land exiliert wurde, oder dass die Juden dem biblischen Judäa entstammen. Nicht von ungefähr ähnelten die jemenitischen Juden so sehr den jemenitischen Muslimen, waren die nordafrikanischen Juden den Berbern derselben Region zum Verwechseln ähnlich, ebenso wie die äthiopischen Juden ihren afrikanischen Nachbarn, die Juden aus Cochin den übrigen Bewohnern dieser Region im Südwesten des indischen Subkontinents, oder die osteuropäischen Juden den türkischen und slawischen Stämmen im Kaukasus und in Südostrussland. Die Anhänger des jüdischen Glaubens waren, zum Verdruss der Antisemiten, niemals eine fremde, infiltrierende »Ethnie«, die von weit her gekommen war, sondern rekrutierten sich vielmehr aus autochthonen Bevölkerungselementen, deren Ahnen zumeist an Ort und Stelle und noch vor der Ankunft des Christentums oder des Islams zum Judentum konvertiert waren.20
Gleichermaßen bin ich überzeugt, dass es dem Zionismus nicht gelungen ist, eine globale jüdische Nation zu schaffen, sondern »nur« ein israelisches Volk, dessen Existenz er – unglücklicherweise – beharrlich leugnet. Wenn Nationalität tatsächlich das Bestreben oder zumindest die Bereitschaft und das Einverständnis von Menschen bezeichnet, zusammen in einem souveränen Staat mit einer eigenen, säkularen Kultur zu leben, dann zieht es die Mehrheit all jener Menschen, die sich rund um den Globus als Juden betrachten, vor, nicht dort zu leben und mit den Israelis ihre nationale Kultur zu teilen. Das gilt selbst für jene, die beständig ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck bringen. Die Prozionisten finden nichts dabei, Bürger ihrer jeweiligen Nationalstaaten zu sein und unmittelbar Anteil an den Aktivitäten und dem Wohlstand der dort lebenden Völker zu haben, gleichzeitig jedoch, wie nimmersatte Immobilienspekulanten, ein historisches Recht auf das »Land der Väter« zu reklamieren, das auf ewig ihnen gehören soll.
Um unnötigen Missverständnissen vorzubeugen, sollte ich noch einmal betonen: a) Ich habe niemals das Recht der jüdischen Israelis in Zweifel gezogen, in einem demokratischen, offenen und alle seine Bürger einbeziehenden Israel zu leben. b) Niemals habe ich die Existenz einer tiefen religiösen, weit zurückreichenden Beziehung der Anhänger des jüdischen Glaubens zu ihrer heiligen Stadt Zion in Abrede gestellt. Doch zwischen diesen beiden Grundannahmen besteht ebenso wenig eine kausale Verbindung wie irgendein moralischer Zusammenhang, aus dem sich irgendwelche Verpflichtungen ableiten ließen.
Erstens ist, soweit ich das überhaupt beurteilen kann, mein politischer Standpunkt immer ein pragmatisch-realistischer geblieben: Wenn die Verpflichtung besteht, vieles zu korrigieren, was in der Vergangenheit getan wurde; wenn ein kategorisches moralisches Gebot uns nötigt, das Unglück und die Zerstörung anzuerkennen, die wir über andere gebracht haben; selbst wenn wir künftig einen hohen Preis an jene zu zahlen hätten, die zu Flüchtlingen geworden sind – es wäre dennoch unmöglich, die Zeit zurückzudrehen, ohne neue Tragödien heraufzubeschwören. Die zionistische Besiedlung hat in der Region nicht nur eine kolonialistische, ausbeuterische Oberschicht hervorgebracht, sondern auch eine Gesellschaft, eine Kultur und sogar ein ortsbezogenes Volk, die zu entwurzeln außer Frage steht. Mithin ist jeder Versuch, das Existenzrecht eines israelischen Staates zu erschüttern, der auf einer gesellschaftlichen und politischen Gleichstellung aller seiner Bürger gründet, nicht nur anachronistisch und töricht, sondern auch ein sicheres Rezept für weitere Katastrophen in der Region – unabhängig davon, ob ein solcher Versuch von Seiten radikaler Muslime erfolgt, die darauf bestehen, diesen Staat vom Antlitz der Erde zu tilgen, oder aber aus der Richtung von Erzzionisten, die in ihrer Verblendung daran festhalten, in diesem Staat die Heimat aller Juden auf der Welt zu sehen.
Zweitens sollte, wenn auch die Politik aus schmerzhaften Kompromissen besteht, die historische Forschung alles daran setzen, sich von solchen fernzuhalten. Zwar bin ich immer von der Annahme ausgegangen, der spirituelle Hunger nach dem von Gott verheißenen Land sei einer der zentralen Identitätsstränge jüdischer Religionsgemeinschaften gewesen und somit eine elementare Voraussetzung für deren Verständnis. Doch die schmerzliche Sehnsucht nach dem himmlischen Jerusalem in der Seele unterdrückter und erniedrigter religiöser Minderheiten war vor allem ein metaphysisches Herbeisehnen der Erlösung – nicht aber das Verlangen nach einer konkreten Landschaft und ihren steinigen Hügeln. Davon abgesehen sollte die religiöse Beziehung zu einer heiligen Stätte, sei es auf Seite von Juden, Christen oder Muslimen, auf keinen Fall dazu dienen, moderne Besitzrechte an ihr zu erwerben.
Bei allen Unterschieden ist das Prinzip dasselbe: Die Kreuzritter hatten keinerlei »historisches Recht«, sich des Heiligen Landes zu bemächtigen, trotz ihrer starken religiösen Bindung an dieses, ihrer langen Anwesenheit dort und der Unmengen von Blut, die sie um seinetwillen vergossen. Auch die Tempelgesellschaft, jene christlich-chiliastische, Mitte des 19. Jahrhunderts im Königreich Württemberg entstandene Religionsgemeinschaft, die sich selbst als das auserwählte, zum Erben des gelobten Landes bestimmte Volk ansah, besaß kein solches Vorrecht. Selbst die christlichen Pilger, die im 19. Jahrhundert in Scharen ins Heilige Land kamen und sich ihm mit großer Inbrunst hingaben, träumten in aller Regel nicht davon, das Land in Besitz zu nehmen. Ähnlich erheben auch jene Juden, die in den letzten Jahren zu Zehntausenden zum Grabmal des Rabbi Nachman von Bratslav im ukrainischen Städtchen Uman pilgern, keinen Herrschaftsanspruch auf diesen Ort. Nebenbei bemerkt bereiste auch Rabbi Nachman selbst, einer der wichtigsten Neuerer des chassidischen Judentums, in den Jahren 1798 / 99 Zion, just zu dem Zeitpunkt, als sich Napoleon Bonaparte in Palästina aufhielt. Aber der Rabbi betrachtete das Land niemals als nationales Eigentum, sondern vielmehr als Zentrum einer sich ausbreitenden Energie des Schöpfers, weshalb er folgerichtig demütig in sein Geburtsland zurückkehrte, wo er später, wie erwähnt, in allen Ehren beigesetzt wurde.
Wenn aber unser Freund Simon Schama über »das Band der Erinnerung zwischen dem Land der Väter und der jüdischen Erfahrung« schreibt, widmet er sich, wie andere prozionistische Historiker auch, nicht mit dem nötigen Ernst dem jüdischen Bewusstsein. Im Grunde genommen gilt seine Absicht vielmehr einer zionistischen Erinnerung und sehr privaten Erlebnissen gleichermaßen. Im Vorwort zu seinem höchst lesenswerten Werk Der Traum von der Wildnis. Natur als Imagination erzählt der angelsächsische Historiker, wie er einst, als Schüler an einer jüdischen Schule in London, in Israel Bäume pflanzte:
Die Bäume waren unsere stellvertretenden Immigranten, die Wälder unsere Siedlungen. Und auch wenn wir davon ausgingen, dass ein Nadelwald schöner aussah als ein von Ziegen- und Schafherden kahlgefressener Hügel, waren wir doch nie ganz sicher, wozu all diese Bäume gut waren. Was wir wussten, war, dass ein Wald mit Wurzeln das Gegenteil einer Landschaft aus Treibsand war, aus nacktem Felsen und rotem Staub, den der Wind aufwirbelt. Die Diaspora war Sand. Was also sollte Israel anderes sein als ein Wald, fest verwurzelt und hoch gewachsen?21
Lassen wir für einen Moment einmal Schamas so symptomatische Ignoranz für die vielen Überreste arabischer Dörfer (mitsamt ihren Olivenhainen, den Orangenplantagen und Kakteenhecken, die sie umgaben) außer Acht, welche die Bäume des Keren Kayemet beschatten und verbergen. Doch Schama weiß besser als manch anderer, dass tief in der Scholle wurzelnde Wälder seit jeher eines der zentralen Motive der Identitätspolitik des romantischen Nationalismus in Mitteleuropa waren. Die Tatsache unerwähnt zu lassen oder gar zu leugnen, dass in der reichen jüdischen Tradition Bewaldung und Aufforstung niemals eine Antwort auf die »Wanderdünen« des Exils dargestellt haben, ist hingegen typisch für die zionistische Historiographie.
Es gab, wie gesagt, sehr wohl eine weit zurückreichende jüdische Erinnerung und Sehnsucht nach Zion, doch waren diese niemals das Streben breiter Massen nach kollektivem Eigentumsrecht über eine nationale Heimstätte. Das »Erez Israel« zionistischer und israelischer Autoren entspricht nicht im Mindesten dem Heiligen Land meiner Vorväter – der realen, nicht der mythologischen –, deren Herkunft und Leben fest mit der jiddischen Kultur Osteuropas verwoben waren. Genau wie die Juden Ägyptens, Nordafrikas oder des fruchtbaren Halbmonds hegten sie gegenüber diesem fernen und hochheiligen Ort Gefühle tiefer Ehrfurcht und Trauer. So hocherhoben über die profane Welt war dieser Ort, dass sie in all den Jahrhunderten nach ihrem Übertritt zum jüdischen Glauben niemals den Versuch unternahmen, dorthin auszuwandern, um in diesem Land zu leben. Für die meisten von ihnen, zumindest für die Mehrheit aller rabbinischen Gelehrten, die schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben, hatte Gott gegeben und wieder genommen, und erst in dem Augenblick, in dem er sich entschlösse, den Messias zu schicken, würde sich die kosmische Ordnung der Dinge ändern. Erst beim Kommen des Erlösers würden alle, die Lebenden und die Toten, im ewigen Jerusalem versammelt. Für die allermeisten von ihnen stellte jedwede Beschleunigung dieser kollektiven Erlösung ein Vergehen dar, für das diejenigen, die sich seiner schuldig machten, schwer bestraft würden. Für andere war das Heilige Land vor allem ein allegorischer, weniger ein konkreter Begriff, ein innerlicher spiritueller Zustand und nicht ein konkreter territorialer Schauplatz. Die Reaktion des jüdischen Rabbinats – des traditionell-orthodoxen wie des reformiert-liberalen gleichermaßen – auf die Geburt der zionistischen Bewegung zeugt mehr als alles andere davon.22
Was wir als Geschichte definieren, ist nicht nur eine Welt der Ideen, sondern auch Zeit und Raum menschlichen Handelns. Die überwiegende Mehrheit aller Menschen in der Vergangenheit hat keinerlei schriftliche Zeugnisse hinterlassen, so dass wir sehr wenig über ihren Glauben, ihre Vorstellungswelt und ihre Gefühle wissen, die individuelle und kollektive Handlungen bedingten. Doch zuweilen sind es gerade die schweren Stunden einer Krise oder Katastrophe, die uns einen Einblick in ihre Neigungen und Präferenzen gewähren. Als jüdische Gemeinschaften im Zuge religiöser Verfolgungen aus ihren Wohnorten vertrieben wurden, suchten sie nicht Zuflucht in ihrem Heiligen Land, sondern unternahmen alle erdenklichen Anstrengungen, um andernorts Asyl zu finden (siehe als eines der markantesten Beispiele die Vertreibung aus Spanien). Und als die moderneren und hässlicheren Bedrückungen in Gestalt der protonationalen Pogrome im Gebiet des russischen Imperiums einsetzten, wandten sich die verfolgten Juden, nun schon deutlich säkularer ausgerichtet, voller Hoffnung neuen Ufern zu. Nur die verschwindend wenigen, die von einer modernen nationalen Ideologie erfüllt waren, phantasierten von einer »alt-neuen« Heimat und wandten sich Palästina zu.23
So war die Situation auch vor und nach dem furchtbaren Genozid der Nazis: Allein die mit der einwanderungsfeindlichen Gesetzgebung von 1924 beginnende und bis in Jahr 1948 dauernde Weigerung der Vereinigten Staaten, die vom europäischen Judenhass Verfolgten aufzunehmen, ermöglichte erst die Umlenkung zahlenmäßig bedeutsamerer Flüchtlingskontingente in den Nahen Osten. Hätte es diese restriktive Immigrationspolitik nicht gegeben, wäre der Staat Israel womöglich niemals entstanden.
Die Geschichte, so hat Karl Marx einmal behauptet, neigt dazu, sich zu wiederholen: Beim ersten Mal tritt sie als Tragödie auf und beim zweiten Mal als Farce. Anfang der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts beschloss der amerikanische Präsident Ronald Reagan, den Verfolgten des Sowjetregimes, unter ihnen viele Juden, die Einwanderung in die Vereinigten Staaten zu ermöglichen. Und tatsächlich wandten sie sich in Scharen dorthin. Die israelische Regierung übte Druck aus und setzte alles daran, die amerikanischen Tore zu schließen. Da sich die Emigranten jedoch auch weiterhin nicht davon abbringen ließen, in den Westen statt in den Nahen Osten zu flüchten, wurde in Jerusalem beschlossen, sie hinters Licht zu führen und dafür auch eine wenig appetitliche Zusammenarbeit mit dem rumänischen Diktator Nicolae Ceau¸sescu in Kauf zu nehmen. Mit Hilfe von Bestechungsgeldern, die an dessen Geheimdienst Securitate und an die korrupten kommunistischen Herrscher in Ungarn flossen, wurden mehr als eine Million jüdischer Emigranten aus der Sowjetunion dazu gebracht, in ihren »angestammten Nationalstaat« auszureisen, für den sie sich überhaupt nicht entschieden hatten und in dem sie nie hatten leben wollen.24
Ich weiß nicht, ob Simon Schamas Eltern oder deren Eltern je die Wahl hatten, in das nahöstliche »Land ihrer Väter« zurückzukehren, oder nicht. Auf jeden Fall haben sie, wie die Mehrheit der jüdischen Emigranten auch, es vorgezogen, nach Westen zu ziehen und weiterhin im peinigenden »Exil« zu leben. Demgegenüber bin ich sicher, dass Simon Schama selbst jederzeit in seine »alte Heimat« hätte auswandern können. Doch er zog es vor, sich von immigrierenden Bäumen vertreten zu lassen, oder auch von Juden, die nicht das Glück gehabt hatten, es nach Großbritannien oder in die USA zu schaffen. Womit er mich an einen guten alten jiddischen Witz erinnert, in dem ein Zionist als Jude definiert wird, der einen anderen Juden um Geld bittet, um es einem dritten Juden zu geben, damit dieser nach »Erez Israel« einwandert – ein Witz, der zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Buches noch viel treffender ist als in der Vergangenheit, weshalb ich ihn in dieser Studie noch einige Male werde bemühen müssen.
Kurzum, ebenso wenig wie die Juden im ersten christlichen Jahrhundert gewaltsam aus dem Lande Judäa ins Exil getrieben wurden, kehrten sie aus freien Stücken nach Palästina und später ins Israel des 20. Jahrhunderts »zurück«. Wir alle wissen, dass es Aufgabe des Historikers ist, die Vergangenheit zu deuten, statt Prophezeiungen über die Zukunft anzustellen, womit ich also ein unnötiges Risiko auf mich nehme. Dennoch stelle ich folgende Vermutung an: Der Mythos von der Exilierung und der Heimkehr, der im 20. Jahrhundert als Folge eines nationalistisch gestimmten Antisemitismus noch virulent war, könnte sich im 21. Jahrhundert zusehends abkühlen. Diese Vorhersage ist allerdings nur unter der Voraussetzung gültig, dass der Staat Israel nicht auch weiterhin alles in seiner Macht Stehende unternimmt, damit jene Judenfeindschaft erneut erwacht und eine neue Schreckensbrut gebiert.
3. Das Land der Väter und seine Namen
In dieser Studie möchte ich unter anderem nachvollziehen, wie es zur Erfindung von »Erez Israel« – dem »Land Israel« – als sich wandelndem territorialem, der Herrschaft des »jüdischen Volkes« unterworfenem Raum gekommen ist, jenes »jüdischen Volkes«, das, wie gesagt, ebenfalls im Zuge eines ideologischen Konstruktionsprozesses erfunden wurde.25 Doch bevor ich meine theoretische Reise in die Tiefen dieses geheimnisvollen Fleckchens Erde beginne, das die westliche Welt seit Urzeiten fasziniert, muss ich die Aufmerksamkeit auf das Thema des terminologischen Mechanismus lenken, der diesen Ort fest umklammert hält. Denn ähnlich wie in einigen anderen nationalen Sprachkulturen finden sich auch im zionistischen Fall semantische, von Anachronismen geprägte Manipulationen, die einen konsequenten kritischen Diskurs erschweren.
Ich werde an dieser Stelle nur ein zentrales Beispiel aus diesem problematischen historischen Wortschatz anführen. Der Begriff »Erez Israel« – »Land Israel« –, der bekanntermaßen niemals, auch heute nicht, deckungsgleich mit dem Gebiet des Staates Israel war, dient in der hebräischen Sprache bereits seit vielen Jahren als Standardbezeichnung für die Region zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan und umfasste in noch nicht allzu ferner Vergangenheit zudem Gebiete östlich des Flusses. Dieser liquide Begriff diente als Navigationsinstrument und Stimulanz für die territorialen Phantasien des zionistischen Siedlungsprojekts seit seinen Anfängen vor über hundert Jahren. Für jemanden, der nicht in und mit der hebräischen Sprache lebt, ist es schwer, das Gewicht und die Bedeutung dieses Begriffes im israelischen Bewusstsein voll zu erfassen. Von Schulbüchern bis zu Promotionsschriften, von Romanen bis zu gelehrten historiographischen Studien, von Lyrik und Liedgut bis hin zu politischer Geographie – dieser Begriff dient bis auf den heutigen Tag als eine Art rhetorischer Code, der sowohl sämtliche Verästelungen des kulturellen Schaffens wie auch all die vielen politischen Sensibilitäten in Israel zusammenführt.26
In den Regalen der Buchhandlungen und den Universitätsbibliotheken stehen Seite an Seite gewichtige Werke über Das prähistorische Erez Israel, über Erez Israel zur Zeit der Kreuzfahrerherrschaft oder über Erez Israel unter arabischer Okkupation etc. Wenn ausländische, fremdsprachige Bücher ein hebräisches Gewand erhalten, wird in ihnen systematisch »Palästina« zu »Erez Israel«. Selbst die Schriften der großen zionistischen Vordenker wie Theodor Herzl, Max Nordau, Ber Borochov und vieler anderer, die – wie die meisten ihrer Anhänger – die gebräuchliche, allgemein akzeptierte Bezeichnung »Palästina« verwendeten, gingen in ihrer hebräischen Übersetzung dieses Tabubegriffs verlustig, an dessen Stelle stets ein »Erez Israel« trat. Diese Sprachregelung erzeugt zuweilen amüsante Absurditäten: Oftmals versteht der naive israelische Leser nicht, warum in der großen Kontroverse, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der zionistischen Bewegung um die Bevorzugung Ugandas vor Palästina geführt wurde, die zahlreichen Gegner dieses Plans »Palästinenser« oder »Palästinozentristen« genannt wurden.
Es finden sich sogar prozionistische Historiker, die versuchen, den Begriff »Erez Israel« auch in anderen Sprachen salonfähig zu machen. So etwa Simon Schama, der dem kolonisatorischen Werk der Familie Rothschild begeistert ein Denkmal setzt und dem Buch den Titel Two Rothschilds and the Land of Israel gibt.27 Wobei daran zu erinnern ist, dass in dem fraglichen Zeitraum der Begriff »Palästina« nicht nur in allen europäischen Sprachen gang und gäbe war, sondern auch von allen jüdischen Protagonisten verwendet wurde, die Schamas Buch bevölkern. Und Bernard Lewis, ein nicht minder bekannter britisch-amerikanischer Historiker und weiterer getreuer Verehrer des zionistischen Projektes, übertrifft Schama sogar noch. In einem gelehrten Aufsatz, in dem es ihm darum geht, den historischen Gebrauch des Ausdrucks »Palästina« nach Kräften herunterzuspielen, erklärt Lewis mit wissenschaftlicher Selbstgewissheit, diese Bezeichnung sei »unter den Juden niemals in Gebrauch gewesen, für sie war der überlieferte Name des Landes seit dem Auszug aus Ägypten und bis in unsere Tage immer nur ›Erez Israel‹«.28
Kein Wunder, dass jüdische Israelis überzeugt sind, dass diese eindeutige Bezeichnung, die den Eigentümer des Landes klar benennt, beinahe ewig sei und mindestens schon seit der göttlichen Verheißung existiere. Wie ich bereits in einem anderen Buch und in anderem Wortlaut geschrieben habe, denken Hebräisch sprechende Zeitgenossen weniger den Mythos »Erez Israel«, als dass das mythologische Land Israel sich selbst durch sie erdenkt und nebenbei die Vorstellung von einem nationalen Raum erschafft, deren politische und moralische Auswirkungen man sich nicht immer voll bewusst macht.29 Die Tatsache, dass seit 1948 keine territoriale Deckungsgleichheit zwischen dem »Land Israel« und der Fläche des Staates Israel mehr besteht, veranschaulicht klar die geopolitische Mentalität und das Bewusstsein von der Grenze – oder genauer gesagt von der nicht vorhandenen Grenze –, die eine deutliche Mehrheit der jüdischen Israelis teilt.
Zuweilen jedoch kann die Geschichte recht ironische Züge annehmen, insbesondere auf dem Feld der Erfindung von Traditionen oder sprachlicher Überlieferungen. Wenige nur machen sich klar oder sind bereit zuzugeben, dass das Erez Israel der Bibel nicht Jerusalem, Hebron, Betlehem und deren Umgebung umfasste, sondern nur Samaria und einige angrenzende Landstriche, sprich: das Territorium des Nordreichs Israel!
Da niemals ein vereintes Reich der Könige Israels und jener des Südreiches Juda existierte, gab es auch keine hebräische Bezeichnung für das gemeinsame Territorium, weshalb in allen Schriften der hebräischen Bibel die pharaonische Bezeichnung der Region beibehalten wurde – »Erez Kna’an«, das Land Kanaan.30 Gott versprach Abraham, dem ersten Konvertiten zum Judentum: »Dir und deinen Nachkommen gebe ich ganz Kanaan, das Land, in dem du als Fremder weilst, für immer zu eigen …« (Genesis 17,8). Und im selben väterlichen, aufmunternden Tonfall fährt er später fort und befiehlt Mose: »Geh hinauf in das Gebirge Abarim, das du vor dir siehst, steig auf den Berg Nebo, der in Moab gegenüber Jericho liegt, und schau auf das Land Kanaan …« (Deuteronomium 32,48 f.). Insgesamt kommt dieser populäre Name in 57 Versen vor.
Jerusalem dagegen lag schon immer im Lande Judäa, und diese geopolitische Bezeichnung, die sich infolge der Gründung des kleineren Königreichs durch das Haus David etablierte, findet 24 Mal Erwähnung. Niemand von den Autoren der biblischen Texte wäre jemals auf die Idee gekommen, das Territorium rings um die Stadt Gottes mit der Bezeichnung »Land Israel« zu belegen. Deshalb heißt es etwa im 2. Buch der Chronik: »Er riss überall auf ihren Plätzen die Altäre nieder, zerstörte die Kultpfähle, zermalmte die Götzenbilder und zertrümmerte die Rauchopferaltäre im ganzen Land Israel. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück« (34,7). Das Land Israel beheimatete bekanntermaßen deutlich mehr Sünder als das Königreich Judäa und taucht dementsprechend in elf weiteren Versen auf, zumeist mit wenig freundlichen Konnotationen. Letztendlich entspricht die Art und Weise, wie die Verfasser der Bibel das in Frage stehende Territorium auffassen, der Wahrnehmung in anderen Zeugnissen des Altertums – in keinem Text oder einem anderweitigen archäologischen Fundstück findet sich die Bezeichnung »Land Israel« für einen allgemein bekannten geographischen Raum.
Diese Regel gilt auch in Bezug auf die lange Epoche, die von der israelischen Geschichtsschreibung als die Zeit des Zweiten Tempels bezeichnet wird: Der erfolgreiche Aufstand der Hasmonäer in den Jahren 167 bis 160 v. u. Z. und die gescheiterte Erhebung der Zeloten in den Jahren 66 bis 73 u. Z. fanden, sämtlichen schriftlichen Zeugnissen zufolge, keineswegs im »Land Israel« statt. Vergebens suchen wir diesen Begriff in den Makkabäerbüchern oder den anderen deuterokanonischen Schriften der hebräischen Bibel.31 Umsonst mühen wir uns, ihn in den philosophischen Abhandlungen Philos von Alexandria oder in den historischen Werken des Flavius Josephus zu finden. Solange in irgendeiner Form ein judäisches Königreich existierte, souverän oder unter dem Schutz einer anderen Macht stehend, war das Territorium zwischen dem Meer und dem Jordan keinesfalls unter dem Markennamen »Land Israel« bekannt!
Die Namen von Regionen und Ländern haben sich in der Vergangenheit häufig gewandelt. Zuweilen ist es üblich, Länder des Altertums mit Namen zu bezeichnen, die ihnen erst in späteren Zeiten angeheftet wurden. Doch diese sprachliche Praxis findet in aller Regel nur dann Anwendung, wenn für den nämlichen Ort kein bekannter, allgemein akzeptierter Name vorliegt. Jeder von uns weiß zum Beispiel, dass Hammurabi nicht über das Gebiet des heutigen Irak herrschte, sondern über Babylon, dass Julius Cäsar nicht das ganze große Frankreich eroberte, sondern nur Gallien. Demgegenüber sind sich nur wenige Israelis bewusst, dass David, der Sohn Isais, oder König Joschija über einen Ort herrschten, der Kanaan oder Judäa hieß, und dass sich der kollektive Freitod auf der Bergfeste Masada mitnichten im Land Israel zugetragen hat.
Wie dem auch sei – diese »schlimme« semantische Vergangenheit hat israelische Historiker nicht im mindesten gestört. Hemmungslos und ohne zu zögern replizieren sie immer wieder diesen sprachlichen Anachronismus. Ihren national-wissenschaftlichen Standpunkt hat seinerzeit Jehuda Elitzur, angesehener Professor für Bibelwissenschaften und historische Geographie an der Bar-Ilan-Universität, auf den Punkt gebracht. Mit seltener Freimütigkeit schrieb er:
Nach unseren Vorstellungen ist unser Verhältnis zum Lande Israel nicht ohne weiteres mit dem Verhältnis anderer Völker zu ihrer Heimat gleichzusetzen. Die Unterschiede lassen sich leicht benennen. Israel war Israel, auch vor seinem Einzug in das Land. Israel war Israel, auch viele Generationen nach seinem Auszug ins Exil, und dieses Land blieb das Land Israel auch als unbewohnte Wüstenei. Dieses gilt nicht für andere Völker. Es gibt keine Engländer, es sei denn, sie sind in England, und es gibt kein England, es sei denn, es wird von Engländern bewohnt. Engländer, die England verlassen, werden in ein oder zwei Generationen aufgehört haben, Engländer zu sein. Und würde England von allen Engländern entvölkert werden, würde es aufhören, England zu sein. Entsprechendes gilt für alle anderen Völker.32
So wie das Volk eine ewige, unveränderliche »Ethnie« ist, so ist auch das Land eine feste, unveränderliche Wesenheit, was ebenso für seinen Namen gilt. In allen Interpretationen der oben erwähnten alten Texte, sowohl der hebräischen Bibel als auch der Schriften aus der Zeit des Zweiten Tempels, wird das Land Israel als klar umgrenztes, beständiges, in jeder Generation und jeder Epoche allgemein bekanntes und anerkanntes Territorium präsentiert. Ich werde einige Beispiele anführen, um zu veranschaulichen, worum es mir geht.
In der hebräischen Neuübersetzung des 1. Makkabäerbuchs, die im Jahre 2004 in einer Prachtausgabe erschien, taucht der Begriff »Erez Israel« in dem aktuellen Vorwort und den Anmerkungen insgesamt 156 Mal auf, obgleich die Hasmonäer selbst mit Sicherheit nicht wussten, dass sie ihren Aufstand in einem territorialen Raum solchen Namens führten. Noch kühner zeigte sich ein Historiker von der Hebräischen Universität in Jerusalem, der ein wissenschaftliches Werk unter dem Titel The Land of Israel as a Political Concept in Hasmonean Literature veröffentlichte, ungeachtet der Tatsache, dass dieses »Konzept« in besagtem Zeitraum überhaupt nicht existierte. Und in nicht allzu ferner Vergangenheit wurde der geo-nationale Mythos noch derart heiß gehandelt, dass die Herausgeber der Schriften von Flavius Josephus es sogar wagten, den Begriff »Erez Israel« den hebräischen Übersetzungen direkt einzupflanzen.33