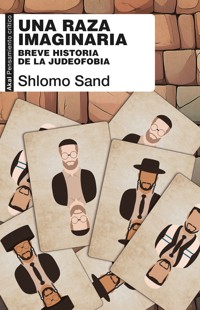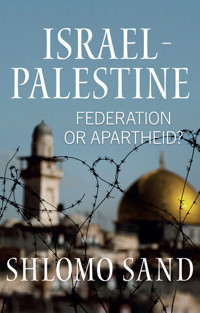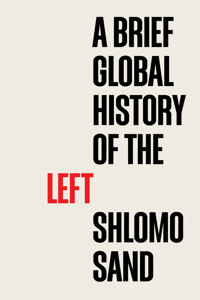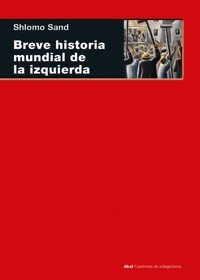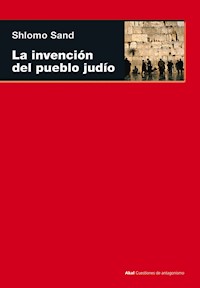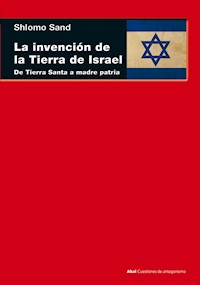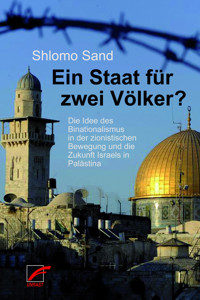
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der renommierte israelische Historiker Shlomo Sand gibt einen komprimierten Überblick über die Idee des Binationalismus in der zionistischen Bewegung seit dem späten 19. Jahrhundert. Die frühen binationalen Zionisten traten für ein jüdisches kulturelles und geistiges Zentrum in Abstimmung mit den palästinensischen Araber:innen ein und warnten vor dem Ziel des politischen Zionismus eines Theodor Herzl, einen ausschließlich jüdischen ethnischen Nationalstaat schaff en zu wollen. Obwohl der Binationalismus nie eine politische Kraft von großem Gewicht war, ist er dennoch eine Option, die immer mehr Menschen anspricht, die für Gleichheit und Menschenrechte in Israel/Palästina kämpfen. Weiterhin untersucht Shlomo Sand, inwieweit die Idee des Binationalismus im Denken einiger arabischpalästinensischer Intellektueller verfängt und findet dort diskutierenswerte Ansätze. Er ist sich dabei völlig im Klaren, dass er eine Minderheitenposition sowohl in Bezug auf den jüdischen als auch den arabischen Mainstream vertritt. Nichtsdestotrotz argumentiert er angesichts der Alternativen von Vertreibung oder Apartheid ähnlichen Besatzungsverhältnissen dafür, Israel neu zu denken, denn die sog. Zweistaatenlösung hält er für ein vollkommen unrealistisches Feigenblatt der internationalen Politik. Neben den diskutierten Möglichkeiten eines binationalen Bundesstaates oder eines einheitlichen säkularen demokratischen Staates streitet Sand schließlich für die Idee einer Konföderation von zwei oder mehr kulturellen Einheiten, die eine gemeinsame Souveränität und Staatsbürgerschaft haben, aber kulturelle und sprachliche Besonderheiten, autonome Regierungsorgane, gewählte Versammlungen usw. Als Beispiele und Ideengeber dienen ihm dafür Länder wie Belgien, Kanada, die Schweiz, Großbritannien, Spanien, Indien, Bosnien-Herzegowina und andere.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
»Ohne Illusionen und mit Klarheit und Ehrlichkeit taucht dieser israelische Historiker in die Vergangenheit ein, um einen kritischen Strang innerhalb der zionistischen Bewegung selbst aufzugreifen, der immer marginal war, aber nie verschwunden ist und dessen Warnungen sich in der gegenwärtigen katastrophalen Situation als richtig erwiesen haben. Dieser marginale Strang taucht jetzt wieder auf, und es besteht die Möglichkeit, dass er, so fern es auch scheint, zu einem sehr dünnen Ariadnefaden der Hoffnung werden könnte, der die beiden Völker durch das gegenwärtige dunkle und unheilvolle Labyrinth in eine alternative Zukunft führt.«
Jewish Voice for Labour
Shlomo Sand, emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Tel Aviv, geboren 1946 in Linz, ist bekannt für seine streitbaren Thesen zur Geschichte Israels und des Zionismus. Sein Bestseller Die Erfindung des jüdischen Volkes löste 2010 hitzige Kontroversen nicht nur unter israelischen und jüdischen Historiker:innen aus. Sand bezeichnet sich selbst als Postzionist, lehnt sowohl Zionismus als auch Antizionismus ab. Er streitet für das Existenzrecht Israels, will aber »den Zionismus als Charakteristikum des Staates Israel abschaffen«.
Shlomo Sand
Ein Staat für zwei Völker?
Die Idee des Binationalismus in der zionistischen Bewegung und die Zukunft Israels in Palästina
Aus dem Englischen übersetzt vom Jona Dieterson Kollektiv
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Shlomo Sand:
Ein Staat für zwei Völker?
1. Auflage, März 2025
eBook UNRAST Verlag, September 2025
ISBN 978-3-95405-234-9
© UNRAST Verlag, Münster 2025
Fuggerstraße 13 a, 48165 Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Titel der Originalausgabe:
Deux peuples pour un État? Relire l’histoire du sionisme
Erstveröffentlichung: Éditions du Seuil, 2023
Copyright © 2023 Shlomo Sand
Übersetzt nach der aktualisierten und erweiterten engl. Ausgabe:
Israel – Palestine. Federation or Apartheid?, Polity Press 2024
Copyright © 2024 Shlomo Sand
Alle Rechte vorbehalten
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, der Übersetzung sowie der Nutzung des Werkes für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: UNRAST Verlag, Münster
Satz: UNRAST Verlag, Münster
Inhalt
Vorwort
1. Das »Land der Vorfahren« oder das Land der Einheimischen?
Das Land der Vorfahren
Zur Nation
Ethnozentrismus
Binationalismus?
2. »Wenn ein Knecht zur Herrschaft kommt«: Die verborgene Frage
Liebhaber der Anderen?
Ein spirituelles Zentrum?
Den Anderen ignorieren
3. Der Friedensbund gegen die ›Eiserne Mauer‹
Die Anfänge der Allianz
Die ›Extremisten‹-Fraktion
Hans Kohn und das Ende der Allianz
4. Martin Buber, Hannah Arendt und das ungeteilte Land
Vom ›völkischen Denken‹ zum »Ich und Du«
Auf dem Weg zur binationalen Idee
Hannah Arendt und der Antisemitismus
Ein jüdischer Nationalstaat?
5. Theopolitik und die pazifistische Ihud
Der unruhige Amerikaner
Der prophetische Kanzler
Ihud (Einheit)
Der letzte Mohikaner
6. Die Linke und die »Brüderlichkeit zwischen den Völkern«
Zionistischer Marxismus
Kommunist:innen in Palästina
Das Ende einer Idee
7. Die Semitische Aktion und eine arabisch-hebräische Föderation
Der ›kanaanitische‹ Hintergrund
Eine ›semitische‹ Linke?
Das Hebräische Manifest
8. 1967 – Ein zu teilendes oder ein zu vereinigendes Land?
Drei Petitionen
Menachem Begin gegen die Apartheid
Die Notlage der weißen Sabra
Risse auf der linken Seite
Die Desillusionierung geht weiter
Erhöhte Sensibilität
9. »Mit einer Hand kann man nicht klatschen«
Neugierde und Versöhnung
Die palästinensische Nationalidee
Ein einziger demokratischer Staat?
Das binationale Paradigma
10. Die Alternativen: Apartheid, Umsiedlung oder eine binationale Lösung?
Das Heimatland dehnt sich aus
Die neuen Pioniere
Hegemonie vor Ort
Stychia und Katastrophe
Die verborgene Option
Denkbare Möglichkeiten
Utopien und Kalamitäten
Nachwort
Anmerkungen
Vorwort
»Es gibt hier einen Apartheidstaat. Wenn in einem Gebiet zwei Menschen nach zwei unterschiedlichen Rechtssystemen behandelt werden, ist das ein Apartheidstaat.«
Tamir Pardo, ehemaliger Leiter des Mossad, Interview mit Associated Press, 6. September 2023.
Gegen Ende des Jahres 1967, kurz nach meiner Rückkehr von den Kämpfen in Jerusalem, wurde ich zum politischen Aktivisten. Von diesem Zeitpunkt an begann ich, an die Mauern von Tel Aviv »Nieder mit der Besatzung« zu sprühen. Seit diesen Tagen habe ich bis vor Kurzem – also ein halbes Jahrhundert lang – hartnäckig die Idee vertreten, dass ein palästinensischer Staat an der Seite Israels in den Grenzen von 1967 zu gründen sei. Das gleiche Recht auf Selbstbestimmung für beide Völker, die im Laufe eines gewaltsamen und äußerst schmerzhaften Prozesses das Land zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan besiedelt haben – das war mein Leitprinzip. Als Soldat und als Bürger musste ich meine anti-kolonialen Ideen in meinem Alltag umsetzen: So wie ich dafür gekämpft hatte, dass Israel ein Staat für alle israelischen Bürger:innen (aber nicht für alle jüdischen Menschen auf der ganzen Welt) wird, so wünschte ich mir von ganzem Herzen, dass daneben auch eine unabhängige palästinensische Republik entstehen würde.
Im Laufe der vergangenen Jahre hat Israel seine Stellung in den besetzten Gebieten weiter ausgebaut. Tausende Israelis haben sich in der Nähe von palästinensischen Dörfern und Städten niedergelassen. Immer mehr Siedler:innen haben viel Land zu niedrigen Preisen erworben, das in ihren Besitz übergegangen ist, und sie befahren ein Straßennetz, das ausschließlich ihnen vorbehalten ist. Gewalttätiger Widerstand war die Antwort der lokalen Bevölkerung auf Unterdrückung und die Verweigerung von Grundrechten, was wiederum zu immer stärkerer Repression führte.
Die erste Intifada im Jahr 1987, die schließlich zu den Osloer Verträgen von 1993 führte, weckte neue Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Konflikts. Viele glaubten, dass Premierminister Yitzhak Rabin die Siedlungen räumen und Israel in die Grenzen von 1967 zurückkehren würde. Aber das enorme Machtgefälle zwischen beiden Seiten verhinderte eine ernsthafte und ausgewogene Einigung; die Gewalt flammte erneut auf, während die Kolonisierung weiterging.
Das linke Lager, dem ich mich angeschlossen hatte, forderte beständig die Räumung aller 1967 besetzten Gebiete, in der Hoffnung, dass die Israelis einsehen würden, dass sie ihr Land logischerweise nicht auf Kosten anderer erweitern und gleichzeitig in Frieden mit ihnen leben können. Wir haben zahlreiche Artikel verfasst, Hunderte von Demonstrationen organisiert und auf vielen Treffen und öffentlichen Versammlungen gesprochen. Und nichts davon hat funktioniert! Das demografische Gleichgewicht verschob sich immer weiter, und die israelische Präsenz im Westjordanland, insbesondere in dem ausgedehnten Gürtel um al-Quds, der offiziell an Israel angegliedert wurde, wurde von 875.000 neuen Siedler:innen besiedelt. Vier Minister der jetzigen Regierung leben in Siedlungen im Westjordanland, ebenso wie eine Reihe hoher Staatsbeamter (wie bspw. der Generalstabschef). Parallel dazu sind die öffentlichen Haushaltsmittel für die Siedlungen in nie dagewesene Höhen geschnellt.
Im Jahr 2023 gab es Massenproteste gegen die willkürlichen antiliberalen Maßnahmen der neuen Regierung, aber die Demonstrant:innen kritisierten nicht die Präsenz Israels in den besetzten Gebieten. In den öffentlichen Aufrufen zur Verteidigung der israelischen Demokratie wurde nicht erwähnt, dass Millionen von Palästinenser:innen seit sechsundfünfzig Jahren unter einem Militärregime leben und ihrer politischen sowie ihrer Bürgerrechte beraubt sind. Noch schlimmer ist, dass die Palästinenser:innen unter der Besatzung an der Seite der Siedler:innen in einem System leben müssen, das sich immer mehr zu einem Apartheidsystem entwickelt. Es ist ihnen verboten, in den Siedlungen zu leben; sie dürfen dort nur arbeiten. Es ist ihnen untersagt, sich mit Jüd:innen zu verheiraten und sie können keine israelische Staatsbürgerschaft beantragen. Die vielen palästinensischen Arbeiter:innen, die täglich die alten Grenzen überqueren, um unter schlechten Bedingungen in der israelischen Wirtschaft zu arbeiten, müssen vor Einbruch der Dunkelheit in ihre Häuser zurückkehrt sein.
Und dann kam der 7. Oktober über den jüdischen Staat, mit dem brutalen Angriff der Hamas auf an Gaza angrenzende Orte. Dieses schreckliche Massaker weist Ähnlichkeiten mit dem Massaker von Sabra und Schatila von 1982 auf, das von christlichen Phalangisten verübt wurde, während die israelischen Verteidigungskräfte unter Ariel Sharon tatenlos zusahen und das Massaker geschehen ließen. Es war derselbe Ariel Sharon, der später, im Jahr 2005, den Gazastreifen räumte und zum Aufstieg der Hamas an die Macht beitrug, was zur tiefen Spaltung der palästinensischen Führung beitrug.
Der 7. Oktober war für die israelische Öffentlichkeit ein absoluter Schock. Zwar wurde der Gazastreifen belagert, und die Lebensqualität war nach wie vor unerträglich, aber die israelischen Siedlungen waren von Sharon geräumt worden und längst verschwunden. Außerdem fehlte im Gazastreifen, anders als im Westjordanland, die bedrückende Präsenz einer ausländischen Armee. Woher kam also dieser rasende Hass, der sich in solch schrecklichen Kriegsverbrechen äußerte?
Für viele Israelis war es bequem, das Massaker mit dem traditionellen Hass des Islam auf das Judentum zu erklären und damit die lange Geschichte der muslimisch-jüdischen Beziehungen seit den Kreuzzügen und Salah ad-Din zu ignorieren. Andere beeilten sich zu argumentieren, dass das Judentum immer und überall auf der Welt grundlos gehasst wurde und werde und dass der 7. Oktober so etwas wie ein verkappter Holocaust gewesen sei.
1956 hielt Moshe Dayan, der damalige israelische Generalstabschef, eine Laudatio auf einen gefallenen israelischen Soldaten, der von Aufständischen aus dem Gazastreifen grausam ermordet worden war. Er sagte: »Wir sollten heute nicht die Schuld auf die Mörder schieben. Warum sollten wir ihren brennenden Hass auf uns erklären? Seit acht Jahren sitzen sie in den Flüchtlingslagern im Gazastreifen, und wir haben vor ihren Augen das Land und die Dörfer, in denen sie und ihre Väter lebten, in unser Eigentum verwandelt.«[1] Nicht viele israelische Führungspersönlichkeiten haben es je gewagt, das in solcher Klarheit auszusprechen.
Ahmad Yasin, der Gründer und geistige Führer der Hamas, wurde 1936 in al-Jura geboren, einem Dorf, das einst an der Stelle stand, an der sich heute die israelische Stadt Aschkelon befindet. Nachdem seine Eltern 1950 nach Gaza vertrieben worden waren, wuchs er im Flüchtlingslager al-Shati auf. Ismail Haniyya, seit dem 7. Oktober Chef des politischen Büros der Hamas[2], ist 1963 in demselben Lager geboren. Auch seine Eltern waren 1950 aus al-Jura vertrieben worden, als es geräumt und anschließend an Aschkelon angegliedert wurde. Jahia Sinwar, seit dem 7. Oktober militärischer Führer der Hamas[3], wurde 1962 im Flüchtlingslager Chan Junis geboren. Seine Eltern waren 1950 aus al-Majdal vertrieben worden, das später ebenfalls Teil von Aschkelon wurde. Die Geschichten dieser Anführer sind nicht ungewöhnlich, ebenso wenig wie die anderer Anführer. Mehr als 60 Prozent der aktuell zwei Millionen Einwohner:innen des Gazastreifens sind Nachkommen von Geflüchteten, die nach 1948 aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben wurden und seitdem in Lagern leben.
In gewisser Weise erinnerte das Massaker vom 7. Oktober indirekt an die Folgen der Nakba, die vor 75 Jahren stattfand. Mehr noch als die Besetzung von 1967 liegen die Ursprünge des Hasses der Palästinenser:innen und des langen schmerzhaften Konflikts im Jahr 1948. Kann unter diesen Umständen ein ausschließlich jüdischer Staat im Nahen Osten überhaupt jemals eine sichere Zukunft haben? Die einzige Antwort, die die israelische Regierung bislang auf den verheerenden Schlag gab, war ein Rachefeldzug, der keine klaren politischen Ziele verfolgt und wohl ebenso grausam ist wie der 7. Oktober. Eine Lösung des blutigen Konflikts scheint in weiterer Ferne denn je.
Während ich dieses Vorwort schreibe, sind mir die unmittelbaren Folgen der jüngsten Katastrophe noch unbekannt. Die Feindseligkeit zwischen beiden Seiten hat sich nur noch verschlimmert, und die Besatzung des palästinensischen Volkes ist nach wie vor unnachgiebig und hartnäckig. Währenddessen gibt die Welt Lippenbekenntnisse zu der Idee ab, dass irgendwann in der Zukunft ein palästinensischer Staat anerkannt werden könnte. Was von der israelischen Linken übrig geblieben ist, skandiert weiterhin das hohle Mantra »zwei Staaten für zwei Völker«, ohne wirklich die Absicht zu haben, dies zu verwirklichen. Die Palästinensische Autonomiebehörde, die völlig von der israelischen Macht abhängig ist und keine wirkliche Unterstützung in der Bevölkerung genießt, macht die traurige Komödie dieser leeren Formel mit und trägt zu dieser unerträglichen Situation ebenso mit bei, obwohl sie genau weiß, dass Israel niemals die Absicht haben kann, eine echte palästinensische Souveränität anzuerkennen.
Diese Situation, in der ein hohler, abstrakter politischer Diskurs mit der Realität einer binationalen Situation zusammentrifft, hat mich veranlasst, dieses Buch zu schreiben. Als ich es schrieb, war ich sehr skeptisch, ob es jemals zu einer egalitären israelisch-palästinensischen Föderation kommen würde, und ich ringe immer noch mit vielen theoretischen Zweifeln. Mein Ausflug in die verborgenen Ecken der ideologischen Vergangenheit des Zionismus hat mir jedoch einige Überraschungen beschert. Als ich mit dem Schreiben begann, hatte ich keine Ahnung, dass die großen Denker der pazifistischen Strömungen innerhalb des Zionismus und diejenigen, die in engem Kontakt mit ihnen standen, die Idee eines ausschließlichen jüdischen Staates in einem überwiegend von Araber:innen bevölkerten Land abgelehnt und stattdessen Bestrebungen zum Aufbau einer binationalen politischen Einheit unterstützt hatten. Über Generationen hinweg, von Achad Ha’am, einem der Begründer des spirituellen Zionismus am Ende des 19. Jahrhunderts, über Gershom Scholem, Martin Buber und Hannah Arendt bis hin zu dem berühmten Schriftsteller A. B. Yehoshua, war die intellektuelle Elite besorgt, dass die Zukunft eines kleinen jüdischen Sparta im Krieg mit einem feindlichen Nahen Osten keineswegs gesichert war. Sie glaubten, dass nur eine egalitäre Integration im Rahmen eines gemeinsamen Staates gewährleisten würde, dass Israel zu einem sicheren Hafen für alle seine Bewohner:innen werden könnte.
Ich bin sehr skeptisch, ob das, was eigentlich eine binationale Existenz ist, in einem föderalen Gebilde nach dem Vorbild der Schweiz, Belgiens, Kanadas oder ähnlicher Staaten verkörpert werden kann. Die jüngsten Entwicklungen und die wachsende Symbiose zwischen Religion und radikalem Nationalismus auf beiden Seiten sind der Entstehung eines Kompromisses und einer politischen Integration kaum förderlich. Es scheint, dass die Region dazu verdammt ist, noch eine Reihe von Katastrophen erleben zu müssen, bevor Vernunft, Gleichheit und Gerechtigkeit in ihr Fuß fassen können. Doch wie Theodor Herzl, der Erfinder der zionistischen Idee, einmal schrieb: »Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen.«[4]
1. Das »Land der Vorfahren« oder das Land der Einheimischen?
»Identität ist das, was wir vererben, nicht das, was wir erben, was wir erfinden, nicht das, woran wir uns erinnern.«
Mahmoud Darwish, »Von nun an bist du nicht mehr du selbst«
»Die Menschen schreiben an das Tor ihres Hauses: ›Kein Zutritt für Fremde‹, dabei sind sie selbst Fremde in ihrem Haus.«
Yehuda Amichai, »Vier Auferstehungen in der Emek-Rephaim-Straße«
Wladimir Jabotinsky wird in der politischen Tradition wie in der Geschichtsschreibung als Gründervater der zionistischen Rechten angesehen. Er war ein eigenwilliger und kompromissloser Denker, der seinen zahlreichen Gegner:innen innerhalb der jüdischen Nationalbewegung nie einen Fußbreit nachgab. Im Jahr 1923 schrieb er (auf Russisch) den Aufsatz »Die eiserne Mauer«, der bis heute als die wichtigste Zusammenfassung seiner Standpunkte in Bezug auf Palästina gilt. Im Gegensatz zu den meisten zionistischen Anführern, die oft aus dem linken Lager stammten, weigerte sich Jabotinsky stets, seine Worte scheinheilig und heuchlerisch zu verpacken. Seiner Ansicht nach kündigte die Ankunft der Jüd:innen in Palästina ganz klar ein koloniales Unterfangen an, das unbestreitbar mit anderen Kolonisationen in der Geschichte vergleichbar sei. »Meine Leser haben eine ungefähre Vorstellung von der Geschichte der Kolonisierung anderer Länder«, schreibt er. »Ich schlage vor, dass Sie alle Ihnen bekannten Präzedenzfälle prüfen und feststellen, ob es auch nur einen einzigen Fall gibt, in dem eine Kolonisation mit Zustimmung der einheimischen Bevölkerung durchgeführt wurde. Es gibt keinen solchen Präzedenzfall.«[5] Nach Ansicht dieses zukünftigen Anführers der nationalistischen Rechten unterschieden sich die Zionist:innen nicht von den spanischen Erober:innen in Südamerika oder den puritanischen Siedler:innen in Nordamerika. So wie sich die Indigenen an anderen Orten mit aller Kraft gegen die Kolonisierung ihres Landes durch Fremde wehrten, ist es nur logisch, dass sich die Araber:innen Palästinas gegen die zionistische Kolonisierung wehrten, und es ist zu erwarten, dass sich dieser Widerstand fortsetzen wird.
Für Jabotinsky bedeutete dies jedoch nicht, dass der Zionismus unmoralisch wäre. In einem ergänzenden Essay legt er ein Argument dar, das er für entscheidend hält: Von Marokko bis Mesopotamien verfügten die Araber:innen über riesige Landflächen, während die Jüd:innen nicht das geringste Territorium besäßen.
»Der Boden gehört nicht denen, die im Übermaß Land besitzen, sondern denen, die keines besitzen. Es ist ein Akt einfacher Gerechtigkeit, jenen Nationen, die zu den größten Landbesitzern der Welt zählen, einen Teil ihres Landes zu enteignen, um einem heimatlosen, umherziehenden Volk einen Zufluchtsort zu bieten. Und wenn sich ein solches Großgrundbesitzervolk wehrt – was ganz natürlich ist –, muss es durch Zwang gefügig gemacht werden.«[6]
Jabotinsky sagt jedoch ausdrücklich, dass dies aber keineswegs die Vertreibung der angestammten Bevölkerung bedeute: »Ich halte es für völlig unmöglich, die Araber aus Palästina zu vertreiben.« Wo zwei Völker lebten, müsse das wandernde Volk sich eine Position der militärischen Überlegenheit – eine »eiserne Mauer« – sichern, um sich gegenüber den Einheimischen durchzusetzen, die sich weigerten, es auf ihrem Territorium willkommen zu heißen.
Die meisten Zionist:innen waren sich sehr wohl bewusst, dass der von Israel Zangwill zu Beginn des 20. Jahrhunderts geprägte christlich-evangelistische Slogan »Palästina ist ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land« falsch und irreführend war. Nicht weniger bedeutsam ist die Tatsache, dass sich Jabotinsky in seinem Gründungstext weder auf ›historische Rechte‹ berief, um das Land zu beanspruchen, noch behauptete, dass es nicht den einheimischen Araber:innen gehöre. Im Jahr 1923 wussten viele gebildete Zionist:innen sehr wohl, dass es in der Antike keinen Massenexodus der einheimischen Bevölkerung oder gar eine nennenswerte Auswanderungswelle gegeben hatte. Die Dominanz der jahrhundertealten christlichen Doxa an das Exil der ›Jüdischen Rasse‹, die verflucht sei, weil sie an der Kreuzigung Jesu mitgewirkt habe, hatte dennoch ihre Spuren im beschämten Judentum hinterlassen, das sich schon immer in Erwartung der Ankunft des Messias als zum (eher metaphysischen als geografischen) Exil verurteilt sah. Es sei auch daran erinnert, dass die Jüdi:nnen während ihrer langen und schmerzhaften religiösen Geschichte nicht die weltliche Bibel voller Heldengeschichten gelesen haben, sondern den Talmud, das Buch des Gesetzes, das weder an eine bestimmte Zeit noch an einen bestimmten Ort gebunden ist und das sich von der Anwendung von Gewalt distanziert.
Von Israel Belkind, einem der allerersten Pioniere, die 1882 in Palästina ankamen, bis zu David Ben-Gurion, der 1948 den Staat Israel gründete, gab es viele, die es für wahrscheinlich hielten, dass die einheimische Landbevölkerung aus Nachfahren der alten Hebräer bestehe, was es absolut inakzeptabel gemacht hätte, ihre Anwesenheit zu leugnen oder sie zu entwurzeln. Belkind war zeitlebens davon überzeugt, dass die Bewohner:innen Palästinas »ein bedeutender Teil unseres Volkes […], Knochen von unseren Knochen und Fleisch von unserem Fleisch« seien.[7] Ben-Gurion und Yitzhak Ben-Zvi (der spätere Präsident des Staates Israel) bestanden bereits 1918 mit Nachdruck darauf:
»Die Bauern stammen nicht von den arabischen Invasoren ab, die im 7. Jahrhundert Eretz Israel und Syrien eroberten. Die siegreichen Araber haben die Landbevölkerung, die sie dort vorfanden, nicht ausgerottet. Sie vertrieben nur die fremden byzantinischen Herrscher, die einheimische Bevölkerung griffen sie nicht an.«[8]
Das Land der Vorfahren
Wie wir wissen, reichte Jabotinskys Hauptaussage – »Ich habe kein anderes Land« – allein nicht aus, um die zionistische Kolonisierung und ihre »eiserne Mauer« moralisch zu rechtfertigen. Daher griff er immer häufiger auf den Mythos des Exils zurück und auf die Vision der Rückkehr in das ›Land der Vorfahren‹ nach zweitausendjähriger Wanderschaft – solange bis dieser Mythos zu einem säkularen zionistischen Dogma wurde, das als authentische historische Wahrheit dargestellt wurde.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Nationalismus in ganz Europa noch auf dem Höhepunkt. Die Deutschen waren davon überzeugt, dass sie von den germanischen Stämmen abstammten, so wie die Franzosen davon überzeugt waren, dass ihre Vorfahren die Gallier waren, die gegen die römischen Legionen von Julius Cäsar gekämpft hatten, und die Italiener wiederum glaubten, die direkten Erben Letzterer zu sein. Die Herausbildung eines nationalen Bewusstseins war schon immer mit dem Bedürfnis nach einem ›Ursprung‹ und einer ›großen Geschichte‹ verbunden. Die Fähigkeit der Zionist:innen, sich eine lange Genealogie auszudenken, ist also nichts Außergewöhnliches. Sie machten sich daran, ein ›Land der Vorfahren‹ zu konstruieren, das auf biblischen Geschichten basierte, die in ›historische Fakten‹ verwandelt wurden, die dann in allen israelischen Schulen als Pflichtfach unterrichtet werden sollten. Akademische Geschichtsschreibung und Archäologie wurden herangezogen, um aus Legendenfetzen, Ruinenfragmenten und Steinen, die nicht immer identifiziert werden konnten, eine zusammenhängende ›wissenschaftliche‹ Vergangenheit zu formen. Der Weg vom ›Auszug aus Ägypten‹ im zweiten Jahrtausend v. Chr. bis zur Rückkehr des Volkes in das ›Land seiner Vorfahren‹ und der Gründung des Staates Israel im 20. Jahrhundert schloss einen mythischen Kreis, der die quasi ewige Existenz eines besonderen und außergewöhnlichen jüdischen Volkes begründen sollte, dem von alters her und bis zum heutigen Tag durch göttliches Edikt das Recht garantiert worden war, die gesamte Landfläche zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan und sogar darüber hinaus zu besiedeln.
Die Französ:innen von heute wissen sehr wohl, dass sie nicht wirklich von den Galliern abstammen; dasselbe gilt für die Italiener:innen im Verhältnis zu den alten Römern. Die meisten Deutschen werden zusammenzucken, wenn man sie daran erinnert, dass ihre Vorfahren sich selbst als Arier betrachteten. Zum Glück für sie haben sich die Amerikaner weniger mit biologischen Dilemmata befasst (solange die Haut weiß ist, natürlich). Die Mehrheit der israelischen Jüd:innen, die sich entschieden haben, der historischen Existenz von mindestens fünf judaistischen Königreichen außerhalb des Landes Kanaan keine Beachtung zu schenken, halten weiterhin an dem Dogma ihrer gemeinsamen Herkunft fest und sind sogar bereit, DNA-Forschungen zu finanzieren, die beweisen sollen, dass sie eine genetische Verbindung zu König Salomon und seinen tausend Frauen haben. (Darüber hinaus sind viele Jüd:innen aus Äthiopien davon überzeugt, dass sie Nachkommen der Liaison zwischen demselben polygamen König und der schönen Königin von Saba sind, die später nach Afrika zurückkehrte).[9]
Von Anfang an wurde die Kolonisierung mit Argumenten wie Existenznot, Diskriminierung und dem ›historischen Recht‹ auf ein Land gerechtfertigt, das angeblich dem ›auserwählten Volk‹ (oder dem ›verfluchten Volk‹!) verliehen worden war. Diese imaginäre Vorstellung von Eigentum wurde in der westlichen christlichen Welt gerne aufgegriffen und stark gefördert, nicht zuletzt, weil sie eine Verringerung der jüdischen Präsenz in Europa zu versprechen schien. Lord Balfour, der wenig Sympathie für das Judentum hegte, setzte darauf, dass seine Erklärung vom November 1917 zum einen die britische Hegemonie im Nahen Osten festigen und zum anderen einen Teil der jüdischen Massen, die an die Tür Englands geklopft hatten, nach Palästina umleiten würde.
Im Gegensatz zu dem, was die zionistische Geschichtsschreibung lehrt, überzeugte der im Aufbau befindliche nationale Mythos die Mehrheit der Jüd:innen und ihrer Nachkommen zunächst nicht. Sowohl orthodoxe als auch reformorientierte Geistliche waren sich sicher, dass ein kollektiver Zustrom ins Heilige Land grundsätzlich der Hoffnung auf den erwarteten Messias widerspricht. Jenseits jeglichen in Mode gekommenen Nationalismus bezog sich für sie ›das Heimatland‹ auf die Heilige Schrift, nicht auf ein physisches Stück Land.[10] Was die Laien betraf, so suchten sie einen Hafen der Ruhe und Sicherheit vor der rauen Wirklichkeit Osteuropas. Die Herzen der verzweifelten jüdischen Migrant:innen aus diesen Regionen sehnten sich nicht nach Zion: Bis 1924 waren mehr als zwei Millionen Jüd:innen auf den amerikanischen Kontinent ausgewandert, während zwischen 1882 und 1924 nur etwa 65.000 Palästina erreichten. Die meisten waren junge nationalistische Idealist:innen, die wie Naftali Herz Imber (Autor der »HaTikwa« – »Hoffnung« –, der heutigen Nationalhymne des Staates Israel) im Osten keine Wurzeln schlugen und sich stattdessen schon früh dem Strom der Einwanderung nach Westen anschlossen.
Die neuen rassistischen Einwanderungsbeschränkungen für Nordamerika, die speziell auf Nicht-Weiße und Nicht-Protestanten abzielten, trafen die jüdischen Flüchtlinge aus Mittel- und Osteuropa hart (ohne diese drastische Beschränkung der Einwanderung wäre vielleicht eine Million Jüd:innen der Vernichtung durch die Nazis entgangen). Mit anderen Worten: Von 1924 bis 1936 kam infolge der rassistischen amerikanischen Einwanderungsgesetzgebung und nach der Verabschiedung der sogenannten ›Nürnberger Rassengesetze‹ fast eine Viertelmillion Jüd:innen zusätzlich nach Palästina. Im Jahr 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, waren es mehr als 600.000, die meisten von ihnen Geflüchtete und Überlebende des Zweiten Weltkriegs, denen die westlichen Staaten das Asyl verweigert hatten. Die arabische Bevölkerung Palästinas belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 1,25 Millionen Menschen.[11]
Jabotinsky wusste sehr wohl, dass die Begegnung zwischen den jüdischen Siedler:innen und der einheimischen Bevölkerung unmöglich ruhig und friedlich verlaufen konnte. Der Erwerb von Land, das von ›Effendis‹ (elitären Grundbesitzern) verkauft wurde, und die anschließende Vertreibung der ›Fellahin‹ (Bauern), die es seit Generationen bewirtschaftet hatten, sowie die wachsende jüdische Präsenz in den Städten weckten den Unmut und die Wut der lokalen Bevölkerung. Bereits 1920 kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen in Jerusalem und 1921 in Jaffa zu noch heftigeren Auseinandersetzungen, bei denen 48 arabische und 47 jüdische Menschen ums Leben kamen. Tödliche Zusammenstöße mit religiöser Dimension fanden dann 1929 in Hebron statt, wo 133 jüdische und 116 arabische Bewohner:innen getötet wurden. 1936 brach der große arabische Aufstand aus – eine Revolte gegen die britische Herrschaft, aber auch gegen die jüdischen Siedlungen. Dieser Aufstand dauerte bis 1939: Fast 5.000 Araber:innen, 400 Jüd:innen sowie 200 Brit:innen verloren ihr Leben. Er war der Beginn einer anhaltenden Konfrontation, die trotz Zeiten des Waffenstillstands bis heute andauert. Obwohl der Konflikt als Auseinandersetzung zwischen Kolonist:innen und Einheimischen begann, nahm er in der Folge eine Reihe anderer Dimensionen an.
Parallel zur imaginären, retrospektiven Konstruktion eines quasi ewigen jüdischen Volkes gelang es der jüdischen Nationalbewegung allmählich, tatsächlich ein israelisches jüdisches Volk zu gründen, bzw. ein ›hebräisches Volk‹, wie es vor der Staatsgründung hieß. Der Zionismus entwickelte eine eigene lokale Kultur. Er belebte die alte hebräische Sprache, die von den Jüd:innen seit Jahrhunderten nicht mehr fließend gesprochen wurde, und machte sie zu einer Sprache, die sowohl volkstümlich als auch poetisch war. Ebenfalls gründete der Zionismus urbane und nationale Institutionen sowie eine paramilitärische Truppe. Er machte sich den inspirierenden sozialistischen Mythos zunutze, den er geschickt in Bezug auf die Anforderungen der nationalen Kolonisierung kanalisierte. Innerhalb kurzer Zeit gelang es den Pionier:innen, den Grundstein für eine neue Nation zu legen, die im Entstehen begriffen war, vielfältig, aber von Antagonismus und Ungleichheit zerrissen: eine Nation, die zunehmend patriotische Gefühle entwickelte.
Unter der arabischen Bevölkerung Palästinas entwickelte sich das Nationalbewusstsein langsamer. Meiner Meinung nach kann man vor den 1950er-Jahren nicht von einer palästinensischen Nation im eigentlichen Wortsinn oder gar von einem palästinensischen Volk sprechen. Das soll natürlich in keiner Weise unser moralisches Urteil über das Leid, das der einheimischen Bevölkerung angetan wurde, schmälern – von der Vertreibung von ihrem Grund und Boden bis zur Massenvertreibung aus dem ganzen Land. Die Bindung des Bauern an seinen Boden ist sicherlich eine andere als die des Patrioten an sein Heimatland, aber sie ist nicht weniger intensiv. Um die Natur des Konflikts und die Faktoren für den Erfolg der zionistischen Kolonisierung zu verstehen, muss man jedoch auch die Unterstützung durch den britischen Kolonialismus und die Tatsache berücksichtigen, dass ein spezifischer, organisierter palästinensischer Nationalismus erst relativ spät entstanden ist. Mit Einschränkungen kann man sagen, dass er erst nach der ›Nakba‹ (arabisch: ›Katastrophe‹, gemeint ist der erzwungene Exodus von 1948) entstanden ist und sich anschließend in mehreren entscheidenden Phasen entwickelt hat, die mit traumatischen politischen Situationen wie der entfremdenden Zerstreuung in die arabischen Nachbarländer einhergingen.[12]
Viele palästinensische Historiker:innen behaupten, dass ein palästinensisches Volk schon lange vor der biblischen Zeit existiert habe und daher mit ›wissenschaftlicher Gewissheit‹ schon vor Beginn der zionistischen Kolonisierung Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist jedoch zweifelhaft, ob der Ackerbauer in Galiläa sich selbst als ›Palästinenser‹ betrachtete und deshalb mehr Solidarität mit einem in der Nähe von Jerusalem lebenden Bauern empfunden hätte als mit einem arabisch sprechenden Bauern, der zwar im Südlibanon, aber halt auch in seiner unmittelbaren Nähe lebte. Das Gleiche gilt für andere Teile der Welt: Ob Kolonisierende nach Nordamerika kamen oder Franzosen sich in Algerien niederließen, der anfängliche Widerstand gegen sie war nie nationalistischer Natur.
Erinnern wir uns daran, dass während der gesamten Zeit des britischen Mandats (1920–1948) alle Einwohner:innen und Institutionen des Vereinigten Königreichs, Araber:innen wie Jüd:innen als ›Palästinenser‹ bezeichnet wurden. Die Bank der Jewish Agency hieß Anglo-Palestinian Bank und die Philharmonie von Tel Aviv war als Palestine Symphony Orchestra bekannt. Freiwillige im spanischen Bürgerkrieg und in den britischen Streitkräften während des Zweiten Weltkriegs, sowohl Jüd:innen als auch Araber:innen, wurden ›Palästinenser‹ genannt. Eine der in Jaffa herausgegebenen arabischen Zeitungen hieß Falastin[13], aber auch das englischsprachige zionistische Organ trug den Namen The Palestine Post[14].
Es ist daher ganz natürlich, dass die ersten nationalistischen Äußerungen der entstehenden intellektuellen Eliten in Palästina in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich selbst als ›arabisch‹ und nicht als ›palästinensisch‹ bezeichneten. Der vorherrschende Diskurs unter diesen Eliten, aber auch unter den Zionist:innen, legte den Schwerpunkt auf den Begriff ›arabisches Volk‹. 1920 wurde neben dem Obersten Islamischen Rat das Arabische Exekutivkomitee gegründet, das die Interessen der Araber:innen Palästinas gegenüber der britischen Mandatsmacht vertrat. Im Jahr 1936 wurde das Arabische Hohe Komitee gegründet, das den großen Aufstand anführen sollte; die Unabhängigkeitspartei (Istiqlal), eine panarabische Organisation, war erst kurz zuvor gegründet worden.
Der muslimische Prediger Taqi a-Din al-Nabhani aus Jerusalem hatte Recht, als er Anfang der 1950er-Jahre vorschlug, dass die arabischen Einwohner:innen des Landes
»den Namen Palästina (und seine Ableitungen) annehmen und ihn als arabischen Namen verwenden sollten. Sie weigerten sich jedoch, ihn als Bezeichnung für eine eigene nationale Identität oder Staatsangehörigkeit zu verwenden. Wenn ein Araber sagte, er sei ›Palästinenser‹, so war dies ein Zeichen seiner Verbundenheit mit dem Land, auf dem er lebte; genauso wie jemand sagen könnte, er sei ›Damaszener‹ oder ›Beiruti‹: Mit anderen Worten, es implizierte nicht in demselben Sinne die Existenz einer palästinensischen Staatsbürgerschaft oder Nationalität wie beispielsweise ›Englisch‹ oder ›Französisch‹.«[15]
Vielleicht erklärt dieses Fehlen eines spezifischen palästinensischen Nationalbewusstseins unter anderem den relativen Mangel an Mobilisierung der lokalen Bevölkerung während der Konflikte von 1948 sowie das Fehlen politischer Bewegungen für die Schaffung eines palästinensischen Staates in den Gebieten, die nach dem Krieg von Israel nicht erobert und ohne Widerstand an die Königreiche Jordanien und Ägypten angeschlossen wurden.
Darüber hinaus verwendete die nicht-zionistische Kommunistische Partei Israels in den 1950er-Jahren und bis Mitte der 1960er-Jahre üblicherweise den Begriff ›israelische Araber‹. Die kraftvolle nationalistische Bewegung El Ard (Das Land), die 1958 in Nazareth gegründet wurde, lehnte zunächst die Idee einer gesonderten palästinensischen Identität ab. Im Jahr 1964, dem Jahr der Gründung der PLO (Palästinensische Befreiungsorganisation), der ersten Bewegung, die ernsthaft und systematisch ein palästinensisches Nationalbewusstsein förderte und verbreitete, verfasste der Dichter Mahmoud Darwish Identity Card, ein Gedicht des nationalen Zorns und des Protests gegen die israelische Unterdrückung, das mit dem Ausruf »Ich bin ein Araber« beginnt, eine Identifizierung, die in jeder Strophe des Gedichts betont wird, jedoch ohne jeden Hinweis auf eine palästinensische Identität.
Seit der antiken hellenistischen Geschichtsschreibung ist der Ort überall (natürlich mit Ausnahme der jüdischen religiösen Tradition) als Palästina bekannt. Dieser Name wurde bereits im 7. Jahrhundert in die arabische Sprache übernommen, aber die Bewohner:innen des Gebiets, die dort seit Jahrhunderten Landwirtschaft betrieben, identifizierten sich nicht als ›Palästinenser:innen‹, sondern als lokale Araber:innen, die aller Wahrscheinlichkeit nach Nachkommen von Jüd:innen waren, die irgendwann zum Christentum oder zum Islam konvertiert waren.
Abgesehen von Ägypten vollzog sich die Bildung spezifischer Nationen im Nahen Osten im Rahmen der willkürlich gezogenen Grenzen des Kolonialismus relativ langsam und viel später, als viele Wissenschaftler:innen annehmen. Dies sollte nicht überraschen, denn entgegen der traditionellen Geschichtsschreibung sind es nicht die Völker, die Staaten gründen, sondern im Gegenteil die Staaten oder nationalen Bewegungen sind es, die Völker schaffen und formen.
Zur Nation
Ich habe die Begriffe ›Nation‹ und ›Nationalismus‹ bereits benutzt. Es lohnt sich daher, ihre Verwendung in diesem Buch, in dem es darum geht, über die Idee des Binationalismus nachzudenken, kurz zu klären. Zentrale Begriffe der politischen Geschichte wie beispielsweise ›Liberalismus‹, ›Demokratie‹ und ›Sozialismus‹ sind sehr unscharf, und das Gleiche gilt auch für den Begriff des ›Nationalismus‹. Viele Historiker:innen betrachten vormoderne Monarchien und Fürstentümer nach wie vor als nationale Gebilde – als ob das England König Edwards des Ersten (›Longshanks‹) im 13. Jahrhundert oder das von Philipp dem Schönen regierte Frankreich im selben Zeitraum Gesellschaften mit einer gemeinsamen nationalen Identität gewesen wären. Dieselben Historiker:innen stellen vormoderne Revolten mit stammesgeschichtlichem oder religiösem Hintergrund gerne als nationale Aufstände dar. Vercingetorix war also ein ›französischer‹ gallischer Rebell, so wie der germanische Arminius ein ›Deutscher‹ war. Judas Makkabäus und Bar Kochba waren selbstverständlich Helden der angestammten jüdischen ›Nation‹, und so weiter und so fort … In Bezug auf vormoderne Gesellschaften, in denen die übergroße Mehrheit der Bevölkerung weder lesen noch schreiben konnte, in denen es weder Schulen noch gedruckte Bücher gab, in denen die Landbevölkerung in jeder Region einen anderen Dialekt sprach und in denen die Bildungselite extrem klein, den Feudalherren unterworfen und im Allgemeinen extrem religiös war, von einem Nationalbewusstsein zu sprechen, ist konzeptionell überaus schräg.
Vor etwa vierzig Jahren vertraten einige Historiker:innen mit verschiedenen Begründungen die These, dass die Nationenbildung erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts begonnen habe. In dieser Zeit vollzog sich ein tiefgreifender Wandel: Veränderungen in der Arbeitsorganisation und -verteilung, Veränderungen in der Produktionsweise und Verstädterung, die die Entwicklung und Ausweitung der Kommunikationsmittel, insbesondere durch die Entwicklung des Buchdrucks, erforderten, die Schaffung von Bildungssystemen, die sich nach und nach der gesamten Bevölkerung öffneten … All dies, zusammen mit dem Aufkommen der Grundsätze der politischen Gleichheit und der Idee der Demokratie, hatte zur Folge, dass sich die alten Monarchien zu Nationalstaaten wandelten, in denen das vorherrschende kollektive Bewusstsein nicht mehr religiös, traditionell, lokal oder regional war, sondern allmählich einer nationalen Identität wich, die sich bald als hegemonial etablieren sollte. Ohne hier eine detaillierte Analyse vorzunehmen, möchte ich einfach die Hypothese aufstellen, dass die Auswirkungen des Nationalismus unter anderem auf die Idee der Demokratie und die demokratische Denkweise zurückzuführen sind – nicht auf die liberalen und pluralistischen Merkmale, die sich in vielen westlichen Demokratien entwickelt haben, sondern auf das einfache populistische Prinzip, das besagt, dass der Staat allen Bürger:innen gehört, die ihre Souveränität durch ihre Vertreter:innen ausüben.
Um diese Vision von nationaler Identität und Demokratie – ob liberal oder autoritär – zu verwirklichen, musste ein größtmöglicher kultureller und sprachlicher Konsens zwischen den Wähler:innen und ihren gewählten Vertreter:innen, zwischen den Bürger:innen und den Regierenden bestehen. Damit die Bürger:innen fast instinktiv davon überzeugt sind, dass der Machtapparat ihren Willen widerspiegelt und sich für ihre grundlegenden Interessen einsetzt, muss er so weit wie möglich ihre Sprache sprechen und sich gemeinsamer kultureller Ausdrucksformen bedienen – mit anderen Worten: Er muss ihnen sehr ähnlich sein. Nur so kann sich der Staat als Fundament des Nationalismus etablieren. Er ist es, der die Existenzsicherheit des Volkes auf einem bestimmten Territorium angesichts der Bedrohungen und Gefahren durch andere souveräne Nationen mit fremden Mentalitäten und Sprachen gewährleistet. Die gewählte Führung muss also ›populär‹, aber auch patriotisch sein. Und während in der Vergangenheit das Feld des Dorfes das ›Vaterland‹ des Bauern war, begann sodann das große nationale Vaterland auf Karten zu erscheinen, die in jedem Schulzimmer hingen, oft neben einem Porträt des Führers der Nation.
Aber die nationale Massenkultur ist weder ex nihilo, noch ist sie in einem Vakuum entstanden. Sie stützte sich stark auf Kulturen aus der vormodernen Vergangenheit, auf partielle und verzerrte kollektive Erinnerungen, auf neuere Erzählungen, auf untergehende religiöse Überzeugungen, die sie knetete und manipulierte und denen sie eine imaginäre kollektive Vergangenheit hinzufügte. Gleichzeitig formte und modellierte sie mit Hilfe von Schulsystemen und Staatsapparaten eine gemeinsame Erinnerung und Sprache. Dieser Prozess verlief manchmal relativ reibungslos, manchmal glich er auch eher einer Dampfwalze (England ist ein gutes Beispiel für den ersten Fall, Frankreich für den zweiten). In außereuropäischen Ländern spielte die koloniale Unterdrückung oft eine wichtige Rolle für die Entstehung nationaler Kulturen, wobei die Befreiungskämpfe den Prozess vorantrieben.
Nach der Einigung Italiens im Jahr 1861 sagte Massimo d’Azeglio, der ehemalige Außenminister von Piemont, bekanntermaßen: »Wir haben Italien gemacht, jetzt müssen wir Italiener machen.« Der Prozess der Nationalisierung der Bewohner:innen der italienischen Halbinsel kam nur langsam voran und wurde wohl erst mit dem Aufkommen des Fernsehens nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen. In anderen Ländern hingegen stieß der Prozess der Nationalstaatsbildung auf verschiedene Hindernisse: Dazu gehörten starke sprachliche Traditionen und weit verbreitete Dialekte, die sich mancherorts an der Schwelle zur Moderne herausgebildet hatten und die Schaffung von Staaten und einheitlichen nationalen Kulturen behinderten.
In Frankreich zum Beispiel wurden die Sprachen und kulturellen Besonderheiten Okzitaniens und der Bretagne unter der Dampfwalze des staatlichen Zentralismus zermalmt, während in Großbritannien Wales, Schottland und Irland ihre vormoderne Einheit bewahrten und so zur Existenz eines hybriden ›multinationalen‹ Staates beitrugen. In der Schweiz hat die konföderale Vereinigung der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Bevölkerung ebenfalls zu einem Staat mit mehreren Identitäten geführt. Das Gleiche gilt für Belgien und Kanada, die bis heute binationale oder multinationale Staaten sind. Trotz Reibungen und manchmal aufflammenden Konflikten haben diese plurinationalen Strukturen überlebt (und die Mehrheit der Bevölkerung hat die Sprachbarrieren und die kulturelle Pluralität akzeptiert), während sie gleichzeitig dafür gesorgt haben, dass die Beziehung zwischen den Bürger:innen und ihren direkten Vertreter:innen durch das demokratische System aufrechterhalten wird.[16]
Die Zerschlagung der vormodernen Monarchien in Mittel- und Osteuropa führte zur Schaffung neuer Nationalstaaten mit parallel existierenden mehrsprachigen politischen Einheiten. Die Tschechoslowakei, Jugoslawien und sogar die UdSSR konstituierten sich in Form von fragilen Föderationen, die unter multinationalen bürokratischen Staatsapparaten ums Überleben kämpften, bis die kommunistischen Regime schließlich fielen. Die Hauptursache dieses Phänomens hängt damit zusammen, dass, wie Hans Kohn bereits in den 1940er-Jahren nachwies, die vorherrschende Form des Nationalismus in Mittel- und Osteuropa stets ein ethnozentrischer Nationalismus war und nicht ein alle Bürger:innen umfassender und politischer.[17] Imaginäre gemeinsame Herkunft und ›Blutsbande‹ waren die wesentlichen Kriterien für neue kollektive Identitäten in dieser Region, in deutlichem Gegensatz zu den inklusiven bürgerlichen und politischen Identitäten, die sich in den westlichen liberalen Staaten längst herausgebildet hatten. So wie in Polen oder Ungarn ein Jude nicht wirklich polnisch oder ungarisch sein konnte, so konnte ein Slowake nicht in erster Linie Tschechoslowake sein, und ein Kroate sah sich nicht wirklich als Jugoslawe.
Für die meisten Brit:innen, Kanadier:innen, Schweizer:innen und Belgier:innen hat sich trotz interner Spannungen, Bruchlinien und Entfremdung eine Art gemeinsames Nationalbewusstsein herausgebildet. Es handelt sich nicht nur um traditionelle liberale Demokratien, die auf dem Prinzip ›eine Person – eine Stimme‹ beruhen, sondern in gewissem Sinne auch um ›Konkordanzdemokratien‹, die nicht nur die Bürgerrechte der Einzelnen, sondern auch die kollektiven Rechte ihrer verschiedenen Sprach- und Kulturgemeinschaften rechtlich anerkennen.[18]
Ethnozentrismus
Der Zionismus entstand in Regionen, in denen ein ethnischer Nationalismus gediehen war. Die meisten Denker:innen, Anführer:innen und Aktivist:innen des jüdischen Nationalismus stammten aus den Gebieten zwischen Wien und Warschau oder Odessa und Vilnius. Sie lehnten die Positionen des autonomistischen Bund[19] ab, der sich für die Bildung eines jiddischen Volkes in Osteuropa stark machte, dessen Sprache und Kultur spezifisch, aber offen für andere sein sollte. Die Zionist:innen hingegen nahmen für sich in Anspruch, im Namen aller jüdischen Gläubigen und aller ihrer säkularen Nachkommen in der ganzen Welt zu sprechen. Nicht weniger bezeichnend ist, dass die meisten Zionist:innen nicht nur dem alten christlichen Dogma anhingen, sondern auch dem modernen antisemitischen Diskurs: Sie sahen sich selbst als Fremde in Europa, als ›Orientalen‹, deren Herkunft aus dem Nahen Osten sie zu einer ›semitischen Ethnie‹ machte.
Der ethnozentrische Ansatz des Zionismus sollte sich erheblich auf die Entwicklung seiner Identitätspolitik auswirken. Dieser essenzialistische und exklusive Ansatz ermöglichte es der zionistischen Bewegung, die arabische Landbevölkerung außen vor zu halten und sie nicht als Mitglieder ›sozialistischer‹ Kibbuzim, landwirtschaftlicher Genossenschaften oder Gewerkschaften zu integrieren, die angeblich einer integrativen, wenn nicht gar internationalistischen Ideologie anhingen. In der Zukunft sollte sich dieser rigide Ethnozentrismus in Verboten für und der Diskriminierung von nicht jüdischen Menschen innerhalb des Staates Israel und in den Gebieten, die er später erobern sollte, voll auswirken. Immer wieder würde der biblische Satz zitiert werden: »Dort, ein Volk, es wohnt für sich, es zählt nicht zu den Völkern« (Numeri 23,9, EIN)). Diese Politik des ethnischen Purismus sollte schließlich auch die Beziehungen zu ›den Ausländern‹ bestimmen, einschließlich derer, die keine andere Wahl hatten, als israelische Staatsbürger zu werden.
Überraschenderweise trug dieses partikulare ethnische Konzept jedoch zum Entstehen von Strömungen der Offenheit gegenüber den einheimischen Araber:innen bei. Als Reaktion auf die Gleichgültigkeit der Deutschen, Polen, Ungarn und Ukrainer ihnen gegenüber entwickelten viele Jüd:innen, die sich ausgeschlossen fühlten, ein imaginäres Identitätsgefühl, das ebenfalls auf Herkunft und Ethnie beruhte, aber zu einer starken Identifikation mit ›Semiten‹ führte. Wie wir oben gesehen haben, sahen einige die einheimischen Araber:innen als ihre entfernten Verwandten an, die in der ›Heimat‹ geblieben waren und sich nicht zerstreut hatten; andere bildeten sich ein, mit eben diesen ›blutsverwandt‹ zu sein.« [20]
Unter den Mitgliedern pazifistischer Organisationen wie Brit Schalom (Friedensbund), Kedma-Mizraha (Ostwärts) und Ihud (Einheit) sowie einer ganzen Reihe von Persönlichkeiten wie Arthur Ruppin, Jacob Thon, Rabbi Benjamin und Martin Buber gab es viele, die neben ihrer Unterstützung für ein binationales Projekt und ihrem Kampf gegen die pompöse Politik des zionistischen Establishments weiterhin ein rassistisches Konzept Israels vertraten, was zu jener Zeit keineswegs außergewöhnlich war. Wie wir weiter unten sehen werden, spielte dieser ›Rassismus‹, so absurd er auch erscheinen mag, mitunter eine wichtige Rolle bei der Forderung nach Koexistenz mit den einheimischen Araber:innen.
Im Unterschied und im Gegensatz zu dem im 20. Jahrhundert in ganz Europa vorherrschenden überheblichen Orientalismus, den auch Theodor Herzl, Max Nordau und Wladimir Jabotinsky vertraten, waren sich diese ›semitischen‹ Pazifist:innen sicher, dass sie zahlreiche geistige und ›biologische‹ Gemeinsamkeiten mit dem Osten hatten und der langen Geschichte des ›Orients‹ Elemente entnehmen konnten, die für die Entwicklung eines modernen jüdischen Nationalismus fruchtbar sein würden. Das Konzept der Ethnie nährte also sowohl den hochmütigen Separatismus, der die gesamte Geschichte des Konflikts geprägt hat, als auch die Vision von Koexistenz, Integration und sogar Verschmelzung mit dem Anderen im ›Gelobten Land‹.[21]
Viele derjenigen, die bis 1948 Frieden und Partnerschaft mit den Araber:innen in Palästina anstrebten, waren von dem Wunsch beseelt, mit ihnen zusammenzukommen, was heute angesichts der neuen radikalen Verschmelzung von Religion und Nationalismus sowohl im Judentum als auch im Islam verwunderlich erscheint. Dies mag damit zusammenhängen, dass viele dieser Pazifist:innen religiös waren und keine Atheisten wie Herzl, Jabotinsky und Ben-Gurion. Wir wissen auch, dass die Mizrachi-Partei, die aus der religiösen Fraktion der zionistischen Bewegung hervorging, bis 1967 eine eher gemäßigte und vorsichtige Haltung zur Inbesitznahme des ›Landes Israel‹ vertrat (diese national-religiöse Partei unterstützte 1903 sogar noch den Plan für einen jüdischen Staat in Uganda). Noch weniger bekannt ist, dass nicht nur Rabbi Benjamin, ein starker Befürworter des Föderalismus, sondern auch bedeutende Persönlichkeiten von Brit Schalom und Ihud – wie Hugo Bergman, Ernst Simon, Martin Buber und Leon Magnes – durch eine starke religiöse Ethik motiviert waren, von der ihre liberale und pazifistische Weltanschauung stark beeinflusst war.
Binationalismus?
In den folgenden Kapiteln wird gezeigt, dass binationale und föderative Ideen in Palästina weitgehend die Domäne ausgewählter, isolierter intellektueller Gruppen waren. Das soll nicht heißen, dass die wesentlichen zionistischen Strömungen binationale, multinationale oder föderalistische Lösungen völlig ablehnten. Solange jüdische Immigrant:innen in Palästina in der Minderheit waren, formulierten die Anführer der Bewegung taktisch verschiedene Vorschläge für ein föderatives Zusammenleben.[22]