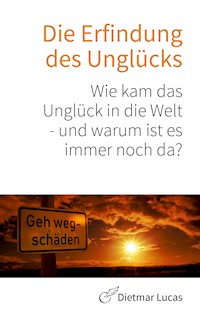
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Kann dieses Buch Sie glücklich machen? Wahrscheinlich nicht – das hat ja bisher auch kein anderes Buch geschafft. Was kann dieses Buch dann für Sie tun? Es kann ihnen eine Last von der Seele nehmen. Sie sind nicht unglücklich, weil Sie den falschen Job, den falschen Partner oder die falsche Religion haben. Dieses Buch belegt: Sie sind unglücklich, weil Sie systematisch unglücklich gemacht wurden. Und es erklärt, warum das so ist - wie das Unglück in die Welt kam und warum es noch immer da ist. Und vielleicht können Sie jetzt aufhören, sich selbst (und andere) zu geißeln mit der Forderung, doch endlich einfach nur glücklich zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1 Persönliche Vorbemerkung
2 Einleitung
2.1 Das haben wir immer schon so gemacht
2.2 Der Pfeil auf der Sehne
2.3 In diesem Buch
2.4 Kein neues Glücks-Rezept
3 Hans im Unglück
3.1 Das nackte Überleben
3.2 Verweile doch Du Augenblick
3.3 Und ewig strebend sich bemühen
4 Das Glücksbegehren
4.1 Glück als höchstes Motiv des Menschen
4.2 Die Werbung hat‘s raus mit dem Glück
4.3 Die kosmische Botschaft
4.4 Proteste gegen Glücksrezepte
4.5 Zyklus der Glücksrezepte
4.6 Glücksratgeber
4.7 Zum Glück geboren
4.8 Wo sind die Glücklichen?
4.9 Historische Abfolge der Glücks-Rezepte
4.10 Die Moderne hilft auch nicht
5 Woher kommt das Glücksbegehren?
5.1 Paradiesvorstellungen
5.2 Paradiese
5.3 Der Schimpansenkrieg
5.4 Die Vertreibung aus dem Paradies
5.5 Tierisches Glück
6 Die Not-wendigen Erfindungen
6.1 Die jüngere Dryas
6.2 Die Erfindung der Zukunft
6.3 Die Erfindung von Macht
6.4 Die Erfindung des Krieges
6.5 Die Erfindung des Fortschritts
6.6 Die Erfindung von Zukunftsangst
7 Die nächste Generation
7.1 Die Säuglingsforschung
7.2 Der innere Schweinehund
7.3 Unterwerfung als Erziehungsziel
7.4 Was Hänschen nicht lernt…
7.5 Der Buddha landet hart
7.6 Die Erinnerung ans Paradies
8 Die Geschichte der Sieger
9 Zusammenfassung
10 Ausblick
11 Danksagung
12 Über den Autor
1 Persönliche Vorbemerkung
Das Leid anderer hat mich schon immer mit einer Wucht angesprungen, die mich erschaudern liess, mich bis tief ins Mark traf und trifft. Meinen eigenen Schmerz kann ich fassen, fühlen, kann versuchen, die Botschaft zu entziffern, die meine Seele mir zukommen lassen möchte. Beim Leid anderer bin ich letztlich hilflos, machtlos, ohnmächtig. Ich habe einen Beruf, eine Berufung daraus gemacht habe, das Leid einzelner zu lindern – aber auch das ganze Instrumentarium der Psychologie fühlt sich angesichts des Leids der Welt unendlich klein an. Es ist, wie mit einem Zahnstocher einzeln jeden Tropfen des pazifischen Ozeans aufzunehmen, auf der Spitze zu balancieren und ihn mit einem liebevollen Kuss wieder in die Weite zu entlassen – und zu wissen, mit jedem Tropfen beginne ich neu. Natürlich ist diese Aufgabe, mit der ich mich konfrontiert sehe, zu groß für mich. Aber wie kann ich mich glücklich nennen, wenn es ein Wesen auf dieser Welt gibt, das leidet? Und sehe ich nicht Leid und Schmerz, Verzweiflung und Not, wohin mein Blick auch fällt? Die Menschheit dieser Welt, die ganze Welt verlangt, schreit nach Heilung.
Also schaue ich mich um, nach Hoffnung, nach Verbündeten, nach Erfolgen. Ja, und ich sehe viele Suchende, viele Menschen, die dieselbe Not fühlen können wie ich, die sich – jede und jeder bewaffnet mit allem, was es an Heilungs- und Rettungsideen und Hilfsmitteln gibt – auf den Weg machen, schon lange vor mir auf den Weg gemacht haben. Und dann fallen Zweifel mich an. Wo, außer in schönen Worten, gesprochen in der Sicherheit eines künstlichen Nests und in einem Empfinden der eigenen Besonderheit, die diese Worte auslösen, finden sich die Erfolge? Und müssen wir nicht immer wieder die vorübergehende Besuchserlaubnis in einem solchen Nest teuer erkaufen?
Warum nur kann ich nicht den Heilsversprechen glauben, mich einfach einer politischen, spirituellen oder religiösen Bewegung, einem Weisen anschliessen und darauf vertrauen, dass „die da vorne“ schon wissen, was der Weg ist? Ist es das mir mit der Milch-Flasche eingeflößte Mißtrauen gegen jegliche Autorität, ist es die schiere Unverschämtheit, mit der manche Anführer heucheln, die ausschließlich ihre eigene Gier befriedigen und dies mit abstrusesten Verrenkungen als Erleuchtung verkaufen wollen? Oder ist es nicht mindestens auch mein scharfer Blick, der das Scheitern dieser Bewegungen an ihren eigenen ursprünglichen Zielen konstatiert – trotz bestem Willen, höchster Disziplin und größter Entschlossenheit?
Wie gerne würde ich dem ein eigenes Rezept zur Rettung dieser Welt entgegensetzen, würde ausrufen: schaut auf mich, ich zeige euch den Weg. Und welche Stimmen in mir alle diese Forderung an mich stellen! Natürlich die Stimme des Mitfühlenden, der den Schmerz vom Antlitz der Welt tilgen will. Es meldet sich aber auch die Stimme, die genau dafür bewundert und gelobt werden will, eine Stimme, die dafür Belohnungen fordert. Auch eine Stimme, die Gefolgschaft, Gehorsam, Unterwerfung einfordert, weil ja ohne Entbehrungen dieser Weg nicht gangbar sei. Und eine Stimme, die dem Zweifel, ob dieses Ziel so oder überhaupt erreichbar ist, zuflüstern möchte: wenn es halt länger dauert, kannst Du ja ein paar Abstriche machen.
Und dann meldet sich mein Mißtrauen zurück. In mir selber kann ich all die Samen in ihren süßen Träumen sich wälzen fühlen, die – ausgewachsen – Fallstricke und Schlingpflanzen ausbilden werden, in denen auch ich mich unweigerlich verfangen würde.
Das lässt zwar meinen Zorn auf all die gescheiterten Gurus geringer werden, beantwortet aber nicht die Frage, wie das Leid der Welt denn nun geheilt werden kann. Es kann doch nicht sein, dass wir es als gegeben hinnehmen müssen, uns damit arrangieren müssen, dass wir selber und unsere Nachbarn auf ewig verdammt sind. Ich jedenfalls kann es nicht dabei belassen, will wenigstens versuchen, herauszufinden, was mein Beitrag zur Heilung der Wunden dieser Welt sein kann.
Und an diesem Punkt begann vor vielen Jahren meine Forschungsreise, deren erstes öffentliches Zwischenergebnis ich hiermit Ihrem und Deinem wachen und kritischen Geist und fühlenden Herz anvertrauen möchte.
2 Einleitung
Unsere Welt steuert auf eine Klima-Katastrophe von ungeheurem Ausmaß zu. Nachdem wir viele Jahre unsere Augen davor verschlossen haben, müssen wir heute entsetzt feststellen, dass wir Menschen, dass unser Verhalten wohl die Hauptursache für diese Katastrophe ist. Noch scheint es die Möglichkeit zu geben, die schlimmsten Auswirkungen zu verhindern. Dafür müssten wir "nur" unser Verhalten innerhalb von wenigen Jahren drastisch ändern. Aber genau dies scheint eine völlig unrealistische Erwartung zu sein. Immer noch steigen wir jeden Tag ins Auto, um zur Arbeit zu fahren, um einzukaufen, fliegen in den Urlaub, verwenden kostbarstes Trinkwasser, um uns die Haare zu waschen und die Toilette zu spülen. Sehenden Auges verschwenden wir die letzten natürlichen Ressourcen, vergiften diese unsere einzige Welt, heizen sie auf bis zum Kollaps.
Warum nur scheint es nahezu unmöglich, die Menschen dazu zu bewegen, dass sie ihren klugen Einsichten auch Taten folgen lassen? Das Hemd sei näher als der Rock1, sagt man. Wenn aber der Rock schon brennt, warum tun wir immer noch nichts? Sicher, wir müssten lieb gewordene Gewohnheiten, Bequemlichkeiten, Ansprüche auf geben. Aber warum scheint dies ein Preis zu sein, den wir für das Überleben der Menschheit nicht bereit sind zu zahlen?
Alle Appelle scheinen ins Leere zu verpuffen, Gesetze zum Schutz der Umwelt werden schon vor ihrer Verabschiedung so verwässert, dass sie keinerlei Auswirkungen haben können. Immer wieder scheitern gute Bemühungen an egoistischen Einzelinteressen. Dem Götzen Wachstum wird unsere Zukunft geopfert. Oder wie es Eduard Simson, ein Zeit- und Leidensgenosse Bismarcks einmal formuliert hat: „dass man, um die Sache noch ein Weilchen in Gang zu halten, für ein Quäntchen Gegenwart unersetzliche Zentner der Zukunft vergeudet, das will in meinen armen Sinn nicht hinein.“2
Wenn wir Menschen eine Chance auf Überleben haben wollen, müssen wir wohl zuerst sehr viel genauer verstehen, was uns hindert, den Weg der Einsicht auch zu beschreiten. Ist es dem Menschen angeboren, sich so rücksichtslos zu verhalten, dann besteht wohl keine Hoffnung auf eine Umkehr. Wenn aber dieses Verhalten erworben und dann weitergegeben worden ist, wenn es Traditionen sind, die zu solch katastrophalen Folgen geführt haben, dann können wir Menschen vielleicht noch rechtzeitig Wege finden, die aus dieser tödlichen Sackgasse heraus führen.
2.1 Das haben wir immer schon so gemacht
Machen wir uns nichts vor: jede auch noch so sinnvoll und dringend erscheinende Veränderung, die vor uns liegt, ist schwer (sonst wäre sie ja wahrscheinlich schon längst vollzogen). Das gilt sicher für den einzelnen genauso wie für Gruppen von Menschen. Bestehende menschliche Systeme, seien es Familien, Dörfer, Staaten oder Religionen, können überhaupt nur über eine längere Zeit existieren, wenn sie einen großen Widerstand gegen Veränderungen besitzen. Andererseits müssen sie auch in der Lage sein, Impulse von außen zu verdauen (sonst werden sie „brüchig“) – sie besitzen also auch eine gewisse Veränderungsoffenheit. Dieser Stabilitätskorridor zwischen Widerstand gegen und Offenheit für Veränderungen ermöglicht das Abfedern der ständig anströmenden Veränderungsimpulse.
Einer Gesellschaft beispielsweise gelingt es entweder, abweichende Wünsche einzelner (Korruption, Verbrechen, Aussteigerwillen, Schmarotzertum) oder vieler (Umsturzversuche, Wahlniederlagen, soziale Bewegungen) zu absorbieren – oder sie gibt ihnen nach und verändert sich, bleibt nicht mehr die, die sie war. Alle Forderungen nach Neuerungen, Reformen, Veränderungen müssen geradezu zwangsläufig auf intensiven und zähen Widerstand stoßen, denn es gibt immer überzeugende Gründe, warum es es genau so ist, wie es ist.
Wie ist das jetzt zu verstehen?
Aus den Alternativen, die Menschen für ihr Verhalten und ihre Haltungen sehen, werden sie natürlich immer diejenige auswählen, die ihnen – in genau diesem Moment (mit genau diesem aktuellen Gefühlscocktail und Informationshorizont) – als die bestmögliche (aus ihrer Sicht) erscheint. Für mich wird hier ein Grundgesetz menschlichen Handelns erkennbar: Menschen handeln immer nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist allerdings immer eine Spekulation mit vielen Unbekannten, eine Wette auf die Zukunft (hoffentlich kommt das raus, was ich mir vorgestellt habe).
Wir können nämlich – mangels hellseherischer Fähigkeiten – immer nur vermuten, was für Folgen unser Verhalten wirklich haben wird. Und auch, wenn wir es gut meinen, können wir in der Wahl unserer Mittel daneben greifen. Fehler werden dadurch erst in der Weisheit der Rückschau erkennbar, aber da sind die Kinder schon in den Brunnen gefallen.
Und es scheint keine größere Entscheidung ohne Nebenwirkungen zu geben. Will ich mehr Geld, kann ich mir überlegen, mich für eine besser bezahlte Arbeit zu bewerben und mich dort womöglich krumm zu buckeln. Ich kann auch auf die Idee kommen, eine Bank zu überfallen – mit dem hohen Risiko, dass Menschen zu Schaden kommen, dass ich erwischt werde und dann auch nichts von dem Geld habe (dass ich ja andernfalls auch sinnvollerweise nicht zu offensichtlich verprasse). Vielleicht kann ich auch einen reichen Partner finden – die sind wohl eher selten und schwer zu gewinnen und vielleicht lande ich auch doch nur in einem goldenen Käfig. Ich kann eine Karriere als Popstar ansteuern – mit viel Glück werde ich eventuell für eine kurze Zeit berühmt und reich, muss mich dafür aber den Rest meines Lebens mit aufdringlichen Paparazzi und gehässigen Massenmedien herumplagen. Ich kann mir auch die Frage vorlegen: „Wozu will ich mehr Geld? Was würde ich damit erreichen?“ und mich diesen Fragen solange meditativ zuwenden, bis ich vielleicht feststelle: „Ne, mehr Geld ist es nicht, was ich brauche. Ich will mehr Freundschaft in meinem Leben“ (und mich aufmachen, hierzu Lösungsideen zu entwickeln…).
Das, was ich vorgestern und gestern getan habe und heute noch tue, ist wahrscheinlich schon so oft durch innere Prüfungen gelaufen, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass es für uns irgendwie schon das Beste sein müsste.
Wünsche nach Veränderungen treffen so auf ein fein aufeinander aufbauendes System von Wechselwirkungen guter Gründe (dafür, dass es so ist, wie es ist). Je besser diese Mechanismen verstanden sind, je klarer ist, was die beharrenden Kräfte sind, umso eher besteht wohl eine realistische Chance auf Veränderung – auch, weil wir uns erst dann genauer damit beschäftigen können, wie der Weg der Veränderung denn aussehen mag.
Wie also konnte es so weit kommen, dass die Welt so aussieht, wie sie gerade aussieht? Wie konnte es kommen, dass wir Menschen auf unserer verzweifelten Suche nach dem Glück so viel Not und Elend als „Kollateralschäden“ erst produziert (oder milder gesagt: in Kauf genommen) haben? Und die wohl ungewohnteste Frage: Wie konnte das Unglück bei den Menschen überhaupt erst Einzug halten?
Besser kennen wir die Frage: Wie werde ich glücklich? Eine Klientin, die viele Jahre treu zu mir kam und ungeduldig über ihre stetigen aber langsamen Fortschritte war, rief einmal mit bebender Stimme aus: „Ich will doch einfach nur glücklich sein!“ Ich erinnere mich noch an die Hilflosigkeit, die ich in diesem Moment empfand. Was sollte ich darauf entgegnen? Ich konnte es nur zu gut verstehen, nagte doch dieser Wunsch an jedem, dem ich bisher in meinem Leben begegnet war.
Wie also werden Menschen glücklich? Ich konnte ihr hier keine Antwort geben, die klassische Wendung des Therapeuten zurück auf den Klienten (Was meinen Sie damit, wenn Sie das sagen? Was glauben Sie denn, wofür das wichtig ist? Wo haben denn Sie so etwas schon mal wenigstens ein bißchen empfunden), wollte mir – angesichts der Dimension ihres Schmerzes – nicht über die Lippen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich damals reagiert habe, aber ihr Ausruf liess mich nicht mehr los.
Für mich war es ein erneuter Anstoß, mich wieder dieser Frage zuzuwenden; ein Weckruf, alte Texte von mir wieder auszugraben und dieses Buchprojekt zu starten. Inzwischen bin ich sicher, dass dieser Fragehorizont zu klein ist. Welche Frage führt wohl weiter: Wo bekomme ich jetzt schon wieder ein Pflaster her? oder: Wozu schneide ich mich dauernd? Sicherlich ist die Antwort auf die erste Frage hilfreich und wichtig, aber langfristig erfolgreicher wird wohl die Antwort auf die zweite Frage sein. Für unsere Zwecke sollte die Frage dann nicht heißen: „Wie werde ich glücklich und bleibe es?“ sondern zuerst: „Wie bin ich so unglücklich geworden?“
2.2 Der Pfeil auf der Sehne
Nicht nur wir Menschen in der konsumorientierten westlichen Gesellschaft leben ständig unter einer ungeheuren Spannung, wie ein bis zum Anschlag aufgedrehtes Uhrwerk. Es ist die Spannung zwischen dem Zustand, den wir jetzt an uns spüren können und dem Ziel, zu dem wir streben, wo wir sein wollen (ja von Naturrechts wegen sein müssten, wie ich weiter unten zu begründen unternehme) – dem Zustand des inneren Friedens, des Glücks.
Wir sind wie ein gespannter Bogen mit uns selbst als Pfeil auf der Sehne, ohne aber zu wissen, wohin wir uns richten sollen. Die meisten von uns versuchen nun, ihrem Leben dennoch eine Richtung zu geben, die Spannung in ein Handeln zu bündeln. Wir basteln uns ein Rezept dafür, wie wir uns den Weg zum Glück vorstellen. Und in diesem blinden Streben ohne klare Wegweiser (Was genau ist das Glück? Woran kann ich erkennen, ob ich mich dem Glück nähere oder mich entferne?) entsteht entsetzlich viel Flurschaden, ungeheuer viel neues Unglück.
Wie aber konnte gerade bei den Menschen eine solche Spannung entstehen? Kann es sein, dass die Menschen sich von einem Urzustand des Glückes, der Geborgenheit und Sicherheit kläglich entfernt haben?
2.3 In diesem Buch
In diesem Buch werde ich
nachzeichnen, wie es zu einer weltumspannenden Tragödie des Unglücks gekommen sein könnte,
dabei eine Idee entwickeln, warum die vielen Glücksrezepte zum Scheitern verurteilt sind und
beschreiben, wie sich das Unglück immer wieder in der Seele jedes Menschen festsetzt.
Ich werde dabei versuchen, den Kern der menschlichen Natur in einem neuen Licht darzustellen, einige der vielen scheinbaren Widersprüche des menschlichen Verhaltens aufzulösen und
auch einige seelische Erkrankungen und Verstörungen, unter denen Menschen leiden, unter diesem neuen Blickwinkel betrachten.
Dieses Buch versucht also snachzuzeichnen, wie das Unglück seinen Weg in die Welt finden konnte und beschreibt die Vorgänge, mit denen wir dafür sorgen, dass das Unglück in der Welt bleibt und wir es von Generation zu Generation weitergeben.
2.4 Kein neues Glücks-Rezept
Ich werde hier nicht den Versuch unternehmen, den unzähligen Glücksrezepten noch ein neues hinzuzusfügen. Hier muss ich die – nur allzu nachvollziehbaren – Erwartungen meiner Leser bremsen. Ich kann nicht auf der einen Seite versuchen zu begründen, wie ich das Scheitern der unzähligen Glücksrezepte als zwangsläufig beschreibe und auf der anderen Seite den so ersehnten wie billigen Trost mit einem eigenen Rezept versprechen. Ich muss es hier mit Sigmund Freud halten, der einmal schrieb: „So sinkt mir der Mut, vor meinen Mitmenschen als Prophet aufzustehen, und ich beuge mich ihrem Vorwurf, dass ich ihnen keinen Trost zu bringen weiß, denn das verlangen sie im Grunde alle, die wildesten Revolutionäre nicht weniger leidenschaftlich als die bravsten Frommgläubigen.“3
Allerdings kann vielleicht die Erkenntnis darüber, warum die bisherigen Rezepte scheitern müssen, denen, die an ihrer eigenen Unzulänglichkeit verzweifeln („es liegt nur an mir, warum ich nicht glücklich bin, ich mache alles falsch“), dennoch einiges an Entlastung bieten.
Vieles von dem, was ich schreibe, sind Vermutungen und Interpretationen. Dabei male ich kein heiteres, unbeschwertes Bild von unserer Welt und von unserem Umgang mit unseren so über alles geliebten Kindern. Und wie schon Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, Anfang des letzten Jahrhunderts gerne sagte: „Alles kann auch anders sein.“4 Oder wie Busch es 1882 köstlich formuliert hat: „Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders, als man glaubt.“5





























