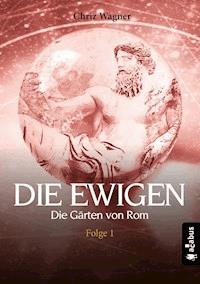Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Ewigen
- Sprache: Deutsch
"Mein Name ist Simon. Ich lebe ewig. Solange ich zurückdenken kann, bin ich auf der Erde. Ich habe außergewöhnliche Dinge gelernt, auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage: Wer bin ich? Ich kann nicht sterben. Ich darf nicht lieben. Ich bin Simon." 1753 n. Chr.: Simon arbeitet in der Werkstatt des Uhrmachers Konrad Meisner in Augsburg. Die Auftragslage ist schlecht. Bis Konrad einen grausigen Großauftrag annimmt, der zwar auf den ersten Blick merkwürdig erscheint, dafür aber viel Geld einbringt. Doch als Simon das Geheimnis der magischen Uhren aufdeckt, verschwindet die schöne Francisca und Simon findet sich in einem Flechtwerk aus Intrigen und Machenschaften wieder. Wird es Simon gelingen, dem Bann der Schicksalsuhren zu entkommen? Und was hat es mit den sonderbaren Gesichtern auf sich, die Konrads Nichte in den Spiegeln gesehen hat? DIE EWIGEN: eine Serie von Geschichten vor den Kulissen der Weltgeschichte. Zu allen Zeiten finden sich Mystery, Horror und ein Hauch Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chriz Wagner
DIE EWIGEN
Vom Schicksal der Zeit
Folge 8
Wagner, Chriz : DIE EWIGEN. Vom Schicksal der Zeit. Folge 8, Hamburg, acabus Verlag 2018
Originalausgabe
epub-ISBN: 978-3-86282-589-9
PDF-ISBN: 978-3-86282-590-5
Lektorat: Sophia Nosthoff, Lea Oussalah, acabus Verlag
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: #126739448, a magic crystal ball on blue astrology background © starblue; www.pixabay.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2018
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Für meine drei Mädels, Manu, Denise und Celine,
weil ihr immer bei mir seid, egal wo ich bin …
Thyri und Simon sind unsterblich.
Auf ihrer Reise durch die Jahrtausende verloren sie sich aus den Augen. Ihre Geschichten führen uns vorbei an mystischen Orten und magischen Begebenheiten auf der
Mein Name ist Simon. Ich lebe ewig. Solange ich zurückdenken kann, bin ich auf der Erde. Ich habe außergewöhnliche Dinge gelernt, auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage: Wer bin ich? Ich kann nicht sterben. Ich darf nicht lieben. Ich bin Simon.
Vom Schicksal der Zeit
I
Augsburg, Deutsches Kaiserreich im Jahr 1753
Tick, tack, tick, tack.
Die Eiseskälte saß mir in den Knochen. Ich vergrub meinen Nacken im Kragen der dicken Lammfelljacke. Und der Duft von verbranntem Buchenholz stieg in meine Nase. Solange das Feuer noch nicht vollständig brannte, roch es herrlich nach Rauchwurst. Das Uhrwerk mit seinen Rädchen, Schräubchen und Federn lag vor mir und wartete darauf, von mir zusammengesetzt zu werden. An einem Tag wie diesem, wenn sich der Schnee kniehoch an den Werkstattwänden türmte, schaffte ich oft nur wenige Teile. Da konnte es schon mal Wochen – Monate – dauern, bis jedes Bauteil an seinem angestammten Platz saß.
Tick, tack, tick, tack.
Ich startete einen neuen Versuch. Ich hielt die Luft an und konzentrierte mich auf das messingfarbene Wunderwerk. Die kleine Maschine versetzte mich in ein Hochgefühl. Ich wusste, es würde ein Gefühl vollendeter Befriedigung durch meinen Körper ziehen, sowie sie zum ersten Mal tickte. Wenn die Unruh zappelte, das Zeigerwerk arbeitete, die Zahnräder ineinandergriffen, die Achsen sich drehten und der Zeiger über das Ziffernblatt fuhr, dann würde das mechanische Herz dieser Uhr im stetigen Rhythmus des Federantriebs schlagen – wie ein neues Leben.
Meine Augen leisteten hervorragende Arbeit. Sie verliehen mir die Fähigkeit jede Kerbe, jede Anspitzung und jede Ungenauigkeit gestochen scharf zu sehen. Aber meine Finger waren zu kalt, zu unbeweglich, um das winzige Rädchen mit der Pinzette passgenau auf die Achse zu heben. Heute würde das nichts werden, soviel war klar. Frustriert legte ich alles beiseite und seufzte.
„Lass dich nicht unterkriegen“, brummte Konrad, der mit dem Rücken zu mir saß. Auch seine Werkbank war so hoch, dass das Werkstück nur wenige Finger breit vor seiner Nase lag. An der Wand zu seiner Linken hingen Sägen, Hämmer, mickrige Schraubwerkzeuge und Feilen an ins Holz geschlagenen Nägeln. Blechscheiben, Zahnräder, Federn und Schrauben türmten sich auf dem Regal neben dem Christuskreuz.
Tick, tack, tick, tack.
Die große Pendeluhr über seinem Kopf wies mir stets mit erhobenem Zeigefinger die Richtung. So hatte jedes Uhrwerk früher oder später zu arbeiten – tick, tack, tick, tack.
Konrad Meisner war der Inhaber des Ladens. Es war nun schon ein paar Jahre her, dass er mich angestellt hatte. „Weil deine Finger so geschickt sind“, hatte er gesagt, nachdem ich aus einem Häufchen mit Messingteilen in Windeseile eine passende Feder hervorgekramt hatte.
Damals reparierten wir Holzräderuhren, setzten Pendeluhren instand und kümmerten uns um klassische Dosenuhren, wenn sie nicht mehr ordnungsgemäß liefen. Aber was die Uhrmacherei Meisner ausmachte, waren Konrads bezaubernde Entwürfe liebevoll ausgearbeiteter Taschenuhren. Sie brachten viele Kunden in den Laden. Und mit ihnen kam das Geld. Konrad hatte bereits vor Jahren das Potential der Meisterstücke mit Sprungdeckel und seitlicher Aufzugskrone erkannt, da schraubten die meisten Augsburger Uhrmacher noch immer Dosenuhren zusammen. Und während er jedes Einzelstück kunstvoll ausarbeitete, mit einer Gravur auf der Kehrseite und handbemaltem Ziffernblatt versah, entstanden massenhaft tickende Dosen, die nicht mehr an den Mann gebracht werden konnten.
Ja. Lass dich nicht unterkriegen, sagte ich mir, dachte dabei aber an Konrad. Er arbeitete emsig wie eh und je, obwohl die Auftragslage seit einer Weile miserabel geworden war.
Die Zeiten hatten sich geändert. Heute war unser Werkzeug rostig und kaputt. Die Konkurrenz hatte den neuen Trend erfasst und war aufgesprungen. Taschenuhren gab es jetzt überall. Und die Lage der Uhrmacherei Meisner, auf dem namenlosen Weg hinter der Rückseite der Becken-Gasse mit Augsburgs Stadtmauer im Nacken, war schlecht. Konrad war kein guter Geschäftsmann. Er war durch und durch Kunsthandwerker, verliebt in seine tickenden Schmuckstücke. Seine Entwürfe waren grandios. Hätte er auf sämtlichen Uhren seinen Namen in geschwungenen Lettern eingraviert, dann hätte man uns den Laden eingerannt. Aber solche Kennzeichnungen waren zur Mitte des 18. Jahrhunderts nicht üblich. Jede Uhr war ein individuelles Kunstwerk, im besten Fall beschriftet mit dem Familiennamen des Besitzers.
Ich schob den Hocker zurück und legte einen Scheit Brennholz nach. Anschließend betrachtete ich Konrad, der konzentriert an einem Gehäuse schraubte. Und wie er so da saß, die grauen Locken über die Wangen baumelnd, den Rücken gekrümmt mit dem Ansatz einer Buckels, tat er mir leid. Aus diesem Grund fragte ich ihn etwas, das ein Meister von seinem Gesellen eigentlich niemals hören sollte. Doch Konrad war mit den Jahren zu einem Freund geworden. Und Freunde sprechen aus, was ihnen auf dem Herzen liegt. Darum sagte ich es geradeheraus: „Wie lange willst du das noch machen?“
„Was meinst du?“ Mit zusammengekniffenen Augen blickte er mich an. Seine Wangen waren rosig. Die Lippen schmal. So kannte ich ihn. Konrads Gesicht, wenn er in die Arbeit vertieft war.
„Der Laden bringt nichts mehr ein.“ Ich schluckte einen Kloß hinunter. Wusste nicht, wie ich weitersprechen sollte. „Du … du …“ Desinteressiert winkte er ab und wandte sich seinem Werkstück zu.
Nach einer Weile sagte er: „Weißt du, Simon, unsere Zeit wird kommen. Davon bin ich fest überzeugt. Und bis dahin tun wir das, was wir am besten können.“ Er sah mich an und lächelte. Und ich fand, dass er aussah wie einer, der aufgegeben hatte. Wie jemand, der sich hinter seiner Arbeit versteckte, weil er die Wirklichkeit nicht wahrhaben wollte. „Und deshalb, Simon, mache ich jetzt diese Uhr fertig“, erklärte er. Und ohne weitere Worte vergrub er sich wieder in sein Handwerk.
Und ich fragte mich, wie lange es die Uhrmacherei Meisner noch geben würde.
II
Ich war auf dem Weg zu meiner Schlafstätte, einer Einzimmerwohnung im Dachgeschoss einer Schlosserei. Konrad wohnte in den hinteren Räumen seiner Werkstatt. Zur Abendstunde schloss er die Tür und war in den eigenen vier Wänden. Im Gegensatz dazu musste ich abends nach Hause laufen. Oftmals drehten sich meine Gedanken dabei um Uhren. Ein bisschen war das Leben selbst wie ein gigantisches Uhrwerk. Wie übergroße Zahnräder griffen die Ereignisse ineinander, eines beeinflusste das nächste, und sie trieben sich gegenseitig an. Die Guten wie auch die Bösen. Tick, tack. Tick, tack.
Meine Stiefel drückten knirschend Spuren in den Schnee. Ich hatte mein Zimmer im Süden von Augsburg nahe dem Barfüßertor. Obwohl es ein Umweg war, nahm ich meistens den Weg über den Predigerberg. Konrad meinte, ich mache das schon richtig, weil auf der breiten Straße etwas mehr Licht war und die Stadtwache hier vorbeikam. Aber das war nicht der wahre Grund.
Dieser Weg führte mich unweigerlich am SCHWABENTANZ vorbei, einem Wirtshaus, das wir immer besucht hatten, wenn Konrad einen großen Auftrag an Land gezogen hatte. Es gab eine Zeit, da waren wir wöchentlich im SCHWABENTANZ gewesen. Das ist lange her. Nun ging ich nur noch dort hin, um nach Feierabend etwas zu trinken. Am liebsten wochentags, kurz bevor die Gastwirtschaft schloss. Dann waren wenige Gäste dort, und Francisca hatte Zeit für einen Plausch.
Jetzt lief ich an den beleuchteten Fenstern vorbei. Ich hielt an, zog den Kragen hoch und stopfte die Hände fest in die Manteltaschen. Der Wind pfiff übers Kopfsteinpflaster und fegte eisigen Schnee um meine Ohren. Drinnen sah es warm und gemütlich aus. Am Fenster saß ein schlecht rasierter Kerl und schob sich dicke Suppe aus einem Holzteller in den Mund. Er beachtete mich nicht.
Dann sah ich Francisca. Sie trug leere Gläser und Teller und lächelte gezwungen über das Gerede eines Mannes mit Hut. Ihre Augen sagten mir, dass sie in Gedanken ganz woanders war. Und ich fragte mich, ob sie vielleicht an mich dachte? Die Vorstellung wärmte mich.
III
Und dann griffen die Zahnräder der Lebensuhr ineinander und rückten den Zeiger der Ereignisse ein Stückchen vor.
Tick, tack.
Der Tag, an dem sich alles ändern sollte, zeigte sich nicht mehr ganz so eisig. Der Schnee taute, und ein niemals endender Wasserlauf gluckste und blubberte am Werkstattfenster hinab. Ich erinnere mich genau, wie Johanna aufgeregt hereinplatzte und behauptete, wieder einmal ein Antlitz im Spiegel gesehen zu haben. Sobald das junge Ding durch die Tür kam, roch es nach Sommerblüten. Johanna war hübsch, aber eigensinnig. Einen Ehemann hatte sie noch nicht.
Immer, wenn es mit ihren Eltern zum Streit kam, stattete sie ihrem Onkel Konrad einen Besuch ab. Und er hörte sich ihre Sorgen an und sprach beruhigende Worte.
Es war nun schon das zweite Mal, dass sie vorbeikam und von diesen geisterhaften Gesichtern erzählte. Sie sagte, es wäre gewesen, als blicke jemand wie durch ein Fenster aus dem Spiegel heraus. Eine unglaubliche Geschichte. Konrad bot ihr eine Erklärung, die von Lichtspiegelungen und Schattenspielen handelte. Aber damit gab sie sich nicht zufrieden.
Ich fand das Thema interessant. Es war möglich, dass mehr an der Sache dran war, als ich vermutete. Dennoch beschloss ich, mich aus Konrads Familienangelegenheiten herauszuhalten. Ich polierte derweil das Gehäuse einer verwitterten Holzräderuhr mit Weckerscheibe.
„… und hin und wieder meint man Dinge im Augenwinkel gesehen zu haben“, erklärte Konrad und gab sich große Mühe, jedes seiner Worte mit Bedacht zu wählen.
„Sie hat mir geradewegs in die Augen gestarrt“, entgegnete Johanna aufgeregt.
Konrad versuchte sich mit einer weiteren Erklärung: „Wenn man morgens in Gedanken versunken ist, kann einem das eigene Gesicht durchaus fremd erscheinen.“
Johanna platzte der Kragen. „Du denkst, ich … ich bin verrückt? Möchtest du das sagen? Dass ich hier oben Probleme habe?“ Sie klopfte mit dem Zeigefinger gegen ihren Kopf. „Im Spiegel war das Gesicht einer grauhaarigen Frau! Und sie hat sich ebenso erschreckt, wie ich mich.“ Sie stampfte zur Tür. Dann rief sie vorwurfsvoll: „Wenn mir nur einmal jemand etwas glauben würde!“, und riss wütend die Tür auf.
Ein kalter Windstoß fegte durch die Werkstatt. Ich erschrak. Vor der geöffneten Tür stand eine Dame mittleren Alters. Sie war aufwendiger gekleidet, als man es für gewöhnlich zu sehen bekam, mit einem roten Mantel und glänzenden, schwarzen Lederstiefeln. Der buschige Fellkragen umrahmte ihr aufwendig geschminktes Gesicht, Lippen und Wangen rot, die Lider blau. Obwohl ihr Haar graue Ansätze aufwies, wirkte es ungewöhnlich edel und gepflegt. Wenn man so lange wie ich mit Menschen zu tun hat, bekommt man ein Gespür dafür, wie sie ticken. Diese Frau hatte Vermögen, das sah ich gleich. Und ihrem entschlossenen Mienenspiel nach war sie gewillt, einen Teil davon hierzulassen – in der Uhrmacherei Meisner.
„Niemand versteht mich!“, kreischte Johanna hysterisch und schob sich hastig an der vermeintlichen Kundin vorbei nach draußen.
Die unerwartete Besucherin ignorierte die Familienszene. Es war ihr lästig, las ich in ihrem Ausdruck. Und, dass es ihren außergewöhnlichen Auftritt zunichtegemacht hatte – ihr die Show stahl. Sie schlug die Augen auf, zog ein Tuch aus der Tasche und tupfte sich die Stirn, als wäre sie noch gar nicht da.
Ein paar unendlich lange Sekunden vergingen.
Konrad war derjenige, der die peinliche Stille unterbrach: „Kann ich Ihnen weiterhelfen?“
„Oh“, sagte sie und sah uns überrumpelt an, als wäre die Tür eben erst aufgegangen. „Selbstverständlich.“ Jetzt trat sie ein.
Ich konnte ihren vernichtenden Blick förmlich spüren, wie er durch die Werkstatt glitt, prüfend, herablassend, und auch vor Konrad und mir keinen Halt machte. Sie verzog den Mund, als hätte sie einen Schweinestall betreten müssen.
Gerade wollte sich die peinliche Stille wieder ausbreiten, da meinte sie: „Ich bin auf der Suche nach einem ausgezeichneten Kunsthandwerker.“
Konrad war sichtlich überrumpelt. Und er schien aus der Starre nicht so bald zu erwachen. Darum riss ich die Situation an mich.
„Da sind Sie hier genau richtig“, sagte ich, sprang auf und hielt ihr die Hand hin. „Frau …?“
Sie kehrte mir den Rücken zu, betrachtete die Wanduhr und meinte: „Und wie mir scheint, habe ich gefunden, wonach ich suche. Ich möchte Uhren kaufen. Kleine Uhren. Taschenuhren. Eine ganze Menge.“ Ihre Art war mir unangenehm. Sie ignorierte mich. Und ihre Worte klangen von oben herab. „Und man sagt, Sie hätten ausreichend Zeit.“
Jetzt packte mich die Wut.
Zum Glück kam Konrad in Bewegung. „Hören Sie mal, Frau …“
„Heckel“, verkündete sie stolz. „Walburga Heckel.“