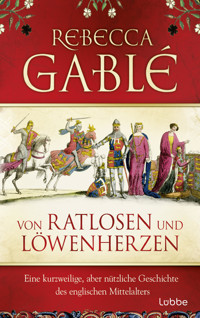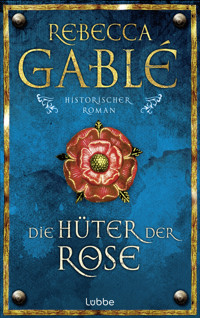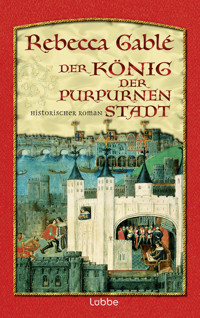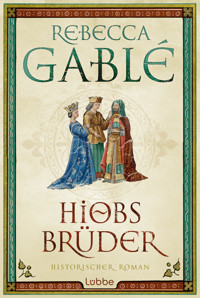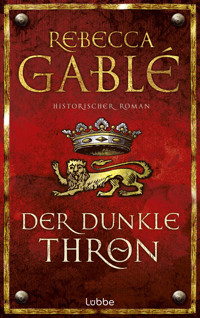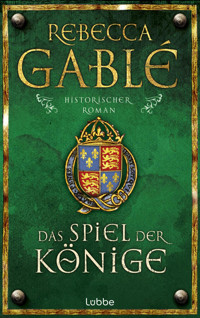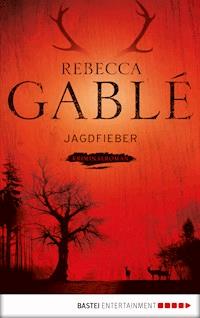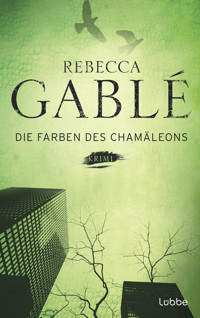
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwanzig Jahre lang hat Hendrik Simons nichts von seinem Vater in Südafrika gehört. Doch eines Tages steht ein Anwalt vor der Tür und berichtet, dass Hendriks Vater in großen Schwierigkeiten steckt. Der Geschäftsmann Anton Terheugen hat unbemerkt große Summen in die Goldminen der Familie Simons investiert. Nun will er Hendriks Halbschwester Lisa heiraten und sich die Minen endgültig unter den Nagel reißen. Als plötzlich der Anwalt der Familie unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, schleicht sich Hendrik bei Terheugen ein und versucht, Kontakt zu seiner Halbschwester aufzunehmen - ohne zu ahnen, dass er in eine tödliche Falle getappt ist...
Die Kriminalromane von SPIEGEL-Bestsellerautorin Rebecca Gablé bei beTHRILLED in der richtigen Reihenfolge (jeder Krimi kann für sich gelesen werden):
Jagdfieber
Die Farben des Chamäleons
Das letzte Allegretto
Das Floriansprinzip
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchTitel123456789101112131415EpilogÜber die AutorinWeitere Titel der AutorinImpressumÜber dieses Buch
Zwanzig Jahre lang hat Hendrik Simons nichts von seinem Vater in Südafrika gehört. Doch eines Tages steht ein Anwalt vor seiner Tür und berichtet, dass Hendriks Vater in großen Schwierigkeiten steckt. Der Geschäftsmann Anton Terheugen hat unbemerkt große Summen in die Goldminen der Familie Simons investiert. Nun will er Hendriks Halbschwester Lisa heiraten und so die Minen endgültig an sich reißen. Als plötzlich der Anwalt der Familie unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, schleicht Hendrik sich bei Terheugen ein und versucht Kontakt zu seiner Halbschwester aufzunehmen – nichtsahnend, dass er in eine tödliche Falle getappt ist …
REBECCA
GABLÉ
DIE FARBEN DES CHAMÄLEONS
KRIMI
1
Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so jung sind«, sagte der Mann missbilligend.
Ich wusste nicht so recht, was ich darauf erwidern sollte. Ich bemühte mich um einen vertrauenerweckenden Gesamteindruck. »Möchten Sie etwas trinken, Herr äh …«
»Van Relger.« Er sah kurz auf seine Uhr. »Nein, danke. Zu früh«, schloss er mit einem dünnen Lächeln.
So, so. Ein Kerl mit eisernen Prinzipien und einer Rolex-Imitation. So ziemlich das Letzte, was man sich an einem frühen Freitagabend wünscht.
»Und was kann ich für Sie tun?«
Offenbar war meiner Stimme anzuhören, dass ich an den lauen Maiabend draußen dachte, an schräge Sonnenstrahlen auf jungen Blättern, an eine Flasche Bier und Feierabend. Mein geheimnisvoller Besucher zog amüsiert die Augenbrauen hoch. »Wie ich höre, sind Sie die richtige Adresse, wenn man eine Menge Geld anlegen will.«
»Stimmt.«
»Steuerneutrales Kapital.«
»Steuerneutral, versteuert, ganz gleich. Ich nehme alles, was kommt.«
»Keine Ausnahmen?«
»O doch. Aus dem Wäschereigeschäft halte ich mich, wenn möglich, raus. Weniger Ärger mit den Aufsichtsbehörden und keine schlaflosen Nächte.«
Er nickte, ohne zu erkennen zu geben, was er von meinen Grundsätzen hielt. »Wie lange sind Sie schon im Geschäft?«
»Ein paar Jahre. Ich bin auch nicht so jung, wie ich aussehe. Und jetzt wäre ich Ihnen wirklich dankbar, wenn wir zur Sache kommen könnten.«
Ich will ihn nicht, dachte ich vage, als ich das sagte. Ich wollte ihn rausekeln.
Van Relger schlug die Beine übereinander. »Ich will ehrlich sein. Ich bin nicht gekommen, weil ich Geld anlegen möchte.«
Als ob ich’s geahnt hätte. Ich wartete ungeduldig.
Er räusperte sich, es schien plötzlich, als fühle er sich nicht besonders wohl in seiner Haut. »Sehen Sie, Herr Simons, ich bin, äh … Rechtsanwalt. In Pretoria. Ich vertrete die Interessen Ihres Vaters.«
Ich blinzelte und versuchte, nicht so auszusehen, als hätte er mir einen Zahn ausgeschlagen. Natürlich. Van Relger. Der schwache niederländische Akzent. Ich hätte selbst drauf kommen können, wäre es nicht so abwegig gewesen.
Ich atmete einmal tief ein. »Wenn das so ist, verschwenden Sie hier nur Ihre Zeit. Tut mir leid wegen der weiten Reise.«
Für eine Sekunde zeigte er erneut das dünne Lächeln, aber es verschwand sofort wieder. »Oh, ich reise sehr gern. Und ich bin es gewöhnt.«
»Umso besser. Ich denke, es ist das Beste, Sie gehen einfach wieder. Es ist spät. Ich hatte einen langen Tag. Also …«
»Ihr Vater ist ein schwerkranker Mann. Wussten Sie das?«
»Nein. Und es ist mir auch egal. Wirklich, Herr van Relger, was immer Sie mir sagen wollen, ich will es nicht hören.«
»Es geht dabei aber auch um eine Menge Geld. Ich meine wirklich eine Menge. Und außer Ihnen gibt es niemanden …«
Ich stand auf. »Gehen Sie.«
Er schien nicht sonderlich beeindruckt. Er blieb sitzen und sah mich durch seine dicke, schwarzumrandete Hornbrille neugierig an. »Sie sollten mich wirklich anhören. Ich bin sicher, es würde Sie interessieren. Sehen Sie, die Dinge haben sich geändert in Südafrika.«
»Ich weiß, was sich in Südafrika geändert hat und was nicht. Das tut nichts zur Sache. Das Problem zwischen meinem Vater und mir ist nicht politischer Natur.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich weiß. Glauben Sie mir, ich bin über die Fakten im Bilde, und ich verstehe, dass mein Besuch Sie … schockiert. Trotzdem bitte ich Sie, mir zuzuhören.«
Ich hatte genug davon. Ich ging um den Schreibtisch herum und öffnete die Tür. »Die Antwort ist nein. Wenn Sie jetzt bitte so freundlich wären … Ich würde Sie ungern rauswerfen. Ist ja nicht Ihr Fehler.«
Er seufzte leise und stand auf. »Wie Sie wünschen.« Er nahm seinen Aktenkoffer in die Rechte, ging an mir vorbei und nickte mir zu. »Auf Wiedersehen.«
Es klang wie eine Drohung.
Ich sah ihm nach, bis ich sicher war, dass er im Aufzug verschwunden war. Dann ging ich wieder hinein, zog mein Jackett über und schaltete das Licht aus. Die Sonne schien immer noch. Die blasse Marmorfassade gegenüber sah beinahe freundlich aus, es herrschte ein fast grünes Licht, wie verzaubert.
Mit einem unruhigen Schulterzucken ging ich zur Tür, schloss ab und überquerte den Korridor, um bei der Konkurrenz anzuklopfen.
»Stella? Bist du noch da?«
»Kommt drauf an. Was willst du?«
Ich steckte den Kopf durch die Tür. »Ich dachte, ich könnte dich zum Essen einladen.«
Sie sah vom Handelsblatt auf und schüttelte ihre kurzen, hellbraunen Zotteln. »Bin noch nicht so weit.«
»Ach, komm schon. Steht wieder nur Schrott drin, ehrlich. Nichts, was du nicht schon mindestens seit gestern weißt. Auf diesen Quatsch bist du doch nicht angewiesen.«
Sie runzelte die Stirn. »Wenn du so redest, führst du was im Schilde. Raus damit. Was willst du?«
»Essen. Dich nach Hause bringen. Und so weiter.«
Sie lachte. »Meinetwegen. Klingt gut.«
Sie packte zusammen und kam raus auf den Flur, eine schlanke Frau in einem unaufdringlich eleganten, fast salopp wirkenden Designerkleid, die nichts von tristen Bürouniformen hielt und Ausgeglichenheit und Selbstvertrauen ausstrahlte. Verstohlen bewunderte ich ihren leichten Schritt. Ohne noch großartig zu reden, gingen wir zum Aufzug.
Wir hatten uns kennengelernt, als sie ihren Ein-Frau-Laden bei mir gegenüber aufmachte. Anfangs hatte ich sie nicht weiter beachtet, weil die meisten innerhalb von drei, vier Monaten wieder verschwanden. Aber sie blieb. Sie war wirklich gut, von der Sorte bedrohliche Konkurrenz. Eine Weile hatten wir einen stillen kleinen Stellungskrieg geführt, weil sie auf eine geschäftliche und ich auf eine genitale Fusion aus war. Irgendwie hatten wir uns arrangiert. Sie schickte mir ihre Kunden, wenn deren Wünsche in mein Spezialgebiet fielen, und umgekehrt, und hin und wieder verbrachten wir eine Nacht zusammen. Ohne Dramen und Schwüre und Exklusivrechte.
»Ärger gehabt?«, fragte sie, als wir in der Tiefgarage in meinen Wagen stiegen.
Ich zündete den Motor und schüttelte den Kopf. »Nicht mehr als sonst.«
»Du siehst so aus, als wolltest du jemandem die Kehle durchschneiden.«
»Nein, nein. So schlimm ist es nicht.« Ich fuhr die Rampe hinauf, und wir reihten uns in den dichten Feierabendverkehr auf der Königsallee ein. »Italienisch, chinesisch, japanisch, indisch, argentinisch … Was willst du?«
Sie überlegte einen Moment. »Lass uns zu dir fahren.«
Ich wunderte mich und folgte schweigend ihrer Bitte.
Ich wohnte ein bisschen weiter draußen in Anrath, denn ich lebe nicht gern in der Stadt. Stella hatte ein Apartment in Oberkassel, und wenn sie mit zu mir kam, hieß das, dass sie die Nacht bei mir verbringen würde. Das kam selten vor. Es kam auch selten vor, dass wir zu Hause aßen. Jede Form von häuslicher Zweisamkeit vermieden wir für gewöhnlich; es sah zu sehr nach einer ernsten Sache aus. Aber in diesem Fall hatte ich nichts dagegen. Im Gegenteil.
Wir brauchten eine knappe Stunde, denn auf der Autobahn herrschte das totale Chaos. Als wir ankamen, war die Sonne fast untergegangen. Es hatte keinen Zweck mehr, sich in den Garten zu setzen.
Wir gingen in die Küche, machten was zu trinken, begutachteten den Inhalt der Tiefkühltruhe und bestellten schließlich ein italienisches Essen.
Ich fand eine Flasche brauchbaren Wein. Wir saßen im Wohnzimmer, ich machte Feuer im Kamin.
»Und?«, fragte sie, als wir schließlich beim Kaffee angekommen waren. »Was war mit deinem geheimnisvollen Termin, der am Telefon keinen Namen nennen wollte? Das große Los?«
Ich winkte ab. »Ein Reinfall, wie erwartet.«
»Für einen Reinfall hast du aber viel Zeit mit ihm verbracht.«
»So, so. Ich hab immer geahnt, dass du mir nachspionierst.«
Sie lächelte unschuldig. »Deine Bürotür quietscht. Wenn ich höre, dass sie geöffnet wird, sehe ich auf die Uhr. Wenn sie das nächste Mal geht, wieder. Du behauptest doch immer, ich könnte noch so viel von dir lernen. Betriebswirtschaftlich und so. Ein gesundes Aufwand-Ertrag-Verhältnis. Effizienz. Das ganze Blabla. Ich lerne.«
Ich seufzte. »In diesem Fall habe ich meine Zeit jedenfalls verschwendet. Noch Kaffee? Einen Cognac?«
»Ja und ja. Ich hole Gläser.«
Ich sah ihr nach, als sie in der Küche verschwand, und dachte an van Relger. Und an meinen Vater …
»Hendrik. Träumst du?«
»Entschuldige. Was hast du gesagt?«
Sie schüttelte ungeduldig den Kopf, stellte die Gläser auf den Tisch und setzte sich neben mich. »Ich fragte, ob du von der New-Zealand-Sowieso-Mining-Anleihe gelesen hast.«
»Ja.«
»Und?«
»Lass bloß die Finger davon.«
»Wieso? Okay, das Währungsrisiko ist gewaltig, aber die Zinsen …«
»New Zealand Tikanamaro Mining ist pleite. Eigentlich schon seit Jahren. Die Zinslast für diese Anleihe wird ihnen endgültig das Kreuz brechen.«
Sie sah mich verdutzt an. »Wie kommst du darauf?«
»Hat mir jemand erzählt.«
»Wer?«
»Ein Kerl, den ich von früher kenne. Ziemlich große Nummer im Goldgeschäft. Verlässliche Quelle.«
Sie schüttelte den Kopf. »Du immer mit deinen geheimnisvollen Quellen. Sehr verdächtig. Woher kennst du diesen Typen, he?«
»Von früher eben. Ein … Schulfreund.«
»Hm.« Sie schien mit der Antwort nicht zufrieden und sah mich misstrauisch an. »Ich frage mich, wieso ich den Verdacht nicht loswerde, dass du eine finstere Vergangenheit hast. Vielleicht, weil’s so ist, he?«
Ich lachte, so gut ich konnte. »Sag mal, bist du mit zu mir gekommen, um über wüste Goldminenanleihen zu reden und diesen ganzen Quatsch, oder weil du mit mir ins Bett willst?«
Sie grinste. »Ich dachte schon, du würdest überhaupt nicht mehr zur Sache kommen.«
2
Samstagmorgen brachte ich Stella nach Hause. Das Wetter war immer noch so göttlich. Als ich zurückkam, zog ich mir ein paar alte Klamotten an und stürzte mich mit Feuereifer auf meinen Garten, beflügelt von der Aussicht, zwei volle Tage lang keinen Menschen sehen und kein Wort reden zu müssen.
Ich reparierte ein Stück Zaun, sah nach den Rosen und pflanzte die kleinen Setzlinge aus dem Frühbeet in kaum weniger als dreißig Töpfe, in der Hoffnung, dass sie sich zu prächtigen, üppigen Blumen entwickeln würden. Ich hatte es gern, wenn’s im Sommer in meinem Garten so richtig griechisch aussah, alles voll blühender Töpfe und Schalen. Nachdem ich die vielversprechenden kleinen Pflanzen sorgsam begossen hatte, schnitt ich das Gras.
Die Sonne hatte eine erstaunliche Kraft, bedachte man, dass gerade mal Mai war. Als ich in Fahrt kam, zog ich mir das T-Shirt aus.
»Äh … Entschuldigung«, ertönte eine leise Stimme hinter mir, und mir fiel vor Schreck die Sense aus den Händen.
Ich fuhr herum und konnte kaum glauben, was ich sah: schlecht sitzender Anzug, schwarzer Lederkoffer, eisig blaue Augen hinter schwarzer Hornbrille, tiefbraunes Gesicht, silberblonde Locken. Nicht schon wieder.
»Sie geben so leicht nicht auf, was?«
Van Relger zuckte unter meinem Sarkasmus fast unmerklich zusammen und lächelte gequält. »Nein. So leicht nicht.«
»Das ist Hausfriedensbruch.«
»Äh … ja. Aber ich kann einfach nicht zurückfliegen, bevor ich nicht wenigstens noch einmal versucht habe, Ihnen zu erklären, wie sich die Lage darstellt.«
»Zum Teufel damit. Verschwinden Sie.«
Er zog eine Augenbraue hoch. »Es ist erstaunlich, wie mühelos Sie mit Ihrer Krawatte Ihre geschliffenen Umgangsformen ablegen. Sie sind genau wie Ihr Vater.«
Das war nun wirklich das Letzte, was ich hören wollte. »Runter von meinem Land, van Relger. Sie haben zwei Minuten.«
Er seufzte. »Das wird kaum reichen, um die Situation zu erklären.«
Ich schüttelte den Kopf. »Sie haben mich falsch verstanden. Sie haben zwei Minuten, um Ihren Arsch von meinem Land zu bewegen.«
Er war nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. »Schön, wie Sie wünschen. Dann werde ich morgen eben wiederkommen. Und am Montag in Ihr Büro. Und am Dienstag …«
So langsam kochte mir die Galle über. »Den Teufel werden Sie! Ich werde den Sicherheitsdienst im Büro anweisen, die Hunde auf Sie zu hetzen, wenn Sie es wagen, Ihr Gesicht da noch mal zu zeigen. Ich werde die Polizei anrufen, wenn Sie sich hier morgen blicken lassen. Ich werde …«
»Finden Sie das nicht lächerlich?«
Ich wischte mir mit dem Arm über die Stirn und sah über seine Schulter hinweg kurz zum Horizont. Grüne Wiesen, blühender Flieder, blauer Himmel, alles wie gehabt. Ich wollte Zeit schinden. Ich dachte nach.
»Nein. Ich glaube nicht, dass das lächerlich ist. Ich will einfach, dass Sie mich in Ruhe lassen. Dass er mich in Ruhe lässt.«
Van Relger blinzelte in die Sonne und ließ ein paar Sekunden verstreichen. Die Luft summte leise von den ersten Insekten. Im Ginster sang eine Amsel sich die Seele aus dem Leib.
»Ich verstehe Sie durchaus, Herr Simons. Ich kenne Ihren Vater gut, ich weiß, wie er ist.«
»Ah ja? Dann muss ich annehmen, dass Sie sich Ihre Klienten nicht sehr sorgfältig aussuchen.«
Das steckte er gelassen weg. Mit dem allzeit bereiten dünnen Lächeln. »Wie ist das denn mit Ihnen und Ihren Kunden?«
Tja. Mit Anwälten sollte man einfach nicht diskutieren. Das kann immer nur nach hinten losgehen. »Die zwei Minuten sind um.«
»Denken Sie eigentlich je an Ihre Schwester?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Nein. Ich kenne sie nicht. Im Übrigen ist sie meine Halbschwester. Und wenn Sie an meinen brüderlichen Beschützerinstinkt appellieren wollen, sind Sie tatsächlich dümmer, als ich gedacht hätte.«
Diesmal war er wirklich amüsiert, das Lächeln wurde breiter. »Nein, das war nicht meine Absicht. Aber immerhin ist sie schuldlos an der Situation, und sowohl ihre finanzielle als auch ihre gesellschaftliche Position stehen auf dem Spiel. Sie wird das eigentliche Opfer sein, wenn nichts getan wird.«
Pech, dachte ich, aber ich wusste im selben Moment, dass dieser verdammte Bure gewonnen hatte.
Ich war neugierig geworden. »Trinken Sie samstags morgens Champagner, oder verstößt das gegen Ihre Prinzipien?«
Er schüttelte den Kopf. »Unter gewissen Umständen trinke ich zu jeder Tageszeit Champagner.«
»Sie meinen, wenn Sie gekriegt haben, was Sie wollen, ja?«
»So weit ist es noch nicht«, erwiderte er vorsichtig.
Ich führte ihn durch die Gartentür ins Wohnzimmer. »Machen Sie’s sich bequem. Ich zieh mir was an und hol den Champagner.«
Als ich zurückkam, fand ich ihn mit auf dem Rücken verschränkten Händen vor meinem Bücherregal. Ich stellte die Gläser auf den niedrigen Tisch am Fenster und schenkte ein.
Er drehte sich zu mir um. »Interessante Bücher.«
»Sie können gern eins borgen, wenn Sie möchten.«
»Sehr freundlich, aber nein, danke. Ich war nur überrascht. Ich hatte gedacht, alle Finanzleute seien Fachidioten.«
»Das habe ich von Juristen auch immer angenommen.«
Er lächelte, dünn, versteht sich, und nahm das Glas, das ich ihm reichte. Er kostete und nickte.
Dann setzte er sich mir gegenüber und sah kurz aus dem großen Fenster.
»Wunderschön ist es hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wenige Kilometer außerhalb der Stadt so malerisch sein könnte.«
»Ja, mir gefällt’s auch.«
Ich war gespannt, wann er zur Sache kommen würde. Aber wenn er drauf wartete, dass ich ihn auffordern würde, dann konnte er lange, sehr lange warten.
»Dieses Grundstück ist wirklich sehr groß. Und ich dachte immer, die Grundstückspreise in Deutschland seien astronomisch«, plauderte er weiter.
Ich grinste ihn an. »Man kann auch Glück haben. Machen Sie mir nicht vor, Sie hätten keine Erkundigungen über mich eingezogen, van Relger. Ich wette, Sie wissen genau, wie’s um mich steht.«
Das bestritt er nicht. »Warum arbeiten Sie allein?«, wollte er wissen.
»Warum nicht?«
»Nun, wie ich höre, gibt es namhafte Firmen, die Sie gern zum Kompagnon hätten. Und das, obwohl Sie gerade mal Anfang dreißig sind. Das ist erstaunlich. Aber Sie lehnen sogar die scheinbar unwiderstehlichen Angebote ab.«
»Ja. Das tue ich.«
Er nickte und machte sich wohl so seine Gedanken.
»Wie denken Sie über Südafrika?«, fragte er schließlich unvermittelt.
Ich machte eine vage Handbewegung. »Ich mache mir selten Gedanken darüber. Aber ich denke, vieles hat sich geändert, und viel muss noch passieren. Vor allem in den Köpfen.«
»Sympathisieren Sie mit einer bestimmten Partei?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Ich bin zu lange weg. Ich weiß nicht genug. Ich bin überhaupt ein unpolitischer Mensch.«
»Weil das bequemer ist?«
»Völlig richtig.«
»Haben Sie den Namen Terre Blanche schon mal gehört?«
»Klar doch. Der Name ist ein Pseudonym. Seinen richtigen Namen kenne ich nicht. Er ist der große Zampano bei den Nazis in Südafrika.«
Van Relger nickte und sah für einen Moment grimmig und sorgenvoll aus. »So ist es. Er ist … die größte Bedrohung für den friedlichen Wandel in Südafrika. Terre Blanche ist eine Pest.«
Ich schwieg, erstaunt darüber, wie plötzlich die kühle Maske gefallen war.
»In letzter Zeit ist bekannt geworden, dass die extreme Rechte sich zu einer Internationalen formiert. Vielleicht haben Sie auch darüber gelesen. In ganz Europa gibt es Verbindungen, und sie reichen inzwischen auch bis nach Südafrika. Ich fürchte, damit ist die Bedrohung für alle betroffenen Länder größer und zugleich unüberschaubarer geworden.« Er machte eine Pause.
»Das lässt Sie wirklich nicht kalt, was? Ich meine, ich bin überrascht, dass Sie persönlich so engagiert sind.«
Er nickte zögernd. »Ja, das bin ich. Sehen Sie, niemand in Südafrika kann es sich leisten, unpolitisch zu sein.«
Ich seufzte. »Das kann sich hier eigentlich auch keiner leisten.«
Nach einer Weile fuhr er fort: »Terre Blanche selbst verlässt Südafrika selten. Er lebt auf seinem Anwesen in Transvaal, wo er seine Paraden abhält und den Nachwuchs zu paramilitärischen Jugendverbänden ausbildet. Aber es gibt andere, die die internationalen Kontakte aufbauen und pflegen. Einer dieser Leute heißt Anton Terheugen. Schon mal gehört?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Er ist Geschäftsmann. Noch ziemlich jung, vielleicht fünf Jahre älter als Sie und sehr erfolgreich. Wie er an sein Geld gekommen ist, weiß keiner. Im- und Export, diese Art von Geschäften. Undurchsichtig. Jedenfalls ist er vermögend. Er lebt für gewöhnlich auf einem alten Landsitz außerhalb eines Dorfes nahe der niederländischen Grenze, nicht sehr weit von hier. Der Ort heißt Verndahl. Terheugen gehört keiner politischen Partei an, aber seine Gesinnung ist bekannt. Er macht auch keinen Hehl daraus. Er unterhält persönliche Beziehungen zu Le Pen in Frankreich und zu Haider in Österreich. Seit Jahren gibt er jeden Sommer zur Sonnenwende ein großes Fest auf seinem Landsitz, wo prominente Redner auftreten und junge Neonazis in Scharen aufmarschieren. Sie zünden Lagerfeuer an, schwenken Fahnen und singen alte Lieder. Kundgebungen, verstehen Sie?«
Ich nickte mit zunehmendem Interesse.
»Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, kam Terheugen vor sieben Jahren zum ersten Mal nach Südafrika. Es gibt Fotos neueren Datums, die ihn mit Terre Blanche zeigen. Die Verbindung ist eine Tatsache. Terheugen transferierte große Geldsummen über die Schweiz auf verschiedene Banken in Kapstadt und Durban und investierte in südafrikanische Werte. Auf dem Silvesterball im Deutschen Club in Pretoria letztes Jahr, also vor ungefähr sechzehn Monaten, wurde er Ihrem Vater vorgestellt.«
Ich hatte plötzlich einen bitteren Geschmack im Mund. Ich erinnerte mich an diese Festlichkeiten im Deutschen Club in Pretoria. Ich erinnerte mich nur zu gut. Mit zunehmendem Alkoholspiegel wurden sie immer deutscher, bis die Stimmung hohe Wellen schlug, und es fand sich immer eine Handvoll trinkfester Urdeutscher, die mit erhobenen Gläsern das Horst-Wessel-Lied grölten.
»Wenn er sich mit diesem Terheugen eingelassen hat, geschieht es ihm verdammt recht, wenn er in Schwierigkeiten ist.«
Van Relger lächelte gequält. »Vielleicht haben Sie recht. Wer weiß.«
»Haben Sie ihn nicht gewarnt?«
Er hob leicht die Schultern. »Er wollte nichts hören.«
»Das sieht ihm ähnlich.«
Dazu sagte er nichts. »Niemand, weder ich noch Ihr Vater, konnte damals ahnen, wohin es führen würde. Und ich bin sicher, Ihr Vater würde einen Arm dafür geben, wenn er es rückgängig machen könnte.«
Er hatte es wirklich drauf, die Sache dramatisch zu gestalten.
»Aber was ist denn nun passiert?« Nur flüchtig dachte ich daran, dass ich das doch eigentlich gar nicht wissen wollte.
»Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie über die finanziellen Verhältnisse Ihres Vaters nicht das Geringste wissen?«
»So ist es.«
Er holte tief Luft und setzte mich ins Bild: »Als vor etwa zehn Jahren der Goldpreis so rasant abstürzte, geriet die Mine in ernste Schwierigkeiten. Für Monate lief sie erheblich im defizitären Bereich. Viele sind damals untergegangen. Ihr Vater nicht. Er wollte nicht untergehen. Gegen meinen dringenden Rat wandelte er die Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft um. Ich dachte, das wäre das Ende, weil natürlich niemand damals Goldminen-Aktien haben wollte. Aber ich irrte mich, und er hatte recht. Vierzig Prozent behielt er selbst, jeweils zwanzig Prozent überschrieb er aus steuerlichen Gründen Ihrer Schwester und Ihrer äh … Stiefmutter.«
Ich verschluckte mich, und er wartete höflich, bis ich aufhörte zu husten.
»Über diese weiteren insgesamt vierzig Prozent hat er laut notariellem Vertrag das volle Stimmrecht. Bis auf Widerruf, versteht sich. Die restlichen zwanzig Prozent gingen an den Markt, und so überlebte die Mine die Krise. Können Sie folgen?«
Ich winkte schwach ab. »Mein täglich Brot.«
»Ach so, ja, natürlich. Terheugen, fanden wir später heraus, hat über Jahre langsam und unauffällig ein Paket von einem zehnprozentigen Anteil erworben. Er hat es wirklich sehr geschickt gemacht. Niemand hätte ihm auf die Schliche kommen können.«
Ich sah ihn erwartungsvoll an. »Na und? Um Schaden anzurichten, braucht er eine Sperrminorität. Dreiundzwanzig Prozent mindestens.«
Van Relger nickte traurig. »Ja. Und die wird er auch bekommen, wenn nichts passiert.«
»Aber wieso denn? Es sind doch nur zwanzig Prozent auf dem Markt …« Ich sah in sein Gesicht und wusste, was kommen würde. Und meine Reaktion brachte mich völlig aus der Fassung.
»Was denn? Dieses elende Nazischwein will meine kleine Schwester heiraten?!«
3
Nachdem van Relger gegangen war, ging ich zurück in den Garten, legte mich ins hohe Gras auf die nur zur Hälfte gemähte Wiese und dachte über all das nach, was er mir erzählt hatte. Und ich dachte mehr an meinen Vater als in den letzten zwanzig Jahren zusammengenommen, und vor allem mehr, als mir lieb war.
Der andauernden, tiefen Krise zwischen meinem Vater und mir lag keine bildzeitungstaugliche Tragödie zugrunde. Ich war weder missbraucht noch misshandelt worden, nicht im herkömmlichen Sinne jedenfalls. Alles war mehr die Folge einer Verknüpfung unglücklicher Umstände. Oder so was Ähnliches.
Mein Vater war, als er meine Mutter heiratete, Steiger auf irgendeiner Zeche in Bochum. Er führte ein für seine Generation und seine Herkunft völlig normales, ereignisarmes Leben.
Fünf Jahre vor meiner Geburt erbte er von einem lange verschollenen und tot geglaubten Onkel eine Goldmine in Südafrika.
Obwohl nichts ihn dafür qualifizierte und niemand es je gedacht hätte, erwies mein Vater sich als cleverer Geschäftsmann. Als ich zur Welt kam, war er viel reicher als zum Zeitpunkt seiner Erbschaft, und meine Eltern waren in ihrer neuen Heimat etabliert. Alles traumhaft. Keine Ahnung, woher die Probleme eigentlich kamen.
Er hatte sich in den Kopf gesetzt, einen richtigen Kerl aus mir zu machen. Ich sollte kein verwöhntes Söhnchen aus reichem Hause werden. Die Idee war ja vielleicht nicht übel. Nur die Umsetzung war völlig daneben.
Er nahm mich mit auf Großwildjagd, als ich kaum laufen konnte, und ich hatte Angst. Er nahm mich mit in die düsteren, katakombenartigen Schächte der Mine, und ich hatte Angst. Er nahm mich im Jeep mit ins Sperrgelände, wenn sie neue Sprengungen in der Mine vornahmen, und der Lärm und das umherfliegende Geröll lähmten mich geradezu. Er brüllte mich an, ich sei ein verdammter Feigling, und davor hatte ich die größte Angst. Er erfand drakonische Maßnahmen, um mich zu stählen: fünf Wochen Pfadfinderlager mit sechs, eine Nacht allein auf dem Minengelände mitten in der Wüste mit sieben Jahren, und alles wurde immer nur noch schlimmer. Meine Erinnerung an meine frühe Kindheit besteht nur aus Angst und Scham für meine Angst.
Meine Mutter war keine große Hilfe. Die verdammte Malaria hatte sie erwischt, als sie kaum ein Jahr in Südafrika lebte. Sie war fast ständig krank. Und es wurde immer schlimmer mit ihr.
Als ich neun war, fing mein Vater an, meine Mutter zu betrügen. Nüchtern betrachtet, muss man ihm das vielleicht nachsehen, nach so vielen Jahren mit einer kranken Frau. Aber niemand soll von mir verlangen, dass ich ihm das verzeihe. Ich finde, er ist der letzte Dreck.
Meine Mutter starb an meinem zwölften Geburtstag. Er war nicht da. Er vögelte seine Flamme in irgendeinem Luxushotelbett in Port Elizabeth. Als er zurückkam, hab ich ihm endlich gesagt, was ich von ihm halte. Er reagierte einfach nicht darauf. Er sagte mir nur, dass er die Flamme geschwängert habe und dass er sie heiraten würde.
Ich machte mich davon. Nach zwei Monaten griff die Polizei mich in Johannesburg auf, und sie brachten mich zurück. Ich lernte die Flamme kennen, hielt es eine Woche aus und machte mich wieder davon. Diesmal war ich schlauer. Als sie mich schnappten, nannte ich ihnen einen falschen Namen. Und mein Vater hatte keine Vermisstenanzeige erstattet.
Zuerst steckten sie mich ins Waisenhaus, und weil ich da ständig abhaute, steckten sie mich schließlich in die Besserungsanstalt. Mit solchen wie mir wussten sie nicht viel anzufangen. Es war keine besonders sonnige Zeit.
Aber ich lernte ein paar wichtige Sachen. Zum Beispiel, dass es schlimmere Dinge als meinen Vater gab, vor denen man Angst haben konnte, und das heilte meine Angst vor meinem Vater. Und dass es überhaupt nicht von Vorteil ist, ständig Angst zu haben, dass man immer den Kürzeren zieht, wenn man nervös ist, und das heilte meine grundsätzliche Neigung zur Angst. Und ich lernte eine Menge Leute kennen, kleine und große Ganoven. Leute, die ich heute anrufen kann, wenn ich mal ein paar fundierte Informationen über eine Minengesellschaft in Neuseeland brauche. Und auch Leute, denen man niemals den Rücken zudrehen darf.
Irgendwann hatte ich genug von der Straße und von Besserungsanstalten, und ich nahm an Schule mit, was sie mir boten. Mit achtzehn ließen sie mich raus, weil ich zum Militär sollte, aber ich wollte nicht. Ich wollte so weit weg wie möglich. Ich arbeitete und stahl, bis ich genug hatte für ein Ticket nach Deutschland. Ich reiste ein bisschen rum, sah mir dies und jenes an, blieb irgendwie in Düsseldorf hängen und suchte mir Arbeit. Weil ich kein Bedürfnis nach der Gesellschaft anderer Menschen habe, war ich oft allein und hatte viel Zeit.
Aus Langeweile ging ich zur Abendschule. Zu meiner Überraschung fand ich heraus, dass ich eine Begabung für Volkswirtschaft und solche Sachen hatte. Auf gut Glück bewarb ich mich um ein Stipendium an der European Business School.
Ein paar Jahre später, an dem Tag, an dem die Börsenaufsicht mir meine Zulassung als Broker erteilte, schrieb ich meinem Vater einen Brief. Ich war sehr betrunken. Ich schrieb ihm, was aus mir geworden war, und ich schrieb ihm auch, was ich nach wie vor von ihm hielt. Vielleicht nicht verwunderlich, dass er nie geantwortet hat.
So war der Stand der Dinge gewesen, und ich war wunderbar damit zurechtgekommen. Bis van Relger gestern in meinem Büro aufkreuzte. Van Relger, der von mir verlangte, meinem lange vergessenen und doch immer noch verhassten Vater in einem aussichtslosen Kampf gegen die internationale extreme Rechte zur Seite zu stehen. Meine unbekannte Schwester ritterlich vor ihrer eigenen Dummheit zu retten. Van Relger, der, wenn auch unausgesprochen, doch irgendwie den Verdacht geäußert hatte, dass meine Ablehnung gegenüber seinem Ansinnen nur in der nach wie vor tief verwurzelten Angst begründet sein konnte. Was für ein Irrsinn.
Was in aller Welt ich denn tun könnte, hatte ich ihn gefragt.
Er hatte es mir erklärt. Er hatte mir erklärt, dass Terheugen und damit die internationale extreme Rechte offenbar eine Menge Geld zu waschen hatte.
Zu diesem Zwecke wurde schmutziges Geld in die Schweiz transferiert, auf verschwiegene Nummernkonten gelegt und von da aus als Guthaben des ehrenwerten Herrn Anton Terheugen nach Kapstadt oder Durban weitergeleitet, wo Terheugen und Terre Blanche es dann für ihre fragwürdigen Absichten einsetzten. Van Relger glaubte, dass die Mine meines Vaters nur der Anfang sei, dass sie sich auf diese oder ähnliche Weise auch noch in andere Wirtschaftsbetriebe einschleichen wollten, um einen der empfindlichsten Machtfaktoren des Landes, die Wirtschaft, unter ihre Kontrolle zu bringen. Er gab zu, dass ihre Chancen nicht schlecht stünden, denn viele der Wirtschaftsbosse seien Buren wie er selbst und fürchteten eine zu starke schwarze Mehrheit im Lande. Viele sympathisierten mit Terre Blanche. Deshalb war er wirklich gefährlich.
»Ihr Vater ist verzweifelt. Terheugen setzt ihm die Pistole auf die Brust. Entweder, er wird an den Geschäftsentscheidungen beteiligt, oder er legt den Betrieb lahm. Und die Möglichkeit wird er haben. Sobald Ihre Schwester ihn geheiratet hat, wird sie den notariellen Vertrag zu Gunsten Ihres Vaters widerrufen. Das hat sie klipp und klar gesagt. Sie ist Terheugen voll und ganz auf den Leim gegangen. Mit ihr ist nicht zu reden. Im Zweifel würde sie sich gegen ihren Vater stellen.«
Ich überlegte für einen kurzen Augenblick, ob mir das die Sache nicht wert wäre. Zum Teufel mit der südafrikanischen Wirtschaft und dem Kreuzzug gegen die rechtsextreme Internationale. War es nicht eine erhebende Vorstellung, dass der alte Tyrann schließlich beide seiner Kinder verlieren sollte?
Van Relger hatte offenbar auf einen Blick erkannt, was ich in diesem Moment dachte. Er hatte mir mit eherner Stimme vorgehalten, dass es kleinmütig und unzivilisiert wäre, dieser Bedrohung nur aufgrund persönlicher Ressentiments tatenlos zuzusehen. »Ihr Vater braucht Ihre Hilfe. Wenn er wüsste, dass ich Ihnen das sage, würde er mich vermutlich erschießen, aber es ist so. Er ist machtlos. Und er ist sehr krank. Er sagt niemandem, was ihm fehlt, aber ich bin sicher, dass er Krebs hat. Er wird schwächer. Er sagt, es bleibt ihm vielleicht noch ein Jahr. Und wenn Ihre Schwester seinen Anteil an der Mine erben sollte, wird de facto Terheugen eine Aktienmehrheit haben. Das ist es, was er am meisten fürchtet. Er hasst Terheugen. Und er ist verbittert, dass er so hereingelegt wurde. Wo er doch sein Leben lang ein guter Sozialdemokrat war, wie er sagt.«
Ich hatte schallend gelacht, obwohl ich nicht wollte. »Sozialdemokrat? Das hat er gesagt, ja? Der Blitz hätte ihn treffen müssen. Mit meinen eigenen Augen habe ich gesehen, wie er einen Minenarbeiter mit einem Knüppel halb totgeprügelt hat, weil der Mann versucht hatte, eine halbe Unze Gold zu stehlen.«
Ich erinnerte mich genau daran. Aus meiner Kinderperspektive dem stummen, blutenden Mann am Boden näher als meinem Vater und den ängstlich umherstehenden Zuschauern, hatte sich sein Bild in mein Gedächtnis eingebrannt. Der schwarze Körper im heißen gelben Staub, riesig war er mir vorgekommen, mit großen, hilflos geballten Fäusten, und in seinem schweißnassen Gesicht war unversöhnlicher Hass. Ich hatte ihn um seinen Mut zur Rebellion beneidet.