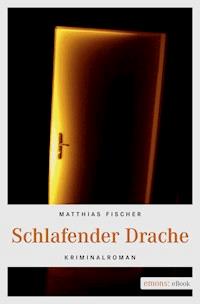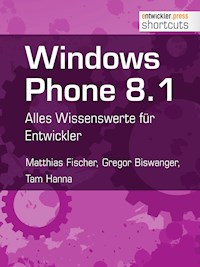Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dr. Caspari
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Drei Ärzte sind einem psychopathischen Serienkiller bereits zum Opfer gefallen, als ein weiterer Mord im Fratzenstein, dem Hexenturm in Gelnhausen, entdeckt wird. Pfarrerin Clara Frank und LKAHauptkommissar Dr. Christoph Caspari versuchen fieberhaft, einen weiteren Mord in Fulda zu verhindern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Fischer, geboren 1964 in Hanau, wuchs in Bruchköbel auf, studierte evangelische Theologie in Oberursel und Mainz und absolvierte sein Vikariat von 1992 bis 1994 in Wächtersbach. Seit 1994 ist er evangelischer Pfarrer in einer Gemeinde im Kinzigtal sowie in der Notfallseelsorge tätig und schreibt erfolgreich Kriminalromane.
Das ist ein Roman. Personen, Ämter und Berufe der Zeitgeschichte kommen darin vor, haben aber nichts mit der eigentlichen Handlung des Romans zu tun. Etwaige Übereinstimmungen wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt. Die dargestellten Charaktere der Protagonisten sind ebenso wie die Handlung frei erfunden.
©eBook-Ausgabe: Emons Verlag GmbH 2016 Alle Rechte vorbehalten Erstausgabe: »Die Farben des Zorns«: Verlag M. Naumann, vmn, Hanau 2006 Umschlagmotiv: istockphoto.com/Mark_Hubskyi Umschlaggestaltung: Nina Schäfer eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-040-9 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
DIES IRAE, DIES ILLA,
CALAMITATIS ET MISERIAE,
DIES MAGNA ET AMARA VALDE.
O JENER TAG: TAG DES ZORNES,
DES UNHEILS, DES ELENDS!
O TAG, SO GROSS UND BITTER!
GIUSEPPE VERDI, REQUIEM,7. SATZ– ALLEGRO AGITATO
PROLOG
CHRISTOPH CASPARI HASSTE NICHTS MEHR als peinliche Situationen. Ein gemeinsamer Nachmittag mit seinem Cousin Benny war die beste Gelegenheit, in eine solche zu geraten.
»Hast du das Schneckchen da vorn am Tresen gesehen? Mann, sieht die gut aus!«
Caspari suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, den sicheren Verlauf der Dinge aufzuhalten. »Schrei doch nicht so, das ganze Fitnesscenter hört ja mit!«
»Ist mir doch egal. Die mach ich jetzt an.«
Caspari rollte die Augen, während sie die Halle mit ihren modernen chromblitzenden Fitnessgeräten und Hanteln durchquerten. Es war immer dasselbe Spiel: Benny baggerte nur zum Spaß jede Frau an, die ihm schon von Weitem gefiel. In der Regel bekam er einen Korb. Jeden anderen Mann hätte das die Art und Weise überdenken lassen, in der er Frauen kennen zu lernen versuchte. Benny war anders. Benny war der fleischgewordene Schuh im Fettnapf.
»Sei doch einmal vernünftig! Du bist klatschnass geschwitzt, und genauso riechst du auch. Meinst du allen Ernstes, du kannst so auch nur einen Blumentopf gewinnen?«
Unaufhaltsam näherten sie sich Bennys neuestem Opfer. »Und? Du siehst auch nicht besser aus.«
»Im Gegensatz zu dir will ich keiner Frau ein Gespräch aufzwingen!«
»Mensch, Alter, so kommst du nie zu was. Wie lange willst du denn noch solo bleiben?«
Caspari verkniff sich eine Erwiderung. Sie waren fast an der Saftbar angelangt, an der eine junge Frau stand und ahnungslos einen Milchshake trank. Hilfe suchend blickte Caspari nach hinten. Aus ihrem Trainingsraum kam gerade der alte Seydel, ihr Lehrer. Lachend schüttelte er den Kopf, als er sah, was sich vorn anbahnte.
»Hallöchen! Neu hier? Ich habe dich noch nie gesehen. Ich meine, es wäre mir ja gleich aufgefallen«, fiel Benny inzwischen mit der Tür ins Haus.
Casparis Zunge klebte am Gaumen. Aber lieber wollte er am Wasserhahn in der Umkleide trinken als noch eine Sekunde länger da bleiben.
»Meinem Kumpel bist du auch gleich aufgefallen.«
Bisher hatte er nur auf einen Hinterkopf mit langem dunkelbraunem, fast schwarzem Haar geblickt. Die zwei äußeren Strähnen waren zum Zopf geflochten, der das Haar dazwischen im Zaum hielt. Nun drehte sich die Frau um und lächelte gequält.
Am liebsten wäre Caspari im Erdboden versunken. Er merkte, wie es langsam heiß in seinem Kopf wurde. Wahrscheinlich war er wieder einmal feuerrot. Benny war ein Idiot! Wie gern hätte er ihm einen Haken verpasst! Stattdessen stand er wie angewurzelt da und brachte keinen Ton heraus.
Das Gesicht der jungen Frau wurde ausdruckslos, als sie sich Benny zuwandte. »Ich muss weitertrainieren.«
Ohne Hast wandte sie sich ab und ging zielstrebig auf die Butterfly-Maschine zu. Immer noch zu jeder Bewegung unfähig, blickte Caspari ihr nach. Sie war eine Frau von natürlicher Schönheit, die weder Schminke noch einer aufwändigen Kosmetik bedurfte. Dank Benny würde er sie nun nie ansprechen können. Andererseits hatte er seit Jahren keine Frau angesprochen. Dazu war er im Grunde viel zu schüchtern.
»Benny, du bist ein Trottel! Musst du Christoph jedes Mal so blamieren?« Seydel war inzwischen an der Safttheke angelangt und versetzte Benny einen Klaps auf den Hinterkopf.
KAPITEL I
»DIE HEXE HAT MEINES WEIBES Leibesfrucht verdorben. Jetzt ging das zweite Kind ab. Hebamme nennt sie sich. Hexe nenne ich sie!«
Zornig dreinschauend deutete der Hufschmied auf die gefesselte Frau, die auf dem Kopfsteinpflaster kniete.
Mit ernster Miene befragte sie der Richter: »Sprich die Wahrheit, Weib! Bist du mit Luzifer im Bunde?«
»Nein, Herr! Mein Leben lang bin ich eine aufrechte Christin gewesen.«
»Aufrechte Christin? Dass ich nicht lache! Seit meine Frau Umgang mit dir hat, verliert sie die Kinder noch vor der Geburt. Das nenne ich einen schlechten Dienst an Nächsten. Sie ist des Teufels, sie ist des Teufels!«
Der Hufschmied tobte.
»Du weißt, Weib, dass wir Möglichkeiten haben, dich zur Wahrheit zu zwingen!«, drohte der Richter. Er gab den Folterknechten ein Zeichen, worauf sie die schreiende Frau packten und wegführten.
Begeistert klatschten die Gäste der historischen Altstadtführung, als die Vorstellung endete. Die Schauspielgruppe verneigte sich tief. Seit Jahren erfreuten sich diese Führungen in Gelnhausen einer sehr großen Beliebtheit. Der Besichtigung des Fratzensteins, wie der Hexenturm auch genannt wurde, war eine besondere Attraktion. Richard Hein war stolz. Von Anfang an war er dabei gewesen, dieses Mal wieder als der Richter Koch. Langsam zogen sich die Darsteller in einen Winkel des kleinen Gartens zurück, der den Turm umgab. Einige Besucher reckten die Köpfe, um seine Spitze besser sehen zu können. Lang und schlank setzte sie sich von dem ansonsten wuchtigen Bauwerk ab. Geduldig wartete Hein, bis sich die Aufmerksamkeit wieder ihm zuwandte.
»Wir gehen nun weiter in den Hexenturm. Er hat eine lange Geschichte. Ursprünglich wurde er als Bollwerk erbaut. Später kerkerte man dort Frauen ein, die als Hexen angeklagt waren. Die Statue rechts neben dem Eingang erinnert an die menschenverachtenden Prozesse, die damit einhergehenden Folterungen und Hinrichtungen. Heute sind in dem Turmverlies Folterinstrumente ausgestellt, aber wir wissen, dass die Frauen an einem anderen Ort dem ›peinlichen Verhör‹ unterzogen wurden.«
Sie gingen eine Holztreppe hinauf, die zu einem kleinen überdachten Wehrgang an der Stadtmauer führte. Umständlich zog Hein wie ein Kerkermeister einen Eisenring aus seinem Wams, an dem alte schwere Schlüssel hingen. Gespannt starrte die Besuchergruppe auf ihn, als er versuchte, das altertümliche Schloss zu öffnen. Mit einem lauten schnappenden Geräusch sprang der Riegel zurück. Um die Spannung zu steigern, tat er, als wäre der Lichtschalter seit dem letzten Mal abhandengekommen. Bereitwillig traten die Besucher dennoch ein und ließen sich von der eisigen Dunkelheit im Inneren verschlucken. Einer nach dem anderen betrat die finstere Galerie, von der aus man über eine Treppe zum Verlies hinuntersteigen konnte.
Hein sog den vertrauten muffig-feuchten Geruch des Turmes ein, während er das Licht anschaltete. Eigentlich hätte ihm dabei auffallen müssen, dass an diesem Tag etwas anders war als sonst. Denn darunter mischte sich dieses Mal kaum merklich eine andere Duftnote, leicht süßlich. Hein achtete jedoch nicht darauf. Seine Aufmerksamkeit galt vollkommen der Inszenierung der bevorstehenden Attraktion. Sobald das Licht angehen würde, könnten alle von hier aus die Museumsstücke bestaunen, die im Auftrag des Magistrats vor einigen Jahren aus ganz Europa zusammengekauft worden waren. Beim Anblick der Folterinstrumente würde auch den Teilnehmern dieser Besuchergruppe ein Schauer über den Rücken laufen. Die in Eisen geschmiedeten Zeugnisse menschlicher Perversion hatten immer diese Wirkung, das hatte Hein oft genug beobachtet.
Doch was die Dunkelheit ausspie, übertraf jede Vorstellung von Grausamkeit. Zwei Frauen, die ganz vorn standen, begannen gleichzeitig zu schreien, eine andere biss sich auf die Faust. Die Gesichter einiger Männer nahmen eine aschfahle Farbe an. Hein konnte sich nicht so recht erklären, was dieses Entsetzen verursacht haben mochte. Er machte einen Schritt nach vorn und sah von der Brüstung der Galerie nach unten.
Der Anblick, der sich ihm bot, schnürte ihm die Kehle zu. Er blickte in den schlimmsten Abgrund seines Lebens. Nie zuvor hatte er so etwas Unfassliches gesehen. Unter ihnen saß ein zu Tode gequälter Mensch auf dem Eisernen Stuhl. Die langen Nägel auf der Sitzfläche hatten ihn völlig durchbohrt. Seine Augen waren weit aus den Höhlen herausgetreten und zeugten von den furchtbaren Qualen, denen er ausgeliefert gewesen sein musste. Sein Mund war zu einem stummen Schrei geöffnet und sah seltsam leer aus. Die Zunge war dem Toten herausgeschnitten worden, die Zähne waren von dunklem, getrocknetem Blut verfärbt. Wo zuvor Daumen, Zeige- und Mittelfinger an der rechten Hand gewesen sein mussten, waren nur noch blutige Stümpfe. Ein unbekannter Folterknecht hatte sie zusammen mit der Zunge an den Stuhlrahmen genagelt.
Richard Hein stand gelähmt vor Entsetzen auf der Galerie. Als der erste Teilnehmer der Gruppe an ihm vorbei ins Freie stürzte, um sich dort zu übergeben, kam wieder Leben in den Fremdenführer. Mit fahrigen Bewegungen suchte er sein Mobiltelefon im Wams seines mittelalterlichen Kostüms und wählte mit zittrigen Fingern den Notruf.
Clara Frank rang mit den Worten. Spanisch war ihre zweite Muttersprache. Dennoch wollte sie gelegentlich an der gestelzten Sprache mancher zeitgenössischer südamerikanischer Schriftsteller schier verzweifeln. Gerade saß sie an der Übersetzung eines Textes, den sie furchtbar fand. Das hatte sie dem Verleger auch in aller Deutlichkeit gesagt. Aber der hatte nicht darauf hören wollen. Er sah in jedem Chilenen, der nur halbwegs den Bleistift halten konnte, einen zweiten Pablo Neruda. Clara musste übersetzen, was er drucken wollte. Warum bloß hatte sie sich dazu breitschlagen lassen, die Übersetzertätigkeit nach ihrem Studium fortzuführen! Jetzt war sie Pfarrerin mit halber Stelle in Gelnhausen. Die übrige Zeit widmete sie den Gedanken unbekannter Poeten und solcher die es noch werden wollten. Dabei verdiente sie allerdings nicht schlecht. Clara widerstand dem Drang, ihre Übersetzungsversuche in die Papiertonne zu werfen.
Ein entsetzlich schrilles Alarmgeräusch ließ sie zusammenfahren. Erschrocken suchte sie nach der Quelle dieses Sirenengeheuls, als es abrupt abbrach und sich eine Männerstimme meldete.
»Kreisleitstelle Main-Kinzig für Notfallseelsorge Gelnhausen. Die Polizei Gelnhausen fordert Sie zur Betreuung von Zeugen in einem Mordfall an. Bitte setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung.«
Der Melder der Notfallseelsorge. Sie trug ihn nun schon fünf Tage mit sich. In dieser Woche hatte sie zum ersten Mal Bereitschaftsdienst. Bisher war der Melder allerdings ein stummer Begleiter gewesen. Die Möglichkeit, zu einem Einsatz gerufen zu werden, hatte sie daher völlig verdrängt. Wann immer die Polizei Unterstützung bei der Überbringung von Todesnachrichten brauchte, der Notarzt einen Seelsorger für notwendig hielt, die Feuerwehr die Betreuung von Unfallopfern und ihrer Angehörigen anforderte, wurden die Pfarrerinnen und Pfarrer, die in der Notfallseelsorge mitarbeiteten, alarmiert.
Clara verwünschte den Tag, an dem sie sich zu diesem Dienst entschlossen hatte. Seit zwei Monaten erst war sie Pfarrerin in Gelnhausen. Schnell hatte sie sich von den Kollegen überreden lassen, im Team mitzuarbeiten. Die Worte ihrer Mentorin am Ende ihres Vikariats gingen ihr wieder durch den Kopf.
»Begehe nicht den typischen Anfängerfehler! Sage nicht zu allem, was andere wichtig finden, ja. Fange schon früh an, nein zu sagen. Sonst sind deine Kräfte schneller erschöpft, als dir lieb ist.«
Wütend über sich selbst griff sie den Telefonhörer und wählte die Nummer der Kreisleitstelle. Als sie auf der anderen Seite die Stimme aus dem Notfallmelder vernahm, hämmerte ihr Herz heftig. Mit einem Kloß im Hals stellte sie sich vor.
»Guten Tag. Pfarrerin Frank von der Notfallseelsorge Gelnhausen. Sie haben mich alarmiert…«
»Es hat einen Mord gegeben. Die Leiche wurde im Hexenturm von den Teilnehmern einer Altstadtführung gefunden. Die Polizei hat Sie zur Betreuung der Gruppe angefordert.«
Clara schluckte. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Am liebsten hätte sie das Telefon an die Wand geschleudert und wäre weggelaufen, so schnell und weit sie nur konnte. Dann fielen ihr bruchstückhaft Passagen aus der Einführung ein.
»Es sind immer zwei Notfallseelsorger. Einer im Vordergrund und einer im Hintergrund. Wenn du als Vordergrunddienst einen Einsatz hast, übernimmt der Hintergrunddienst deine Bereitschaft. Wirst du angefordert und hast den Eindruck, du brauchst Unterstützung, dann lässt du den Hintergrunddienst auch anfordern. Bei besonders schwierigen Einsätzen mit vielen Betroffenen kannst du auch die Kreisleitstelle beauftragen, den Kriseninterventionsdienst vom Roten Kreuz zu alarmieren. Wir arbeiten eng zusammen.«
Sie musste Zeit gewinnen, um eine Entscheidung treffen zu können.
»Wie viele Personen sind betroffen?«
»Nach unserem Kenntnisstand etwa fünfundzwanzig.«
Der Mann am anderen Ende der Leitung konnte seine Ungeduld kaum verhehlen.
»Gut, dann alarmieren Sie bitte den Hintergrunddienst und den KID.«
»Geht klar. Soll ein Einsatzfahrzeug Sie abholen?«
»Das wäre sehr hilfreich.«
Clara hatte zu ihrem Amtsantritt von ihrem Vorgesetzten, Dekan Kern, eine historische Altstadtführung geschenkt bekommen. Doch in ihrer Aufregung hätte sie beim besten Willen nicht sagen können, wie sie zum Hexenturm finden sollte.
Der Notrufmelder sandte wieder schrille Töne durch ihre Wohnung. Die Stimme von der Leitstelle, die den Hintergrunddienst anforderte, riss sie aus ihrer Erstarrung. Sie musste die Weste der Notfallseelsorge aus dem Schrank holen. Der Aluminiumkoffer mit Kuscheltieren, Gummibärchen, Zigaretten, einem Gebet-, einem Gesangbuch und einer Bibel stand schon im Flur. Das Martinshorn gellte von Weitem, als sie mit zittrigen Knien auf die Straße trat. Unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen, die in der Altstadt galten, raste ein blau-weißer Passat auf sie zu. Die ungewöhnlich warme Oktobersonne blendete sie, als sie ihm entgegenblickte. Die Beifahrertür wurde aufgerissen, und ein junger Uniformierter sprang heraus. »Pfarrerin Frank?«
»Ja.«
»Schneider. Wir bringen Sie zum Fundort.«
Der Polizist öffnete die Tür. Clara nahm auf dem Rücksitz Platz. Hastig grüßte sie den Fahrer, der ihr über die Ränder seiner Sonnenbrille im Rückspiegel ernst zunickte.
Während der Fahrt wollte sie sich auf die Situation vorbereiten, Fragen stellen, sich einen ersten Eindruck verschaffen. Es war nicht möglich. Der Fahrer glich eher einem pubertären Verkehrsrowdy denn einem Polizeibeamten. Er raste mit einer unglaublichen Geschwindigkeit durch die engen Gassen und über das graue Kopfsteinpflaster der Altstadt. Clara hatte Schwierigkeiten, sich trotz Gurt in ihrem Sitz zu halten.
Als sie vor der Einmündung in die steil abfallende Gasse zum Stehen kamen, die zum Hexenturm führte, schämte sie sich für den Aufwand, der für sie betrieben worden war. Der Hexenturm lag nur zweihundert Meter von ihrem Pfarrhaus entfernt. Zu Fuß wäre sie in drei Minuten dort gewesen. Mit dem Wagen hatten sie einen großen Umweg durch die Altstadt nehmen müssen. Die Polizisten mussten sie für völlig unbeholfen halten.
Etwas benommen versuchte sie sich abzuschnallen. Dank des Fahrstils von Mister Sonnenbrille hatte ihr Gurt blockiert. Schneider öffnete die Tür und betrachtete nachsichtig ihre Bemühungen, den Streifenwagen zu verlassen. Nach einer Zeit, die ausreichend genug war, um sich zu blamieren, schaffte es Clara, aus dem Wagen zu steigen.
»An wen kann ich mich wenden, um Einzelheiten meines Einsatzes zu erfahren?«
Der Polizist blickte sich um. »Am besten, Sie gehen zu Hauptkommissar Jungmann. Der steht direkt neben dem Eingang an der Gartenmauer vor dem Turm.«
Clara bedankte sich kurz bei Schneider. Auf Höflichkeiten gegenüber dem Fahrer verzichtete sie ganz bewusst. Sie atmete noch einmal tief durch und streifte sich ihre Weste über, bevor sie auf die Absperrung zuging. Ein weiterer Uniformierter, der Schaulustige und allzu dreiste Pressevertreter mit seinem strengen Blick davon abhielt, näher zu treten, hob die Banderole hoch, damit sie gebückt durchlaufen konnte.
Wie ein mahnender Zeigefinger ragte der Hexenturm vor ihr auf. Sein Schatten nahm ihr die Sonne. Sie fröstelte, als sie ihm näher kam. Neben dem kleinen Tor, das zum Turmgarten führte, bemerkte Clara einen sportlich wirkenden Mann in einer schwarzen Lederjacke. An einem Oberarm trug er eine rote Binde mit der Aufschrift »Polizei«. Mit der linken Hand hielt er sich sein Mobiltelefon ans Ohr, während er mit der rechten hastig in ein Notizbuch schrieb. Als er sein Gespräch beendet hatte, nahm er sie wahr. Mit einem einnehmenden Lächeln kam er auf Clara zu und reichte ihr die Hand.
Ihre Augen blieben an seiner Erscheinung hängen. Der Drei-Tage-Bart unterstrich sein schlankes Gesicht. Die wohlgeformte Nase überspielte den dünnlippigen Mund. Von dem üppigen braunen Haar hatte sich eine Strähne gelöst und hing ihm in die Stirn. Die braunen Augen und das Grübchen am Kinn unterstrichen seine Attraktivität. Sein Händedruck war ihr allerdings unangenehm. Er hatte etwas Vereinnahmendes. Sie zwang sich zu lächeln.
»Guten Tag. Ich bin Hauptkommissar Jungmann. Sie müssen die Notfallseelsorgerin sein.«
»Ja, ich bin Pfarrerin Frank.«
»Sind Sie schon länger bei der Notfallseelsorge?«
»Ehrlich gesagt ist das mein erster Einsatz.«
Jungmann schaute sie mitleidig an. Clara fühlte sich an ihren großen Bruder erinnert.
»O Gott! Da haben Sie es ja gleich richtig getroffen. Das ist eine ziemlich hässliche Angelegenheit hier.«
Was sollte das? Jungmann traute ihr wohl nicht zu, professionell an diese Situation heranzugehen. Langsam erwachte in Clara Trotz. So gönnerhaft ließ sie sich nicht behandeln.
Betont sachlich konterte sie: »Das habe ich mir bereits gedacht, als die Leitstelle mir einige Einzelheiten mitteilte. Ich habe deshalb auch einen weiteren Notfallseelsorger und den KID alarmieren lassen. Können Sie mir einen Überblick über das geben, was geschehen ist? Ich muss mir ein ungefähres Bild von dem machen, was die Besuchergruppe erlebt hat.«
»Ja, natürlich!«
Jungmann setzte gerade an, als eine Donnerstimme vom Eingang her schallte. »Jürgen! Wo bleibst du denn? Die Kollegen können die Angehörigen schneller feststellen, wenn du sie nicht dauernd anrufst!«
»Das ist doch schon längst erledigt. Die Notfallseelsorgerin ist gerade eingetroffen, die du angefordert hast. Ich gebe ihr gerade einen kurzen Überblick.«
Im Eingangstor des Turmes erschien ein breitschultriger Mann. Sein gepflegter schwarzer Bart war mit etlichen Grautönen durchsetzt, während sein kurzgeschorenes Haar sich mit Erfolg gegen diesen Farbwechsel gewehrt hatte. Sein kantiges Gesicht zierte eine große schlanke Nase, unter der ein energisches Kinn hervorsprang. »Ach ja, das mache ich. Geh du wieder rein und hilf der Spurensicherung.«
Clara spürte Erleichterung, als sich Jungmann widerwillig von ihr abwand und die Treppe zum Eingang hinaufeilte. Flüsternd wechselte er mit dem Älteren auf dem Absatz vor dem Tor noch schnell ein paar Worte, ehe er vom Turm verschluckt wurde. Flink ging der Ältere die Treppe hinunter auf Clara zu.
»Ich bin Oberhauptkommissar Bertram. Guten Tag, Frau Frank. Gut, dass Sie da sind. Vor ungefähr einer halben Stunde hat eine Besuchergruppe hier im Hexenturm die Leiche eines Mannes gefunden, der vor seinem Tod wahrscheinlich gefoltert wurde. Die Leute sind völlig verstört und unter Schock. Einen entstellten Toten während einer Altstadtführung im Hexenturm zu finden ist natürlich nicht die Art von Attraktion, die man sich wünscht.«
Clara wollte sich erst gar nicht vorstellen, was die Besucher gesehen hatten. Mit aller Kraft unterdrückte sie Phantasien, die aus ihrem Unterbewusstsein vor ihr inneres Auge drängten.
»Wir sind mit der Zeugenbefragung fast fertig. Sie können sich also gleich um die Gruppe und den Führer kümmern.«
Über Bertrams Schulter hinweg sah sie den Kollegen Horst Gärtner und zwei Männer vom KID auf sie zukommen. Sie war erleichtert, die drei zu sehen. Bertram drehte sich herum und folgte ihrem Blick.
»Ah, da kommt ja Verstärkung für Sie. Sehr gut. Die Kollegen haben Anweisung, Ihnen Bescheid zu sagen, wenn sie fertig sind. Brauchen Sie noch etwas?«
»Etwas zu trinken für die Leute vielleicht.«
»Das ist eine gute Idee. Daran hatte ich in dem Trubel gar nicht mehr gedacht. Ich werde das gleich veranlassen.«
Das Gespräch war beendet. Clara ging zu ihrem Team, das etwas abseits an der grob verputzten Gartenmauer auf sie wartete. Als sie zum Reden ansetzte, schnitt ihr der Klang zwei weiterer Martinshörner jäh das Wort ab. Sie blickte wieder zu Bertram. Der sah sich fragend um. Aus Richtung Untermarkt kamen die schrillen Sirenen beängstigend schnell näher. Clara fühlte sich auf unangenehme Weise an ihre Fahrt über das alte Kopfsteinpflaster hierher erinnert.
An der Einmündung der Straße hielt der Uniformierte die Banderole hoch. Zwei Kombis glitten darunter hindurch und hielten mitten auf der ohnehin schon engen Gasse.
Aus dem Passat stieg ein südländisch aussehender Gigolo mit langen Koteletten und gegeltem Haar. Neben ihm schwang sich eine dynamisch wirkende Frau mit kupferroter Löwenmähne heraus.
Und aus dem Volvo schälte sich ein Mann, der zu diesem wuchtigen Wagen passte. Seine Körpermaße lagen jenseits jeder Konfektionsgröße. Clara schätzte sein Alter auf fünfunddreißig bis vierzig. Er musste knapp zwei Meter groß sein. Seine breiten Schultern, die kräftigen Arme und Beine ließen den Südländer neben ihm schmächtig wirken. Das rotblonde Haar schien sich mit Erfolg gegen jeden Versuch zu wehren, es in die Form einer Frisur zu zwingen. Der Vollbart leuchtete rot in der Sonne und umrahmte das breite Gesicht. Ohne das Blaulicht vom Dach abzunehmen, wandte er sich den beiden anderen zu und trieb sie zur Eile an. Sein schwerer Gang wirkte behäbig und strahlte dennoch etwas Kraftvolles aus. Clara fühlte sich bei seinem Anblick an jemanden erinnert; sie konnte aber beileibe nicht sagen, an wen.
Während sich die drei mit Koffern auf den Turm zu bewegten, lamentierte Jungmann vor dem Turmeingang. »O nein, Doktor Freud persönlich. Musste das sein, Heinz? Hältst du uns für so inkompetent? Den Fall können wir auch ohne das LKA lösen!«
»Von Zeit zu Zeit solltest du die Dienstpost lesen«, antwortete Bertram ungehalten. »Das Präsidium hat uns angewiesen, bei diesen Fällen mit dem Landeskriminalamt zusammenzuarbeiten.«
Clara blickte aus dem Augenwinkel zu Bertram hinüber. Sein gereizter Gesichtsausdruck entspannte sich, als der Hüne mit seiner Mannschaft vor ihm stand. Herzlich schüttelte er dem anderen die Hand. Der grinste wie ein Lausbub nach einem gelungenen Streich. Bertrams Donnerstimme bekam einen warmen Klang.
»Grüß dich, Christoph. Tut gut, dich zu sehen, auch wenn das hier mal wieder kein erfreulicher Anlass ist. Wie geht’s denn?«
»Ich kann nicht klagen. Ein bisschen weniger Arbeit täte gut. Aber daraus scheint vorerst ja nichts zu werden. Das sind übrigens meine Leute: Hauptkommissarin Tina Hergenrath und Hauptkommissar Mario Bartoldi.«
Bertram gab beiden die Hand. »Meinen Mitarbeiter muss ich dir ja nun wirklich nicht mehr vorstellen«, raunte Bertram.
»O ja, ich hatte schon befürchtet, ihn hier zu sehen«, seufzte der Hüne und rollte dabei die Augen.
Clara blickte den beiden noch einen Moment hinterher, wie sie mit den zwei anderen die Treppe zum Eingang hinaufstiegen. Dann wandte sie sich ihrem Kollegen und den Männern vom KID zu, die ebenfalls Zaungäste dieser Begegnung gewesen waren.
Das Leder des alten englischen Sessels knarrte vertraut, als sie sich müde darauffallen ließ. Sie streifte die Pumps von den Füßen und warf sie nachlässig auf den Teppich. Als die Beine auf dem Hocker lagen, pochte das Blut heftig in ihren Zehen. Stöhnend massierte sie die Füße. Sie hatte diese Schuhmode schon immer gehasst. Aber was half’s? Man kam ja doch nicht daran vorbei. Langsam begann sie sich zu entspannen.
Wie sie einst in dieses Haus und in dieses Leben kam, wusste sie nicht mehr genau. Es spielte genau genommen auch keine Rolle. Sie hatte die Erinnerung abgelegt wie ein Kleid, das aus der Mode gekommen war. Sie nannte sich Inge. Dieser Name schien ihr passend. Mit zwei kräftigen Schlucken leerte sie ihr Weinglas. Chardonnay, etwas Besseres gab es nicht. Ihr langes haselnussfarbenes Haar lag wie ein Fächer auf ihren Schultern und verlieh ihrem muskulösen Körper einen weichen, femininen Ausdruck. Ihre Erschöpfung wich dem Gefühl einer unnatürlichen Zufriedenheit. Sie war erfolgreicher gewesen, als sie zu träumen gewagt hatte. Bald schon würde ihre Mission erfüllt sein. Doch was kam dann? Konnte sie so einfach von ihrer Aufgabe lassen und wieder ganz selbstverständlich in ihr normales Leben eintauchen?
Inge musste sich eingestehen, dass sie die Jagd liebte wie einen Rausch. Es erregte sie, Finten zu legen, die Dämonen in die Falle zu locken und die Angst in ihren Augen zu betrachten, wenn sie ihnen den Lebensatem nahm. Ohne ihren Atem verloren sie ihre Macht, konnten sie ihr nichts tun. Inges Mund verzog sich zu einem hässlichen Grinsen, als in ihr die Erinnerung an den letzten Dämon, den sie getötet hatte, wieder erwachte. Er hatte gezappelt wie ein Fisch an der Angel, als der Lebensodem aus ihm wich. Ihr langes Messer hatte den Bann gebrochen, in dem er andere Menschen gefangen hielt. Seine Zunge konnte sie nicht mehr einlullen. Er konnte seine rattenfängerischen Worte nicht mehr von sich geben, denen sie so blind vertrauten wie die Lemminge. Seine Finger konnten die anderen nicht mehr als Opferlämmer am Altar eines grausamen Gottes verstümmeln.
Inge goss sich zufrieden nach und nahm einen großen Schluck. Den Wein behielt sie eine Weile im Mund, bis er sein ganzes Aroma entfaltet hatte. Dann schluckte sie ihn mit einem tiefen Seufzer hinunter.
Der wievielte Dämon war es mittlerweile gewesen? Sie wusste es nicht. Diese Unwissenheit machte sie unsicher. Sie ließ diesen Gedanken wieder fallen. Wichtig war doch nur das Ziel. Weit entfernt glaubte sie es jedenfalls nicht mehr. Bald würden auch alle anderen aufwachen und begreifen. Dann war Inges Mission erfüllt. Das Ziel lag schon greifbar nahe. Aber bis dahin gab es noch einiges zu tun.
Inges Blick verfinsterte sich. Plötzliche Zweifel zermahlten ihre Visionen wie schroffe Mühlsteine. Hart presste sie die Lippen aufeinander. Warum hatten die anderen ihre Botschaft noch nicht verstanden? Noch erkannten sie nicht, dass Inge sie vor den Dämonen beschützte, noch hassten die Menschen sie für ihr eingeübtes Blutritual. Sie umklammerte unwillig das leere Glas. Warum dauerte es so lange, sie aufzurütteln? Oder blieb sie am Ende etwa die einzige, die die Wahrheit erkennen konnte? Nein, das konnte, das durfte nicht sein! Sie war die Botin, die Prophetin! Was aber, wenn ihr Rufen nicht gehört würde? Sie hasste diesen Gedanken. Er machte alles kaputt, fraß ihre Selbstzufriedenheit auf.
Das Glas zersprang, als es dem Druck ihrer Hand nicht mehr standhalten konnte. Feine Splitter bohrten sich in ihr Fleisch. Als wäre sie die Beobachterin eines fremden Geschehens, sah sie ohne jede Regung von Schmerz, wie das Blut von ihrer Hand auf das Parkett troff. Nein, das Blut sprach eine klare Sprache. Irgendwann würden die anderen ihre Botschaft begreifen; irgendwann! Bis dahin würde Inge ihrer Berufung folgen.
Der Anblick ihrer blutenden Hand erregte sie. Inge spürte heißes Verlangen. Mit ihrer unverletzten Hand begann sie sich zu streicheln. Ihre Finger bekamen plötzlich ein Eigenleben. Sie gehörten einem körperlosen Liebhaber, der ihrer verzweifelten Lust entstieg. Er liebkoste ihren Körper, streichelte zärtlich über ihre Beine. Langsam fuhr er nach oben. Dann glitt die Hand in ihren Slip. Mit heftigem Keuchen gab sie sich ihrer Begierde hin. Nein, sie würde nicht mit ihrer Mission aufhören! Noch nicht! Zu sehr liebte sie das erregende Gefühl der Jagd.
Caspari trat durch den Eingang des Turms. Durch die dicken Mauern war die Wärme des milden Oktobertags nicht nach innen gedrungen. Das eisige Klima kam indes nicht nur von der Kühle des Raumes. Der Zustand der Leiche jagte selbst dem Hartgesottensten einen Schauer über den Rücken. Caspari, der hinter Bertram ging, sah, wie sich diesem die Nackenhärchen stellten. Er selbst atmete beim Anblick des Toten geräuschvoll aus. Es war nicht das erste Mal, dass er einen Menschen so zugerichtet vorfand. Sein Magen reagierte mittlerweile auf diese Konfrontation des Grauens nicht mehr, Gott sei Dank. Gewöhnen konnte er sich an die Bilder von geschundenen Leibern trotzdem nicht. Sein Mitleid für diese so brutal ermordeten Menschen verdrängte jede Form des Abstumpfens.
»Porca miseria.«
Mario brach das Schweigen, wofür ihm Caspari dankbar war. Er blickte sich nach seinen Leuten um und sah einen jungen Streifenbeamten, der den Eingang bewachte. Sein Gesicht war kreidebleich. Der nachlässig weggewischte Speichel in den Mundwinkeln des jungen Beamten zeugte davon, dass er sicher zum ersten Mal mit dem Anblick einer so grausam zugerichteten Leiche konfrontiert war.
Die Männer von der Spurensicherung untersuchten den Boden hinter dem Folterstuhl. In ihren weißen Overalls, den Hauben auf dem Kopf und den Überschuhen aus Folie erschienen sie Caspari wie aus einer anderen Welt.
Bertram wandte sich zu ihm. »Die Kriminaltechnik ist fast fertig. Nur noch das kleine Stück da hinten.«
Neben der Leiche kniete Doktor Richter, der gerade die Temperatur des Verstorbenen zu ermitteln versuchte.
Caspari blickte ihn verwundert an. »Guten Abend, Doktor. Was machen Sie denn hier? Müssten Sie nicht längst in Heidelberg sein? Das Semester fängt doch bald an.«
»Guten Abend, Doktor Caspari. Der Innenminister des Landes Hessen höchstpersönlich hat die Kultusministerin von Baden-Württemberg gebeten, mich so lange zu beurlauben, bis die Mordserie aufgeklärt ist. Hatten Sie das schon wieder vergessen?«
Bertram machte auf einem Treppenabsatz halt. »Als ich an das Präsidium in Offenbach den Leichenfund meldete, wurde ich angewiesen, Doktor Richter einzuschalten.«
Die Treppenstufen knarrten, als Caspari hinabstieg. Bartoldi und Hergenrath folgten ihm in respektvollem Abstand. Unten angekommen, öffneten sie die Koffer und nahmen Vinylhandschuhe heraus. Während Caspari sich diese unkomfortable zweite Haut überstreifte, mied er den Blick zu Jungmann, dessen Augenpaar er auf sich gerichtet spürte. Er wollte eine Konfrontation so lange vermeiden, wie es nur irgendwie ging. Doch er wusste nur allzu gut, dass Jungmann nicht lange auf sich warten ließ. Bedächtig, als wolle er den Toten nicht in seiner Ruhe stören, ging er auf den Stuhl zu, dessen Nägel sich in das Fleisch des Unglücklichen gebohrt hatten.
»Können Sie schon etwas zur Todesursache sagen?«
Der Gerichtsmediziner richtete sich auf. Er war deutlich kleiner als Caspari. Sein grau meliertes Haar war kurz geschnitten, seine Kleidung tadellos. Selbst im Arztkittel sieht er noch elegant aus, schoss es Caspari durch den Kopf. Die farbliche Komposition von Hemd und Krawatte zeichneten ihn als einen Menschen mit weltmännischem Geschmack aus. Ein feiner Hauch von Eau de Toilette stieg Caspari in die Nase. Er war dankbar dafür. Der Duft von Sandelholz war ihm deutlich angenehmer als Formalin und Verwesungsgeruch.
Doktor Richter antwortete wie immer präzise. Überflüssige Ausführungen waren ihm wesensfremd. Die strenge Aura eines nüchternen preußischen Geheimrates umgab den Gerichtsmediziner seit jeher.
»Was sich bis jetzt sagen lässt, ist dies: Der Todeszeitpunkt ist wahrscheinlich zwischen gestern dreiundzwanzig Uhr und heute zwei Uhr morgens eingetreten. Der Mann wurde zuerst mit einer Gavotte erdrosselt. Die Drahtsaite staute das Blut in der Carotis. Für die medizinischen Analphabeten in diesem Raum: Das ist die Halsschlagader. Todesursache ist also nicht die Erstickung, sondern der Hirntod aufgrund eines dauerhaften Blutstaus im Gehirn. Die Zunge wurde dem Toten post mortem abgeschnitten, gleiches gilt für die Finger. Dass sich hier trotzdem noch relativ viel Blut befindet, weist darauf hin, dass die Amputation der Finger rasch nach der Erdrosselung stattgefunden haben muss. Bei der Zunge scheint der Täter sich etwas mehr Zeit gelassen zu haben. Die Amputationen sind, wie auch in den vorausgehenden Fällen, mit einer gewissen Professionalität ausgeführt worden. Die Wundränder sind glatt. Ebenso wurden die Knochen sehr korrekt durchtrennt. Meine Meinung dazu kennen Sie ja. Es muss jemand aus dem Metzgerhandwerk oder aus einem chirurgischen Beruf sein. Dementsprechend wurde dafür ein fachspezifisches Werkzeug benutzt. Da kommt nur ein sehr scharfes Schlachter- oder ein Amputationsmesser in Frage. Mit einem Skalpell schafft man so etwas nicht. Das ist alles, was ich bisher feststellen konnte. Die Details lesen Sie in meinem morgigen Bericht. Bevor wir den Toten allerdings aus seinem Nagelbett befreien, muss ich mir noch etwas genauer ansehen, wie er darauf sitzt.«
»Wie meinen Sie das, Dottore?« Bartoldi war neugierig herangetreten.
»Die Art, wie er sitzt, und wo die Nägel in welcher Tiefe in seinen Körper eingedrungen sind, gibt möglicherweise Aufschluss darüber, ob er in diesen Stuhl gestoßen wurde, oder ob man ihn vielleicht unter heftiger Gegenwehr seinerseits auf den Stuhl gedrückt hat.«
Caspari ging in die Hocke und sah sich die rechte Hand des Gefolterten aus nächster Nähe an. Die Handgelenke des Mannes waren bis auf die Knöchel wund gescheuert. An den Lederbändern, mit denen die Arme an den Lehnen fixiert waren, sah er Blut. Er musste bis zum Schluss versucht haben, sich zu befreien.
»Mario, ich will Detailaufnahmen von dem Toten. Kleidung, Gesichtsausdruck, Haltung der Hände, einfach alles. Sie kennen das ja schon zur Genüge.«
»Das könnt ihr euch schenken! Wir haben alles schon fotografiert«, schaltete sich Jungmann gereizt ein. »Es sei denn, dass das LKA über eine bessere Fotoausstattung verfügt als wir Provinzbullen.«
Caspari ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Das hier war sein Fall. Der »Chirurg«, wie die Polizei den Täter mittlerweile wegen seiner fachmännischen Amputationen nannte, hatte wieder einen Menschen getötet. Ihm waren Caspari und seine Mannschaft seit sechs Wochen auf den Fersen. Caspari hatte es zu seiner persönlichen Aufgabe gemacht, diesen Mörder zur Strecke zu bringen. Das war er den Opfern und ihren Familien schuldig. Das gereizte Klima zwischen Jungmann und ihm hatte hier keinen Platz. Das war eine reine Privatangelegenheit.
Er zog eine Taschenlampe und eine Lupe aus seiner Tasche. Der Leichnam erzählte seine Geschichte. Nichts davon durfte ihm entgehen. Als Caspari das Gesicht genauer betrachtete, durchflutete ihn eine Woge des Mitleids. Dieser Mensch hatte nicht in Frieden aus diesem Leben gehen dürfen. Die verkrampften und verzerrten Gesichtszüge des Mannes ließen keinen Zweifel daran. Obwohl sie leblos waren, meinte Caspari einen Ausdruck von Trauer in den Augen zu entdecken. Vielleicht gab es für den Toten Menschen, die er nicht so plötzlich und unvorbereitet verlassen wollte, denen er gern noch Lebewohl gesagt hätte. Ein solcher Tod hatte eine furchtbare zerstörerische Gewalt nicht nur für das Opfer, sondern auch für alle, denen dieser Mensch lieb und teuer war. Caspari wurde einmal mehr bewusst, wie krank jemand sein musste, der, einem absurden Trieb folgend, ohne Mitleid für seine Opfer und deren Familien auf diese Weise tötete.
Er wandte sich dem Gerichtsmediziner zu. »Und?«
Doktor Richter gefielen Ein-Wort-Sätze überhaupt nicht. Als Zeichen seiner Missbilligung zog er die linke Augenbraue hoch. Caspari kannte diese Reaktion. Sie störte ihn nicht weiter. Vor einer Leiche kniend war ihm der akademisch korrekten Satzbau egal.
»Der Mann wurde ohne Gegenwehr in den Stuhl gesetzt«, antwortete der Arzt. »Wahrscheinlich betäubt und dann zum Ort seiner Hinrichtung gebracht, wie die anderen auch.«
»Woran machen Sie das fest?«
In Detailfragen ließ Caspari nicht locker. Eine scheinbar unwesentliche Beobachtung konnte sich als wichtiges Teilchen im großen Mosaik des Mordes entpuppen.
Doktor Richter deutete auf die Nägel, die sich in das Gesäß und die Oberschenkel des Toten gebohrt hatten. »Wäre er in den Stuhl mit Wucht gestoßen worden, hätten sich die Nägel nicht so sauber in das Fleisch gebohrt, sondern breitere Wunden gerissen. Deshalb entfällt auch die Möglichkeit eines Kampfes, in dem er in diesen Stuhl gedrückt worden wäre. Er ist wahrscheinlich darauf gehoben worden, ohne Gegenwehr zu leisten. Es würde mich keineswegs wundern, wenn wir auch in seinem Blut die Reste von Chloroform finden würden. Dann wurden die Bänder um Hände, Brust und Beine fest gezogen. Wahrscheinlich hat man Druck auf die Oberschenkel und das Gesäß ausgeübt, was den Körper mehr oder weniger gleichmäßig tief in das Nagelbrett gedrückt hat. Genauere Angaben kann ich erst nach der Obduktion machen.«
Caspari nickte. Die Vorgehensweise war identisch mit den drei Fällen, die sie untersuchten.
Er sehnte sich nach frischer Luft und blickte zum Ausgang hinauf. Der junge Beamte, der dort oben stand, schien nach der Beschreibung des Gerichtsmediziners mit dem Rest seines Mageninhaltes zu kämpfen. Caspari sah, wie er tief Luft holte und dabei immer wieder aufstieß. Er musste jetzt etwas tun, bevor der Junge den ganzen Tatort voll kotzte. Eilig lief er die Holztreppe hinauf. Tina, die gerade in ein Gespräch mit einem Kriminaltechniker vertieft war, sah irritiert auf.
»Wie spät ist es jetzt?«, fragte Caspari den jungen Streifenbeamten.
Der blickte ihn überrascht an und blickte auf seine Uhr. »Halb sechs.«
Caspari griff in die Brusttasche seiner Jacke und holte sein Portmonee heraus. »Ah, gut! Dann haben die Geschäfte ja noch auf. Kennen Sie den Tabakladen beim Ziegelturm?«
»Ja, ich glaube schon.«
»Bitte seien Sie so gut und holen mir ein paar Zigarren dort. Ich möchte drei Santa Damiana Pyramides und drei Punch Corona. Können Sie sich das merken?«
Der Junge schüttelte vollkommen irritiert den Kopf.
Caspari ließ nicht locker. »Schreiben Sie sich das auf!«
Caspari diktierte dem jungen Beamten, der die Angaben nervös in seinen Notizblock kritzelte. Dann steckte er ihm einen Fünfzig-Euro-Schein in die Brusttasche und klopfte ihm auf die Schulter. »Ach, und bringen Sie mir noch ein Päckchen Streichhölzer mit! Die gibt es dort als Beigabe kostenlos.«
Caspari sah dem jungen Mann ins Gesicht. Der Verwirrung war ein Ausdruck von Dankbarkeit gewichen. Er klopfte ihm auf die Schulter und ging wieder nach unten.
Jungmann verzog verächtlich seinen schmalen Mund. »Was soll der Mist? Kannst du dir deine Zigarren nicht selbst holen? Wer bist du, dass du hier einfach einen Beamten für dein Privatvergnügen abziehst?«
Caspari brauchte seine Konzentration nicht mehr für die Untersuchung der Leiche. Nun konnte er sich ganz seinem Intimfeind widmen. Eisig blickte er Jungmann an. Aus den Augenwinkeln sah er, wie Tina und Mario fragende Blicke tauschten.
»Wer ich bin? Ich bin derjenige, der die Untersuchung hier leitet! Und ich kann keinen jungen Kollegen gebrauchen, der mir beim Anblick seiner ersten Leiche den ganzen Tatort voll kotzt. Erinnere dich einmal an deinen ersten Toten. Mein Gott, was hast du da gereihert! Und der sah nicht annähernd so schlimm aus wie dieser hier. Im Übrigen: Wenn dir mein Stil nicht passt, oder wenn du Privates nicht von Dienstlichem trennen kannst, wird es kein Problem sein, dich von dem Fall abzuziehen.«
Caspari wandte sich zu Bertram um, der Jungmann einen warnenden Blick zuwarf. Der verzog seinen Mund zu einem verächtlichen Grinsen.
Bertram winkte Caspari zu sich und stellte sich mit ihm etwas abseits. »Was soll ich nur mit euch beiden machen? Wollt ihr euch wirklich gegenseitig das Leben schwer machen, bis ihr alt und grau seid? Mensch, früher wart ihr unzertrennlich. Ich mag euch beide. Ich kann nicht verstehen, dass ihr euch anfallt wie tollwütige Hunde, wenn ihr euch über den Weg lauft. Das muss ein Ende haben! Elke leidet furchtbar darunter.«
Der Name seiner Ex-Frau versetzte Caspari selbst nach den Jahren der Trennung immer noch einen Stich. Er schaute unter sich. Er wollte nicht, dass sein früherer Mentor es bemerkte. Was sollte er darauf antworten? Ratlos zuckte er mit den Schultern.
»Es ist zu viel kaputt gegangen bei Jürgen und bei mir. Das kann man nicht mehr kitten.«
»Dann versucht wenigstens, euch nicht noch mehr auf der Seele herumzutrampeln.«
Caspari schaute zu Bertram mit versöhnlichem Blick. »An mir soll es nicht liegen«, antwortete er und fügte mit ernster Miene hinzu: »Wenn er allerdings unsere privaten Probleme miteinander nicht aus dem Fall heraushalten kann, werde ich dich auf dem Dienstweg bitten, ihn davon abzuziehen. Es geht hier um Menschenleben! Wir müssen den Killer kriegen, bevor er noch mehr Menschen hinrichtet. Das hat für mich absoluten Vorrang gegenüber verletzten Eitelkeiten.«
Bertram nickte. »Du hast recht«, antwortete er. »Willst du eine Dienstbesprechung einberufen?«
»Morgen, wenn die ersten Laborergebnisse vorliegen und die Protokolle der Zeugenvernehmungen geschrieben sind, machen wir einen runden Tisch. Sagen wir: so gegen halb elf Uhr?«
»Das müsste reichen, um alles zusammengestellt zu haben. Anschließend sollten wir uns der Presse widmen.«
Christoph rollte die Augen. »Ja, du hast recht!«, lenkte er ein. »Sag mal, was wisst ihr eigentlich von dem Toten?« Es war ihm unangenehm, dass er fast vergessen hätte, diese Frage zu stellen. Normalerweise war das eines der ersten Dinge, die er geklärt wissen wollte. Doch bei diesem Mord war es anders. Er hatte sich diesmal wohl mehr, als ihm lieb war, auf die Begegnung mit Jungmann konzentriert.
»Das ist…« Bertram unterbrach sich und fing noch einmal von vorn an. »Das war Doktor Karl Hoffmann, ein bekannter Gelnhäuser Arzt, Allgemeinmediziner. Im vergangenen Jahr feierte er seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag mit allerlei Stadtprominenz. Vor sieben Jahren hatte er seine Praxis verkauft, nachdem seine Frau gestorben war. Hoffmann lebte seither allein. Er hat einen Sohn, der in den USA lebt, eine Tochter in Mainz und eine Schwester, die hier in einem Altenpflegeheim lebt. Ein weiterer Verwandter, der Enkelsohn dieser Schwester, ist in Altenhaßlau gemeldet.«
Caspari notierte sich Name und Adresse des Großneffen. »Also wieder ein Arzt. Das würde für unseren ›Chirurgen‹ sprechen. Die Art der Hinrichtung und die Verstümmelungen an dem Toten sprechen auch dafür. Die Inszenierung ist hier allerdings eine ganz andere. Der Ort ist diesmal anders gewählt, und der Scheiterhaufen fehlt. Ich bin mir noch nicht im Klaren, was das zu bedeuten hat.«
Ein untersetzter Polizist kam durch das Turmtor und rief von der Galerie aus nach unten: »Der Leichenwagen ist da! Kann der Bestatter den Toten mitnehmen?«
Doktor Richter blickte hoch. »Von mir aus schon. Wie steht es mit der Kriminaltechnik, Herr Jungmann?«
»Wir sind mit allem fertig«, antwortete er und fügte mit eisigem Ton hinzu: »Es sei denn, das Landeskriminalamt braucht noch etwas Zeit.«
Caspari blickte seine Mitarbeiter an. »Ich habe alles gesehen, was ich wollte. Tina, Mario, sind Sie fertig?«
Tina nickte. »Ich denke, wir haben alles.«
Mario tätschelte seine Kamera. »Alles im Kasten, Chef!«
Caspari blickte zu Bertram. »Na, dann kann sie in die Gerichtsmedizin. Ich möchte, dass der Stuhl in unser Labor nach Wiesbaden kommt.« Respektvoll fragte er: »Ist das in Ordnung, wenn unser Laden ihn auseinander nimmt?«
Bertram nickte. »Einverstanden. Ich kümmere mich darum, dass er zu euch gebracht wird.«
Ein rumpelndes Geräusch ließ sie aufschrecken. Zwei schwarz gekleidete Männer manövrierten gerade einen Zinksarg durch das Tor zur Holztreppe. Langsam kamen sie damit die Treppe herunter. Als sie schnaufend und verschwitzt den Sarg auf dem Boden abstellten, richtete sich ihr Blick auf die Leiche im Folterstuhl.
»Großer Gott«, entfuhr es dem einen, »man bekommt im Laufe der Jahre ja einiges zu sehen; aber das hier, das ist ja furchtbar!«
Caspari zuckte mit dem Schultern und ging zur Treppe. Tina und Mario folgten ihm. Bertram wies sein Team noch an, den Bestattern zu helfen, dann schloss er sich an.
Christoph war froh, den Turm wieder verlassen zu können. Tief sog er die angenehm milde Abendluft ein. Ihr würziger Duft verdrängte die finsteren Gedanken. Der junge Streifenbeamte kam durch das Gartentor und reichte ihm eine kleine Schachtel, ein Päckchen Streichhölzer und das Wechselgeld.
»Mit den besten Empfehlungen des Inhabers. Bei dieser Bestellung wusste er gleich, für wen die Zigarren sind.«
Caspari schmunzelte. Er hatte wieder etwas, womit er seinen Humidor auffüllen konnte. Die aschfahle Gesichtsfarbe des Jungen war einem gesunden Rot gewichen.
Er wandte sich seinen Mitarbeitern zu. »Tina und Mario, Sie fahren mit auf das Revier und sind bei den Verhören der Schauspieltruppe dabei. Ich fahre jetzt noch zum Großneffen des Verstorbenen. Morgen Früh gehe ich dann in das Altenpflegeheim zur Schwester von Doktor Hoffmann und rede mit ihr.«
»Lass dich von einem der Notfallseelsorger begleiten«, schaltete sich Bertram ein. »Wir haben hier ein Team, das sich um die Zeugen kümmert. Ich frage mal schnell nach, wer von denen noch Zeit und Kraft hat.«
Ohne auf eine Erwiderung zu warten, war Bertram losgezogen. Caspari sah ihn mit einer jungen Frau zurückkommen, die in ihren Jeans, der Bluse und den Turnschuhen sportlich wirkte. Er fragte sich, ob er sie ohne ihre violette Einsatzweste der Notfallseelsorge für eine Pfarrerin gehalten hätte. Gleich darauf verwarf er diesen Gedanken. Von Klischees hatte er noch nie etwas gehalten. Er hatte sich selbst ja seit jeher Mühe gegeben, keinem zu entsprechen. Irgendwie kam ihm diese Frau bekannt vor, er konnte sie aber beim besten Willen nicht zuordnen. Als sie ihren Kopf zur Seite drehte, während sie Bertram etwas sagte, erkannte Christoph den in eigentümlicher Weise geflochtenen Zopf wieder. Ein flaues Gefühl machte sich in seiner Magengrube breit. Hastig blickte er zu seiner Mitarbeiterin.
»Tina, fahren Sie lieber mit der Pfarrerin«, sagte er heiser. »Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich bei den Verhören im Revier anwesend bin.«
»Nee, Chef, das geht nun wirklich nicht mehr. Wir haben uns schon mit den Kollegen aufgeteilt und untereinander abgesprochen. Das mit den Angehörigen ist Ihr Ding!«
Casparis Ohren wurden plötzlich heiß. Aus Tinas belustigtem Blick zu schließen, hatte sein ganzes Gesicht die leuchtend rote Farbe seines Bartes angenommen.
Mario zog die Augenbrauen hoch und spitzte den Mund. »Ma che bella!«
Bertram stand nun mit Bennys Opfer aus dem Fitnesscenter vor ihm. »Christoph, das ist die Notfallseelsorgerin, Pfarrerin Frank.– Frau Frank, das ist Doktor Caspari, Oberhauptkommissar beim Landeskriminalamt.«
Caspari hatte wieder jenen Kloß im Hals, der sich immer dann zu expandieren entschloss, wenn ihm eine attraktive Frau begegnete. Er zwang sich zu einem Lächeln, nickte kurz und gab ihr die Hand.
»Guten Abend.« Ihre Stimme war weich, klangvoll und freundlich.
Caspari fasste Mut und sprach in der Hoffnung, sein Kloß hätte sich nach diesem freundlichen Gruß dazu durchgerungen, auf Erbsengröße zu schrumpfen. »Angenehm. Lassen Sie uns gleich fahren. Das wird vielleicht noch eine lange Nacht.«
Sein sonst sonoriger Bass hörte sich zwar merkwürdig heiser an. Doch er hatte es aber immerhin geschafft, zu antworten.
»Ja, Sie haben recht. Kann ich bei Ihnen mitfahren? Ich wurde von einem Streifenwagen hierher gebracht.«
Caspari nickte verlegen. Mario klopfte ihm auf die Schulter und zwinkerte seinem Vorgesetzten mit einem »Andiamo« zu. Auf dem Weg zum Auto überlegte Caspari fieberhaft, wie er die peinliche Situation im Fitnesscenter wieder aus der Welt schaffen konnte. Beim Gespräch mit dem Großneffen des Toten brauchte er schließlich alle seine Sinne und durfte nicht abgelenkt oder blockiert sein.
Das war allerdings nicht das einzige, was ihn zu diesem Versuch trieb. Unter dem massiven Panzer seiner Schüchternheit regte sich so etwas wie ein kleiner Schimmer von Interesse. Doch was sollte er sagen? Er begann zu schwitzen. Bestimmt war sein Gesicht immer noch knallrot. In ihm keimte die verzweifelte Hoffnung, dass es bei der einsetzenden Dämmerung nicht so auffiel. Als er ansetzen wollte, kam nur ein »Mmmmh« aus seinem Mund. Seine Zunge klebte am Gaumen und ließ sich nur mit großer Anstrengung lösen. Er kam sich vor wie ein Idiot.
»Bevor wir gemeinsam arbeiten– ich meine«, er räusperte sich ein wenig zu laut, »bevor wir in diesen Wagen steigen, nun ja, möchte ich etwas aus der Welt schaffen, was mir sehr– wie soll ich sagen– sehr peinlich ist.«
Die junge Pfarrerin sah ihn mit einer Mischung aus Interesse und Belustigung an.
»Das im ›Get Fit‹, na ja, Benny ist immer ein wenig… unsensibel, besser gesagt, er benimmt sich manchmal wie der letzte Trottel.«
Er sah, wie sich der Mund von Clara Frank zu einem leisen Lachen verzog. »Ach, Sie waren das in Begleitung dieses Ladykillers! Ich hatte Sie jetzt auf den ersten Blick gar nicht erkannt. Im Fitnesscenter sahen Sie mit der weißen Jacke und dem schwarzen Rock so anders aus.«
»Hakama, der Rock heißt Hakama. Das ist die Trainingskleidung im Aikido.«
»Aikido?«, wiederholte sie fragend.
»Das ist eine japanische Kampfkunst«, gab er heiser zurück.
»Und ihr Trainingspartner führt Sie immer so vor, wenn er Frauen anspricht?«
»Gelegentlich schon. Benny ist im Grunde genommen ein feiner Kerl. Aber wenn es um das weibliche Geschlecht geht, benimmt er sich wie ein Neandertaler.«
Clara lachte auf, und Christoph merkte, dass er langsam wieder zu seiner alten Stimmlage fand. Er hielt ihr die Wagentür auf und ließ sie einsteigen.
Auf dem Weg nach Altenhaßlau erzählte er ihr bruchstückhaft über den Mord, das Opfer und seine Verwandten. Sie hörte schweigend zu. Caspari bekam am Lenkrad feuchte Hände. Ganz leise regte sich eine tiefe Sehnsucht in ihm. Er genoss es, ihre körperliche Nähe im Auto zu spüren. Andererseits war er gerade im Dienst. Und der verlangte höchste Aufmerksamkeit. Er war bereit, dieser Aufgabe seine volle Konzentration zu widmen. Die Aufklärung von Morden war sein Metier; hier war er zu Hause, hier war er auf eine Art und Weise selbstsicher, wie er es rein privat im Beisein von Frauen selten hatte sein können. Die berufliche Ebene war für ihn die einzige Chance, einer so schönen und sympathischen Frau nahe zu sein.
»Haben Sie schon einmal eine Todesnachricht überbracht?«
Sie blickte ihn wortlos an. Dann sprach sie mit einer ruhigen Stimme: »Nichts von dem, was ich seit Beginn dieses Einsatzes getan habe, hat es zuvor in meinem Leben gegeben. Das gilt auch für die Überbringung der Nachricht.«
»Ich bin froh, jemanden bei mir zu haben, der nicht vor Selbstsicherheit strotzt«, entgegnete Caspari. »Das hilft mir, mein flaues Gefühl im Magen besser zu ertragen. Ich habe in den vergangenen Jahren häufiger Todesnachrichten überbringen müssen. Glauben Sie mir: Man gewöhnt sich nie daran!«
Er war erstaunt über seine eigenen Worte. Wie hatten sie gebildet und ausgesprochen werden können, ohne dass er über sie nachgedacht hatte?
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Danke.«
Die Hauptstraße lag im Ortskern. Sie stiegen vor einem schön restaurierten Fachwerkhaus aus. Ein altes, grün gestrichenes Eisentor versperrte ihnen den Weg in den Hof, von dem aus man zum Eingang auf der rückliegenden Seite kommen musste, wie Caspari annahm. Er konnte mit Mühe darübersehen. Eine Pergola, die mit wildem Wein bewachsen war, überdachte den mit Kopfstein gepflasterten Hof. Alles machte einen gepflegten Eindruck.
Caspari drückte den in der Hauswand eingelassenen Klingelknopf, als im selben Augenblick ein Mann auf einem Rennrad um die Kurve geschossen kam. Er bremste und stieg vor dem Haus ab. Caspari musterte ihn in seinem engen Radsport-Dress. Mit dem Helm, der Brille und den Handschuhen wirkte er futuristisch. An diesem Mann war kein Gramm Fett zu viel. Er war durchtrainiert und drahtig. Etwas beschämt schaute Caspari an sich herunter. Er war beileibe nicht dick; aber von einem Waschbrettbauch war er meilenweit entfernt.
Der Radfahrer musterte sie. »Kann ich Ihnen helfen?«
Caspari zog seinen Dienstausweis. »Jochen Arnold?«
»Ja, der bin ich. Worum geht es denn?«
»Christoph Caspari vom Landeskriminalamt. Das ist Pfarrerin Frank. Wir müssen mit Ihnen reden.«
Arnold erbleichte. Den Ausdruck auf dem Gesicht seines Gegenübers hatte Caspari schon oft gesehen. Der Mund stand offen, die Augen weiteten sich wie bei einem bösen Traum, dem man durch hastiges Erwachen zu entfliehen versucht.
»Was ist denn passiert?«, fragte Arnold entsetzt.
»Herr Arnold, lassen Sie uns das besser im Haus besprechen«, schaltete sich die Pfarrerin ein.
»Ja, natürlich. Bitte entschuldigen Sie.«
Arnold kramte aus der Satteltasche einen Schlüssel und öffnete das Hoftor. Er ging voraus und stellte das Rad nachlässig an die Hauswand. Caspari folgte ihm nach der Pfarrerin und schloss das Tor hinter sich. Gierig sog er unter dem Blätterdach noch einmal die klare Abendluft mit ihrem milden Aroma ein, bevor er in das Haus trat. Arnold führte sie in eine große Küche und bat sie, sich an den massiven Esstisch zu setzten. Mit fahrigen Bewegungen entledigte er sich seiner Radsportschuhe und schlüpfte hastig in ein Paar Hausschuhe, die im Flur standen. Er wirkte nervös, als er sich zu ihnen setzte.
»Herr Arnold«, begann die Pfarrerin mit ruhiger, einfühlsamer Stimme, »wir müssen Ihnen eine schlimme Mitteilung machen.«
Caspari schaute sie überrascht an. Sie hatten auf der Fahrt gar nicht darüber gesprochen, wer das Gespräch beginnen sollte. Im ersten Augenblick war er irritiert über ihre Initiative. Doch ihre Art, mit dem Angehörigen zu reden, empfand er als sehr angenehm und empathisch.
»Ihr Großonkel«, fuhr sie fort, »Doktor Hoffmann, ist leider verstorben.«
»Wie?«, fragte Arnold mit heiserer Stimme.
»So wie es aussieht, ist er das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Mehr kann Ihnen Doktor Caspari sagen.«
»Herr Arnold, ihr Großonkel ist in der vergangenen Nacht im Gelnhäuser Hexenturm gefoltert und dann erdrosselt worden. Mehr kann ich Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Es tut mir sehr leid!«
Arnold rang nach Fassung. Er presste die Lippen aufeinander, während der Unterkiefer zitterte. Mit dem Handrücken fuhr er sich über die Augen, dann konnte er die Tränen nicht mehr halten. Er vergrub das Gesicht in seine Hände und schluchzte leise.
Caspari war froh, dass er die Notfallseelsorgerin mitgenommen hatte. Fremde Menschen zu trösten fiel ihm schwer. Er konnte mit der sich plötzlich einstellenden Nähe nur schwer umgehen. Außerdem war der emotionale Abstand für ihn wichtig, um klar denken zu können.
Clara Frank legte ihre Hand auf Arnolds Arm und fuhr ihm mit der anderen sanft über den Rücken. Caspari fühlte sich wie ein Voyeur. Er versuchte seinen Blick abzuwenden, es gelang ihm aber nicht. Gebannt blickte er auf die Szene wie auf eine Bronzeplastik im Museum. Alles schien er intensiver wahrzunehmen als sonst. Das kurze, blonde Haar Arnolds, das an der Stirn licht zu werden begann, der durchtrainierte Körper, von dem ein leichter Schweißgeruch ausging, und die dunklen Augen, aus denen er sich nun die Tränen wischte, prägten sich fest in Casparis Bewusstsein ein.
Daneben drängte sich eine Wahrnehmung ganz unprofessioneller Art. Er roch an diesem Abend zum ersten Mal Clara Franks Parfüm. Es war ein angenehm weicher, leichter Duft. Er versuchte ihn in seiner Nase und in seiner Erinnerung festzuhalten. Sein Blick glitt über ihr Gesicht. Die ebenmäßige Nase gefiel ihm genauso wie der Mund, dessen Bewegungen ihre Empfindungen stumm zu beschreiben schienen. Caspari tat sich schwer, seine Aufmerksamkeit von ihrem ausdrucksvollen Gesicht und ihren grünblauen Augen weg wieder auf Jochen Arnold zu lenken. Tief atmete er durch.
Arnold fasste sich. »Wissen Sie, er war nicht nur mein Großonkel. Er war mir der Vater, den ich nie hatte. Alles, was ich heute bin und kann, verdanke ich meinem Großonkel«, erklärte er.
Er stand auf, nahm drei Gläser aus einem Hängeschrank und goss sich Wasser ein. Danach fragte er Christoph und die Pfarrerin, ob sie auch etwas trinken wollten. Beide nickten und ließen sich einschenken. Sie tranken schweigend. Caspari spürte, dass Arnold diese Pause brauchte, um sich von dem Schock zu erholen. Arnold starrte auf sein Glas, das er mit wenigen hastigen Zügen ausgetrunken hatte, bevor er weitersprach.
»Wissen Sie schon, wer es war? Ich meine, wer bringt denn so einen lieben alten Mann einfach um?«
»Wir verfolgen mehrere Spuren. Mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Morgen, wenn wir die Untersuchungsergebnisse ausgewertet haben, wissen wir mehr.«
Caspari vermied es, von dem Serientäter zu sprechen. Er wollte Arnold nicht mehr belasten, als er es ohnehin schon war.
»Ich muss Sie bitten, morgen Früh zur Polizeiwache nach Gelnhausen zu kommen.«
»Warum? Verdächtigen Sie etwa mich?« Arnold starrte ihn ungläubig an.
»Nein, aber wir hoffen, von Ihnen etwas über die Menschen erfahren zu können, mit denen Ihr Großonkel Kontakt hatte. Vielleicht finden wir unter ihnen zumindest eine Person, die den Mörder kennt. Mit Ihrer Großmutter müssen wir allerdings auch sprechen!«
»Ausgeschlossen!«, rief Arnold heftig. »Die Frau hat keine besonders stabile Gesundheit! Sie lebt in einem Seniorenheim! Die Nachricht vom Tod ihres Bruders wird sie umbringen!«
»Sie können es Ihrer Großmutter nicht verschweigen«, schaltete sich Clara Frank ein. »Sagen Sie es ihr, bevor sie von anderen darauf angesprochen wird. Wenn es Ihnen eine Hilfe ist, gehe ich mit Ihnen zu ihr.«
»Ich werde ebenfalls mitkommen«, unterstrich Caspari. »Keine Angst, ich werde die größtmögliche Rücksicht auf Ihre Großmutter nehmen.«
Caspari erhob sich müde.
Clara Frank blickte Arnold an. »Haben Sie jemanden, der jetzt bei Ihnen sein kann? Soll ich jemanden für Sie anrufen?«
Arnold schüttelte den Kopf. »Nein, danke. Das ist sehr nett. Ich lebe allein, wissen Sie? Die traurige Pflicht, meinen Großcousin und meine Großcousine zu informieren, liegt wohl bei mir. Ich gehe dann rüber zu den Nachbarn, alte Freunde der Familie. Da habe ich Menschen, mit denen ich darüber reden kann.«
»In welchem Altenheim wohnt Ihre Großmutter?«
Arnold wirkte erschöpft. »Im Kreisruheheim.«
»Können Sie um neun Uhr dort sein?«
Arnold nickte.
Caspari blickte fragend zu der Seelsorgerin.
»Neun Uhr ist in Ordnung.«
Er spürte den Drang, wieder klare Abendluft einzuatmen. Auf dem Weg zum Ausgang hielt er aber noch einmal inne und wendete sich um.
»Fast hätte ich es vergessen. In der Kleidung Ihres Großonkels waren keine Schlüssel zu finden. Sind Sie im Besitz von Haustür- oder Wohnungsschlüssel?«
»Ja, natürlich. Ich habe öfters nach dem Haus gesehen, wenn er seine Kinder besuchte.«
Arnold gab ihm ein Schlüsselbund. Er begleitete sie zur Tür. Beim Verabschieden reichte er beiden die Hand.
Caspari gefiel der feste, entschlossene Händedruck. Er hasste das Gefühl, einen feuchten Schwamm zu drücken. Linkisch öffnete er der Pfarrerin das Hoftor und die Wagentür. Ihre Blicke trafen sich, als Clara Frank einstieg. Caspari bemerkte, wie ein Schmunzeln über ihr müde wirkendes Gesicht huschte. Bevor er losfuhr, gab er eine Nummer auf der Tastatur am Radio ein. Der CD-Wechsler startete, und eine Cello-Suite1 erfüllte mit ihrer ruhig-melancholischen Melodie den Innenraum des Wagens. Die Frau neben ihm legte ihren Kopf in den Nacken und atmete geräuschvoll aus. Sie schloss die Augen und nahm gierig jeden Ton in sich auf.
»Bach?«, fragte sie leise.
»Bach«, nickte er zustimmend.
Schweigend genossen sie die Ruhe, die das Cello wie einen kostbaren Teppich ausbreitete. Während sie vor den heruntergelassenen Schranken des Bahnübergangs standen, der Altenhaßlau von Gelnhausen trennt, zerriss der Klingelton von Casparis Mobiltelefon die klangvolle Stille. Unwillig fischte er es aus seiner Jackentasche.
Tina meldete sich am anderen Ende. »Chef, wir sind hier so weit fertig und können jetzt mit der Kriminaltechnik in die Wohnung des Opfers. Das einzige Problem ist bloß, dass wir keinen Schlüssel haben. Die Kollegen wollen einen Schlüsseldienst anfordern.«
»Nicht nötig«, antwortete er müde. »Ich bin auf dem Weg mit dem Schlüssel. Wir treffen uns vor dem Haus.«
Der Zauber der Musik war verflogen. Die Aussicht, die halbe Nacht mit dem Durchsuchen von Doktor Hoffmanns Haus zuzubringen, drückte seine Stimmung. Er wollte nur in seinem Wagen sitzen und mit dieser Frau dem Atem des virtuos gespielten Instruments lauschen. Sie seufzte neben ihm, und er nahm es als ein Ausdruck des Bedauerns.
»Das wird wohl noch eine lange Nacht für Sie.«
»Das steht zu befürchten«, raunte er.
Ein Intercity Express rauschte vorbei, und die Schranken öffneten sich. Langsam arbeitete sich der schwere Wagen durch die Innenstadt. Je näher sie dem Untermarkt kamen, umso unruhiger wurde Caspari. Er wollte noch etwas sagen. Hektisch suchte er nach Worten, die beschreiben sollten, wie wohl er sich in ihrer Nähe gefühlt hatte. Doch ihm wollte nichts einfallen. Sollte er es nicht doch lieber lassen? Wenn er schwiege, würde er jeder Peinlichkeit aus dem Weg gehen.
»Hier ist es!«
Ihre Stimme riss ihn aus seinen Grübeleien. Der Wagen kam vor dem Eingang des Pfarrhauses zum Stehen.
»Danke«, sagte sie ihm zugewandt.
»Wofür?«, fragte er überrascht.
»Das war mein erster Einsatz. Sie haben mir trotzdem zugetraut, dass ich das schaffe.«
»Es war sehr angenehm, mit Ihnen zusammenzuarbeiten«, gab er spontan zurück und war froh, dass ihm eine unverfängliche Antwort geglückt war.
Ein Lächeln huschte ihr über das Gesicht. »Bis morgen«, sagte sie erleichtert und stieg aus dem Volvo.
Caspari nickte zum Abschied und fuhr davon. Im Rückspiegel sah er, wie sie ihre Tür aufschloss und von dem dunklen Pfarrhaus verschluckt wurde. Ihr Duft begleitete ihn bis vor Doktor Hoffmanns Haus.
»Na, Chef, wie ist es gelaufen?«, fragte Tina mit einem verschwörerischen Ton in der Stimme.
»Der Großneffe hatte ein enges Verhältnis zum Ermordeten. Entsprechend betroffen hat er auch reagiert«, antwortete Caspari sachlich.
Tina rollte die Augen.
»Patrone«, schaltete sich Mario ein, »wir wissen, wie es ist, wenn man eine Todesnachricht überbringt. Tina meinte eigentlich etwas Anderes.«
Caspari lächelte. Seine beiden Assistenten waren die einzigen Mitarbeiter des Landeskriminalamts, die seine Geschichte kannten. Seine große Schüchternheit gegenüber Frauen, denen er außerhalb seiner beruflichen Aufgaben begegnete, war ihnen nicht entgangen. Tina und Mario versuchten von Zeit zu Zeit, Amor zu spielen. Meist musste dann eine Freundin oder eine Cousine herhalten. Wenn sie nach einem langen Arbeitstag noch gemeinsam ein Bier trinken gingen, tauchte plötzlich eine dieser Damen auf und versuchte, mit Caspari ins Gespräch zu kommen. Meist fiel ihm nichts ein, worüber er mit einer wildfremden Frau hätte reden können. Eigentlich frustrierten ihn solche Begegnungen, weil er sich als Langweiler vorkam. Andererseits wollte er Tina und Mario nicht vor den Kopf stoßen, hinter deren Kuppelversuchen er ein aufrichtiges Bemühen und Sorgen um ihn sah.
»Die Lotosblüte entfaltet sich dort am prächtigsten, wo man es am wenigsten vermutet«, antwortete er nach einer Pause.
»Che? Was heißt das jetzt wieder?« Mario schüttelte überfordert den Kopf.
»Alles und nichts, mein Lieber«, meinte Tina und klopfte ihm auf die Schulter. »Ich erkläre es dir nachher.– Wir brauchen den Schlüssel, Chef. Sie sollten nach Hause fahren. Lukas wird sicher schon lange warten.«
Caspari war dankbar für ihre Rücksichtnahme. Er wusste, dass er sich auf seine Mitarbeiter verlassen konnte. Müde drückte er ihr den Schlüssel in die Hand, nickte beiden zu und ging zu seinem Wagen.
Hinter sich hörte er Mario fragen: »Was ist das mit dem Lotos?«
»Der wächst in Asien und gedeiht am besten im Schlamm.«
»He? Was meint er damit?« Mario war hilflos.
»Er meint, dass man dem richtigen Menschen meist dann begegnet, wenn man gar nicht damit rechnet.«
»Ah– und was bedeutet das?«
»Wir sollen uns keine Sorgen machen. Comprende?«
»Mamma mia, ich kapiere gar nichts!«
»Das musst du auch nicht, Schätzchen. Lass uns arbeiten!«