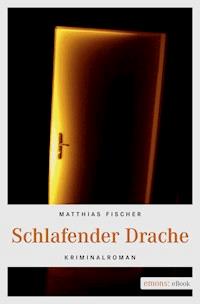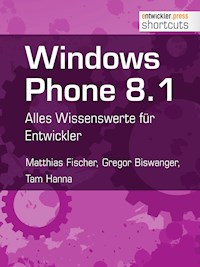9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Kriminalrat und die Pfarrerin: ein ungleiches Ermittlerduo, das nicht besser harmonieren könnte. Kriminalrat Dr. Caspari kehrt nach längerer Auszeit in den Dienst beim Bundeskriminalamt Wiesbaden zurück und wird gleich mit einem heiklen Fall betraut: Er soll ermitteln, warum eine Elitepolizistin sensible Daten von einem Firmencomputer gestohlen und sich anschließend eine Schießerei mit dem Wachpersonal geliefert hat. Doch die Frau schweigt beharrlich. Als es Caspari endlich gelingt, ihr Vertrauen zu gewinnen, eröffnet sich ihm ein erschreckendes Szenario von landesweitem Ausmaß.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Matthias Fischer, geboren 1964 in Hanau, studierte Evangelische Theologie in Oberursel und Mainz und absolvierte sein Vikariat in Wächtersbach. Im Anschluss war er evangelischer Pfarrer in einer Gemeinde im Kinzigtal sowie in der Notfallseelsorge tätig. 2005 schrieb er seinen ersten Kriminalroman.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Hanka Steidle/Arcangel.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-901-3
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Medienagentur Gerald Drews, Augsburg.
Für Paula, Sarah und Ole
Prolog
»Ist es wirklich das, was du willst?«
Caspari sah nur verschwommene Umrisse. Wer hatte ihn das gefragt? Er konnte niemanden erkennen. Er blinzelte, um besser sehen zu können. Es half nichts. Mit den Handrücken rieb er sich die Augen. Langsam klärte sich seine Sicht. Vor ihm spielte sich eine surreale Szene ab. Eine Frau mit brünetten Haaren saß zusammengekauert im Sand und starrte verzweifelt auf einen Mann, der leblos am Strand lag. Beiderseits von ihm kniete je ein weiß gekleideter Mann. Beide mühten sich damit ab, den Liegenden wiederzubeleben. Der Ersthelfer auf der linken Seite presste mit durchgedrückten Armen und aufeinandergelegten Händen seinen unteren Handballen in einem Rhythmus auf die Brust des reglosen Mannes, den sein Gegenüber ihm vorgab.
»Dreizehn, vierzehn, fünfzehn.«
Die Herzdruckmassage stoppte für einen Moment, in dem der Taktgeber dem Reglosen Luft durch die Nase blies. Dessen Brustkorb hob und senkte sich. Dann fuhr der Linke mit seiner Arbeit fort. Caspari betrachtete mit seltsamer Distanz, wie der reglose Körper unter den kräftigen Stößen regelrecht durchgeschüttelt wurde.
Dann fiel sein Blick wieder auf die Frau. Die Kleidung klebte ihr am Körper, genauso wie bei den knienden Männern – und dem Reglosen auf dem Boden. Mit beiden Händen schob sie sich ihre nassen Haare aus dem Gesicht, wobei sie eine Spur feinen Sands hinterließ. Tränen liefen ihr über die Wangen und wuschen auf ihrem Weg zum Kinn den Sand in feinen Rinnsalen von ihrem Gesicht. Die Frau schien es gar nicht wahrzunehmen. Ihre Aufmerksamkeit war ganz und gar auf die beiden Männer und ihre Wiederbelebungsversuche gerichtet. Sie atmete stockend, immer wieder von einem kurzen Schluchzen unterbrochen.
Caspari tat die Frau leid. Er hätte sie gern getröstet, aber er wusste nicht, wie. Ein Rauschen drang an sein Ohr. Er blickte auf und sah sich um. Vor ihm lag die Nordsee, die sich mit der Flut immer weiter nach vorn an den Strand schob. Ein kräftiger Wind blies vom Meer. Caspari konnte sehen, wie er eine Windhose am Mast zappeln ließ, doch er selbst spürte ihn nicht. Ebenso wenig wie die einsetzende Kühle des frühen Abends, die die Frau frösteln ließ. Wo um Himmels willen war er nur? In was für eine Szene war er nur hineingeraten?
Er versuchte, sich zu erinnern. Langsam setzten sich Bilder und Gesprächsfetzen zu einem Ganzen zusammen. Er stand auf einem Strand auf der Insel Borkum. Und der Mann, um dessen Leben die beiden Helfer kämpften, war … er. Mit einem Mal überfluteten ihn die Erinnerungen. Er, oder vielmehr sein Ich, das reglos vor ihm auf dem Boden lag, war Patient in einer psychosomatischen Klinik auf der Insel. Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus, in dem er nach einem schweren Burn-out stationär behandelt worden war, hatte man ihn zur Regeneration auf die Nordseeinsel überwiesen.
Die ärztlichen Prognosen waren sehr positiv. Er würde bald wieder als Leiter seiner Abteilung im Bundeskriminalamt arbeiten, die auf Serientäter spezialisiert war. Der letzte mordende Psychopath, den sie verfolgt hatten, war allerdings kein Mensch, sondern eine wolfsähnliche Bestie gewesen. Obwohl Panikattacken und schwere Depressionen ihn während der Ermittlungen überfallen hatten wie die Bestie ihre Opfer, hatte er nicht aufhören können, sie zu jagen. Schließlich war er selbst zum Gejagten geworden und hatte schwer traumatisiert nur knapp überlebt.
Und nun? War er nun endlich tot? Er stand am Strand und sah, wie zwei Männer, die wie Pfleger gekleidet waren, sich abmühten. Sie hielten die hauchdünne Schnur fest, die ihn noch an das Leben band. Die Frau wischte sich mit einem Ärmel ihrer nassen Sommerjacke über das Gesicht und verschmierte damit den Sand und die Tränen auf ihren Wangen noch mehr.
Clara! Caspari begriff endlich, wer sie war. Seine große Liebe hockte völlig verstört im Sand. Er erinnerte sich plötzlich, wie sie beide sich kennengelernt hatten. Er hatte mit seiner Abteilung in einer Mordserie ermittelt. Eines der Opfer war im Hexenturm von Gelnhausen zu Tode gefoltert worden. Gerade einmal zwanzig Kilometer von seinem Zuhause entfernt hatte er Mörder gejagt. Dabei war ihm Clara begegnet.
Sie war Pfarrerin und die Notfallseelsorgerin, die die Angehörigen des Ermordeten betreut hatte. Caspari hatte sich Hals über Kopf in sie verliebt. Sie hatte das Herz einer Kämpferin und die Seele eines Engels. Selbstbewusst und einfühlsam, energisch und gelassen – diese Kombination hatte ihn sofort fasziniert. Sportlich, intellektuell und nicht minder hitzköpfig, was auf ihre irischen Wurzeln zurückging.
Er war nicht in der Lage gewesen, sie außerhalb der rein beruflichen Ebene anzusprechen. Dabei hatte ihm seine allzu große Schüchternheit im Weg gestanden. Wer war er schon? Ein Akademiker im Körper eines Holzfällers, dessen Körper die Arbeit mit der Axt geformt hatte. Caspari fühlte sich in seinem wuchtigen Körper gefangen. Dass ein Mann wie er von einer Frau als attraktiv gesehen werden könnte, war für ihn außerhalb jeder Vorstellung gewesen. Doch sie hatte ihn mit ihren wunderschönen Augen angesehen und sich dabei in ihn verliebt.
Diese blauen Augen, die sonst so viel Lebenskraft und Lebensfreude ausstrahlten, waren nun total verweint. Caspari kniete sich neben sie auf den Sand und wollte sie in den Arm nehmen. Doch er konnte es nicht. Seine großen Arme glitten durch ihren Körper einfach hindurch. Er war ein Schatten, nicht mehr. Und doch schien sie etwas gespürt zu haben. Clara erschauderte und drehte sich zu ihm um. An ihrem Blick erkannte er, dass sie durch ihn hindurchsah. Nahe beieinander und doch getrennt waren sie in diesem Augenblick.
So wie wohl in den zurückliegenden Wochen. Er hatte sich in seinem Beruf vollkommen aufgerieben. Zu viel Tod und unvorstellbare Grausamkeit waren ihm begegnet. Der professionelle Abstand war ihm im Laufe der Jahre still und leise abhandengekommen. Die Hochzeit mit Clara war geplatzt, weil er sich nicht auf seine Heilung hatte konzentrieren können. Er war wie ein Jagdhund, mit dem der Jagdtrieb auch dann noch durchging, wenn ein Hinterlauf gebrochen war. Das war für Clara zu viel gewesen. Zu viel an Konfrontation mit dem Tod, selbst für eine Pfarrerin. Zu viel an selbstzerstörerischem Verlangen, dem Tod und seinem Knecht, dem Serientäter, das Handwerk zu legen.
Während seines langen Klinikaufenthaltes war Caspari bewusst geworden, dass er sein Leben ändern musste. Er wollte in seiner Abteilung seine Mitarbeiter nur noch leiten, ohne selbst aktiv einzugreifen. Seine Dozententätigkeit an der Wiesbadener Fachhochschule, wo die Polizeianwärter studierten, wollte er ausbauen. Als promovierter und erfahrener Kriminalpsychologe konnte er den jungen Frauen und Männern viel Wissen vermitteln.
Das alles hatte er Clara erzählen wollen, als sie nach Borkum zu Besuch gekommen war. Doch sie war gekommen, um ihm im Beisein seines behandelnden Arztes mitzuteilen, dass sie sich von ihm trennen würde. Diese Offenbarung hatte ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Entgegen der Einschätzung des Psychiaters war er nicht stark genug dafür gewesen.
Er hatte so nicht weiterleben wollen, nicht weiterleben können. Deshalb hatte er sich weggeschlichen und war zu dem Strand gegangen, den er besonders mochte. Caspari hatte sich dort hingesetzt und mit seinem Leben abgeschlossen. Ein für alle Mal. Dann war er ins Wasser gegangen. Hatte sich nach dem kalten, dunklen und nassen Grab der See gesehnt. Die Schreie vom Strand hatte er ausgeblendet und gleichzeitig losgelassen. Er war dieses Lebens so satt gewesen. Er wollte nicht mehr damit ringen, immer maximalen Einsatz zu geben, um gut genug zu sein. Es war genug gewesen. Caspari hatte einmal noch ausgeatmet und sich dann sinken lassen. An mehr konnte er sich nun, am Strand stehend, nicht mehr erinnern.
»Ist es wirklich das, was du willst?«, fragte die Stimme erneut. Caspari sah sich um und sah einen Mann, den er auf Anfang vierzig schätzte. Er verkörperte all das, was Caspari so gern gewesen wäre – er war gut aussehend. Die blonden Haare waren lässig nach hinten gekämmt. Ein gepflegter Vollbart umrahmte sein schmales Gesicht. Das weiße Sommerhemd und die beige Hose ließen einen hager-athletischen Körper erahnen. Die Hände hatte der Mann lässig in die Hosentaschen gesteckt.
»Warum ausgerechnet David Beckham?«, durchfuhr es Caspari.
»Damit dir bewusst wird, woran du dich dein ganzes Leben abgearbeitet hast«, antwortete der Mann, als hätte Caspari seine Gedanken laut ausgesprochen. »Du warst schon immer frustriert darüber, dass du eine völlig andere Figur hast.«
»Ich verstehe nicht«, stammelte Caspari.
»Du bist schon dein ganzes Leben der Ansicht, dass du nur dann einen Selbstwert besitzt, wenn du mehr leistest und besser bist als andere. Dass du nur schön bist, wenn du anders aussiehst, als du es tatsächlich tust.«
»Aha«, antwortete Caspari wie ein kleiner Messdiener, dem der Priester erklärte, wie man den Weihrauch im Fässchen zum Qualmen brachte.
»Wenn du dich dazu entscheidest zu leben, wirst du mit diesem Thema endlich Frieden schließen müssen«, erklärte der Mann. »Wenn du loslässt, spielt es keine Rolle mehr, welchen Körper du hattest, wie gebildet, reich oder gesund du warst.«
»Worum geht es dann?«
»Um die Liebe, einzig um die Liebe! Sie ist die Energie, die alles durchströmt. Durch sie verbindet sich die große Weltenseele mit allem, und alles ist mit ihr verbunden. Wenn du stirbst, gehst du ganz in diesen Strom ein, aus dem du hervorgegangen bist.«
»Und wenn ich mich entscheide, am Leben zu bleiben?«, fragte Caspari.
»Dann ist es deine Aufgabe, die Liebe anzunehmen, die die Weltenseele dir schon immer geschenkt hat. Du bist ein wertvoller Mensch, weil du genau so gewollt bist, wie du bist. Akzeptiere das und akzeptiere dich. Gib diese Liebe an andere Menschen weiter. Darin liegt der tiefste Sinn allen Seins.«
»Bleibt Clara bei ihrer Entscheidung, wenn ich zurückkehre?«, fragte Caspari zögerlich.
»In der Liebe gibt es keinen doppelten Boden. Sie beinhaltet auch immer das Risiko, verletzt zu werden«, gab der Mann zur Antwort.
»Na toll!«, brummte Caspari unschlüssig.
»Du musst dich entscheiden«, drängte der andere. »Der Notarzt ist gleich hier. Wenn du bis dahin nicht weißt, was du tun willst, wird er die Reanimation nach einer Weile abbrechen.«
»Volles Risiko?«, hakte Caspari noch einmal nach.
»Nicht ganz«, antwortete der Mann mit einem Augenzwinkern.
»Heißt das, Clara und ich bleiben zusammen?«
»Finde es heraus!«
Eineinhalb Jahre später
Tanja hasste Hochhäuser. Sie empfand diese Türme als Legebatterien, in denen Menschen dicht aufeinandergedrängt ihr Dasein fristeten, entweder als Arbeitnehmer oder als Mieter oder als beides. Das Bürogebäude hatte ein weitläufiges Foyer. Am Empfang saßen zwei junge Frauen in uniformen Kostümen.
»Guten Tag«, sprach sie eine der beiden an.
Die Rezeptionistin setzte ein berufsmäßiges Lächeln auf. »Bitte?«
»Ich möchte in die radiologische Praxis«, erklärte Tanja und hielt einen Überweisungsschein hoch.
»Dr. Baulig«, bestätigte die Frau. »Die Praxis befindet sich im zweiten Stockwerk.«
Tanja bedankte sich und ging zu den Aufzügen. Im zweiten Stockwerk stieg sie aus und ging zielsicher zum Treppenhaus. Langsam stieg sie die Treppe nach oben. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, sie spürte, wie das Blut in ihren Schläfen pochte. Dabei war sie nicht einmal außer Atem. Ein bisschen Treppensteigen belastete sie kaum. Sie war körperlich fit. Das musste sie als Leiterin einer SEK-Einheit auch sein.
Jahrelang hatte sie als Frau in dieser Männerdomäne kämpfen müssen, bis sie diese Position erreicht hatte. Sie hatte sich dabei nicht geschont, war unzählige Male mit schmerzenden Gliedern und völlig erschöpft nach einem harten Trainingstag ins Bett gefallen.
»Als Frau musst du härter als die Jungs trainieren und viel mehr einstecken«, hatte ihr eine Kollegin zu Beginn ihrer Zeit beim SEK gesagt. Sie hatte recht behalten. Tanja hatte viel dafür geopfert, Mitglied eines dieser Teams zu sein. Sie hatte sich ihren Platz und ihren ausgezeichneten Ruf hart erarbeitet und war nach etlichen Jahren an vorderster Front dann zur Teamleiterin befördert worden. Und nun war sie in diesem Hochhaus im Frankfurter Bankenviertel und kämpfte beim Treppensteigen gegen ihre innere Unruhe an.
Sie wusste, warum sie hier war, wusste, dass es getan werden musste. Jemand musste es stoppen, bevor es zu groß wurde. Im fünften Stock verließ sie das Treppenhaus und ging durch den Flur, vorbei an etlichen Nebenfluren, in denen die Büros von Start-up-Unternehmen untergebracht waren. Vor einer Tür mit dem Schild »Haustechnik« blieb sie stehen und zog eine Chipkarte aus ihrer Jackentasche. Mit angehaltenem Atem schob sie diese in den Schlitz neben der Tür. Als ein sattes Klicken ertönte, atmete sie erleichtert aus, drückte die Tür auf und trat ein.
Tanja ließ den Rucksack, den sie lässig wie eine Studentin über der Schulter getragen hatte, auf den Boden gleiten und setzte sich daneben. Der Raum war eng, aber für ihre Zwecke gut genug. Aus dem Rucksack holte sie ein Notizbuch und studierte noch einmal ihre Aufzeichnungen. Möglichst wenig durfte sie dem Zufall überlassen. Sie griff wieder in den Rucksack und holte den Gebäudeplan vom sechsten Stockwerk hervor. Dort lag der Firmensitz eines einzigen Unternehmens, der Troja Marketing. Mit dem Zeigefinger fuhr sie den Weg vom Treppenhaus bis zum Büro der Geschäftsleitung entlang. Dorthin musste sie unbemerkt gelangen.
Akribisch ging Tanja ihre Ausrüstung durch. Schließlich warf sie einen Blick auf ihre Uhr. Fast fünf. Ihr blieb noch eine Stunde, bis die Leute von der Gebäudereinigung kamen. Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und versuchte, sich zu entspannen. Wenn das hier schiefging, war sie entweder im Gefängnis oder tot. Falls sie erfolgreich sein sollte, würde man sie als Heldin feiern.
Sie begann, Atemübungen zu machen und sich zu fokussieren. Eine Dreiviertelstunde später verließ sie den kleinen Raum, durchquerte den Flur und verschaffte sich mit einer anderen Magnetkarte Zutritt zu einem Büro. Es bestand aus nur zwei Arbeitsräumen und einer Teeküche. Sie befand sich im Firmensitz eines Miniunternehmens, das zwei Personal Trainern gehörte. Die beiden teilten sich einen Büroraum. Sie waren ohnehin die meiste Zeit unterwegs, um ihre Kunden sportlich fit zu halten. Führungskräfte aller Altersstufen zahlten viel Geld, um von den beiden trainiert zu werden.
Bei ihrer Planung war Tanja vor ein paar Monaten auf die zwei gestoßen und hatte sich an ihre Fersen geheftet. Während einer der beiden einen Bewegungsmuffel durch den Ostpark scheuchte, hatte sie sein Auto geknackt und die Daten seiner Schlüsselkarte auf ein mobiles Lesegerät kopiert, das ihr Holger, ein befreundeter Kollege aus der Abteilung für Internetkriminalität beim LKA, besorgt hatte. Heute und morgen waren die beiden Trainer mit ihrer Sekretärin wie in jedem Jahr auf der FIBO, einer großen Messe rund um das Thema Fitness. Das war der ideale Zeitpunkt für ihr Vorhaben.
Tanja setzte sich im Büro der Sekretärin an den Schreibtisch, schob die Tastatur beiseite und steckte das Internetkabel in die Buchse an ihrem MacBook. Als der Computer lief, hackte sie sich in das Überwachungssystem des Bürogebäudes. Holger hatte sie an vielen Abenden darin intensiv trainiert. Dann schloss sie eine externe Festplatte an den Laptop an. In der Nacht zuvor hatte sie die Aufnahmen der Überwachungskameras mitgeschnitten und dort abgespeichert.
Ein Surren, gefolgt von einem Klicken, ließ Tanja zusammenfahren. Eine Putzkraft schob ihren Wagen in den kleinen Flur. Tanja schoss aus ihrem Stuhl und eilte zu der Frau. Sie zwang sich zu einem Lächeln.
»Nein, vielen Dank, heute müssen Sie nicht sauber machen!«
Die Frau sah sie verständnislos an.
»Aber donnerstags bin ich immer hier.«
»Das stimmt«, erwiderte Tanja, die sich innerlich dafür verfluchte, dass sie dieses Detail übersehen hatte. »Wir haben in dieser Woche allerdings das Büro geschlossen. Die Kollegen sind auf einer Messe.«
»Ach so«, antwortete die Raumpflegerin. »Sind Sie neu? Ich habe Sie hier noch gar nicht gesehen.«
»Homeoffice«, log Tanja, »ich mache die Buchhaltung von zu Hause aus. Nur manchmal muss ich hier an die Akten.«
»So ist das«, sagte die Frau. Offenbar gab sie sich mit der Erklärung zufrieden. »Ich brauche hier also nicht zu putzen?«
»Nein, heute nicht«, bestätigte Tanja.
Mit einem Schulterzucken verließ die Frau den kleinen Flur und schloss hinter sich die Tür. Erleichtert atmete Tanja auf und ging wieder zu ihrem Laptop. In den Wochen zuvor hatte sie alles haarklein recherchiert. Sie wusste, wie lange das Putzen der Büros dauern würde. Bis die Reinigungskräfte das Gebäude wieder verließen, würden noch zwei Stunden vergehen. Wieder war sie zum Warten verdammt. In Gedanken ging sie wohl zum hundertsten Mal an diesem Tag ihren Plan durch.
Die Schlüsselkartenkopie zum Trakt der Troja Marketing hatte sie sich auf die gleiche Weise besorgt wie die zu diesem Büro. Im Dunkeln würde sie dort hineingehen und sich an den Schreibtisch des Geschäftsführers setzen. Nach getaner Arbeit würde sie sich bis zum Morgen in diesem Büro verstecken. Erst dann konnte sie genauso unauffällig durch den Haupteingang verschwinden, durch den sie gekommen war. Vorausgesetzt, es verlief alles nach Plan. Doch dessen konnte sie sich nicht sicher sein. Sie spielte ein Spiel mit einem hohen Einsatz und einigen Variablen.
Als es dämmerte, trat sie an das große Fenster und blickte auf die Lichter der Großstadt, die nie wirklich zur Ruhe kam. Unter sich sah sie kleine Gestalten, die aus dem Gebäude kamen. Sie stiegen in drei Kleinbusse, die sie zu einem anderen Bürogebäude fahren würden, um dort sauber zu machen. Sobald es gänzlich dunkel geworden war, setzte sich Tanja wieder an ihr MacBook. Alles war vorbereitet. Mit einigen wenigen Mausklicks schaltete sie die Überwachungskameras des gesamten Gebäudes aus und spielte dem Überwachungssystem stattdessen die Filme von ihrer Festplatte vor. Zu guter Letzt legte sie die Bewegungsmelder im Treppenhaus noch lahm. Dann zog sie sich eine Sturmhaube auf und machte sich auf den Weg.
Eine Stunde Zeit blieb ihr für ihr Vorhaben. Fast lautlos eilte sie durch den Flur und dann die Treppen hinauf. Am Trakt der Troja Marketing angekommen, beruhigte sie erst wieder ihren Atem, bevor sie die Schlüsselkarte in den Schlitz schob. Ein Surren verriet ihr, dass die Karte akzeptiert worden war. Tanja sah sich nach allen Seiten um, bevor sie die Tür öffnete. Lautlos bewegte sie sich in den dunklen Räumen. Ihre kleine Stablampe brauchte sie nicht anzuschalten. Das Licht der Straße und der anderen Gebäude drang von draußen herein.
Wie ein Schatten huschte sie bis zur schweren Holztür, hinter der das Büro des Geschäftsführers lag. Die Tür war mit der Schlüsselkarte nicht zu öffnen, das wusste sie. Ein kleiner Kasten mit einem schwach beleuchteten Tastaturfeld war in Brusthöhe neben der Tür angebracht. Ohne die richtige Zahlenkombination würde sie dort nicht hineinkommen. Holger hatte ihr auch einen Minicomputer besorgt, der solche Codes knacken konnte. An der Unterseite der Türsicherung befand sich eine Buchse. Tanja verband das Gerät über ein Kabel mit dem Codeknacker und startete ihn. Auf dem kleinen Bildschirm sah sie, wie sich nacheinander vier Ziffern aneinanderreihten. Ein Surren beschied ihr, dass Holgers kleiner Helfer seine Arbeit getan hatte. Vorsichtig drückte sie die Tür auf und glitt in das großzügige Büro.
Der Computer auf dem schweren Schreibtisch war ausgeschaltet. Sie fuhr ihn hoch und sah zu, wie der Bildschirm zum Leben erwachte. Sie schob einen USB-Stick in eine der Buchsen am Rechner. Sofort übernahm das Programm von dort die Steuerung und umging die Passwortabfrage. Holger war ein wahrer Künstler, wenn es um digitale Spionage ging. Nach weniger als einer Minute konnte Tanja alle Dateien öffnen. Fieberhaft suchte sie nach einem Ordnernamen. Es musste ein Begriff aus der griechischen Mythologie sein. Da stand er mit einem Mal vor ihr, schwarz auf weiß – »Odysseus«.
Sie bewegte den Cursor auf den Namen und öffnete den Ordner mit einem Doppelklick. Es war, als hätte sie eine riesige Bibliothek betreten. Vor ihr entfaltete sich ein Verzeichnis von Unterordnern, das sie schlucken ließ. Tanja hatte mit vielem gerechnet. Dass die Sache allerdings diese Dimension hatte, verschlug ihr den Atem. Diese unglaubliche Menge an Dokumenten konnte sie unmöglich in einer Stunde auf Facebook veröffentlichen. Dieser Upload würde deutlich länger in Anspruch nehmen.
Entschlossen nahm sie eine externe Festplatte aus ihrem Rucksack, schloss sie an den Computer an und gab dem Rechner den Befehl, die Daten auf das andere Medium zu exportieren. Ihre Festplatte kam aus der neuesten Generation. Großes Fassungsvermögen, schnelles Laden. Während die Upload-Symbole sich in atemberaubender Geschwindigkeit auf dem Bildschirm ablösten, bemerkte sie in der Startleiste ein oranges Dreieck mit einem Ausrufezeichen in der Mitte, das ständig aufblinkte. Das konnte nur eines bedeuten: Ihre Aktivitäten waren entdeckt worden. Mist!
Tanja sprang vom Sessel auf und spähte in den Flur. Dort war alles ruhig. Sie lief zum Fenster und schaute auf den Hof vor dem Gebäude. Ein Konvoi schwarzer Karossen fuhr mit hoher Geschwindigkeit darauf zu und bremste so abrupt, dass ihre Fronten sich nach unten neigten. Nicht gut! Gar nicht gut! Tanja eilte zum Computer. Der Vorgang war endlich abgeschlossen. »Odysseus« war komplett auf ihre Festplatte kopiert. Sie riss das Kabel aus der Buchse des Computers, stopfte die Festplatte eilig in ihren Rucksack, holte ihre Heckler & Koch samt Holster daraus hervor und befestigte sie an ihrem Gürtel. Dann rannte sie aus dem Büro des Geschäftsführers, durch den Flur des Bürotraktes der Firma und auf den Flur zu den Fahrstühlen hinaus.
Die Anzeigen aller Aufzüge sah sie um die Wette blinken. Sie kamen! Tanja stieß die Tür zum Treppenhaus auf und glitt mehr über die Stufen, als dass sie darauf trat. Lieber langsamer auf der Flucht, als zu viel Geräusch zu verursachen. Diese Taktik machte sich bezahlt. Von unten hörte sie hastige Schritte vom Erdgeschoss heraufkommen. Sie öffnete die Tür zum fünften Flur fast lautlos. In diesem Stockwerk befand sich das Büro der Personal Trainer – ihre einzige Chance. Mit der Pistole im Anschlag lehnte sie an der Wand neben der Tür zum Treppenhaus. Doch ihre Jäger trappelten wie die Elefanten aufwärts in den nächsten Stock.
Die Tür im Visier, ging sie rückwärts zum Büro, in dem ihr MacBook dem System vorgaukelte, es gäbe keine Bewegung im Gebäude. Mit der Schlüsselkarte verschaffte sie sich erneut Zutritt. Im Büro der Sekretärin keuchte sie sich die Anspannung aus dem Körper. Was sollte sie nun tun? Auch hier hätte sie kaum die Möglichkeit, die riesige Datenmenge auf dem Stick viral zu verbreiten. Die Zeit für einen Upload auf Facebook oder Instagram hatte sie nicht. Ihre Verfolger würden mit Hilfe des Wachpersonals jedes Zimmer in diesem Gebäude durchkämmen. Sie konnte sich ausrechnen, wie lange es dauern würde, bis man auf das Büro dieser Minifirma stoßen würde.
Plan B! Sie schob das Kabel ihrer Festplatte in ihr MacBook und gab den Befehl, »Odysseus« in ihre Cloud zu kopieren und auf dem externen Medium zu löschen. Die Cloud hatte Holger ihr für diesen Fall angelegt. Der Mann mochte ja im analogen Leben eine Pfeife sein, aber im digitalen Raum war er ein Titan. Es war, als würde sie einem Staubsauger bei der Arbeit zusehen. Nachdem der Vorgang abgeschlossen war, holte sie einen orangefarbenen USB-Stick aus einem Fach ihres Rucksacks und steckte ihn in ihren Laptop. Mit Bedauern aktivierte sie das Zerstörungsprogramm darauf. Der Computer war ein Geschenk von Toni gewesen, ein Jahr bevor er gestorben war. Eine Kakofonie kam aus dem winzigen Lautsprecherbereich des Laptops. Dieses Gerät würde niemandem mehr verraten, wohin sie den antiken Seefahrer geschickt hatte.
Tanja hörte leise Geräusche im Flur. Bald würden sie sie gefunden haben. Sterben war eine Option, die sie einkalkuliert hatte. Holger würde dann für sie die Daten aus der Cloud ins Netz stellen. So war es abgesprochen. Doch Tanja wollte ihre Haut so teuer wie möglich verkaufen. Diese Leute hatten keine Skrupel gehabt, ihren Mann zu töten. Dafür konnten sie ruhig einen hohen Preis bezahlen. Sie griff erneut in ihren Rucksack und förderte eine Mini-Uzi hervor. Diese kleine Maschinenpistole hatte in ihrem Rucksack kaum Platz benötigt, ganz im Gegenteil zu den Magazinen, die sie dazugetan hatte.
Sie klappte die Schulterstütze aus, befestigte einen Laserpointer auf der Halterung und schob das erste Magazin ein. Auf dem Weg zur Teeküche blieb ihr Blick an dem schnurlosen Telefon hängen, das in der Station auf dem Schreibtisch stand. Jemand rüttelte von außen an der Flurtür. Sie griff sich das Telefon. Dann hörte sie ein Geräusch, das sie allzu gut kannte. Ein Surren kam vom Türschloss, dann ein Klicken, als der Schnapper nachgab und die Tür aufgedrückt wurde. Die Kerle hatten einen Universalschlüssel. Der Lichtkegel einer Taschenlampe huschte unruhig wie eine Wespe durch den Flur.
»Hier ist nichts!«, rief eine raue Männerstimme.
»Das weißt du doch gar nicht. Du hast doch nur den Flur gesehen!«, bellte eine andere. »Wir müssen alle Räume checken!«
»In Ordnung«, kam die Antwort. Durch das Dämmerlicht der Notbeleuchtung sah Tanja, wie sich eine breit gebaute Gestalt in den Flur schob, eine Pistole im Anschlag. Eine andere gab ihm von hinten Deckung. Ihren Laserpointer ließ Tanja ausgeschaltet. Die beiden würde sie auch bei diesem Schummerlicht mühelos treffen. Der erste Häscher leuchtete in beide Büros. Als er das aufgeklappte MacBook auf dem Schreibtisch der Sekretärin sah, stutzte er.
»Irgendwas stimmt hier nicht!«, rief er seinem Spießgesellen zu. »Das müssen wir uns genauer ansehen.«
Als er sich zur Teeküche auf der gegenüberliegenden Seite umdrehte, schoss Tanja eine Salve von vier Schüssen als Warnung in die Türfüllung. Der Häscher duckte sich und rannte zum Ausgang.
»Scheiße«, hörte sie ihn fauchen, »ruf die anderen! Zu zweit schaffen wir das nicht.«
Der Zweite flüsterte etwas in sein Mikrofon oder Handy. So genau konnte sie es nicht erkennen. Ihre Finger wählten dagegen wie ganz von selbst die Nummer 110 auf dem Telefon, das sie aus dem Büro mitgenommen hatte. Als sich der Kollege von der Bereitschaft am anderen Ende meldete, holte sie tief Luft, bevor sie sprach.
»Hören Sie genau zu! Mein Name ist Tanja Wedekind. Ich bin Leiterin der SEK-Einheit 2 Südhessen. Meine Dienstnummer lautet 123-Alpha 578. Haben Sie das verstanden?«
»Ja«, bestätigte der Polizist.
»Ich bin hier im Bürogebäude in der Herbert-Boehm-Straße 20, im fünften Stock. Ich habe mir illegal Zutritt zu einem der Büros verschafft und werde jetzt von Personen verfolgt, die nicht zum Sicherheitspersonal des Komplexes gehören.
»Wie meinen Sie das?«, fragte der Mann am anderen Ende der Leitung. Wie zur Antwort wurden drei Schüsse abgefeuert. Die Projektile schlugen in ihrer Nähe in der Wand ein.
»In Ordnung! Ich verstehe, was Sie meinen«, rief der Polizist durch das Telefon. »Hilfe ist unterwegs.«
In einer fließenden Bewegung legte Tanja das Telefon auf den Boden und legte die Uzi an. Sie hatte sich die Stelle genau gemerkt, wo sie Mündungsfeuer gesehen hatte. Dann zog sie den Abzug. Ein kurzer Aufschrei folgte, dann ein Stöhnen.
»Scheiße, es hat Mike getroffen!«, rief eine Stimme vom Hauptflur her.
Tanja richtete den Lauf ihrer Maschinenpistole in diese Richtung, drückte den Schulterbügel fest an ihren Körper und ließ die Uzi jene Arbeit tun, für die sie gebaut worden war.
Wiederkehr
»Wie geht es Ihnen?«
Caspari sah Helmut Fuhr, den Präsidenten des Bundeskriminalamts, einen Moment schweigend an. Der blickte mit seinen grauen Augen zurück, geduldig wartend. Fuhr wirkte auf den ersten Blick wie der klassische Bürokrat. Maßgeschneiderter anthrazitfarbener Anzug, dazu eine Krawatte in einem kräftigen Rotton als Kontrast, italienische Schuhe, der feingliedrige Körperbau eines Ausdauersportlers und das scharf geschnittene Gesicht mit jener Nase, die jeder Julius-Cäsar-Büste Ehre gemacht hätte.
Was sollte Caspari nun seinem höchsten Dienstvorgesetzten als ehrliche Antwort geben? Im Grunde wusste er das selbst nicht so genau. Eineinhalb Jahre war es her, dass er zum Sterben ins Meer gegangen war. Nun saß er in Fuhrs Büro. Hinter ihm lagen ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, etliche ambulante Therapiestunden und Schweigewochen im Meditationszentrum einer evangelischen Kommunität.
Er war sich bewusst, dass er diese Zeit ohne Clara nicht geschafft hätte. Sie beide zogen sich gegenseitig fast schon magisch an. Er, der optisch und in seiner Rolle als Polizist wie ein Granitblock wirkte, unter der robusten Schale aber unter seiner Schüchternheit und seinem wuchtigen Aussehen litt, war dem Charme und dem Temperament der deutsch-irischen Theologin erlegen.
Clara war immer in seine Fälle involviert. Irgendwie schaffte sie es jedes Mal, in die Ermittlungen der Serienmordfälle hineinzuschlittern, die sich im Kinzigtal und in den angrenzenden Mittelgebirgen, dem Vogelsberg und dem Spessart, ereigneten. Bei ihrer Arbeit als Gemeindepfarrerin und später als Schulseelsorgerin kam sie mit Menschen in Kontakt, die für Casparis Untersuchungen eine Rolle zu spielen schienen. Claras Temperament brachte sie dabei oft mit dem Tod in Berührung, dem sie durch Casparis Einsatz einmal nur um Haaresbreite entkommen war.
Er selbst hatte sich bei der Menge seiner Ermittlungen psychisch vollkommen erschöpft. Mittlerweile Kriminalrat, leitete er die Abteilung für Serienmorde beim BKA. Als promovierter Kriminologe und Psychologe hatte er die Gabe, die Muster hinter den Taten zu erkennen und gemeinsam mit seinen Leuten den Tätern auf die Spur zu kommen.
Für Clara war das Leben an der Seite eines Mannes, der ständig dem Tod nachjagte, nicht mehr zu ertragen gewesen. Nachdem sie sich deswegen von ihm getrennt hatte, gab er der Sehnsucht nach, das alles zu beenden und sich das Leben zu nehmen. Clara, die sich mittlerweile in einer Nachbesprechung mit Casparis Psychiater ihrer eigenen Gefühle klar geworden war, hatte sich auf die Suche nach ihm gemacht. Ihr war bewusst geworden, dass sie Caspari nicht aufgeben wollte. Schließlich war sie es gewesen, die ihn mit Hilfe anderer halb tot aus dem Meer gezogen hatte.
Seither führten sie ein stilles, eng aufeinander bezogenes Leben. Vor zwei Wochen hatte der Psychiater Caspari attestiert, dass er wieder in der Lage sei, seinen Dienst zu tun. Nach langen, intensiven Gesprächen waren Clara und er übereingekommen, dass er noch einmal versuchen sollte, in die Ermittlungsarbeit einzusteigen, statt gänzlich als Dozent an der Polizeifachhochschule zu arbeiten. Nun saß er Fuhr gegenüber, um die Modalitäten für seine Wiedereingliederung zu besprechen.
»Es geht mir deutlich besser als mitten in den Ermittlungen bei dem Fall mit der Bestie«, sagte Caspari schließlich. »Ich denke, ich habe gelernt, mich mental besser von den Fällen abzugrenzen. Diese Annahme würde ich gern dem Praxistest unterziehen.«
»Es freut mich für Sie, dass Sie sich wieder fit fühlen. Es freut mich aber auch für uns. Auf Ihre Fähigkeiten kann das BKA nur schwer verzichten«, antwortete Fuhr.
»Oh, danke für die Blumen«, erwiderte Caspari. »Ich denke allerdings, ich habe hervorragende Leute in meiner Abteilung, die ihre Arbeit auch sehr gut ohne mich hinkriegen.«
»Ja, Sie haben ein hervorragendes Team«, bestätigte Fuhr. »Doch Sie sind der Leitwolf. Ihre Leute brauchen Sie noch eine Zeit unter Ihrer Führung, um exzellent zu werden.«
»Die Wiedereingliederung ist sicher eine gute Gelegenheit, auf alle Prozesse innerhalb einer Ermittlung zu schauen. Ich werde mir Mühe geben, die Arbeit meiner Abteilung behutsam zu steuern, ohne selbst zu direkt und offensiv einzugreifen.«
Fuhr schüttelte den Kopf. »Ihre Leute schreiben gerade die Berichte zu den Fällen der Moorleichen in der Rhön und tragen alles für die Verhandlung vor Gericht zusammen. Da gibt es derzeit nicht viel für Sie an Steuerungstätigkeit. Dr. Caspari, ich brauche Sie für eine andere Sache.«
Casparis Neugier war geweckt. Allerdings mischte sich daneben auch das Gefühl von Angst. Er wollte sich nicht noch einmal so tief in einen Fall hineinziehen lassen wie ein Schwimmer, der in einen Strudel geriet.
»Worum handelt es sich dabei?«
»Es geht um einen Fall mit vielen Ungereimtheiten«, begann Fuhr. »Sagt Ihnen der Name Toni Wedekind etwas?«
»Nein, der Name sagt mir nichts.«
»Toni Wedekind war ein Kollege aus dem Landeskriminalamt. Ein Top-Ermittler im Bereich Wirtschaftskriminalität. Vor eineinhalb Jahren lief gegen ihn eine Ermittlung wegen des Verdachts der Korruption. Wedekind nahm sich das Leben. Oder er wurde dazu gezwungen. Niemand weiß es. Es gibt keine eindeutigen Spuren, weder für einen Suizid noch für einen Mord. Es war ein Schuss mit der Dienstwaffe in den Mund. In seinem Abschiedsbrief gestand er seine Schuld. An der Echtheit dieses Schreibens bestehen nach wie vor Zweifel, die bisher nicht ausgeräumt werden konnten. Die Akte ist daher immer noch offen. Wedekind hinterließ eine Frau und eine Tochter. Die Tochter studiert in Harvard. Seine Frau Tanja ist die Leiterin eines der SEK-Teams im Rhein-Main-Gebiet. Sie ist eine beeindruckende Persönlichkeit.«
»Das muss sie auch sein, wenn sie sich in dieser Männerdomäne durchsetzen kann«, meinte Caspari.
»Wohl wahr! Frau Wedekind ist in der vergangenen Woche in den Hauptsitz der Firma Troja Marketing im Frankfurter Büroviertel Niederrad eingebrochen und hat sich an einem der Computer dort zu schaffen gemacht. Die Firma hat dort in einem dieser Bürotürme ein ganzes Stockwerk gemietet. Was genau Frau Wedekind dort getan hat, kann oder will uns der Inhaber der Firma nicht sagen. Sie selbst schweigt seither. Anschließend versteckte sie sich in dem Büro einer anderen Firma in demselben Gebäude, von wo aus sie mit ihrem eigenen Computer Zugriff auf das Internet hatte. Was sie dabei im Detail getan hat, ist nicht mehr zu recherchieren. Den Laptop, den sie dazu verwendete, zerstörte sie anschließend, ebenso eine externe Festplatte.«
Fuhr hielt inne und atmete tief ein, bevor er fortfuhr.
»Bis zu diesem Punkt ist das bereits eine merkwürdige Geschichte. Nun aber wird es vollends mysteriös. Während sie in diesem zweiten Büro mit dem Internet verbunden war, stürmte ein Trupp von einer Sicherheitsfirma in das Bürohaus, vorbei an den vollkommen überrumpelten Wachleuten, und durchkämmte die Etagen nach dem Eindringling. Das stand den Leuten natürlich nicht zu. Nach Eindringlingen in dem Büro der Firma zu suchen, für deren Sicherheit man zuständig ist, ist eine Sache. Ein ganzes Bürohaus auf links zu drehen, eine ganz andere. Es kam zu einer Schießerei. Frau Wedekind hatte eine kleine Überraschung für den selbst ernannten Sturmtrupp dabei: ein Uzi mit reichlich Munition.
Caspari pfiff leise.
»Zwei der Männer liegen noch im Krankenhaus. Ohne ihre kugelsicheren Westen wären sie jetzt eher in der Rechtsmedizin, mit einem Zettel am großen Zeh. Frau Wedekind erwischte eine Kugel an der Schläfe. Streifschuss. Sie verlor viel Blut und lag mehrere Tage im Koma. Seitdem sie aufgewacht ist, sagt sie kein Wort. Sie schweigt nicht nur gegenüber den Kollegen, die sie befragen wollen. Auch dem Klinikpersonal gegenüber verständigt sie sich nur mit Zeichensprache, und das auch eher selten. Die Ärzte schließen nicht aus, dass es eine Auswirkung der Verletzung sein könnte. Derzeit prüft ein Psychiater, ob das zutrifft oder ob es sich um eine Traumatisierung handelt. Ich halte das für unwahrscheinlich. Meine Vermutung ist, dass sie sich und ihren Komplizen mit ihrem Schweigen schützen will.«
»Komplizen?«, fragte Caspari nach.
»Holger Uhl. Ebenfalls vom LKA. Er ist ein extrem fähiger Kopf in der Abteilung Cyberkriminalität. Ein – wie sagt man heute? –, ein Nerd. Und ein enger Freund der Familie. Mit Hilfe der Standortdaten von Frau Wedekinds Mobiltelefon konnten wir feststellen, dass die beiden in den letzten Wochen vor dem Einbruch sich sehr oft trafen. Auch die Anrufliste spricht dafür.«
»Vielleicht hatten die beiden ja auch nur angebandelt«, wandte Caspari ein.
»Nein«, widersprach Fuhr. »Uhl ist nun so gar nicht der Typ von Frau Wedekind. Ihr Mann war ein durchtrainierter Sportler. Uhl ist, nun ja …«
Fuhr machte eine ausladende Bewegung mit seinen Armen. »Er ist doch recht massiv. Das ist aber nicht das ausschlaggebende Moment. Holger Uhl ist eine Nacht später spurlos verschwunden. Das legt seine Beteiligung an der Planung des Einbruchs nahe oder zumindest die Vermutung, dass er davon wusste. Außerdem verfügte Frau Wedekind bisher nicht über die Computerkenntnisse, die es für ihre Aktion gebraucht hat. Sie ist eher ein Durchschnittsanwender, so wie Sie und ich. Ein elektronisches Türschloss zu knacken und die Passwörter eines Rechners mal eben so zu umgehen, gehört nicht zum Standardrepertoire einer SEK-Beamtin. Das sieht eher nach einem Spezialisten für Cyberkriminalität aus.«
»Da gebe ich Ihnen recht«, sagte Caspari. »Was soll ich nun tun?«
»Reden Sie mit der Frau«, antwortete Fuhr.
»Ich bin kein Forensiker«, gab Caspari zu bedenken.
»Als solchen will ich Sie auch nicht. Wir haben schon einen Psychiater, der sich an ihr die Zähne ausbeißt. Bringen Sie die Frau zum Reden. Ich weiß, dass Sie das können. Ihnen haben Serientäter ihr Herz ausgeschüttet. Sie haben eine Begabung dafür.«
Caspari grinste schief. »Warum?«, fragte er schließlich.
»An der Sache ist etwas faul. Es hat etwas mit den Vorwürfen gegen Toni Wedekind und seinem Tod zu tun, da bin ich mir sicher. Ich will wissen, was es ist.«
»Ein Einbruch, dessen Zweck nicht ermittelt werden kann, eine Sicherheitsfirma, die sich wie ein Sturmtrupp aufführt, und ein verschwundener Komplize sind für sich genommen schon Gründe genug, Verdacht zu schöpfen«, sagte Caspari. »In Verbindung mit dem Tod des Ehemannes könnte man auf die Idee kommen, dass sich eine große Nummer hinter den Kulissen abspielt.«
»Das sehe ich genauso. Sie sind in den nächsten vier Wochen noch in der Wiedereingliederung. Deshalb möchte ich, dass Sie sich erst einmal mit Frau Wedekind befassen. Falls Sie dabei auf etwas stoßen, das weiterer Ermittlungen bedarf, ziehen Sie Ihre Leute dazu heran.«
»Oh, ich bin mir sicher, dass ich auf etwas stoßen werde, was der Ermittlungsarbeit bedarf«, erwiderte Caspari.
»In dem Fall dürfte Ihre Abteilung froh sein, zwischen der Schreibtischtätigkeit und den Aussagen in der Gerichtsverhandlung wieder echte Polizeiarbeit machen zu dürfen.«
»In Ordnung, ich bin dabei«, sagte Caspari.
»Schön, Sie wieder an Bord zu haben, Dr. Caspari«, sagte Fuhr und reichte ihm die Akte zu dem Fall.
Caspari nahm sie und verabschiedete sich.
»Passen Sie auf sich auf. Fangen Sie langsam wieder an«, redete Fuhr ihm ins Gewissen, bevor er dessen Bürotür hinter sich schloss.
Dunkle Vergangenheit
»Die Ariergesetze galten damals auch in der Evangelischen Kirche«, erläuterte Nikita in seiner Präsentation. »Es gab eine ganze Reihe von Persönlichkeiten innerhalb kirchlicher Einrichtungen, die Hitlers Ideen begeistert aufgriffen. Sie wollten einen nationalistischen Protestantismus. Sie hielten sich für die Avantgarde eines modernen völkischen Christentums. Doch es gab auch eine Reihe von Gegenstimmen, nicht nur unter den Vertretern des Pfarrernotbundes und der Bekennenden Kirche.«
Clara hörte dem Schüler gern zu. Er machte das richtig gut. Nikita konnte nicht nur vor einer Gruppe reden, sondern er hatte seinen Vortrag auch exzellent vorbereitet. Der Jugendliche war ansonsten bei den Lehrern für seine Versuche bekannt, mit möglichst wenig Aufwand die bestmögliche Note herauszuholen. Hier hatte er sich allerdings einmal so richtig in die Arbeit gekniet. Seine Augen leuchteten. Er hatte tatsächlich für diesen Vortrag sein Äußeres ein wenig herausgeputzt. Der Undercut war sauber gestutzt, der Zopf auf der Hauptesmitte sorgfältig gekämmt und gebunden. Statt seiner üblichen Jogginghose trug er an diesem Tag sogar einmal eine Jeans.
»Kirche unter dem Hakenkreuz« stand auf dem Lehrplan für die zehnte Klasse. Es war Clara ein Anliegen, dieses Thema ausführlich mit den Schülern zu behandeln. Sie wollte ihren Teil dazu beitragen, dass sich die Menschen in Deutschland nie wieder von einer absurden Ideologie faszinieren und sich zu grausamen und menschenverachtenden Gedanken und Taten hinreißen ließen, wie es im Dritten Reich geschehen war. Sie empfand ein bisschen Stolz dabei, dass sie ihre Schüler für die Auseinandersetzung mit einem der dunkelsten Kapitel protestantischer Vergangenheit hatte begeistern können. Die bisher vorgetragenen Referate zeugten zumeist von einer echten Beschäftigung mit diesem Thema.
»Was man damals mit den Juden angestellt hat, ist absolut verwerflich«, hörte sie einen Zwischenruf. »Aber ist es nicht so, dass Hitlers Ablehnung der Juden nicht unbegründet war?«
Clara drehte sich nach hinten um und suchte den Schüler, der diese Frage in den Raum geworfen hatte. Es war Tom, der Nikitas Vortrag unterbrochen hatte. Das Kinn vorgereckt, forderte er ihn förmlich heraus.
Bevor Clara reagieren konnte, fragte Nikita zurück: »Wie meinst du das?«
Tom schien nur auf diese Gelegenheit gewartet zu haben. Der sonst so stille Junge mit dem traurigen Blick und den braunen Locken begann, auf eine Art zu dozieren, die Clara an ihm völlig fremd war. »Hitler hat den Juden vorgeworfen, sich an den Deutschen zu bereichern. Als Händler und Bankiers hatten sie wirtschaftlichen Erfolg. Im Gegensatz dazu ging es der Mehrheit der Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg richtig schlecht. Viele Menschen lebten in Armut.«
»Willst du damit sagen, dass die Gaskammern und all das andere gerechtfertigt waren?«, mischte sich Anne aus der dritten Reihe ein.
Für einen Augenblick kehrte der vertraute Ausdruck in Toms Gesicht zurück. Anne war so etwas wie sein Lieblingsmensch. Sie und Tom kamen aus demselben Dorf im Spessart und kannten sich im Grunde seit der Wiege.
Anne war stämmig, hatte ein rundes Gesicht und trug eine Nickelbrille. Daneben hatte sie die Körperkraft ihres Vaters, eines Hufschmieds, geerbt, dem sie, wie sie Clara erzählt hatte, mit großer Freude bei der Arbeit zur Hand ging, seit sie denken konnte. Außerdem war Anne sehr schlau. In Claras Augen besaß sie das Mitgefühl einer Heiligen. Alle diese außergewöhnlichen Eigenschaften hatten sie wohl schon im zarten Kindergartenalter zu Toms bester Freundin gemacht. Wenn die älteren Kinder in dem traurigen und verträumten Sohn einer psychisch kranken Mutter das willkommene Opfer bei Sandkastenschlachten ausgemacht hatten, sorgte Anne dafür, dass sie sich kopfüber in ebenjenem Element wiederfanden, in dem sie Tom bis zur Halskrause einbuddeln wollten.
Gott sei Dank wird es immer Menschen geben, die keine Heidi Klum brauchen, um unglaublich schön zu sein, dachte Clara, als sie zu Anne hinübersah.
Tom kam indessen emotional ins Straucheln, als er zu Anne blickte. »Nein, das will ich nicht. Das habe ich doch eben klar gesagt«, wehrte er sich fast patzig. »Aber ich finde, dass Hitlers Vorbehalte gegen die Juden berechtigt waren.«
»Also Massenvernichtung zwar nicht, aber Rassentrennung und Zwangsenteignung gehen klar? Habe ich dich richtig verstanden?«, fragte Benjamin, der Überflieger des Jahrgangs.
»So in etwa«, bestätigte Tom.
Clara war innerlich sehr aufgewühlt, bemühte sich aber um Sachlichkeit in ihrem Tonfall. »Wie begründest du diese Behauptung?«
»Hitler kannte die Protokolle der Weisen von Zion«, begann Tom.
»Die nachweislich eine Fälschung sind«, fiel ihm Clara ins Wort.
»Das sagen Sie«, konterte Tom. »Beweisen lässt sich das nicht.«
»Da liegst du falsch. Es gibt eine Reihe wissenschaftlicher Methoden, mit denen man die Echtheit von Texten nachweisen oder widerlegen kann«, sagte sie. Im Theologiestudium hatte sie sich ausführlich mit der Exegese von alt- und neutestamentlichen Texten befassen müssen. Toms Behauptung war dazu angetan, sie auf die Palme zu bringen.
»Unter den Wissenschaftlern gibt es unterschiedliche Meinungen zu den Protokollen der Weisen von Zion. Ich berufe mich auf die, die sie für echt halten.«
»Schön, dann bring in der nächsten Stunde eine dieser wissenschaftlichen Meinungen in gedruckter Form mit.«
Der Junge nickte selbstbewusst.
»Was steht denn eigentlich in diesen Protokollen?«, fragte Janina aus der hintersten Reihe. Ihre Augenbrauen stießen dabei förmlich gegeneinander. Die reichlich aufgetragene Abdeckcreme, mit der die Jugendliche ihre Akne zu überdecken versuchte, geriet dabei an ihre Leistungsgrenze.
»Es geht um eine angebliche Verschwörung des Weltjudentums. Darin werden Pläne geschmiedet, wie man Gesellschaft und Wirtschaft in den unterschiedlichen Ländern destabilisieren und zum Kollaps bringen will. Anschließend soll die Welt von den Juden als dem auserwählten Volk Gottes regiert werden. An der Spitze steht dann ein jüdischer König«, fasste Clara zusammen, während sie gebannt auf den Riss in der Schminke blickte, der zurückgeblieben war, nachdem die Stirn des Mädchens sich wieder entspannt hatte.
»Was für ein Scheiß«, echauffierte sich Janina. »Daran hat Hitler geglaubt?«
»Keine Ahnung«, antwortete Nikita, der offensichtlich bemüht war, sein Referat zu Ende zu bringen. »Er hatte einen abgrundtiefen Hass gegenüber den Juden. Das hing mit persönlichen Erfahrungen zusammen.«
»Was für Erfahrungen?«, fragte Anne.
»Hitlers Mutter war todkrank. Ein jüdischer Arzt versuchte, sie zu retten, es gelang ihm aber nicht. Hitler war noch sehr jung damals. Er machte den Arzt für den Tod seiner Mutter verantwortlich«, erklärte Nikita. »Später dann wollte Hitler an der Wiener Kunstakademie Malerei studieren. Der Professor, der ihn ablehnte, war ebenfalls Jude. Er hat wohl sehr rüde die Bilder runtergemacht, die Hitler eingereicht hatte.«
»Das ist die gängige Erklärung«, meldete sich erneut Tom zu Wort. »Ich finde, das ist ein sehr schwaches Argument, um den Ursprung für die Nürnberger Rassengesetze zu erklären.«
Das Schweigen der Zeugin
Bevor er sich zum Gespräch mit Tanja Wedekind auf den Weg machen wollte, besuchte Caspari seine Mannschaft. Der Terminus »Besuch« beschrieb tatsächlich seine Anwesenheit in der Abteilung, die er bis vor eineinhalb Jahren als sein zweites Zuhause angesehen hatte. In dem Moment, in dem er durch die Glastür in den Flur trat, auf dem die Büros lagen, fühlte er einen leisen Anflug von Fremdheit. Selbst das asthmatische Gurgeln der Kaffeemaschine, das aus dem Aufenthaltsraum drang, war ihm nicht mehr vertraut. Er warf einen Blick hinein und sah die rote Löwenmähne einer Frau, die mit dem Rücken zu ihm stand, während sie benutztes Geschirr in die Spülmaschine räumte.
»Bist du diese Woche mit dem Küchendienst an der Reihe?«, fragte er, an den Türrahmen gelehnt.
Die Frau drehte sich mit einem Lächeln auf den Lippen herum.
»Mensch, Christoph. Du bist es wirklich! Wie schön, dass du da bist!«
Tina Hergenrath, eine seiner beiden Stellvertreter, kam auf ihn zu und umarmte ihn. Er roch ihr Parfum. Es war immer noch Chanel. Die Nummer hatte er sich nie merken können. Tina sah wie immer umwerfend aus, sportlich und gleichermaßen weiblich. Die Mittdreißigerin konnte sehr empathisch sein, aber auch sehr hart und bestimmend, je nachdem, was die Situation erforderte, in der sie sich jeweils befand.
Mit ihren grünen Augen sah sie ihn an und grinste breit, während sie seine Hände hielt. Er betrachtete ihre Finger.
»Immer noch keinen Ehering«, stellte er schmunzelnd fest.
»Du wärst einer der Ersten, der das erfahren würde«, gab sie lachend zurück.
Mario, sein zweiter Stellvertreter, und sie waren seit Jahren ein Paar. Beide waren schon Casparis Mitarbeiter gewesen, als er noch eine Abteilung beim Landeskriminalamt geleitet hatte. Eigentlich hätte er als ihr Vorgesetzter darauf bestehen müssen, dass sich einer von beiden in eine andere Abteilung versetzen ließ. Aber er wollte weder auf Tina verzichten noch auf Mario.
Die energische Polizistin hatte einen Blick für Details bei Befragungen, die selbst Caspari übersah. Ebenso wenig wollte er ohne Mario ermitteln, der jede Nadel im Heuhaufen fand, wenn es darum ging, in der Vita von Zeugen oder Verdächtigen etwas zu entdecken, das nicht zu ihren Aussagen passte oder den Ermittlungen eine entscheidende Wendung gab. Wer ihn nicht kannte, traute dem Sohn italienischer Gastarbeiter ein solch akribisches Arbeiten gar nicht zu, wirkte Mario vom Auftreten her doch eher wie die junge Ausgabe von Adriano Celentano.
»Was führt dich hierher?«, fragte sie schließlich. »Kommst du wieder zurück, oder bist du nur zufällig in Wiesbaden?«
»Weder noch«, erklärte er. »Ich beginne mit einer Wiedereingliederung, vorerst allerdings nicht als Chef der Abteilung.«
Tina sah ihn fragend an.
»Wirst du unsere Abteilung abgeben?«
»Nein, davon ist keine Rede. Der Präsident braucht mich in einer anderen Sache, sozusagen als Sonderermittler.«
»Aha, du darfst die spannenden Sachen machen, während wir uns mit Ermittlungsberichten abrackern«, entrüstete sich Tina mit einem Augenzwinkern.
»Das macht ihr doch mit links«, kommentierte Caspari.