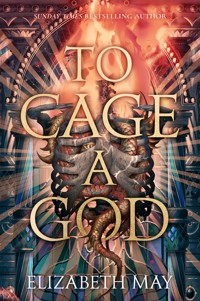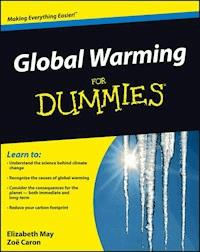11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Feenjägerin
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Schön, talentiert und tödlich – Aileana Kameron hat nur ein Ziel: die Feen, die ihre Mutter getötet haben, zur Strecke zu bringen
Ballsaison im Edinburgh des Jahres 1844: Jeden Abend verschwindet die junge und bildschöne Aileana Kameron für ein paar Stunden vom Tanzparkett. Die bessere Gesellschaft zerreißt sich natürlich das Maul über sie, aber niemand ahnt, was die Tochter eines reichen Marquis während ihrer Abwesenheit wirklich tut: Nacht für Nacht jagt sie mithilfe des mysteriösen Kiaran die Kreaturen, die vor einem Jahr ihre Mutter getötet haben – die Feen. Doch deren Welt ist dunkel und tückisch, und schon bald gerät Aileana selbst in tödliche Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Ähnliche
ELIZABETH MAY
DIE FEENJÄGERIN
Roman
WILHEL HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Edinburgh im Jahre 1844: Aileana Kameron, die bildschöne Tochter eines reichen Marquis, scheint eine ganz normale junge Frau aus gutem Hause zu sein. Sie träumt davon, einmal zu heiraten und eine Familie zu gründen. Bis zu dem Abend, an dem sie ihre Mutter tot auffindet – ermordet von einer Fee. Aileana schwört, nicht eher zu ruhen, bis sie ihre Mutter gerächt hat, und sie will andere vor diesem schlimmen Schicksal bewahren. Seither tauscht sie Nacht für Nacht Rüschenkleider gegen Stiefel und Hosen aus und geht bis an die Zähne bewaffnet auf Feenjagd. Doch diese magischen Kreaturen sind nicht nur schwer zu töten, sie sind auch undurchschaubar. So wie Kiaran, Aileanas mysteriöser Mentor. Warum steht er der jungen Frau zur Seite? Und wieso ist ihre Fähigkeit, Feen zu jagen, so eng an ihn gebunden? Als Aileana endlich Kiarans dunkles Geheimnis erfährt, ist es fast schon zu spät – für sie und ganz Schottland …
Die Autorin
Elizabeth May wurde in Kalifornien geboren, wo sie auch ihre ersten Lebensjahre verbrachte, bevor sie nach Schottland zog. Sie studierte Anthropologie an der Universität von St. Andrews und schreibt derzeit an ihrer Doktorarbeit. Wenn sie sich nicht gerade der Wissenschaft widmet, stürzt sie sich mit Begeisterung in fantastische Welten. Die Autorin lebt zusammen mit ihrem Mann in Edinburgh.
@HeyneFantasySF
twitter.com/HeyneFantasySF
Titel der englischen Originalausgabe
THE FALCONER
Deutsche Übersetzung von Kathrin Wolf
Deutsche Erstausgabe 03/2015
Redaktion: Martina Vogl
Copyright © 2013 by Elizabeth May
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe
und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft, Augsburg
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-14561-3
Mr. May, das ist für dich.
Danke für all die Mitternachtsspaziergänge.
1
EDINBURGH, SCHOTTLAND, 1844
Ich habe mir jede ihrer Anschuldigungen eingeprägt: Mörderin. Sie hat es getan. Sie hat blutbesudelt über der Leiche ihrer Mutter gekauert.
Hinter mir drängen sich ein paar vornehme Damen. Ihre Kleider berühren sich, und ihre Köpfe sind im Gemurmel gesenkt – der übliche Anblick eines jeden Balls, den ich besucht habe, seit meine Trauerzeit vor zwei Wochen zu Ende gegangen ist. Doch egal, wie oft ich ihre Kommentare auch höre, sie schmerzen noch immer.
»Es heißt, ihr Vater soll sie direkt nach dem Vorfall erwischt haben.«
Ich zucke von dem Punschspender zurück. Auf der goldenen, zylinderförmig zulaufenden Seite des Apparats öffnet sich eine Klappe. Ein metallischer Arm surrt heraus, entfernt meine Porzellantasse aus der Vorrichtung unter dem Hahn und stellt sie zurück auf den Tisch.
»Du kannst doch nicht allen Ernstes glauben, dass sie dafür verantwortlich ist«, entgegnet eine andere Lady. Sie steht so weit weg, dass ich ihre Worte über all die angeregten Unterhaltungen in dem überfüllten Ballsaal gerade noch verstehen kann. »Mein Vater meinte, sie müsse gesehen haben, was passiert ist, aber du glaubst doch nicht …«
»Nun, mein Bruder war letztes Jahr bei ihrer Einführung in die Gesellschaft dabei, und er hat gesagt, sie sei bis zu den Ellbogen über und über in … ach, ich kann nicht weitersprechen. Zu grausig.«
»Die Obrigkeit beharrt darauf, dass ihre Mutter von einem Tier angefallen wurde. Sogar die Marquise von Douglas hat das gesagt.«
»Nun, ihr Vater konnte ja auch kaum seine eigene Tochter beschuldigen, oder?«, antwortet die Erste. »Er hätte sie in die Irrenanstalt schicken sollen. Weißt du eigentlich, dass sie …« Ihre Stimme wird zu leise, als dass ich den Rest hören könnte.
Ich packe den Stoff meines Kleids. Wäre da nicht die dicke Seide, meine Nägel würden sich in meine Haut graben. Nur so kann ich mich davon abhalten, die unter meinen Unterröcken versteckte Pistole hervorzuziehen.
Dir geht es gut, sage ich mir. Du bist nicht wütend. Das ist nur ein Haufen Dummköpfe, es lohnt nicht, sich über sie aufzuregen.
Doch mein Körper hört nicht auf mich. Fest beiße ich die Zähne zusammen und lasse mein Kleid los, um meinen Daumen auf den beschleunigten Puls an meinem Handgelenk zu pressen. Einhundertzwanzig Schläge später hat er sich noch immer nicht verlangsamt.
»Na?«, sagt eine Stimme neben mir. »Nimmst du einen Punsch, oder willst du für den Rest des Abends den Apparat da anstarren?«
Meine Freundin, Miss Catherine Stewart, mustert mich mit einem beruhigenden Lächeln. Wie gewöhnlich sieht sie wunderschön aus in ihrem rosaroten Seidenkleid. Ihre blonden Locken – jede genau da, wo sie sein soll – glänzen im Licht der Deckenbeleuchtung, als sie sich nach vorne beugt, eine unbenutzte Tasse vom Tisch nimmt und sie mir reicht.
Mein Atem geht stoßweise, und zwar hörbar. Wie unglaublich ärgerlich. Ich hoffe, sie merkt es nicht. »Leblose Gegenstände anstarren wird meine neueste Lieblingsbeschäftigung«, entgegne ich.
Forschend blickt sie mich an: »Ach so? Und ich dachte, du lauschst vielleicht dem Geschnatter dort am anderen Ende des Büffets.«
Die Damenschar keucht kollektiv auf. Ich frage mich, welchen Gesetzesverstoß sie mir diesmal anlasten – abgesehen von dem offensichtlichen natürlich.
Nein, besser nicht darüber nachdenken, sonst drohe ich ihnen am Ende noch körperliche Gewalt an. Und zücke vielleicht meine Pistole. Dann stecken sie mich aber wirklich in eine Irrenanstalt.
Ich stelle die Tasse unter den Hahn und drücke fester als nötig auf den Knopf der Maschine. Oben entweicht Dampf. Punsch strömt hervor, der meine Tasse fast bis zum Rand füllt. Ich nehme sie und nippe daran.
Zur Hölle. Nicht mal eine Andeutung von Whisky. Einer der Anwesenden hat doch bestimmt einen Flachmann hier hereingeschmuggelt, um uns vor diesem faden Geschwätz zu bewahren!? Irgendjemand macht das immer.
»Keine schlagfertige Erwiderung?«, fragt Catherine mit schnalzender Zunge. »Du musst krank sein.«
Ich werfe einen Blick auf die Tratschtanten. Drei junge Ladys, in nahezu identische weiße Kleider gehüllt, ein jedes mit verschiedenfarbigen Bändern und blumigen Ornamenten geschmückt. Ich erkenne keine von ihnen. Die Flüsternde hat dunkles, aus dem Gesicht gekämmtes Haar. Eine einzelne Locke ruht auf ihrer Schulter.
Ihre Augen begegnen meinen. Schnell wendet sie sich ab und wispert ihren Gefährtinnen etwas zu. Bevor sie sich gemeinsam wegdrehen, schauen sie mich an. Gerade so lange, dass ich Bestürzung und einen Hauch Bösartigkeit in ihren Zügen sehen kann.
»Guck nur«, sage ich. »Die sind bereit, Blut fließen zu lassen, meinst du nicht?«
Catherine folgt meinem Blick. »Wenn mich meine Augen nicht täuschen, hat Miss Stanley ihre Krallen ausgefahren. Hast du mitbekommen, was sie gesagt hat?«
Ich atme etwas lauter aus als nötig und versuche, mich zu beruhigen. In mir gibt es einen Ort für meine Wut, eine Grube, in der ich sie auch jetzt tief begrabe. Dieser täglich stattfindende Kontrollmechanismus erlaubt mir, ein gefälliges Gebaren an den Tag zu legen, ein strahlendes Lächeln, abgerundet durch ein gezwungenes, sprudelndes Lachen, das ein wenig banal, ja sogar dumm klingt. Mein wahres Ich kann ich nie zeigen. Wenn ich das täte, würden sie alle erkennen, dass ich eine sehr viel schlimmere Frau bin, als sie bisher dachten.
Mit aller Gelassenheit, die ich aufbringen kann, koste ich noch etwas von dem Punsch. »Dass ich ein Bild der Anmut abgebe«, antworte ich sarkastisch. »Du weißt genau, was sie gesagt hat.«
»Hervorragend.« Catherine streicht die Vorderseite ihres Ballkleides glatt. »Dann gehe ich mal deine Ehre verteidigen. Erwarte meine triumphale Rückkehr.«
Ich stelle mich ihr in den Weg und sage unverblümt: »Nein. Tu das lieber nicht.«
Ganz offensichtlich habe ich während meines Trauerjahrs die schöne Kunst der höflichen Beschimpfung verlernt. Die alte Aileana Kameron wäre zu dem Damengrüppchen hinübergeschlendert, um etwas Liebenswürdiges und gleichzeitig überaus Schneidendes zu sagen. Jetzt besteht mein erster Impuls darin, eine der Waffen zu ziehen, die ich bei mir habe. Vielleicht hätte das massive Gewicht des Schwerts etwas Tröstliches.
»Sei nicht dumm«, sagt Catherine. »Abgesehen davon mochte ich Miss Stanley noch nie. Sie hat mein Haar mal während einer Französischstunde in ein Tintenfass getaucht.«
»Du hattest seit drei Jahren keine Französischstunde mehr. Meine Güte, du kannst ganz schön nachtragend sein.«
»Seit vier. Und meine Meinung von ihr hat sich in der Zwischenzeit nicht gebessert.«
Sie versucht sich an mir vorbeizumanövrieren, doch ich bin zu schnell. In meiner Hast stoße ich gegen den Tisch mit den Getränken. Porzellantassen klirren, und ein paar der Untertassen rutschen an die Tischkante. Das Damengrüppchen merkt es und flüstert noch angeregter.
»Himmel noch mal!« Catherine bleibt stehen. »Willst du wirklich hier rumstehen und Punsch trinken, während dich dieser Drachen fälschlicherweise beschuldigt …«
»Catherine.«
Sie starrt mich an. »Sag was, oder ich tu’s.«
Niemand – Catherine eingeschlossen – weiß, dass das Gerücht so falsch nicht ist. Eher untertrieben. In zwölf Monaten habe ich genau einhundertachtundfünfzig Morde begangen. Und meine Strichliste wird inzwischen fast jede Nacht länger.
»Und was soll ich deiner Ansicht nach das nächste Mal tun?«, frage ich. »Jeden, der dasselbe sagt, herausfordern, oder was?«
Sie rümpft die Nase. »Das ist nichts als lächerlicher, abgedroschener Klatsch, der bald in Vergessenheit geraten wird. Leute wie Miss Stanley weigern sich, es gut sein zu lassen, weil sie sonst nichts zu besprechen hätten. Niemand glaubt dieses grässliche Gerücht wirklich.«
Ich rücke vom Tisch ab. Der Ballsaal der Hepburns ist voller umherlaufender Paare und Grüppchen, die sich an den Erfrischungen gütlich tun, bevor die nächste Tanzrunde beginnt.
In der Mitte des Saals hängt ein Kristallleuchter. Seit ich das letzte Mal hier war, hat man ihn ganz neu mit Elektrizität ausgestattet. Laternen schweben unter der Decke, jedes Glasgehäuse mit einem ganz eigenen Design. Während sie über die Menge hinweggleiten, summt der Mechanismus in ihrem Inneren, und das gefärbte Glas wirft Schatten auf die Tapeten mit dem Blumenmuster.
Während ich die Anwesenden in ihren feinen Kleidern und den maßgeschneiderten Anzügen betrachte, dreht sich mehr als nur ein Kopf in meine Richtung. Die Blicke sind schwer, verurteilend. Ich frage mich, ob mich alle, die damals bei meiner Einführung in die Gesellschaft dabei waren, immer so wahrnehmen werden wie in jener Nacht – als das blutüberströmte Mädchen, das weder sprechen noch weinen noch schreien konnte.
Ich habe Unglück in ihr sauberes, aufgeräumtes Leben gebracht, und das Rätsel vom Tod meiner Mutter wurde nie gelöst. Denn, welches Tier schlachtet sein Opfer so methodisch ab wie jenes, von dem sie angeblich getötet wurde? Und welche Tochter sitzt neben der Leiche ihrer Mutter, ohne eine einzige Träne zu vergießen?
Ich habe nie auch nur ein Wort darüber verloren, was in jener Nacht passiert ist. Habe nach außen hin nie ein Zeichen von Trauer zur Schau getragen – nicht einmal bei der Beerdigung meiner Mutter. Ich habe schlicht nicht wie ein unschuldiges Mädchen reagiert.
»Jetzt komm schon«, murmle ich. »Du warst schon immer eine grauenhafte Lügnerin.«
Catherine wirft einen finsteren Blick in Miss Stanleys Richtung. »Die sind nur so gehässig, weil sie dich nicht kennen.«
Sie klingt, als wäre sie sich so sicher, was mich betrifft. Sicher, dass ich unschuldig bin und ein guter Mensch. Einst hat Catherine mich gekannt. So wie ich damals war. Jetzt gibt es nur noch ein einziges lebendes Individuum, das mich wirklich versteht. Und das den zerstörerischen Teil meines Wesens kennt, den ich vor all den anderen verberge – denn genau dieses Individuum hat mir geholfen, ihn zu erschaffen.
»Sogar deine Mutter verdächtigt mich, irgendwie mit der Sache zu tun zu haben, dabei kennt sie mich, seit ich ein Kind war.«
Catherine grinst mich an. »Du tust aber auch herzlich wenig, um ihre Meinung von dir zu bessern, wenn du von jeder Gesellschaft verschwindest, zu der sie uns begleitet.«
»Ich habe nun mal oft Kopfschmerzen«, erwidere ich.
»Beim ersten Mal ist die Lüge noch ganz gut, beim siebten Mal eher verdächtig. Vielleicht solltest du es demnächst mit einem anderen Leiden versuchen?«
Sie stellt ihre leere Tasse ab. Sofort hebt der Arm des Spenders sie auf und befördert sie auf das Fließband, welches das schmutzige Geschirr in die Küche zurücktransportiert.
»Ich lüge nicht«, beharre ich. »Den Kopfschmerz, der sich gerade in meinen Schläfen ausbreitet, habe ich Miss Stanley zu verdanken.«
Catherine verdreht die Augen.
Am Ende des Raums streichen die Geiger des Orchesters zur Übung ein paar Töne. Gleich geht es los, und die Tanzkarte um mein Handgelenk ist erstaunlich voll. Adelige sind so scheinheilig. Sie haben sich ein Verbrechen ausgedacht, mich dafür verurteilt, und dennoch betreiben sie die Bekanntschaft mit mir ohne Unterbrechung weiter. Meine Mitgift ist von einer Anziehungskraft, die viele Gentlemen sicher nicht ignorieren werden.
Das Ergebnis: Keine einzige Lücke auf meiner Karte und stundenlange geistlose Unterhaltungen. Wenigstens macht das Tanzen Spaß.
»Dein Lord Hamilton lässt seine Kameraden stehen«, bemerkt Catherine.
Lord Hamilton schiebt sich an einem Damengrüppchen neben den Getränketischen vorbei. Er ist ein kleiner, beleibter Mann, ungefähr zwanzig Jahre älter als ich, mit einer beginnenden Stirnglatze und einer Vorliebe für ungewöhnlich gemusterte Krawatten. Abgesehen davon hat er die etwas unglückliche Angewohnheit, mir das Handgelenk zu tätscheln – was mir vermutlich Trost spenden soll, mir aber einfach nur das Gefühl gibt, wieder zwölf Jahre alt zu sein.
»Er ist nicht mein Lord Hamilton«, antworte ich. »Du lieber Gott, er ist alt genug, mein Vater zu sein.« Ich beuge mich vor und flüstere: »Und wenn er noch einmal mein Handgelenk tätschelt, schreie ich los.«
Catherine schnaubt undamenhaft. »Du hast doch eingewilligt, mit ihm zu tanzen.«
Ich werfe ihr einen vernichtenden Blick zu. »Ich bin ja auch kein totaler Trottel. Ich lehne keinen Tanz ab, es sei denn, mich hat schon ein anderer aufgefordert.«
Lord Hamilton bleibt vor uns stehen. Auf seiner heutigen Seidenkrawatte versammeln sich malvenfarbene, grüne und blaue Farbtupfer zu einem seltsamen Muster. Er lächelt höflich, immer ganz Gentleman.
»Guten Abend, Lady Aileana«, sagt er. Dann nickt er Catherine zu. »Miss Stewart, ich hoffe, es geht Ihnen gut.«
»Das tut es in der Tat«, antwortet sie. »Und wenn Sie mir die Bemerkung erlauben … das ist wirklich eine … auffallende Krawatte.«
Lord Hamilton blickt liebevoll an sich herunter, so als hätte ihn jemand für eine große Leistung beglückwünscht. »Oh, danke. Die Farben setzen sich aus den Umrissen eines Einhorns zusammen. Ein Teil des Hamilton’schen Familienwappens, wissen Sie?«
Ich kneife die Augen zusammen. Wenn überhaupt, dann ähnelt das da irgendeiner Meereskreatur. Doch Catherine nickt nur. »Wie wunderbar. Ich finde, sie steht Ihnen ausgezeichnet.«
Ich sage nichts. Was gesellschaftliche Nettigkeiten betrifft, bin ich schrecklich aus der Übung. Ich würde ihm wahrscheinlich an den Kopf werfen, dass die malvenfarbenen Spritzer wie Tentakel aussehen.
Das Orchester kratzt noch ein paar Töne, während immer mehr Paare zur Mitte des Saals schlendern und sich für den Tanz aufstellen.
Lord Hamilton streckt mir seine behandschuhte Hand entgegen. »Gestatten Sie mir das Vergnügen?«
Ich lege meine Finger in seine, und er tätschelt Herrgott noch mal meine Hand. Ich höre, wie Catherine ein Kichern unterdrückt, während ihr eigener Verehrer sie von uns fortführt. Über die Schulter werfe ich ihr einen finsteren Blick zu, während Lord Hamilton und ich uns zu den Tanzenden gesellen. Er deponiert mich am Ende der Reihe und stellt sich mir gegenüber in Position.
Doch im selben Augenblick, in dem das Orchester zu spielen beginnt, streicht ein seltsamer Geschmack über meine Zunge, von der Spitze bis nach hinten. Wie eine flüchtige Mischung aus Schwefel und Ammoniak rieselt es mir heiß und brennend die Kehle hinab.
Fast entkommt meinen Lippen ein unflätiges Schimpfwort. Eine Fee ist hier.
2
Ich schließe die Augen und versuche, die Kraft der Fee hinunterzuschlucken. Der chemische Geschmack auf meiner Zunge ist so beißend, ich würde mich am liebsten auf den Boden des Ballsaals übergeben. Ich würge, verliere den Halt und falle vornüber.
»Uff!« Ich krache gegen die Dame, die mir am nächsten steht. Die bauschigen Röcke unserer Gewänder prallen aneinander ab, und fast stürzen wir auf die marmornen Fliesen. Gerade noch rechtzeitig packe ich sie an den Schultern, um mich abzufangen.
»Entschuldigen Sie«, sage ich. Meine Stimme ist rau.
Dann blicke ich zu der Frau auf. Miss Fairfax. Sie mustert mich mit wohlbeherrschtem, mildem Widerwillen. Meine Augen fliegen zu den anderen Tänzern. Zahllose Paare der Strathspey-Formation recken die Hälse, um etwas von dem Aufruhr mitzubekommen. Obwohl die beschwingte Musik weiterspielt, starrt mich jeder – wirklich jeder – an.
Einige flüstern, und wieder kann ich ihre Anschuldigungen hören. Oder zumindest glaube ich das. Mörderin. Sie ist verrückt geworden. Der Tod der Marquise war …
Ich wende mich von Miss Fairfax ab. Es verlangt all meine Kraft, die nach oben drängenden Erinnerungen zu bannen. Zu bleiben, wo ich bin, und nicht auf und davonzustürmen. Ich weiß, was Vater sagen würde. Dass ich die Tochter eines Marquis bin und den Familiennamen allzeit vertreten muss.
»Es tut mir so leid, Miss Fairfax. Ich habe mich verzählt«, sage ich schließlich.
Miss Fairfax streicht sich lediglich die Röcke glatt, richtet sich ihr derangiertes Haar und schließt sich mit hochgerecktem Kinn wieder den Tänzern an.
»Lady Aileana?«, sagt Lord Hamilton. Er wirkt ziemlich besorgt. »Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
Ich zwinge mich zu einem Lächeln und antworte ohne nachzudenken: »Es tut mir schrecklich leid – ich muss gestolpert sein.«
Ach, zur Hölle. Ich hätte sagen sollen, dass ich mich einer Ohnmacht nahe fühle. Das wäre die perfekte Entschuldigung gewesen, um mich zu verabschieden und zu gehen. Wie konnte ich so dumm sein?
Jetzt ist es zu spät. Lord Hamilton lächelt nur, nimmt mich bei der Hand und führt mich zurück in die Reihe der Tanzenden. Ich meide die neugierigen Blicke meiner Standesgenossen und schlucke die auf meiner Zunge zurückgebliebene Feenkraft hinunter.
Ich muss diese verfluchte Kreatur finden, bevor sie ihr Opfer ködert. Mein Instinkt rät mir, den Ball zu verlassen, die Fee ausfindig zu machen und sie abzuschlachten. Ich werfe einen Blick in Richtung Ausgang. Zum Geier mit meinem Ruf und der idiotischen Ansicht, eine Dame dürfe nicht ohne Begleitung durch einen Ballsaal gehen oder ihn gar verlassen.
Ich fühle, wie sich meine dunkle Seite regt und in mir anschwillt – verzweifelt darauf aus, nur drei Dinge zu tun: jagen, verstümmeln, töten.
O ja, das will ich, mehr als alles andere. Die Fee ist in der Nähe, gleich dort draußen vor dem Ballsaal. Ich trete aus der Strathspey-Formation heraus und gehe Richtung Tür. Lord Hamilton fängt mich ab und stellt mir eine Frage, die ich aber über das pochende Verlangen und meine mörderischen Gedanken hinweg nicht hören kann.
Verantwortung, rufe ich mir ins Gedächtnis. Familie. Ehre. Verdammnis.
Ich antworte mit einem schlichten »natürlich«.
Lord Hamilton lächelt wieder. Er tut mir leid, sie alle tun mir leid. Sie glauben, ich sei das einzige Monster in ihrer Mitte, dabei können sie die wahre Gefahr nicht sehen. Feen suchen sich ihre Opfer aus und wirken durch kleine Impulse auf ihren Geist ein, um sie sich gefügig zu machen, sich an ihnen zu nähren, sie zu töten.
Fünf Minuten. Länger brauche ich nicht, um die Kreatur ausfindig zu machen und ihr eine Patrone ins Fleisch zu jagen. Nur eine kurze, unbeobachtete Zeitspanne, um …
Fest drücke ich Lord Hamiltons Hand. Zu lange war ich aus der Gesellschaft ausgestoßen, als dass mir die Jagd nicht zur zweiten Natur geworden wäre. Ich muss meine barbarischen Gedanken zum Schweigen bringen, sonst handle ich zu schnell und verliere mich. In meinen Gedanken spulen sich Benimm-Lektionen ab: Die Tochter eines Marquis stürmt nicht aus einem Ballsaal. Die Tochter eines Marquis lässt ihren Partner nicht mitten im Tanz stehen.
Die Tochter eines Marquis jagt keine Feen.
»… meinen Sie nicht auch?«, fragt Lord Hamilton und zieht mich zu den Tänzern zurück.
Ich schüttle mich. »Natürlich.« Tatsächlich gelingt mir ein zuversichtlicher Tonfall.
Lord Hamilton tätschelt mein Handgelenk. Ich beiße die Zähne zusammen, um eine heftige Reaktion zu unterdrücken, während wir um ein anderes Paar herumtanzen.
Der Strathspey scheint ewig weiterzugehen. Linker Fuß hopp, rechter Fuß zurück, linker Fuß in die zweite Position. Schritt nach vorn, dritte Position. Rechtes Knie gebeugt, zweite Position. Immer und immer wieder. Die Musik ist nicht mehr als solche auszumachen. Sie ist zu einem Hintergrundgeräusch quietschender Saiten geworden, dabei ist erst die Hälfte des Tanzes um.
Meine Hand streicht seitlich über mein blaues Seidenkleid, direkt über der Stelle, wo sich meine Leuchtpistole verbirgt. Ich stelle mir vor, wie ich durch die Korridore jage, ziele …
Ruhig, sage ich mir. Wieder betrachte ich die schönen Details des Raums, die Laternen aus Mosaikglas, die immer noch über unseren Köpfen schweben. Über ihnen klicken Messing-Zahnräder, die am Deckenrand an Drähten entlanglaufen. Sie alle sind mit dem Stromnetz von New Town verbunden.
Ich konzentriere mich auf das Klicken, darauf, im Geiste meine Lektionen herzusagen. Anstand. Klick. Anmut. Klick. Bescheidenheit. Klick. Höflichkeit.
Zum Teufel noch mal.
Die Geigen kratzen weiter. Lord Hamilton sagt noch etwas. Mir gelingen ein Lächeln und ein unverbindliches Nicken.
Ich versuche es erneut. Höflichkeit. Klick. Bescheidenheit. Klick.
Endlich verebbt die Musik, und ich wende mich zu Lord Hamilton um. Kommentarlos bietet er mir seinen Arm und führt mich an den Rand des Ballsaals. Wieder beäuge ich die Tür. »Ach«, murmelt Lord Hamilton, »wo ist denn Miss Stewart? Ich sollte Sie hier nicht allein zurücklassen.«
Catherine ist nirgends zu sehen – dem Himmel sei Dank. Eine Person weniger, von der ich mich loseisen muss.
»Es sei Ihnen verziehen«, erwidere ich mit der lieblichen Stimme, die ich so hasse. »Wenn Sie erlauben, muss ich mich für ein paar Minuten in den Damensalon entschuldigen.« Sanft berühre ich meine Schläfe. »Kopfschmerzen, fürchte ich.«
Lord Hamilton runzelt die Stirn. »Herrje, wie schrecklich. Erlauben Sie mir, Sie zu begleiten.«
Als wir an den Flügeltüren ankommen, die auf den Korridor hinausgehen, bleibe ich stehen und lächle. »Es gibt keinen Grund für Sie, den Ballsaal zu verlassen, Mylord. Ich finde den Salon auch allein.«
»Sind Sie sicher?«
Fast hätte ich ihn angeblafft, doch ich zwinge mich, tief durchzuatmen und etwas von meiner Beherrschung wiederzuerlangen. Mein Verlangen zu jagen meldet sich pochend, unnachgiebig. Wenn es mich ganz und gar verzehrt, wird mich Höflichkeit nicht mehr aufhalten können. Ich werde nichts wollen als Blut, Rache und ein Ventil dafür.
Ich schlucke. »Ja, wirklich.«
Lord Hamilton scheint keine Veränderung an mir zu bemerken. Er lächelt nur, deutet eine Verbeugung an und tätschelt mir wieder das Handgelenk. »Haben Sie vielen Dank für das Vergnügen Ihrer Gesellschaft.«
Er wendet sich zum Gehen, und ich trete mit einem erleichterten Seufzer in den Korridor. Endlich.
Als ich mich auf Zehenspitzen von Ballsaal und Damensalon entferne, verursacht mir die wieder aufsteigende Feenkraft ein Kribbeln im Mund. Nach der ersten heftigen Reaktion gewöhnt sich mein Körper langsam an den Geschmack, und ich erkenne die Feenrasse, von der sie abstammt. Wiedergänger.
Da ich erst vier Wiedergänger getötet habe, und auch nie auf eigene Faust, bin ich den intensiven Geschmack ihrer Kraft noch nicht so gewöhnt wie den der anderen, die ich öfter umbringe. Meiner begrenzten Erfahrung nach haben sie drei verwundbare Punkte: eine Öffnung am Thorax, direkt über dem linken Brustmuskel, die Magengrube mit dem weichen Fleck in einer ansonsten undurchdringlichen Haut und eine, sagen wir, suboptimal ausgeprägte Intelligenz.
Ihre Schwächen gleichen die Wiedergänger durch eine starke Muskulatur aus, die es noch schwerer macht, sie zu töten. Andererseits: Ich liebe ja Herausforderungen.
Ich greife in die kleine, in eine Falte meines Ballkleids eingenähte Tasche und ziehe einen dünnen, geflochtenen Seilgflùr-Halm hervor. Diese seltene, in Schottland fast ausgestorbene Distel, versetzt mich in die Lage, Feen zu sehen.
Vor Tausenden von Jahren hatten die Feen sie fast vollkommen ausgerottet, um uns Menschen daran zu hindern, die Wahrheit herauszufinden – dass die Pflanze nämlich ihre einzig wahre Schwäche ist. Oh, sie alle haben ein paar Stellen an ihren Körpern, die man mit einer gewöhnlichen Waffe durchbohren könnte, aber dann wäre trotzdem nur eine von ihnen verletzt. Seilgflùr hingegen ist mörderisch genug, um ihre Feenhaut zu verbrennen oder ihnen gar eine tödliche Wunde zuzufügen. Ich verwende sie in den Waffen, die ich mir für die Jagd anfertige.
Ich binde die Seilgflùr-Distel um meinen Hals und setze mich wieder in Bewegung. Meine Muskeln sind bereit – gelockert und gleichzeitig gestählt vom zwölfmonatigen zermürbenden Training mit Kiaran. In den Nächten, in denen ich ein paar Feen ohne Hilfe abgeschlachtet habe, hat sich meine Technik verbessert. Kiaran behauptet, ich sei noch nicht so weit, auf eigene Faust zu jagen. Dutzende Male habe ich ihn Lügen gestraft. Natürlich weiß er nicht, dass ich seinen direkten Befehl missachtet habe, aber ich habe eben die ausgeprägte Neigung, nicht zu gehorchen, wenn sich die Gelegenheit bietet.
Wieder empfinde ich einen neuerlichen Stoß intensiver Feenkraft auf der Zunge. Irgendwo hinter der nächsten Ecke muss sie sein. Abrupt bleibe ich stehen. »Brillant«, murmle ich.
Der Korridor führt zu den Schlafzimmern. Würde man mich dort erwischen, ich hätte keine Chance, den unweigerlich folgenden Skandal zu verhindern. Mein Ruf ist nur deshalb noch als intakt zu bezeichnen, weil die Gerüchte, die über mich kursieren, nicht bewiesen werden konnten. Dabei erwischt zu werden, wie ich in den Privatgemächern der Hepburns herumschnüffle, wäre ein echtes Problem. Eines, das ich mir angesichts meiner angeschlagenen Reputation nicht leisten kann.
Ich verlagere mein Gewicht. Vielleicht, wenn ich ganz schnell bin …
»Aileana!«
Ich wirble herum. Oh … Hölle.
Catherine und ihre Mutter, die Vicomtesse von Cassilis, stehen hinter mir im Korridor bei den Flügeltüren, die zum Ballsaal führen. Als sie näher kommen, starrt Catherine mich überrascht und verwirrt an, und ihre Mutter – nun, die betrachtet mich mit unverhohlenem Argwohn.
»Aileana«, wiederholt Catherine, als mich die beiden eingeholt haben. »Was machst du denn hier?«
Beide Frauen haben das gleiche glänzend blonde Haar und große, blaue Augen, auch wenn Lady Cassilis’ Blick eher durchtrieben wirkt als unschuldig. Sie hat eine schier unglaubliche Fähigkeit, jeden noch so kleinen Verstoß gegen die Etikette zu bemerken, jeden kleinsten Hinweis auf eine Schmach.
Ach, verdammt noch mal. Dabei erwischt zu werden, wie man zum privaten Flügel der Hepburns unterwegs ist, ist mehr als schlecht. Keine ehrbare Frau würde sich hier herumtreiben. Oder zumindest – und das ist der eigentlich ausschlaggebende Punkt – würde sie sich nicht erwischen lassen.
»Nur ein bisschen verschnaufen«, erwidere ich eilig. Zur Bekräftigung atme ich schwer. »Lord Hamilton hat ein ganz schönes Tempo drauf, weißt du?«
Catherine scheint das übermäßig zu amüsieren. »Ach ja? Nun ja, für einen Mann seines Alters vielleicht.«
»Also«, sage ich und werfe Catherine aus zusammengekniffenen Augen einen Blick zu. »Ich bin hier, um mich einen Moment zu erholen. Das ist alles.«
»Meine Liebe«, erwidert Lady Cassilis mit Nachdruck. »Du solltest dich im Ballsaal erholen, und der befindet sich in dieser Richtung.« Sie weist mit dem Kopf zu den Flügeltüren hinter uns.
Die Kraft der Fee hinterlässt ein pulsierendes Pochen auf meiner Zunge – bestimmt sendet sie sie erneut aus, um jemanden anzulocken.
Mein Körper reagiert mit Anspannung. »Oh, aye«, erwidere ich in gekünsteltem Ton. »Aber …«
»Ja«, korrigiert mich die Vicomtesse. »›Aye‹ klingt so schrecklich unkultiviert.«
Lady Cassilis gehört zu der kleinen, aber immer größer werdenden Zahl schottischer Aristokraten, die glauben, Schottland würde als zivilisiertere Nation durchgehen, wenn wir nur wie die Engländer sprächen. Wenn ihr mich fragt, ist das ein Riesenhaufen Mist. Wir sind auch so schon wunderbar kultiviert. Aber ich möchte diese Angelegenheit nicht unbedingt in einem Korridor diskutieren, während eine blutrünstige Fee hier frei herumschwirrt.
»Aye, natürlich … äh, ich meine, ja«, antworte ich. Du lieber Gott, gibt es denn keine Möglichkeit, mich elegant aus dieser Konversation zu retten?
»Mutter.« Catherine schiebt sich zwischen uns. »Ich bin sicher, Aileana hat eine vernünftige Erklärung dafür, dass sie … hier so herumlungert.« Sie wendet sich mir zu. »Ich dachte, du hättest diesen Tanz Lord Carrick versprochen?«
»Ich habe Kopfschmerzen«, erwidere ich und versuche, so unschuldig wie möglich zu klingen. »Ich habe den Damensalon gesucht, um mich auszuruhen.«
Catherine hebt eine Augenbraue. Ich reagiere mit einem stechenden Blick.
»Nun, dann lass mich mit dir kommen«, meint Catherine.
»Ah, der stets vorhaltende Kopfschmerz«, fällt Lady Cassilis ein. »Wenn du dir im Damensalon Linderung verschaffen möchtest – der befindet sich am anderen Ende des Korridors.«
Die Vicomtesse blickt mich aus zusammengekniffenen Augen an. Ich mache mir keine Illusionen: Hätte sie einen Beweis für ein schreckliches Benehmen meinerseits, dürfte Catherine schon längst nicht mehr mit mir verkehren. Lady Cassilis gibt mir bei Festakten nur deshalb Geleit, weil Catherine sie darum gebeten hat. Die Vicomtesse und meine Mutter waren befreundet. Was in aller Welt sie gemeinsam hatten, kann ich mir allerdings nicht vorstellen.
»Davon abgesehen«, sagt Lady Cassilis, »sollte eine Lady nie ohne Begleitung einen Ballsaal verlassen. Und das weißt du ganz genau, Aileana. Muss ich dich wirklich daran erinnern, dass es einen weiteren Verstoß gegen die Etikette bedeutet, wenn du dich allein in einem Korridor aufhältst?« Sie rümpft die Nase. »Wäre deine Mutter noch unter uns, sie wäre sehr betrübt, fürchte ich.«
Catherine saugt scharf den Atem ein. Ich balle die Hände zu Fäusten und ringe nach Luft. Für einen kurzen Moment steigt Kummer in mir auf, gefolgt von Wut und dem überwältigenden Bedürfnis nach Rache – nach einer weiteren erlegten Beute, die die schmerzliche Erinnerung an den Tod meiner Mutter noch einmal unter sich begräbt. Selbst meine umsichtige Selbstkontrolle hat Grenzen. Ich muss diese Fee finden, bevor mein Trieb mich auffrisst.
»Mutter«, sagt Catherine bedächtig, »würdest du im Ballsaal auf mich warten? Ich bin gleich da.« Als Lady Cassilis den Mund öffnet, um zu protestieren, fügt Catherine hinzu: »Ich brauche nicht lange. Lass mich Aileana einfach nur wohlbehalten zum Salon bringen.«
Die Vicomtesse mustert mich kurz, hebt das Kinn ein wenig und geht dann zielstrebig Richtung Ballsaal.
Catherine seufzt. »Sie hat es nicht so gemeint.«
»Doch, hat sie.«
»Aileana, was immer du auch planst … mach schnell, sonst kann ich dich am Mittwoch nicht besuchen. Mutter …«
»Ich weiß. Sie denkt, ich habe einen schlechten Einfluss auf dich.«
Catherine zuckt zusammen. »Nun ja, vielleicht nicht gerade den besten.«
Ich lächle. »Ich weiß es zu schätzen, dass du mir zuliebe lügst.«
»Ich lüge nie. Ich beschönige höchstens Informationen, wenn es die Situation erfordert. Jetzt zum Beispiel beabsichtige ich, Mutter zu sagen, dass deine Kopfschmerzen sehr schlimm sind und du unter Umständen ein paar Tänze verpassen wirst.«
»Wie überaus taktvoll von dir.« Ich reiche Catherine mein Handtäschchen. »Würdest du das für mich aufbewahren?«
Catherine starrt es an. »Im Damensalon sind Handtaschen erlaubt, denke ich.«
»Schon, aber meine Kopfschmerzen könnten schlimmer werden, wenn ich sie dabeihabe.« Ich drücke ihr das Täschchen in die Hand.
»Hmm. Weißt du, eines Tages werde ich Fragen stellen. Und du wirst sie mir vielleicht sogar beantworten.«
»Eines Tages«, stimme ich zu, dankbar für ihr Vertrauen.
Sie wirft mir ein Lächeln zu und sagt: »Na schön. Dann stürz dich in dein mysteriöses Abenteuer. Aber denk wenigstens an unser Mittagessen. Deine Köchin ist die Einzige, die weiß, wie man richtiges Shortbread zubereitet.«
»Ist das wirklich der einzige Grund für deinen Besuch? Das dämliche Shortbread?«
»Die Gesellschaft ist auch ganz nett … Wenn sie nicht gerade ›Kopfschmerzen‹ hat.«
Mit einem undamenhaften Zwinkern schreitet sie vondannen und geht langsam durch die Flügeltüren in den Ballsaal.
Endlich befreit rausche ich mit raschelndem Rock und von drei steifen Petticoats aufgebauschten Volants den Korridor entlang. Seit ich vor einem Jahr mit dem Training begonnen habe, ist mir mehr und mehr bewusst geworden, wie sehr einen Damenbekleidung einschränkt. Der Schmuck ist wunderschön – aber im Gefecht vollkommen nutzlos.
Als ich um die Ecke biege, kehrt die Feenkraft mit aller Gewalt zu mir zurück. Ich lasse zu, dass sich der scharfe Geschmack über meine Zunge legt. Die gespannte Erwartung tut mir gut. Dies ist einer meiner Lieblingsmomente beim Jagen, gleich nach dem Töten an sich. Ich stelle mir vor, wie ich auf meine Beute schieße, fühle die friedliche Erleichterung, wenn sie stirbt …
Dann, schlagartig, wird mir der Geschmack mit einem derartigen Ruck aus der Kehle gerissen, dass ich mich vornüberbeuge und würge.
»Verdammt«, flüstere ich. Dieses aggressive Schwinden der Kraft bedeutet, dass der Wiedergänger sein Opfer gefunden hat und sich an menschlicher Energie nährt.
Mit einem weiteren gemurmelten Fluch lasse ich meine Stola von meinen Schultern gleiten, um sie mir – zur Hölle mit der Schicklichkeit – um die Taille zu binden. Dann raffe ich meine ausladenden Röcke und Petticoats und stürze die Treppe hinauf. Oben angekommen, blicke ich mich entsetzt um. So viele Türen. Jetzt, da die Kraft verschwunden ist, kann ich nicht länger sagen, in welchem Zimmer sich die Fee befindet.
Schnell laufe ich den Korridor hinab. Hier ist es so still. Zu still. Jede raschelnde Stofffalte meines Kleids und jede knarzende Diele unter meinen Satinschuhen wird mir schmerzlich bewusst.
Ich drücke mein Ohr an die nächstgelegene Tür. Nichts. Um ganz sicherzugehen, öffne ich sie, doch das Zimmer dahinter ist leer. Ich versuche es mit einer anderen Tür. Wieder nichts.
Als meine Hand die nächste Klinke umschließt, höre ich ein leises Keuchen. Die Art Atemzug, den jemand tut, der nur noch wenige Augenblicke zu leben hat.
Ich wäge meine Möglichkeiten genau ab. Ich habe nur eine einzige Gelegenheit, das Wiedergänger-Opfer zu retten. Wenn ich einfach so drauflos- und hineinstürme, könnte die Fee die betreffende Person töten, bevor ich schieße.
Leise schiebe ich meine Petticoats zur Seite und ziehe die Leuchtpistole aus dem Halfter an meinem Oberschenkel. Ich halte den Griff der Waffe umklammert, während ich sachte die Tür aufstoße, um nach drinnen zu spähen.
Neben dem Himmelbett in einer Ecke des Raums beugt sich die monströse Silhouette des Wiedergängers über ihr Opfer. Mit ihrer Größe von gut zwei Metern ähnelt die muskulöse Fee einem verwesenden Troll. Strähniges, schlaffes Haar hängt ihr in Büscheln um die Kopfhaut. Die bleiche Haut der Kreatur erinnert an totes Fleisch, weist da und dort Verfallsflecken auf und schält sich an anderen Stellen. An der Wange klafft ein Loch, das den Blick auf ihren Kiefer und eine Zahnreihe freigibt. Feen können die meisten Verletzungen in weniger als einer Minute heilen, doch für Wiedergänger ist dies ihr natürlicher Zustand – sie sehen durch und durch widerlich aus, wie Leichen.
Die Fingerspitzen der Fee sind tief in der Brust eines Gentlemans vergraben, in dem ich sogleich den betagten Lord Hepburn erkenne. Seine Weste ist blutdurchtränkt, und seine Haut hat eine bläuliche Färbung.
Wenn sich eine Fee an menschlicher Energie nährt, werden beide in ein erstaunlich weißes Licht getaucht. Lord Hepburn ist noch nicht tot, aber beinahe.
Ich stelle das Atmen ein und hebe die Leuchtpistole etwas weiter an, bis sie sich auf Höhe der Brust des Wiedergängers befindet, direkt über der Thoraxöffnung. Mein Griff wird fester, mein Daumen fährt in einer zärtlichen Liebkosung über die kunstvolle Gravur.
Beweg dich, befehle ich dem Wiedergänger in Gedanken. Nur ein kleines Stück, damit ich unseren liebenswürdigen Gastgeber nicht verletze.
Die Fee bewegt sich nicht. Zeit, einzuschreiten.
Ich lasse die Pistole sinken, betrete das Zimmer und schließe die Tür mit einem vernehmlichen Klicken hinter mir.
Der Kopf des Wiedergängers fährt hoch. Er bleckt zwei spitze Zahnreihen und stößt ein grollendes Knurren aus, bei dem sich die feinen Härchen auf meinen Armen aufstellen.
Ich lächle lieblich. »Hallöchen.«
Ich merke, wie sich Lord Hepburn kaum merklich regt, und entspanne mich etwas. Gott sei Dank, er lebt wirklich noch. Der schwarze, starre Blick des Wiedergängers folgt mir, während ich mich neben das samtene Sofa stelle, doch er bleibt, wo er ist, und trinkt immer noch gierig von der Energie des armen Mannes.
Ich muss ihn zwingen, mir wieder seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. »Lass ihn fallen, du grässliches Ding.« Das Biest faucht, und ich trete vor. »Fallen lassen, habe ich gesagt. Sofort.«
Als die Kreatur von Lord Hepburn ablässt und sich zu ihrer vollen Größe aufrichtet, schließen sich meine Finger erneut fester um die Pistole. Jetzt, da die Fee mit dem Saugen aufgehört hat, kommt der stechende Geschmack nach Ammoniak und Schwefel zurück. Riesig und muskelbepackt ragt sie vor mir auf. Eine klare Flüssigkeit, die ich lieber nicht genauer inspiziere, tropft an ihr herab.
Eine vertraute, ekstatische Erregung erfüllt mich, als die Fee erneut knurrt. Mein Herz pumpt schneller. Das Blut rauscht in meinen Adern, und meine Wangen brennen.
»Ja, so ist es gut«, flüstere ich. »Nimm mich an seiner statt.«
Die Fee macht einen Satz nach vorn.
3
Ich ziele mit der Pistole, doch die Fee ist sehr viel schneller, als ich erwartet habe, eine einzige verschwommene Bewegung. Noch bevor ich schießen kann, schlägt sie mir die Waffe aus der Hand und donnert mich gegen die Wand. Die Tapete bekommt einen Riss. Eine Vase auf dem Regal neben uns fällt zu Boden. Durch das Geräusch splitternden Glases hindurch höre ich, wie die Pistole über die Dielen schlittert.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!