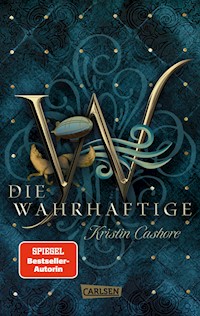9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine starke Frauenfigur kämpft um ihr Glück: hinreißende romantische Fantasy! Wer das Mädchen mit den Haaren wie Feuer einmal gesehen hat, wird es nie wieder vergessen: Fire übt eine unwiderstehliche Macht auf alle Lebewesen in ihrer Nähe aus. Sie kann in die Gedanken anderer Menschen eindringen. Nur nicht in die von Prinz Brigan. Wer ist dieser unnahbare Feldherr und welche Rolle spielt er im Kampf um den Thron? Um Fire herum entspinnt sich ein Netz aus Verschwörungen. Und obwohl sich ihr Innerstes dagegen sträubt, kommt sie dem Prinzen immer näher. Alle Bände der romantischen Bestseller-Serie sind auch unabhängig voneinander lesbar: Die Beschenkte (Band 1) Die Flammende (Band 2) Die Königliche (Band 3) Die Wahrhaftige (Band 4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
KRISTIN CASHORE – DIE FLAMMENDE
Wer das Mädchen mit den Haaren wie Feuer einmal gesehen hat, wird es nie wieder vergessen: Fire übt eine unwiderstehliche Macht auf alle Lebewesen in ihrer Nähe aus. Sie kann in die Gedanken anderer Menschen eindringen. Nur nicht in die von Prinz Brigan. Wer ist dieser unnahbare Feldherr und welche Rolle spielt er im Kampf um den Thron? Um Fire herum entspinnt sich ein Netz aus Verschwörungen. Und obwohl sich ihr Innerstes dagegen sträubt, kommt sie dem Prinzen immer näher.
Alle Bände der Serie sind auch unabhängig voneinander lesbar:
Die Beschenkte (Band 1)
Die Flammende (Band 2)
Die Königliche (Band 3)
Die Wahrhaftige (Band 4)
WOHIN SOLL ES GEHEN?
Buch lesen
Danksagung
Vita
Für meine kleine Schwester Catherine, die (korinthische) Säule meines Herzens
DELLIANISCHE KLAGE
Als ich nicht hinsah, erlosch dein Feuer
Zurück blieb nur Asche, die ich zertrat
Welch Verlust eines Wunders, das du warst
In meinem lodernden Feuer
bewahre ich deine Wut und meine
In meinem lodernden Feuer
bewahre ich deinen Schmerz und meinen
Über den schändlichen Verlust eines Lebens
PROLOG
Larch dachte oft, dass er den Tod seiner Frau Mikra niemals verwunden hätte, wenn sein neugeborener Sohn nicht gewesen wäre. Zum einen, weil der Säugling einen atmenden, funktionierenden Vater brauchte, der morgens aufstand und den Tag über arbeitete; zum anderen wegen des Kindes selbst – so ein gutmütiges Baby, so ruhig. Sein Glucksen und Gurren war so melodisch und seine Augen dunkelbraun wie die seiner toten Mutter.
Larch war Jagdaufseher auf einem Anwesen im südöstlichen Königreich Monsea. Wenn er nach einem Tag im Sattel nach Hause zurückkehrte, nahm er der Amme das Baby beinahe eifersüchtig ab. Verdreckt und nach Schweiß und Pferden stinkend barg Larch den Jungen an seiner Brust, setzte sich in den alten Schaukelstuhl seiner Frau und schloss die Augen. Manchmal weinte er, dann malten die Tränen saubere Streifen in sein schmutziges Gesicht, aber immer lautlos, damit er keins der Geräusche überhörte, die das Kind machte. Der Junge betrachtete ihn. Seine Augen beruhigten Larch. Die Amme sagte, es sei ungewöhnlich für ein so kleines Kind, einen dermaßen klaren Blick zu haben. »Das ist kein Grund zur Freude«, warnte sie, »ein Kind mit seltsamen Augen.«
Larch brachte es nicht fertig, sich Sorgen zu machen. Die Amme sorgte sich schon für zwei. Jeden Morgen untersuchte sie die Augen des Babys, wie es die unausgesprochene Angewohnheit aller frischgebackenen Eltern in den sieben Königreichen war, und jeden Morgen atmete sie ein wenig freier, sobald sie festgestellt hatte, dass sie unverändert waren. Denn ein Säugling, der mit gleichfarbigen Augen einschlief und mit verschiedenfarbigen Augen wieder aufwachte, war ein Beschenkter; und in Monsea wurden beschenkte Babys wie in den meisten Königreichen umgehend Eigentum des Königs. Ihre Familien bekamen sie in der Regel nie wieder zu Gesicht.
Auch nachdem der erste Geburtstag von Larchs Sohn verstrichen war, ohne dass sich die braunen Augen des Jungen verändert hätten, hörte die Amme nicht auf zu unken. Sie hatte Erzählungen von Beschenkten gehört, bei denen es länger als ein Jahr gedauert hatte, dass die Augen ihre endgültige Farbe angenommen hatten, und Beschenkter oder nicht, das Kind war auf jeden Fall nicht normal. Erst vor einem Jahr war Immiker aus dem Bauch seiner Mutter gekrochen und er konnte schon seinen Namen sagen. Mit fünfzehn Monaten bildete er einfache Sätze; mit anderthalb Jahren hatte er die Babysprache abgelegt. Zu Beginn ihrer Zeit bei Larch hatte die Amme gehofft, durch ihre Fürsorge einen Ehemann und einen starken, gesunden Sohn zu gewinnen. Jetzt fand sie das Baby, das wie ein kleiner Erwachsener sprach, während es an ihrer Brust trank, und jedes Mal wortgewandt Bescheid gab, wenn seine Windeln gewechselt werden mussten, geradezu unheimlich. Sie kündigte.
Larch war froh über den Weggang der missmutigen Frau. Er baute eine Trage, in der das Kind während der Arbeit vor seiner Brust hing. Er weigerte sich, an kalten oder regnerischen Tagen auszureiten; er weigerte sich, mit dem Pferd zu galoppieren. Er arbeitete weniger und machte häufig Pausen, um Immiker zu füttern, ihn in den Schlaf zu wiegen und zu wickeln. Das Kind plapperte unentwegt, fragte nach den Namen von Pflanzen und Tieren und erfand Nonsensgedichte, die sich Larch gern anhörte, weil sie ihn immer zum Lachen brachten.
»Die Vöglein, sie lieben die Wipfel der Bäume, denn in ihrem Kopf sind das Wunderorte«, sang der Junge geistesabwesend und tätschelte im Rhythmus den Arm seines Vaters. Dann, einen Augenblick später, sagte er: »Vater?«
»Ja, mein Sohn?«
»Du liebst die Dinge, die ich mir erträume, denn in deinem Kopf gelten nur meine Worte.«
Larch war vollkommen glücklich. Er wusste nicht mehr, warum ihn der Tod seiner Frau so betrübt hatte. Er sah jetzt ein, dass es besser so war, mit ihm und seinem Sohn allein auf der Welt. Er begann den Leuten auf dem Anwesen aus dem Weg zu gehen, weil ihre Gesellschaft ihn langweilte und er nicht einsah, warum sie in den Genuss des Umgangs mit seinem Sohn kommen sollten.
Als Immiker drei Jahre alt war, öffnete Larch eines Morgens die Augen und sah, dass sein Sohn wach neben ihm lag und ihn anstarrte. Das rechte Auge des Jungen war grau. Sein linkes Auge war rot. Larch sprang entsetzt und mit gebrochenem Herzen auf. »Sie werden dich mitnehmen«, sagte er zu seinem Sohn. »Sie werden dich mir wegnehmen.«
Immiker blinzelte ruhig. »Das werden sie nicht, weil dir etwas einfallen wird, wodurch du sie daran hindern kannst.«
Dem König einen Beschenkten vorzuenthalten, war Diebstahl, der mit Gefängnis und Geldstrafen geahndet wurde, die Larch niemals würde bezahlen können, und trotzdem wurde er von dem Drang getrieben zu tun, was der Junge sagte. Sie würden ostwärts reiten müssen, in die felsigen Berge an der Grenze, wo kaum jemand lebte, bis sie auf einen Felsbrocken oder ein Gestrüpp stießen, das ihnen als Versteck dienen konnte. Als Jagdaufseher konnte Larch Tiere aufspüren, jagen, Feuer machen und Immiker ein Heim bereiten, das niemand finden würde.
Immiker war bemerkenswert ruhig angesichts ihrer Flucht. Er wusste, was ein Beschenkter war. Larch nahm an, dass die Amme es ihm gesagt hatte; oder vielleicht hatte auch Larch selbst es ihm erklärt und dann wieder vergessen. Larch wurde vergesslich. Er spürte, wie sich Teile seiner Erinnerung vor ihm verschlossen, wie dunkle Räume hinter Türen, die er nicht mehr öffnen konnte. Larch schrieb das seinem Alter zu, da er genau wie seine Frau nicht mehr ganz jung gewesen war, als diese bei der Geburt ihres Sohnes starb.
»Ich habe schon manchmal überlegt, ob deine Gabe etwas mit Sprechen zu tun hat«, sagte Larch, als sie durch die Hügel ostwärts ritten und den Fluss und ihr altes Zuhause hinter sich zurückließen.
»Hat sie nicht«, sagte Immiker.
»Natürlich nicht«, sagte Larch und verstand nicht, wie er überhaupt auf diese Idee hatte kommen können. »Macht nichts, mein Sohn, du bist ja noch jung. Wir werden es schon herausfinden. Hoffen wir, dass es etwas Nützliches ist.«
Immiker antwortete nicht. Larch überprüfte die Gurte, die den Jungen vor ihm im Sattel hielten. Er beugte sich vor, um Immikers Goldschopf zu küssen, und trieb das Pferd an.
Eine Gabe war eine besondere Fähigkeit, die weit über das Können eines normalen Menschen hinausging. Eine Gabe konnte alle möglichen Formen annehmen. Die meisten Könige hatten mindestens einen Beschenkten in ihrer Küche, einen übermenschlich begabten Bäcker oder Kellermeister. Glücklich schätzen konnten sich die Könige mit Soldaten in ihrer Armee, die über die Gabe des Schwertkampfes verfügten. Es gab Beschenkte, die ein unglaublich gutes Gehör hatten, so schnell rennen konnten wie ein Berglöwe, große Summen im Kopf ausrechnen konnten oder sogar spürten, ob Essen vergiftet war. Es gab auch nutzlose Gaben wie die Fähigkeit, den Oberkörper an der Taille einmal rundherum zu drehen oder Steine zu essen, ohne krank zu werden. Und es gab unheimliche Gaben. Manche Beschenkte konnten Ereignisse voraussagen. Manche konnten in den Geist anderer eindringen und Dinge sehen, die sie nichts angingen. Der König von Nander hatte angeblich eine Beschenkte, die durch einen einzigen Blick ins Gesicht eines Menschen sagen konnte, ob derjenige jemals ein Verbrechen begangen hatte.
Die Beschenkten waren Werkzeuge der Könige und weiter nichts. Man hielt sie für widernatürlich und wer ihnen aus dem Weg gehen konnte, tat das, in Monsea genauso wie in den meisten der sechs anderen Königreiche. Niemand war gerne in Gesellschaft eines Beschenkten.
Larch hatte diese Ansicht früher geteilt. Jetzt erkannte er, dass das grausam, ungerecht und dumm war, denn sein Sohn war ein normaler kleiner Junge, der anderen zufällig in vielerlei Hinsicht überlegen war, nicht nur, was seine Gabe anging, als was auch immer die sich entpuppen mochte. Für Larch war das nur ein weiterer Grund, seinen Sohn von der Gesellschaft fernzuhalten. Er würde Immiker nicht an den Hof des Königs schicken, wo man ihn meiden und verspotten würde und für den Zweck benutzen, den der König für richtig hielt.
Sie waren noch nicht lange in den Bergen, als Larch widerwillig einsehen musste, dass man sich dort unmöglich verstecken konnte. Das Problem war nicht die Kälte, obwohl der Herbst hier so rau war wie der Winter auf dem Anwesen des Lords. Es war auch nicht das Gelände, obwohl das Gestrüpp hart und stachelig war, sie jede Nacht auf dem blanken Fels schliefen und es keinen Platz gab, von dem man sich auch nur vorstellen konnte, dass dort Gemüse oder Getreide wachsen würde. Das Problem waren die Raubtiere. Es verging keine Woche, in der Larch nicht irgendeinen Angriff abwehren musste. Berglöwen, Bären, Wölfe. Riesige Vögel, Greifvögel, deren Spannweite doppelt so breit war wie ein Mann groß. Einige der Tiere verteidigten ihr Revier, alle waren bösartig, und sobald der Winter unbarmherzig über Larch und Immiker hereinbrach, waren alle hungrig. Das Pferd verloren sie eines Tages an zwei Berglöwen.
Nachts wärmte Larch den Jungen unter seinem Mantel im Innern des dornigen Unterschlupfs, den er aus Ästen und Gestrüpp gebaut hatte, und lauschte auf das Geheul, die losgetretenen Steine am Abhang, das Gekreisch, das bedeutete, dass ein Tier ihre Witterung aufgenommen hatte. Beim ersten verräterischen Geräusch schnallte er den schlafenden Jungen in der Trage vor seine Brust. Er entzündete eine Fackel, so hell, wie sein Brennstoffvorrat es erlaubte, und stellte sich vor den Unterschlupf, um den Angriff mit Feuer und Schwert abzuwehren. Manchmal stand er stundenlang dort. Larch bekam nicht viel Schlaf.
Er aß auch nicht viel.
»Du wirst noch krank, wenn du weiter so viel isst«, sagte Immiker zu Larch, als sie vor ihrem kärglichen Abendessen aus zähem Wolfsfleisch und Wasser saßen.
Larch hörte augenblicklich auf zu kauen, denn wenn er krank würde, könnte er den Jungen nicht verteidigen. Er reichte ihm den größten Teil seiner Portion. »Danke für die Warnung, mein Sohn.«
Sie aßen eine Weile schweigend weiter und Immiker verschlang Larchs Essen. »Könnten wir nicht höher in die Berge steigen und sie überqueren?«, fragte Immiker.
Larch blickte in die unterschiedlichen Augen des Jungen. »Meinst du, dass wir das tun sollten?«
Immiker zuckte seine schmalen Schultern. »Wäre es möglich, lebendig auf die andere Seite zu gelangen?«
»Was glaubst du?«, fragte Larch, dann schüttelte er über seine Frage den Kopf. Das Kind war erst drei Jahre alt und wusste nichts davon, wie man Gebirge überquerte. Es war ein Zeichen für Larchs Erschöpfung, dass er so oft und so verzweifelt nach der Meinung seines Sohnes fragte.
»Wir würden es nicht überleben«, sagte Larch mit fester Stimme. »Ich habe noch nie von jemandem gehört, dem es gelungen wäre, über das Gebirge nach Osten zu gelangen, weder hier noch in Estill oder Nander. Ich weiß nichts über das Land jenseits der sieben Königreiche, abgesehen von den haarsträubenden Geschichten, die die Leute im Osten über regenbogenfarbene Ungeheuer und unterirdische Labyrinthe erzählen.«
»Dann musst du mich wieder hinunter in die Hügel bringen, Vater, und mich verstecken. Du musst mich beschützen.«
Larchs Verstand war benebelt, erschöpft, hungrig und wurde von nur einem einzigen Blitz aus Klarheit durchzuckt: seiner Entschlossenheit zu tun, was Immiker sagte.
Es schneite, als Larch vorsichtig einen steilen Hang hinabging. Der Junge war unter seinem Mantel festgeschnallt. Larchs Schwert, sein Bogen und die Pfeile, einige Decken und gebündelte Fleischstücke hingen ihm auf dem Rücken. Als der große braune Greifvogel über einem entfernten Gebirgskamm auftauchte, griff Larch müde nach seinem Bogen. Aber der Vogel stürzte so schnell auf sie zu, dass er schon einen Augenblick später zu nah herangekommen war – es war unmöglich, noch auf ihn zu schießen. Larch stolperte von dem Tier weg, stürzte und merkte, wie er den Hang hinabrutschte. Er verschränkte die Arme vor dem Körper, um das Kind abzuschirmen, dessen Schreie das Gekreisch des Vogels übertönten: »Beschütze mich, Vater! Du musst mich beschützen!«
Plötzlich gab der Hang unter Larchs Rücken nach und sie fielen durch Dunkelheit. Eine Lawine, dachte Larch benommen, in dessen Körper jeder Nerv darauf konzentriert war, das Kind unter seinem Mantel zu behüten. Seine Schulter stieß an etwas Spitzes und Larch spürte reißendes Fleisch und Nässe, Wärme. Eigenartig, so abwärtszustürzen. Der Sturz war berauschend, schwindelerregend, als fiele Larch senkrecht, im freien Fall; und kurz bevor er das Bewusstsein verlor, fragte er sich, ob sie wohl durch den Berg zum Grund der Erde fielen.
Larch schrak hoch und hatte nur einen verzweifelten Gedanken: Immiker. Der Körper des Jungen berührte seinen nicht und die Gurte hingen leer vor seiner Brust. Wimmernd tastete Larch mit den Händen umher. Es war dunkel. Der Untergrund, auf dem er lag, war hart und glatt, wie glitschiges Eis. Er bewegte sich, um seine Reichweite zu vergrößern, und schrie unvermittelt auf, als Schmerz seine Schulter und seinen Kopf durchzuckte. Übelkeit stieg in ihm auf. Er kämpfte dagegen an und blieb still liegen. Dabei weinte er hilflos vor sich hin und stöhnte den Namen des Jungen.
»Vater«, sagte Immikers Stimme ganz nah neben ihm. »Hör auf zu weinen und steh auf.«
Larchs Weinen verwandelte sich in Schluchzer der Erleichterung.
»Steh auf, Vater. Ich habe mich umgesehen. Da vorne ist ein Tunnel und wir müssen weiter.«
»Bist du verletzt?«
»Mir ist kalt und ich habe Hunger. Steh auf.«
Larch versuchte den Kopf zu heben und schrie auf, verlor beinahe das Bewusstsein. »Es hat keinen Zweck. Die Schmerzen sind zu stark.«
»Die Schmerzen sind nicht so stark, dass du nicht aufstehen kannst«, sagte Immiker, und als Larch es erneut versuchte, stellte er fest, dass der Junge recht hatte. Es tat entsetzlich weh und er übergab sich ein- oder zweimal, aber es war nicht so schlimm, dass er sich nicht auf die Knie und seinen unverletzten Arm stützen und über den eisigen Untergrund hinter seinem Sohn herkriechen konnte.
»Wo …«, keuchte er, dann brach er seine Frage ab. Sprechen war zu anstrengend.
»Wir sind durch eine Felsspalte gestürzt«, sagte Immiker. »Wir sind gerutscht. Da vorne ist ein Tunnel.«
Larch verstand es nicht und die Vorwärtsbewegung kostete ihn so viel Kraft, dass er den Versuch, es zu verstehen, aufgab. Der Weg war rutschig und es ging bergab. Dort, wo sie hinkrochen, war es etwas dunkler als dort, wo sie herkamen. Der kleine Umriss seines Sohnes huschte vor ihm den Hang hinunter.
»Hier ist eine Stufe«, sagte Immiker, aber Larch war so langsam von Begriff, dass er bereits fiel, bevor er verstanden hatte, und kopfüber einen kleinen Felsvorsprung hinunterstürzte. Er landete auf seiner verletzten Schulter und verlor einen Augenblick das Bewusstsein. Von einem kalten Luftstrom und einem modrigen Geruch, der ihm Kopfschmerzen verursachte, wachte er auf. Er lag in einem engen Spalt, eingeklemmt zwischen nah zusammenstehenden Wänden. Er versuchte zu fragen, ob sein Sturz den Jungen verletzt hatte, bekam aber nur ein Stöhnen heraus.
»Wo lang?«, fragte Immikers Stimme.
Larch wusste nicht, was er meinte, und stöhnte erneut.
Immikers Stimme klang müde und ungeduldig. »Ich hab dir doch gesagt, dass das hier ein Tunnel ist. Ich habe mich zu beiden Seiten an der Wand entlanggetastet. Entscheide dich für eine Richtung. Bring mich hier raus.«
In beide Richtungen war es gleich düster, gleich muffig, aber Larch musste sich entscheiden, wenn der Junge das für das Beste hielt. Er bewegte sich vorsichtig. Sein Kopf tat weniger weh, wenn der Luftzug von vorne kam, als wenn er ihm den Rücken zukehrte. Das gab den Ausschlag. Sie würden auf die Quelle des Luftzugs zugehen.
Und so traten Larch und Immiker nach vier Tagen Bluten, Stolpern und Hungern, nach vier Tagen, in denen Immiker Larch immer wieder daran erinnerte, dass es ihm gut genug ging, um in Bewegung zu bleiben, aus dem Tunnel hinaus. Nicht in das Licht des Vorgebirges von Monsea, sondern in das eines fremden Landes auf der anderen Seite des Gebirges. Ein östliches Land, von dem keiner von ihnen mehr gehört hatte als törichte Geschichten, die in Monsea beim Abendessen erzählt wurden – Geschichten von regenbogenfarbenen Ungeheuern und unterirdischen Labyrinthen.
Larch fragte sich manchmal, ob an jenem Tag, als er durch den Berg gefallen war, ein Schlag auf den Kopf sein Gehirn geschädigt hatte. Je mehr Zeit er in diesem neuen Land verbrachte, desto stärker kämpfte er gegen den Nebel an, der über den Rändern seines Verstands schwebte. Die Leute hier sprachen anders und die fremden Wörter und Klänge bereiteten Larch Schwierigkeiten. Er war auf Immiker als Übersetzer angewiesen. Mit der Zeit war er bei immer mehr Dingen auf Immikers Erklärungen angewiesen.
Dieses Land, die Dells, war bergig, stürmisch und rau. In den Dells lebten verwandte Arten der Tiere, die Larch aus Monsea kannte – normale Tiere, deren Aussehen und Verhalten Larch verstand und wiedererkannte. Aber in den Dells lebten auch farbenprächtige, erstaunliche Wesen, die das dellianische Volk Monster nannte. Es war ihre ungewöhnliche Färbung, an der sie als Monster zu erkennen waren, denn in allen anderen körperlichen Einzelheiten glichen sie normalen dellianischen Tieren. Sie hatten die Gestalt dellianischer Pferde, dellianischer Schildkröten, Berglöwen, Greifvögel, Libellen, Bären; aber ihre Farbpalette umfasste Fuchsia, Türkis, Bronze, schillerndes Grün. Ein grau geschecktes Pferd in den Dells war ein Pferd. Ein Pferd, so orange wie der Sonnenuntergang, war ein Monster.
Larch verstand diese Monster nicht. Die Mausmonster, die Fliegen-, Eichhörnchen-, Fisch- und Spatzenmonster waren harmlos; aber die größeren Monster, die menschenfressenden Monster, waren furchtbar gefährlich, viel gefährlicher als ihre tierischen Pendants. Sie hatten es auf Menschenfleisch abgesehen und nach dem Fleisch anderer Monster waren sie geradezu verrückt. Nach Immikers Fleisch schienen sie ebenfalls verrückt zu sein, und sobald Immiker groß genug war, einen Bogen zu spannen, lernte er zu schießen. Larch war sich nicht sicher, wer es ihm beigebracht hatte. Immiker schien immer irgendjemanden bei sich zu haben, einen Mann oder Jungen, der ihn beschützte und ihm bei diesem und jenem half. Nie dieselbe Person. Sie verschwanden immer, sobald Larch ihre Namen gelernt hatte, und ihr Platz wurde von jemand Neuem eingenommen.
Larch wusste noch nicht einmal genau, wo die Leute herkamen. Immiker und er lebten erst in einem kleinen Haus und später in einem größeren und dann in einem noch größeren auf einer felsigen Lichtung am Rand einer Stadt, und einige von Immikers Leuten kamen aus der Stadt. Aber andere schienen aus Spalten in den Bergen und der Erde zu kommen. Diese eigenartigen, bleichen unterirdischen Leute brachten Larch Medikamente. Sie heilten seine Schulter.
Er hatte gehört, dass es ein oder zwei Monster in Menschengestalt mit leuchtend bunten Haaren in den Dells gab, aber er bekam sie nie zu Gesicht. Das war auch besser so, denn Larch konnte sich nie merken, ob die menschlichen Monster gutartig waren oder nicht, und gegen Monster im Allgemeinen war er machtlos. Sie waren zu schön. Ihre Schönheit war so überwältigend, dass Larchs Verstand ganz leer wurde und sein Körper erstarrte, wann immer er einem gegenüberstand, sodass Immiker und seine Freunde ihn verteidigen mussten.
»Das ist ihre Taktik, Vater«, erklärte Immiker ihm immer wieder. »Es ist Teil ihrer Macht als Monster. Sie lähmen dich mit ihrer Schönheit und dann überwältigen sie deinen Verstand und machen dich dumm. Du musst lernen, deinen Verstand vor ihnen zu schützen, so wie ich.«
Immiker hatte zweifellos recht, aber Larch verstand immer noch nicht. »Was für eine schreckliche Vorstellung«, sagte er. »Ein Wesen, das die Kontrolle über deinen Verstand übernehmen kann.«
Immiker brach in fröhliches Gelächter aus und umarmte seinen Vater. Und Larch verstand immer noch nicht; aber Immikers Zuneigungsbeweise waren selten und sie überwältigten Larch immer mit stummer Freude, die das Unbehagen seiner Verwirrung betäubte.
In seinen seltenen Momenten geistiger Klarheit war Larch sicher, dass er selbst mit Immikers Heranwachsen immer dümmer und vergesslicher geworden war. Immiker erklärte ihm immer wieder die instabile politische Lage dieses Landes, die militärischen Fraktionen, in die es zerfallen war, den Schwarzmarkt, der in den unterirdischen Gängen blühte, die es durchzogen. Zwei dellianische Lords, Lord Mydogg im Norden und Lord Gentian im Süden, versuchten ihre eigenen Reiche in die Landschaft zu meißeln und dem dellianischen König seine Macht zu entreißen. Weit entfernt im Norden gab es eine weitere Nation aus Seen und Berggipfeln mit Namen Pikkia.
Larch konnte das alles in seinem Kopf nicht auseinanderhalten. Er wusste nur, dass es hier keine Beschenkten gab. Niemand würde ihm seinen Sohn mit den verschiedenfarbigen Augen wegnehmen.
Verschiedenfarbige Augen. Immiker war ein Beschenkter. Larch dachte manchmal darüber nach, wenn sein Verstand klar genug zum Denken war. Er fragte sich, wann die Gabe seines Sohnes in Erscheinung treten würde.
In seinen klarsten Momenten, die er nur hatte, wenn Immiker ihn eine Weile allein ließ, fragte sich Larch, ob sie das nicht schon getan hatte.
Immiker hatte Hobbys. Er spielte gern mit kleinen Monstern. Er band sie fest und riss ihnen die Klauen aus oder ihre leuchtend bunten Schuppen oder Büschel ihrer Haare oder Federn. Als der Junge zehn Jahre alt war, überraschte Larch ihn eines Tages, als er einem Kaninchen von der Farbe des Himmels den Bauch aufschlitzte.
Sogar, wie es so blutend, zitternd und mit weit aufgerissenen Augen dalag, fand Larch das Kaninchen schön. Er starrte es an und vergaß, was er von Immiker gewollt hatte. Es war so traurig, zu sehen, wie etwas so Kleinem und Hilflosem, etwas so Schönem zum Spaß Schaden zugefügt wurde. Das Kaninchen begann Geräusche zu machen, ein entsetzliches panisches Quieken, und Larch hörte sich selbst wimmern.
Immiker warf Larch einen Blick zu. »Es tut ihm nicht weh, Vater.«
Augenblicklich fühlte Larch sich besser, jetzt, wo er wusste, dass das Monster keine Schmerzen litt. Aber dann stieß das Kaninchen ein ganz leises, verzweifeltes Jaulen aus, und Larch war verwirrt. Er sah seinen Sohn an. Der Junge hielt dem zitternden Wesen einen Dolch, von dem das Blut tropfte, vor die Augen und lächelte seinen Vater an.
Irgendwo tief unten in Larchs Verstand regte sich ein leiser Verdacht. Larch fiel wieder ein, was er von Immiker gewollt hatte.
»Ich habe eine Idee«, sagte Larch langsam, »was es mit deiner Gabe auf sich haben könnte.«
Immikers Blick begegnete ruhig und vorsichtig Larchs. »So?«
»Du hast gesagt, die Monster übernehmen mithilfe ihrer Schönheit die Kontrolle über meinen Verstand.«
Immiker senkte den Dolch und sah seinen Vater mit schräg gelegtem Kopf an. Da war etwas Seltsames im Gesichtsausdruck des Jungen. Fassungslosigkeit, dachte Larch, und ein seltsames amüsiertes Lächeln. Als spielte der Junge ein Spiel, das er zu gewinnen gewohnt war, und diesmal hatte er verloren.
»Manchmal glaube ich, dass du die Kontrolle über meinen Verstand übernimmst«, sagte Larch, »mithilfe deiner Worte.«
Immikers Lächeln wurde breiter und dann fing er an zu lachen. Das Gelächter machte Larch so glücklich, dass er ebenfalls zu lachen anfing. Wie sehr er dieses Kind liebte. Die Liebe und das Gelächter perlten aus ihm heraus, und als Immiker auf ihn zukam, breitete er die Arme weit aus. Immiker stieß Larch den Dolch in den Magen. Larch stürzte wie ein Stein zu Boden.
Immiker beugte sich über seinen Vater. »Du warst wunderbar«, sagte er. »Ich werde deine Hingabe vermissen. Wenn man doch jeden so leicht kontrollieren könnte wie dich. Wenn doch nur alle so dumm wären wie du, Vater.«
Es war eigenartig zu sterben. Kalt und schwindelerregend wie der Sturz durch die Berge von Monsea. Aber Larch wusste, dass er nicht durch die Berge von Monsea fiel; im Sterben begriff er zum ersten Mal seit Jahren ganz deutlich, wo er war und was mit ihm geschah. Sein letzter Gedanke war, dass es nicht Dummheit gewesen war, die es seinem Sohn erlaubt hatte, ihn so leicht mit Worten zu verzaubern. Es war Liebe gewesen. Larchs Liebe hatte verhindert, dass er Immikers Gabe erkannte, denn schon vor der Geburt des Jungen, als Immiker nicht mehr war als ein Versprechen in Mikras Körper, war Larch bereits verzaubert gewesen.
Eine Viertelstunde später brannten Larchs Leiche und sein Haus, und Immiker saß auf dem Rücken seines Ponys und bahnte sich einen Weg durch die Höhlen Richtung Norden. Es war befreiend, wieder unterwegs zu sein. Er war seiner Umgebung und seiner Nachbarn in letzter Zeit überdrüssig geworden und er war ruhelos. Bereit für mehr.
Er beschloss diesen neuen Lebensabschnitt durch eine Änderung seines törichten, sentimentalen Namens einzuläuten. Die Leute dieses Landes hatten eine eigenartige Art, Larchs Namen auszusprechen, und Immiker hatte immer gefallen, wie das klang.
Er änderte seinen Namen in Leck.
Ein Jahr verging.
1
Es überraschte Fire nicht, dass der Mann im Wald auf sie geschossen hatte. Was sie überraschte, war, dass er aus Versehen auf sie geschossen hatte.
Der Pfeil traf sie mitten in den Arm und schleuderte sie seitlich gegen einen Felsbrocken, was ihr den Atem nahm. Sie stürzte zu Boden, warf ihren Bogen weg und tastete nach dem Messer in ihrem Stiefel. Der Schmerz war so stark, dass sie ihn nicht ignorieren konnte, aber dahinter konzentrierte sie ihren Geist, machte ihn kalt und klar wie einen einzelnen Stern am schwarzen Winterhimmel. Wenn es ein kaltblütiger Mann war, der wusste, was er tat, wäre er gegen sie gewappnet, aber diese Art Mann begegnete Fire selten. Meistens waren die Männer, die versuchten, sie zu verletzen, wütend oder hochmütig oder ängstlich genug, dass sie einen Riss in der Festung ihrer Gedanken finden und sich hineinstehlen konnte.
Fire fand das Bewusstsein dieses Mannes sofort und stellte fest, dass es weit geöffnet war – sogar so weit, so einladend, dass sie sich fragte, ob er womöglich ein Einfaltspinsel war, der von jemand anderem angeheuert worden war. Sie duckte sich an den Felsen – wobei sie sogar in ihrem Schmerz stur darauf achtete, den Geigenkasten auf ihrem Rücken nicht zu zerdrücken. Seine Schritte ertönten durch die Bäume und dann sein Atem. Sie durfte keine Zeit verschwenden, denn er würde erneut auf sie schießen, sobald er sie entdeckte. Du willst mich nicht töten. Du hast es dir anders überlegt.
Dann kam er um einen Baum herum und seine blauen Augen weiteten sich bei ihrem Anblick vor Erstaunen und Entsetzen.
»O nein, ein Mädchen!«, rief er.
Fire gab sich Mühe, ihre Gedanken neu zu sortieren. Hatte er sie gar nicht treffen wollen? Wusste er nicht, wer sie war? Hatte er Archer umbringen wollen? Sie zwang sich dazu, ihre Stimme ruhig zu halten. »Auf wen hatten Sie es denn abgesehen?«
»Nicht auf wen«, sagte er, »auf was! Ihr Umhang ist aus braunem Pelz. Ihr Kleid ist braun. Bei allen Felsen, Mädchen«, sagte er in einem Ausbruch von Verärgerung. Er kam auf sie zu und untersuchte den Pfeil, der in ihrem Oberarm steckte, das Blut, das ihren Umhang, ihren Ärmel und den Schal um ihren Kopf tränkte. »Man könnte meinen, Sie hätten es darauf angelegt, von einem Jäger angeschossen zu werden.«
Von einem Wilderer, um genau zu sein, denn Archer hatte die Jagd in diesem Wald um diese Tageszeit verboten, damit Fire ihn durchqueren konnte. Außerdem hatte sie diesen gedrungenen, helläugigen Mann mit lohfarbenem Haar noch nie gesehen. Wie auch immer. Wenn er nicht nur ein Wilderer war, sondern darüber hinaus ein Wilderer, der Fire versehentlich angeschossen hatte, während er verbotenerweise auf Archers Land gejagt hatte, würde er sich nicht freiwillig einem von Archers berüchtigten Wutanfällen aussetzen; aber Fire musste ihn dazu bringen, genau das zu wollen. Sie verlor Blut und ihr wurde langsam schwindelig. Sie würde seine Hilfe brauchen, um es bis nach Hause zu schaffen.
»Jetzt muss ich Sie töten«, sagte er mürrisch. Und dann, bevor sie dieser ziemlich eigenartigen Aussage etwas entgegensetzen konnte: »Moment mal. Wer sind Sie? Sagen Sie mir bitte, dass Sie nicht sie sind.«
»Wen meinen Sie?«, fragte sie ausweichend, während sie erneut in sein Bewusstsein eindrang, das immer noch seltsam leer war, als schwebten seine Absichten verirrt im Nebel.
»Sie haben Ihre Haare bedeckt«, sagte er. »Ihre Augen, Ihr Gesicht – Erbarmen.« Er wich vor ihr zurück. »Ihre Augen sind so grün. Ich bin ein toter Mann.«
Er war ein komischer Kerl mit seinem Gerede davon, dass er sie umbringen und selbst sterben würde, und seinem sonderbar wabernden Verstand; und jetzt sah es so aus, als wollte er davonrennen, was Fire nicht zulassen durfte. Sie griff nach seinen Gedanken und rückte sie zurecht. Du findest meine Augen und mein Gesicht gar nicht so bemerkenswert.
Der Mann warf ihr einen verwirrten Blick zu.
Je länger du mich ansiehst, umso mehr stellst du fest, dass ich ein ganz normales Mädchen bin. Du hast ein ganz normales verletztes Mädchen im Wald gefunden und jetzt musst du mich retten. Du musst mich zu Lord Archer bringen.
Hier stieß Fire auf einen leichten Widerstand in Form von Angst. Wahrscheinlich hatte der Mann Angst vor Archer. Sie zog stärker an seinem Verstand und lächelte ihn an – mit dem strahlendsten Lächeln, das sie zustande brachte, während der Schmerz in ihr pochte und sie auf den Waldboden blutete. Lord Archer wird dich belohnen und dich beschützen und man wird dich als Helden verehren.
Ohne zu zögern, nahm er den Köcher und den Geigenkasten von ihrem Rücken und hängte sie zu seinem eigenen Köcher über seine Schulter. Er nahm ihre beiden Bogen in eine Hand und legte ihren rechten Arm, den unverletzten, um seinen Hals. »Kommen Sie, Mädchen«, sagte er. Halb führte er sie, halb trug er sie zwischen den Bäumen hindurch auf Archers Landsitz zu.
Er kennt den Weg, dachte sie müde, und dann verscheuchte sie den Gedanken. Es kam nicht darauf an, wer er war oder wo er herkam. Es kam nur darauf an, dass sie wach und in seinem Kopf blieb, bis er sie nach Hause gebracht hatte, wo Archers Leute ihn festnehmen konnten. Mit allen Sinnen und ihrem ganzen Verstand war sie auf der Hut vor Monstern, denn weder der Schal um ihren Kopf noch der geistige Schild vor ihrem Bewusstsein würden sie vor ihnen verbergen können, wenn sie ihr Blut rochen.
Wenigstens konnte sie darauf zählen, dass dieser Wilderer ein anständiger Schütze war.
Archer erlegte gerade ein Greifvogelmonster, als Fire und der Wilderer zwischen den Bäumen hervorstolperten. Ein herrlicher, weiter Schuss von der oberen Terrasse aus, den Fire in ihrem Zustand nicht bewundern konnte, der den Wilderer jedoch dazu brachte, leise etwas darüber zu murmeln, wie zutreffend der Spitzname des jungen Lords war – Archer bedeutete Bogenschütze.
Das Monster fiel vom Himmel und krachte auf den Weg, der zum Tor führte. Seine Farbe war das kräftige Goldorange einer Sonnenblume.
Archer stand hoch aufgereckt und anmutig auf der steinernen Terrasse, die Augen zum Himmel erhoben, den Langbogen locker in der Hand. Er griff nach dem Köcher auf seinem Rücken, legte einen weiteren Pfeil an und suchte die Baumwipfel ab. Da sah er Fire und den Mann, der sie blutend aus dem Wald schleppte. Er machte auf dem Absatz kehrt und rannte ins Haus, und sogar von hier unten, sogar aus dieser Entfernung und mit steinernen Mauern zwischen ihnen, konnte Fire ihn schreien hören. Sie sandte seinem Geist Wörter und Gefühle, ohne die Kontrolle über sein Bewusstsein zu übernehmen, sandte ihm nur eine Botschaft. Keine Sorge. Ergreife und entwaffne ihn, aber tu ihm nicht weh. Bitte, fügte sie hinzu, was immer das bei Archer auch nützen mochte. Er ist ein netter Mann und ich musste ihn täuschen.
Archer kam mit Hauptmann Palla, seinem Heiler und fünf seiner Wachmänner durch das große Eingangstor gestürmt. Er sprang über den Greifvogel hinweg und rannte auf Fire zu. »Ich habe sie im Wald gefunden«, rief der Wilderer. »Ich habe sie gefunden. Ich habe ihr das Leben gerettet.«
Sobald die Wachmänner den Wilderer gepackt hatten, ließ Fire seinen Geist frei. Vor Erleichterung bekam sie weiche Knie und kippte gegen Archer.
»Fire«, sagte ihr Freund. »Fire. Ist alles in Ordnung? Wo bist du sonst noch verletzt?«
Sie konnte nicht stehen. Archer umfasste sie und ließ sie auf die Erde sinken. Sie schüttelte benommen den Kopf. »Nirgends.«
»Lassen Sie sie herunter«, sagte der Heiler. »Sie soll sich hinlegen. Ich muss die Blutung stillen.«
Archer war außer sich. »Wird sie wieder gesund?«
»Bestimmt«, sagte der Heiler, »wenn Sie mir aus dem Weg gehen und mich die Blutung stillen lassen. Mylord.«
Archer atmete heftig aus und küsste Fire auf die Stirn. Er löste sich von ihr, hockte sich auf die Fersen, ballte die Fäuste und öffnete sie wieder. Dann drehte er sich zu dem Wilderer um, der von seinen Wachen festgehalten wurde, und Fire dachte warnend, Archer, weil sie wusste, dass seine Ängste jetzt in Wut umschlagen würden.
»Ein netter Mann, der trotzdem festgesetzt werden muss«, zischte er den Wilderer an und stand auf. »Ich sehe, dass der Pfeil in ihrem Arm aus Ihrem Köcher stammt. Wer sind Sie und wer hat Sie geschickt?«
Der Wilderer beachtete Archer kaum. Er starrte mit ungläubigen Augen auf Fire hinab. »Sie ist wieder schön«, sagte er. »Ich bin ein toter Mann.«
»Er wird Sie nicht töten«, sagte Fire besänftigend. »Er tötet keine Wilderer und außerdem haben Sie mich gerettet.«
»Wenn Sie auf sie geschossen haben, werde ich Sie mit Vergnügen töten«, sagte Archer.
»Es spielt keine Rolle, was Sie tun«, sagte der Wilderer.
Archer sah den Mann böse an. »Und wenn Sie so fest entschlossen waren, sie zu retten, warum haben Sie dann nicht selbst den Pfeil entfernt und die Wunde verbunden, bevor Sie sie durch die halbe Welt hier hergezerrt haben?«
»Archer«, sagte Fire und hielt dann inne. Sie unterdrückte einen Schrei, als der Heiler ihren blutigen Ärmel abriss. »Er stand unter meiner Kontrolle und ich bin nicht darauf gekommen. Lass ihn in Ruhe.«
Archer drehte sich zu ihr um. »Und warum bist du nicht darauf gekommen? Wo ist dein gesunder Menschenverstand geblieben?«
»Lord Archer«, sagte der Heiler gereizt. »Hier wird niemand angeschrien, der vor Blutverlust wahrscheinlich gleich ohnmächtig wird. Machen Sie sich nützlich. Halten Sie sie fest, während ich den Pfeil herausziehe; und dann kümmern Sie sich am besten um den Himmel.«
Archer kniete sich neben sie und hielt ihre Schultern. Sein Gesicht war versteinert, aber seine Stimme zitterte vor Rührung. »Vergib mir, Fire.« Zu dem Heiler sagte er: »Wir sind wahnsinnig, das hier draußen zu machen. Sie riechen das Blut.«
Und dann ein plötzlicher Schmerz, durchdringend und grell. Fire riss den Kopf herum und kämpfte gegen den Heiler an, gegen Archers Kraft. Der Schal rutschte ihr vom Kopf und enthüllte das schimmernde Prisma ihrer Haare: Sonnenaufgang, Mohn, Kupfer, Fuchsia, Flammen. Ein Rot, leuchtender als das Blut, das den Weg tränkte.
Sie aß in ihrem Steinhaus zu Abend, das sich direkt hinter Archers befand und unter dem Schutz seiner Wache stand. Er hatte das tote Greifvogelmonster in ihre Küche geschickt. Archer war einer der wenigen Menschen, vor denen sie sich nicht dafür schämte, dass sie den Geschmack von Monsterfleisch liebte.
Sie aß im Bett und er leistete ihr Gesellschaft. Er schnitt ihr das Fleisch klein und redete ihr gut zu. Essen tat weh, alles tat weh.
Der Wilderer war in einen der Monsterkäfige unter freiem Himmel gesperrt worden, die Fires Vater, Lord Cansrel, in den Hügel hinter dem Haus gebaut hatte. »Ich hoffe, es kommt ein Gewitter«, sagte Archer. »Ich hoffe auf eine Flut. Ich würde mich freuen, wenn sich der Boden unter deinem Wilderer auftun und ihn verschlingen würde.«
Sie ignorierte ihn. Sie wusste, es war nur heiße Luft.
»Ich bin in deiner Diele Donal begegnet, der sich mit einem Stapel Decken und Kissen hinausschlich«, sagte er. »Du baust deinem Mörder da draußen ein Bett, stimmts? Und fütterst ihn wahrscheinlich so gut wie dich selbst.«
»Er ist kein Mörder, nur ein Wilderer mit eingeschränktem Sehvermögen.«
»Daran glaubst du sogar noch weniger als ich.«
»Also gut, aber ich glaube sehr wohl, dass er mich für einen Hirsch hielt, als er auf mich schoss.«
Archer lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. »Vielleicht. Wir werden morgen noch mal mit ihm reden und uns seine Version der Geschichte anhören.«
»Ich würde lieber nicht dabei helfen.«
»Ich würde dich lieber nicht darum bitten, Liebes, aber ich muss wissen, wer dieser Mann ist und wer ihn geschickt hat. Er ist schon der zweite Fremde, der in den vergangenen zwei Wochen auf meinem Land gesehen wurde.«
Fire lehnte sich zurück, schloss die Augen und zwang ihren Kiefer zum Kauen. Alle waren Fremde. Fremde kamen aus den Felsen, den Hügeln, und es war unmöglich, von jedem die Wahrheit zu erfahren. Sie wollte sie nicht erfahren – und ebenso wenig wollte sie ihre Macht dazu benutzen, sie herauszufinden. Es war eine Sache, die Kontrolle über den Verstand eines Mannes zu übernehmen, um ihren eigenen Tod zu verhindern, aber eine völlig andere, ihm seine Geheimnisse zu stehlen.
Als sie sich wieder Archer zuwandte, blickte er sie ruhig an. Sie sah sein weißblondes Haar und seine tiefbraunen Augen, seinen stolzen Mund. Die vertrauten Züge, die sie kannte, seit sie ein Kleinkind war und er ein Junge, der immer einen Bogen mit sich herumtrug, genauso groß wie er selbst. Sie war es gewesen, die als Erste seinen richtigen Namen Arklin in Archer verwandelt hatte, und er hatte ihr das Schießen beigebracht. Und als sie ihm jetzt ins Gesicht sah, das Gesicht eines erwachsenen Mannes, der für ein Landgut im Norden verantwortlich war, für das Geld, die Landwirtschaft, die Leute, verstand sie seine Besorgnis. Es herrschten nicht gerade friedlichen Zeiten in den Dells. In King’s City klammerte sich der junge König Nash mit einer gewissen Verzweiflung an den Thron, während aufständische Lords wie Lord Mydogg im Norden und Lord Gentian im Süden Armeen aufstellten und darüber nachdachten, wie sie den König stürzen könnten.
Ein Krieg kündigte sich an. Und die Berge und Wälder wimmelten von Spionen und Dieben und anderen gesetzlosen Männern. Fremde waren immer ein Grund zur Sorge.
Archers Stimme war sanft. »Du kannst erst wieder alleine rausgehen, wenn du wieder schießen kannst. Die Greifvögel sind außer Kontrolle. Tut mir leid, Fire.«
Fire schluckte. Sie hatte versucht, diesen deprimierenden Gedanken zu verdrängen. »Es spielt keine Rolle. Ich kann sowieso nicht Geige spielen oder Harfe oder Flöte oder sonst eins meiner Instrumente. Es besteht keine Notwendigkeit, dass ich das Haus verlasse.«
»Wir werden deine Schüler benachrichtigen.« Archer seufzte und rieb sich den Nacken. »Und ich überlege mir, wen ich an deiner Stelle zu ihnen schicke. Bis du wiederhergestellt bist, sind wir dazu gezwungen, unseren Nachbarn ohne die Hilfe deiner Klarsicht zu vertrauen.« Denn von Vertrauen konnte in diesen Zeiten nicht die Rede sein, noch nicht einmal unter langjährigen Nachbarn, und eine von Fires Aufgaben während ihrer Musikstunden war es, Augen und Ohren offen zu halten. Gelegentlich erfuhr sie etwas – Informationen, Gespräche, das Gefühl, dass etwas nicht stimmte –, was Archer und seinem Vater Brocker, beides loyale Verbündete des Königs, weiterhalf.
Außerdem würde Fire lange Zeit ohne den Trost ihrer eigenen Musik auskommen müssen. Sie schloss erneut die Augen und atmete langsam. Die Verletzungen, die sie vom Geigespielen abhielten, waren immer die schlimmsten. Sie summte vor sich hin, ein Lied über die nördlichen Dells, das sie beide kannten, ein Lied, das Archers Vater sie immer gerne spielen hörte, wenn sie bei ihm saß.
Archer nahm die Hand ihres unverletzten Arms und küsste sie. Er küsste ihre Finger, ihr Handgelenk. Seine Lippen streiften ihren Unterarm. Sie hörte auf zu summen, öffnete die Augen und sah, wie seine sie verschmitzt und braun anlächelten.
Das ist nicht dein Ernst, wandte sie sich in Gedanken an ihn.
Er berührte ihre Haare, die sich leuchtend von dem Laken abhoben. »Du siehst unglücklich aus.«
Archer. Jede Bewegung schmerzt.
»Du musst dich nicht bewegen. Und ich kann dich deine Schmerzen vergessen machen.«
Sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen und sagte laut: »Zweifellos. Aber Schlaf kann das auch. Geh nach Hause, Archer. Ich bin sicher, dass du eine andere findest, die du ihre Schmerzen vergessen machen kannst.«
»Wie hartherzig du bist«, sagte er neckend, »wo du doch weißt, was für Sorgen ich mir heute um dich gemacht habe.«
Das wusste sie allerdings. Sie bezweifelte nur, dass die Sorgen ihn verändert hatten.
Natürlich konnte sie nicht schlafen, als er gegangen war. Sie versuchte es, wurde jedoch immer wieder von Albträumen geweckt. An den Tagen, an denen sie unten bei den Käfigen gewesen war, waren ihre Albträume immer am schlimmsten, denn dort war ihr Vater gestorben.
Cansrel, ihr schöner Monstervater. Die Monster in den Dells stammten von Monstern ab. Ein Monster konnte sich mit einem Nichtmonster seiner Spezies fortpflanzen – ihre Mutter war kein Monster gewesen –, aber die Nachkommen waren immer Monster. Cansrel hatte glitzerndes silbernes Haar mit blauen Sprenkeln gehabt und dunkle tiefblaue Augen. Sein Gesicht war wie sein Körper atemberaubend gewesen. Sanft und schön geschnitten wie ein Kristall, der das Licht reflektiert, hatte es mit diesem undefinierbaren Etwas geleuchtet, über das alle Monster verfügen. Solange er lebte, war er der hinreißendste Mann der Welt gewesen, oder zumindest hatte Fire das gefunden. Er hatte das Bewusstsein der Menschen besser kontrollieren können als sie. Er hatte viel mehr Übung darin gehabt.
Fire lag im Bett und versuchte die Erinnerung an den Traum abzuschütteln. Das knurrende Leopardenmonster, mitternachtsblau mit goldenen Flecken, rittlings auf ihrem Vater. Der Geruch nach dem Blut ihres Vaters, seine wunderschönen Augen, die ungläubig auf ihr ruhten. Sterbend.
Jetzt wünschte sie, dass sie Archer nicht nach Hause geschickt hätte. Archer verstand ihre Albträume und Archer war lebendig und leidenschaftlich. Sie sehnte sich nach seiner Gesellschaft, seiner Vitalität.
Sie wurde immer rastloser in ihrem Bett und schließlich tat sie etwas, das Archer zur Weißglut gebracht hätte. Sie schleppte sich zu ihrem Schrank und zog sich unter Schmerzen langsam Mantel und Hose an, dunkelbraun und schwarz, um in der Nacht nicht aufzufallen. Der Versuch, ihre Haare zu verhüllen, brachte sie beinahe dazu, ins Bett zurückzukehren, da sie dafür beide Arme brauchte und es fürchterlich wehtat, den linken Arm zu heben. Irgendwie gelang es ihr dann doch, und widerwillig nahm sie schließlich einen Spiegel zu Hilfe, um sicherzugehen, dass kein Haar mehr zu sehen war. Normalerweise mied sie Spiegel. Es machte sie verlegen, dass ihr eigener Anblick ihr den Atem raubte.
Fire steckte ein Messer in ihren Gürtel und nahm einen Speer mit, wobei sie ihre innere Stimme ignorierte, die ihr zurief, zuraunte, zuschrie, dass sie sich in dieser Nacht noch nicht einmal gegen ein Stachelschwein verteidigen könnte, geschweige denn gegen ein Greifvogelmonster oder ein Wolfsmonster.
Der nächste Schritt war mit nur einem Arm der schwierigste Teil. Sie musste sich über den Baum vor ihrem Fenster aus ihrem eigenen Haus schleichen, da Archers Wachen an allen Türen standen und nie zulassen würden, dass sie verletzt und alleine in den Hügeln umherspazierte. Außer wenn sie ihre Macht dazu nutzte, ihren Verstand zu kontrollieren, und das würde sie nicht tun. Archers Wachen vertrauten ihr.
Archer war derjenige gewesen, dem aufgefallen war, wie nah dieser alte Baum neben dem Haus stand – vor zwei Jahren, als Cansrel noch lebte und Archer achtzehn war und Fire fünfzehn und ihre Freundschaft sich auf eine Art entwickelte, deren Einzelheiten Cansrels Wachleute nicht wissen mussten. Eine Art, die für Fire unerwartet kam und ihr lieb war und die kurze Liste ihrer Glücksmomente anwachsen ließ. Was Archer nicht wusste, war, dass Fire beinahe umgehend begonnen hatte, den Weg über den Baum selbst zu benutzen, zunächst, um Cansrels Männer zu umgehen, und später, nach Cansrels Tod, Archers eigene. Nicht, um irgendetwas Schreckliches oder Verbotenes zu tun; einfach nur, um nachts alleine spazieren zu gehen, ohne dass alle davon wussten.
Sie warf ihren Speer aus dem Fenster. Dann folgte eine Quälerei, die viele Flüche, zerrissene Kleider und abgebrochene Fingernägel mit sich brachte. Als sie schwitzend und zitternd wieder festen Boden unter den Füßen hatte und ihr inzwischen klar geworden war, was für eine blödsinnige Idee sie da gehabt hatte, benutzte sie ihren Speer als Spazierstock und schleppte sich vom Haus weg. Sie wollte nicht weit gehen, nur unter den Bäumen hervor, damit sie die Sterne sehen konnte, die ihre Einsamkeit immer linderten. Sie stellte sie sich als schöne Wesen vor, glühend und kalt; jeder von ihnen allein und traurig und still wie sie.
Heute standen sie klar und wunderschön am Himmel.
Auf einem steinigen Pfad, der hinter Cansrels Monsterkäfigen anstieg, badete Fire im Sternenlicht und versuchte etwas von der Ruhe der Sterne in sich aufzusaugen. Mit tiefen Atemzügen rieb sie sich eine monatealte Pfeilnarbe an ihrer Hüfte, die noch gelegentlich wehtat. Einer der Nachteile einer neuen Wunde war immer, dass auch die alten Wunden sich wieder bemerkbar machten und erneut schmerzten.
Sie war bisher noch nie aus Versehen verletzt worden. Es war schwierig, diesen Angriff in ihrem Kopf einzuordnen; sie fand es beinahe lustig. Sie hatte eine Dolchnarbe auf einem Unterarm und eine auf ihrem Bauch. Ein jahrealtes Loch von einem Pfeil im Rücken. So etwas passierte einfach dann und wann. Auf jeden friedlichen Mann kam einer, der sie verletzen oder sogar töten wollte, weil sie umwerfend war und er sie nicht haben konnte oder weil er ihren Vater verachtet hatte. Und auf jeden Angriff, der eine Narbe zurückgelassen hatte, kamen fünf oder sechs weitere, die sie hatte abwehren können.
Bissspuren an einem Handgelenk: ein Wolfsmonster. Krallenspuren an einer Schulter: ein Greifvogelmonster. Und andere Wunden, die kleinen, unsichtbaren. Erst diesen Morgen in der Stadt: die glühenden Augen eines Mannes auf ihrem Körper und die Ehefrau des Mannes daneben, die Fire eifersüchtig und hasserfüllt anfunkelte. Oder die regelmäßige Erniedrigung, während ihrer Monatsblutung auf eine Wache angewiesen zu sein, die sie vor Monstern schützte, weil diese ihr Blut riechen konnten.
»Die Aufmerksamkeit für deine Person sollte dir nicht peinlich sein«, hätte Cansrel gesagt. »Du solltest dich darüber freuen. Spürst du es nicht – das Vergnügen daran, auf alles und jeden Eindruck zu machen, einfach nur durch deine bloße Existenz?«
Cansrel hatte nichts von alledem je erniedrigend gefunden. Er hatte Raubtiermonster als Haustiere gehalten – einen silbrig-lavendelfarbenen Greifvogel, einen Berglöwen, der blutrot bis purpurfarben leuchtete, einen grasgrünen, golden glänzenden Bären, den mitternachtsblauen Leoparden mit goldenen Flecken. Er hatte sie absichtlich nur wenig gefüttert und war zwischen ihren Käfigen umherspaziert, mit unbedeckten Haaren und kleinen Kratzern auf der Haut, die er sich mit dem Messer selbst zugefügt hatte, damit Blutstropfen hervortraten. Es war eine seiner Lieblingsbeschäftigungen gewesen, seine Monster dazu zu bringen, zu kreischen und zu brüllen und ihre Zähne an den Gitterstäben zu wetzen, außer sich vor Verlangen nach seinem Monsterkörper.
Sie konnte sich nicht vorstellen, sich je ohne Angst und Scham so zu fühlen.
Die Luft wurde feucht und kühl und Frieden zu finden war Fire heute Nacht nicht vergönnt.
Langsam ging sie zurück zu ihrem Baum. Sie versuchte Halt an dem Stamm zu finden und hinaufzuklettern, aber es dauerte nicht lange, bis sie einsehen musste, dass es ihr unter keinen Umständen gelingen würde, auf demselben Weg zurück in ihr Schlafzimmer zu gelangen, auf dem sie es verlassen hatte.
Erschöpft und voller Schmerzen an den Baum gelehnt, verfluchte Fire ihre Dummheit. Es gab jetzt nur noch zwei Möglichkeiten und keine von beiden war annehmbar. Entweder musste sie sich den Wachen an ihrer Tür stellen und morgen mit Archer eine Schlacht um ihre Freiheit schlagen oder sie musste sich ins Bewusstsein eines der Wachmänner schleichen und ihn täuschen.
Sie ließ zögernd ihre Gedanken schweifen, um herauszufinden, wer in der Nähe war. Der Verstand des Wilderers, der in seinem Käfig schlief, tauchte kurz darin auf. Vor ihrem Haus hielten einige Männer Wache, deren Geist sie wiedererkannte. Am Seiteneingang stand ein älterer Mann namens Krell, der eine Art Freund von ihr war – oder es gewesen wäre, hätte er nicht die Tendenz, sie zu sehr zu bewundern. Er war Musiker, mindestens genauso talentiert wie sie und mit mehr Erfahrung. Sie spielten gelegentlich zusammen, Fire auf der Geige und Krell auf der Querflöte oder der Tin Whistle. Krell war zu überzeugt davon, dass sie perfekt war, um sie zu verdächtigen. Eine leichte Beute.
Fire seufzte. Archer war ein besserer Freund, wenn er nicht jede Einzelheit in ihrem Leben und ihrem Kopf kannte. Es blieb ihr nichts anderes übrig.
Sie schlich auf das Haus zu und zwischen die Bäume neben dem Seiteneingang. Das Gefühl, wenn ein Monster sich nach den Pforten des eigenen Bewusstseins ausstreckte, war kaum wahrnehmbar. Ein starker, geübter Mensch konnte lernen, den Übergriff zu erkennen und die Pforten zuzuschlagen. Krells Verstand war in dieser Nacht auf der Hut vor Eindringlingen, aber nicht vor dieser Art Angriff; sein Geist war weit offen und gelangweilt, und Fire schlich sich hinein. Er bemerkte eine Veränderung und versuchte erschrocken, sich darauf zu konzentrieren, aber sie beeilte sich, ihn abzulenken. Du hast etwas gehört. Da, hörst du es? Rufe vor dem Haus. Geh von der Tür weg und sieh nach, was es ist.
Ohne zu zögern, gab er den Eingang frei und wandte ihr den Rücken zu. Sie schlich zwischen den Bäumen hervor zur Tür.
Du hörst nichts hinter dir, nur vor dir. Die Tür hinter dir ist verschlossen.
Er drehte sich in keinem Moment um, zweifelte nicht im Geringsten an den Gedanken, die sie seinem Bewusstsein eingab. Sie öffnete die Tür hinter ihm, schlüpfte hindurch und schloss sie wieder, dann lehnte sie sich einen Moment an die Wand in ihrer Diele, eigenartig bedrückt, weil es so leicht gewesen war. Es sollte nicht so leicht sein, einen Mann zum Narren zu halten.
Vor Selbstekel in eher düsterer Stimmung, schleppte sie sich nach oben in ihr Zimmer. Ein bestimmtes Lied ging ihr nicht aus dem Kopf und erklang dort immer und immer wieder, obwohl sie nicht wusste, warum. Es war das Klagelied, das in den Dells gesungen wurde, wenn man um den Verlust eines Lebens trauerte.
Vermutlich hatten die Gedanken an ihren Vater ihr das Lied ins Gedächtnis gerufen. Sie hatte es nie für ihn gesungen oder auf der Geige gespielt. Sie war nach seinem Tod vor Kummer und Verwirrung zu benommen gewesen, um irgendetwas zu spielen. Man hatte ein Feuer für ihn entzündet, aber sie war nicht hingegangen.
Ihre Geige war ein Geschenk von Cansrel gewesen. Einer seiner eigenartigen Liebesbeweise, denn er hatte für ihre Musik nie Verständnis gezeigt. Und jetzt war Fire allein, das letzte lebende menschliche Monster in den Dells, und ihre Geige war eins der wenigen schönen Dinge, die sie an ihn erinnerten.
Schön.
Nun, vermutlich gab es im Gedenken an ihn manchmal auch schöne Momente. Aber das konnte nichts an den Tatsachen ändern: Auf die eine oder andere Weise ließ sich alles, was in den Dells nicht gut war, auf Cansrel zurückführen.
Das war kein Gedanke, der Frieden brachte. Aber Fire war inzwischen so müde, dass sie fest einschlief und die Dellianische Klage nur noch die Hintergrundmusik für ihre Träume war.
2
Fire erwachte, weil sie Schmerzen hatte, und nahm dann ein außergewöhnliches Maß an Unruhe in ihrem Haus wahr. Unten liefen Wachen geschäftig hin und her, darunter auch Archer.
Als eine Dienerin vor ihrer Schlafzimmertür vorbeiging, rief Fire nach ihr, indem sie das Bewusstsein des Mädchens berührte. Die Dienerin betrat das Zimmer, ohne Fire anzusehen. Stattdessen starrte sie rebellisch den Staubwedel in ihrer Hand an. Aber wenigstens war sie hereingekommen. Einige gingen schnell davon und taten so, als hätten sie nichts gehört.
Steif sagte sie: »Ja, bitte, Lady?«
»Sofie, warum sind da unten so viele Männer?«
»Der Wilderer wurde heute Morgen tot in seinem Käfig aufgefunden, Lady«, sagte Sofie. »Mit einem Pfeil im Hals.«
Dann drehte sie sich auf dem Absatz um und zog die Tür hinter sich zu. Fire blieb tief betrübt im Bett zurück.
Sie wurde das Gefühl nicht los, dass das ihre Schuld war, weil sie ausgesehen hatte wie ein Hirsch.
Fire zog sich an und ging zu ihrem grauhaarigen, willensstarken Diener Donal hinunter, der ihr zu Diensten stand, seit sie ein Baby war. Donal sah sie mit einer hochgezogenen Augenbraue an und wies mit dem Kopf auf die hintere Terrasse. »Ich glaube, es ist ihm ziemlich gleichgültig, wen er erschießt«, sagte er.
Fire wusste, dass er Archer meinte, dessen Ärger sie durch die Wand hindurch spüren konnte. All seinen hitzigen Worten zum Trotz mochte Archer es nicht, wenn Leute in seiner Obhut starben.
»Hilf mir bitte, mein Haar zu bedecken, Donal.«
Eine Minute später, ihre Haare in einen braunen Schal gewickelt, ging Fire hinaus, um Archer in seiner Traurigkeit beizustehen. Die Luft auf der Terrasse war feucht, als stünde Regen bevor. Archer trug einen langen braunen Mantel. Alles an ihm sah gefährlich aus – der Bogen in seiner Hand und die Pfeile auf seinem Rücken, seine frustrierten ruckartigen Bewegungen, der Ausdruck, mit dem er über die Hügel schaute. Fire lehnte sich neben ihn an das Geländer.
»Ich hätte es vorhersehen müssen«, sagte er, ohne sie anzuschauen. »Er hat uns ja geradezu darauf hingewiesen, dass genau das passieren würde.«
»Du hättest nichts dagegen unternehmen können. Deine Wache ist sowieso schon zu sehr ausgedünnt.«
»Ich hätte ihn drinnen einsperren können.«
»Und wie viele Wachen wären dafür nötig gewesen? Wir leben in Steinhäusern, Archer, nicht in Palästen, und wir haben keine Verliese.«
Er fuhr mit der Hand durch die Luft. »Wir sind verrückt, weißt du das? Verrückt zu glauben, dass wir hier leben können, so weit von King’s City entfernt, und uns vor den Leuten aus Pikkia, den Plünderern und den Spionen aufständischer Lords schützen können.«
»Er sah nicht aus wie jemand aus Pikkia und sprach auch nicht so«, sagte sie. »Er war aus den Dells wie wir. Und er war sauber, gepflegt und zivilisiert, ganz anders als die Plünderer, die wir sonst zu Gesicht bekommen.«
Pikkia war das Land nördlich der Dells, das von Seeleuten bevölkert wurde. Es stimmte, dass diese manchmal die Grenze überquerten, um im Norden der Dells Holz und sogar Arbeiter zu rauben. Aber obwohl die Männer aus Pikkia nicht alle gleich aussahen, waren sie meistens größer und hellhäutiger als ihre Nachbarn aus den Dells – auf jeden Fall nicht so klein und dunkel wie der blauäugige Wilderer. Und die Menschen aus Pikkia sprachen mit einem deutlichen kehligen Akzent.
»Nun«, sagte Archer, entschlossen, sich nicht besänftigen zu lassen, »dann war es ein Spion. Das ganze Königreich wimmelt nur so von Lord Mydoggs und Lord Gentians Spionen, die den König, den Prinzen und sich gegenseitig auskundschaften – und wahrscheinlich auch dich, wer weiß«, fügte er missmutig hinzu. »Ist dir nie der Gedanke gekommen, dass die Feinde von König Nash und Prinz Brigan dich vielleicht entführen und als Werkzeug benutzen wollen, um die königliche Familie zu stürzen?«
»Du denkst immer, alle wollten mich entführen«, sagte Fire sanft. »Wenn dein eigener Vater mich in Fesseln legen und für ein paar Münzen an einen Monsterzoo verkaufen würde, würdest du behaupten, dass du ihn schon immer in Verdacht gehabt hättest.«
Er schnaubte. »Du solltest deinen Freunden gegenüber sehr wohl misstrauisch sein, zumindest allen außer mir und Brocker. Und du solltest nicht ohne Wache das Haus verlassen und die Leute, denen du begegnest, schneller manipulieren. Dann müsste ich mir weniger Sorgen machen.«
Das waren alte Streitpunkte und er kannte ihre Antworten bereits auswendig. Sie ignorierte ihn. »Unser Wilderer war weder ein Spion Lord Mydoggs noch Lord Gentians«, sagte sie ruhig.
»Mydogg hat sich im Nordosten eine ganz ordentliche Armee aufgebaut. Wenn er beschließen sollte, sich unser zentraler gelegenes Gebiet als Stützpunkt in einem Krieg gegen den König zu ›borgen‹, könnten wir ihn nicht daran hindern.«
»Archer, bleib realistisch. Die königliche Armee würde uns nicht einfach unserem Schicksal überlassen. Außerdem ist der Wilderer nicht von einem aufständischen Lord hergeschickt worden; dazu war er viel zu unbedarft. Mydogg würde niemals einen unbedarften Späher einsetzen, und auch wenn Gentian nicht über Mydoggs Intelligenz verfügt, wäre er trotzdem nicht so dumm, einen Mann mit einem vernebelten, leeren Bewusstsein zum Spionieren herzuschicken.«
»Also gut«, sagte Archer mit vor Ärger erhobener Stimme, »dann kehre ich zu meiner Theorie zurück, dass es was mit dir zu tun hat. Sobald er dich erkannt hat, hat er immer wieder gesagt, er sei ein toter Mann, und er war diesbezüglich ganz offensichtlich gut informiert. Kannst du mir das bitte erklären? Wer war der Mann und warum bei allen Felsen ist er tot?«
Er war tot, weil er sie verletzt hatte, dachte Fire; oder vielleicht auch, weil sie ihn gesehen und mit ihm gesprochen hatte. Es ergab nicht viel Sinn, hätte allerdings einen guten Witz abgegeben, wenn Archer in der Stimmung für Witze gewesen wäre. Der Mörder des Wilderers war ein Mann nach Archers Geschmack, denn Archer mochte es auch nicht, wenn jemand Fire verletzte oder ihre Bekanntschaft machte.
»Und er war ein ziemlich guter Schütze«, fügte sie laut hinzu.
Archer starrte immer noch wütend in die Ferne, als rechnete er damit, dass der Mörder jeden Moment hinter einem Felsbrocken auftauchen und ihm zuwinken könnte. »Hmm?«
»Du würdest dich gut mit diesem Mörder verstehen, Archer. Er musste sowohl durch die Gitterstäbe der äußeren Einfriedung schießen als auch durch die Gitterstäbe des Käfigs, in dem der Wilderer saß, stimmts? Er muss ein guter Schütze sein.«
Die Anerkennung für einen anderen Bogenschützen schien Archer etwas aufzuheitern. »Mehr als das. Von der Tiefe der Wunde und dem Einschusswinkel her zu schließen, glaube ich, dass er aus großer Entfernung geschossen hat, von den Bäumen jenseits dieser Anhöhe aus.« Er zeigte auf die kahle Stelle, zu der Fire in der vergangenen Nacht hinaufgestiegen war. »Durch zwei Reihen Gitterstäbe hindurch ist schon beeindruckend genug und dann noch genau in den Hals des Mannes? Wenigstens können wir sicher sein, dass keiner unserer Nachbarn es persönlich getan hat. Niemand von ihnen würde einen solchen Schuss zustande bringen.«
»Und du?«
Die Frage war ein kleines Geschenk, um seine Laune zu verbessern, denn es gab keinen Schuss, zu dem Archer nicht auch fähig war. Er grinste sie an. Warf ihr dann einen weiteren, aufmerksameren Blick zu. Sein Gesicht entspannte sich. »Ich bin ein Ekel, dass ich erst jetzt frage, wie es dir heute Morgen geht.«
Ihre Rückenmuskeln fühlten sich an wie fest verknotete Taue und ihr bandagierter Arm schmerzte; ihr gesamter Körper bezahlte teuer für die nächtliche Misshandlung. »Mir geht es gut.«
»Ist dir warm genug? Hier, nimm meinen Mantel.«
Sie saßen eine Weile auf den Stufen der Terrasse, Fire in Archers Mantel gehüllt. Sie sprachen über Archers Pläne, die Felder umzugraben. Bald würde der Frühling anbrechen, Pflanzzeit, und der felsige, kalte Boden hier im Norden widersetzte sich immer gegen den Beginn einer neuen Wachstumsperiode.
Ab und zu spürte Fire ein Greifvogelmonster über sich. Sie verbarg ihren Geist vor ihnen, damit sie sie nicht als die Monsterbeute erkannten, die sie war; aber natürlich fraßen sie in Ermangelung von Monstern auch jedes andere verfügbare Lebewesen. Einer der Greifvögel, der Fire und Archer erblickt hatte, stieß herab und kreiste über ihnen, setzte sich ungeniert in Szene, atemberaubend schön, und griff nach ihrem Bewusstsein, wobei er ein hungriges, primitives und eigenartig besänftigendes Gefühl verströmte. Archer stand auf und schoss ihn ab, dann schoss er noch ein weiteres Monster, das es ebenfalls auf sie abgesehen hatte. Das erste war violett wie der Sonnenaufgang, das zweite von einem so blassen Gelb, dass es aussah, als fiele der Mond vom Himmel.
Auf dem Boden sorgten sie wenigstens für einige Farbtupfer in der Landschaft, dachte Fire. Zu Anfang des Frühlings gab es im Norden der Dells wenig Farbiges – die Bäume waren grau und das Gras, das in Büscheln aus Felsspalten spross, noch braun vom Winter. Genau genommen war der Norden der Dells auch im Hochsommer nicht gerade das, was man farbenprächtig nennen würde, aber wenigstens wurde aus dem braun gesprenkelten Grau im Sommer grün gesprenkeltes Grau.
»Wer hat den toten Wilderer eigentlich entdeckt?«, fragte Fire beiläufig.
»Tovat«, sagte Archer. »Einer der neueren Wachmänner. Du bist ihm vielleicht noch nicht begegnet.«