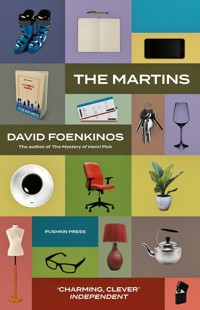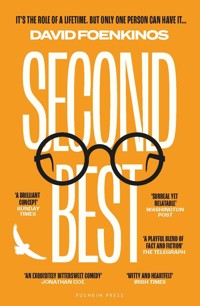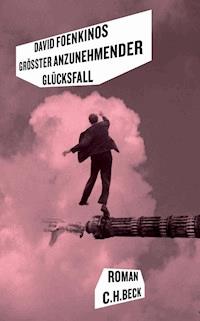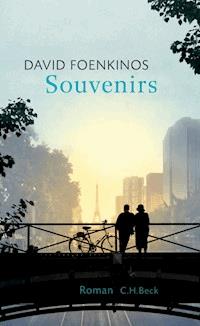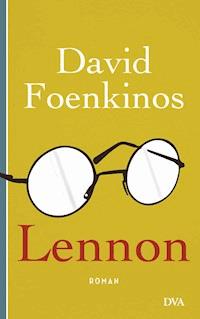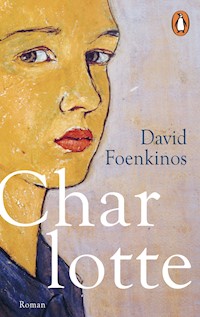5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn das Leben einen zu Umwegen zwingt und daraus ein neues Glück erwächst
Völlig unerwartet kündigt Antoine Duris seine Professorenstelle an der Hochschule der Schönen Künste in Lyon und zieht mit nur einem Koffer nach Paris. Im Musée d'Orsay, wo die farbenfrohen Gemälde von Manet, Monet und Modigliani hängen, bewirbt er sich als Museumswärter. Doch warum flieht er Hals über Kopf aus seinem bisherigen Leben? Keiner weiß, wie sehr ihn das Schicksal seiner hochbegabten Studentin Camille mitgenommen hat. Erst als er Mathilde kennenlernt, findet Antoine einen Weg, sich der Freude, dem Genuss und der Liebe wieder hinzugeben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Warum nur flieht Antoine Duris Hals über Kopf aus seinem bisherigen Leben? Er war Professor an der Kunsthochschule in Lyon und zieht nun nach Paris, um im Musée d’Orsay, wo die farbenfrohen Gemälde von Manet, Monet und Modigliani hängen, Wärter zu werden. Keiner kennt die Gründe für diesen plötzlichen Wandel, keiner weiß, wie sehr ihn das Schicksal seiner hochbegabten Studentin Camille mitgenommen hat. Erst als er Mathilde kennenlernt, findet Antoine einen Weg, sich der Freude, dem Genuss und der Liebe wieder hinzugeben …
Ein kluger, feinfühliger Roman, der vom Mut erzählt, dem Leben eine neue Wendung zu geben – und eine Liebesgeschichte voller Momente der Schönheit.
»Wie ›Charlotte‹hat auch diese Geschichte etwas Strahlendes, Vitales.« Le Figaro Littéraire
»Von der Hässlichkeit des Verbrechens zur Schönheit von Bildern … ein wunderbarer Roman über das Leid und die heilende Kraft der Kunst.« Le Journal du Dimanche
»Eine Geschichte, die uns nicht mehr loslässt, die uns verblüfft und erschüttert.« RTL
David Foenkinos, 1974 geboren, lebt als Schriftsteller und Drehbuchautor in Paris. Neben den Romanbiografien, »Charlotte« (2015) und »Lennon« (2018), finden auch seine Komödien begeisterte Leserinnen und Leser, darunter die Bestseller »Nathalie küsst« (2011) und »Das geheime Leben des Monsieur Pick« (2017), dessen Verfilmung 2019 ins Kino kommt. »Die Frau im Musée d’Orsay« ist Foenkinos’ neuester Roman, der wochenlang in Frankreich auf der Bestsellerliste stand.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
DAVID FOENKINOS
Die Frau im Musée d’Orsay
Roman
Aus dem Französischen vonChristian Kolb
ERSTER TEIL
1
Das Pariser Musée d’Orsay ist ein ehemaliger Bahnhof. Die Gegenwart wandelt somit auf ungewöhnliche Art auf den Spuren der Vergangenheit. Man kann die Gedanken schweifen lassen und sich vorstellen, wie zwischen Gemälden von Manet und Monet die Züge einfahren. Auch eine Form des Reisens. Auf dem Platz vor dem Museum hat mancher Besucher vielleicht Antoine Duris gesehen. Still und verdutzt stand er da, als wäre er vom Himmel gefallen. Verdutzt ist wohl das richtige Wort, um seine Gefühlslage zu beschreiben.
2
Er kam viel zu früh zu seinem Termin mit der Personalchefin. Seit Tagen bereitete er sich innerlich auf dieses Vorstellungsgespräch vor. Er wollte unbedingt im Musée d’Orsay arbeiten. Mit ruhigem Schritt ging er auf den Mitarbeitereingang zu. Mathilde Mattel hatte am Telefon ausdrücklich betont, er solle auf keinen Fall den Besuchereingang nehmen. Ein Mann vom Sicherheitsdienst forderte ihn auf, stehen zu bleiben.
»Haben Sie eine Zugangskarte?«
»Nein, aber ich werde erwartet.«
»Von wem?«
»…«
»Von wem werden Sie erwartet?«
»Pardon … von Madame Mattel.«
»In Ordnung. Melden Sie sich bitte am Empfang.«
»…«
Ein paar Meter weiter erklärte er erneut den Grund seines Erscheinens. Eine junge Frau warf einen Blick in ein großes schwarzes Kalenderheft.
»Sind Sie Monsieur Duris?«
»Ja.«
»Darf ich Ihren Ausweis sehen?«
»…«
Das war doch absurd. Wer würde sich schon für ihn ausgeben wollen? Brav holte er seinen Ausweis hervor und überspielte seine Unsicherheit mit einem verständnisvollen Lächeln. Das Vorstellungsgespräch schien bereits beim Sicherheitsdienst und der Empfangsdame anzufangen. Es galt, vom ersten Bonjour an auf der Höhe zu sein, sich bloß kein holpriges Merci zu erlauben. Nachdem die junge Frau überprüft hatte, ob er wirklich Antoine Duris war, beschrieb sie ihm den Weg. Er sollte einem Flur folgen, an dessen Ende sich ein Aufzug befand. »Das ist ganz einfach, Sie können das Büro gar nicht verfehlen«, fügte sie hinzu. Antoine schwante, dass er sich aufgrund dieser Äußerung nun garantiert verlaufen würde.
In der Mitte des Flurs angelangt, wusste er schon nicht mehr, wohin. Hinter einer Glasfront entdeckte er ein Gemälde von Gustave Courbet. Die Schönheit war immer noch das beste Mittel gegen den Zweifel. Seit Wochen kämpfte er dagegen an, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Er spürte, dass er mit seinen Kräften am Ende war, die beiden kurzen Gespräche, die er hinter sich hatte, hatten ihn schon erhebliche Anstrengungen gekostet. Dabei war es nur darum gegangen, ein paar Worte zu sagen, völlig harmlose Fragen zu beantworten. Sein Weltverständnis war in ein Primärstadium zurückgefallen, er hatte oft irrationale Angstzustände. Er merkte, dass das, was er erlebt hatte, Spuren hinterlassen hatte. Würde er es wenigstens schaffen, mit der Personalchefin des Musée d’Orsay, Madame Mattel, ein Vorstellungsgespräch zu führen?
Als er mit dem Aufzug in den zweiten Stock fuhr, stellte er bei einem flüchtigen Blick in den Spiegel fest, dass er Gewicht verloren hatte. Es wunderte ihn nicht, er nahm zurzeit nicht viel zu sich, vergaß manchmal schlicht das Mittag- oder Abendessen. Sein Magen nahm es ohne Knurren hin, sein ganzer Körper war so etwas wie eine betäubte Stelle. Nur der Kopf sagte: »Antoine, du musst was essen.« Es gibt zwei Arten von menschlichem Leid. Leid, gegen das der Körper sich wehrt, und Leid, gegen das der Geist sich wehrt. Dass beide sich wehren, ist selten.
Im zweiten Stock wurde er von einer Frau empfangen. Normalerweise erwartete Mathilde Mattel ihre Gäste in ihrem Büro, doch für Antoine Duris setzte sie sich in Bewegung. Sie hatte es furchtbar eilig, die Gründe seiner Bewerbung zu erfahren.
»Sind Sie Antoine Duris?«, fragte sie dennoch, um sicherzugehen.
»Ja. Wollen Sie meinen Ausweis sehen?«
»Nein, wieso?«
»Unten hat man ihn sehen wollen.«
»Das ist wegen des Ausnahmezustands. Tut mir leid.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, wer auf die Personalchefin des Musée d’Orsay einen terroristischen Anschlag verüben sollte.«
»Man kann nie wissen«, antwortete sie lächelnd.
Was sich als geistreicher oder scherzhafter Kommentar verstehen ließ, war eigentlich eher eine kühle Bemerkung. Mathilde wies ihm mit einer Handbewegung den Weg zu ihrem Büro. Sie liefen einen langen, engen, leeren Flur entlang. Während er hinter ihr herging, dachte Antoine, dass diese Frau, die zu einer Zeit, zu der das übrige Personal noch gar nicht da war, potenzielle künftige Angestellte begrüßte, ein ziemlich langweiliges Leben haben musste. Er dachte recht ungeordnet und nicht allzu logisch.
In ihrem Büro bot ihm Mathilde alles Mögliche zu trinken an, Tee, Kaffee, Wasser, aber Antoine sagte Nein, Nein, Nein, danke. Also begann sie mit dem Vorstellungsgespräch:
»Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, als ich Ihren Lebenslauf bekommen habe.«
»Warum?«
»Warum? Sie fragen, warum? Sie sind Hochschulprofessor …«
»…«
»Sie haben einen gewissen Ruf. Ich glaube, ich bin sogar schon einmal auf einen Artikel von Ihnen gestoßen. Und Sie bewerben sich als … Saalaufsicht.«
»Genau.«
»Kommt Ihnen das nicht komisch vor?«
»Nicht sonderlich.«
»Ich habe mir erlaubt, bei der Kunsthochschule in Lyon anzurufen«, sagte Mathilde nach einer Weile.
»…«
»Man hat mir bestätigt, dass Sie Ihre Stelle dort aufgegeben haben. Einfach so, von heute auf morgen, ohne irgendeine Erklärung.«
»…«
»Haben Sie keine Lust mehr zu unterrichten?«
»…«
»Haben Sie … Depressionen? Ich habe für so etwas Verständnis. Burn-outs sind weitverbreitet.«
»Nein. Nein. Ich brauche einfach mal eine Pause. Bestimmt werde ich irgendwann wieder anfangen zu unterrichten, aber …«
»Aber was?«
»Hören Sie, Madame, ich habe mich hier um eine Stelle beworben und würde gerne wissen, ob ich Aussicht darauf habe, sie zu bekommen.«
»Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen überqualifiziert sind?«
»Ich mag Kunst. Ich habe sie auch studiert, ich habe sie gelehrt, in Ordnung, aber im Augenblick möchte ich eben nur dasitzen und von schönen Bildern umgeben sein.«
»Saalaufsicht ist aber nicht unbedingt eine geruhsame Arbeit. Man wird ständig mit Fragen gelöchert. Und es kommen auch viele Touristen hierher. Man muss die ganze Zeit aufpassen.«
»Vielleicht können Sie mich ja zur Probe einstellen, wenn Sie an mir zweifeln.«
»Wir brauchen Leute, nächste Woche wird die große Modigliani-Ausstellung eröffnet. Da werden die Massen strömen. Das wird ein Riesenereignis.«
»Das trifft sich gut.«
»Wieso?«
»Modigliani war das Thema meiner Doktorarbeit.«
Mathilde erwiderte nichts. Antoine hatte gedacht, diese Auskunft könnte sich zu seinen Gunsten auswirken. Doch sie schien der Personalchefin vielmehr noch einmal vor Augen zu führen, wie merkwürdig sein Vorhaben doch war. Was wollte ein Gelehrter wie er hier? Stimmte es, was er sagte? Er wirkte wie ein verängstigtes Tier, das sich offenbar nur durch die Flucht in ein Museum retten konnte.
3
An nicht einmal einem Tag hatte Antoine seine Wohnung aufgelöst und die Schlüssel abgegeben. Sein Vermieter sagte zu ihm: »Sie haben zwei Monate Kündigungsfrist, Monsieur Duris … Sie können nicht einfach so weggehen. Ich muss mich ja wieder nach jemandem umschauen.« In völlig verzweifeltem Ton setzte er noch ein paar Sätze hinzu. Antoine fiel ihm ins Wort: »Keine Sorge. Ich zahle Ihnen die zwei Monate.« Er mietete einen kleinen Lastwagen und belud ihn mit seinen Kisten. In den meisten waren Bücher. Er hatte einmal einen Artikel gelesen über Leute, die von einem Tag auf den anderen ihr ganzes bisheriges Leben aufgaben. In Japan nannte man sie die, die sich in Nichts auflösen. Der wunderbare Ausdruck verschleierte ein wenig ihre dramatische Lage. Häufig handelte es sich um Männer, die ihren Job verloren hatten und in einer Gesellschaft, in der es darauf ankam, den äußeren Schein zu wahren, den sozialen Abstieg nicht verkrafteten. Lieber sein Heil in der Flucht suchen und auf der Straße leben als einer Frau, der Familie, den Nachbarn ins Auge sehen. Das war jedoch überhaupt nicht Antoines Situation, der als geachteter und renommierter Professor auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand. Dutzende von Studentinnen und Studenten hofften jedes Jahr, bei ihm ihre Abschlussarbeit schreiben zu dürfen. Was also war passiert? Louise hatte ihn verlassen, aber diese Wunde war in den vergangenen Monaten praktisch schon geheilt. Und so ein Liebesleid musste doch jeder mal ertragen. Deswegen ließ man nicht alles liegen und stehen.
Er hatte sämtliche Kisten und die paar Möbel, die er besaß, in einem Container in Lyon eingelagert. Und war mit einem einzigen Koffer in den Zug nach Paris gestiegen. Nachdem er die ersten Nächte in einem Zwei-Sterne-Hotel in der Nähe des Bahnhofs geschlafen hatte, fand er ein kleines Apartment in einem beliebten Viertel der Hauptstadt. Er brachte keinen Namen am Briefkasten an und musste weder einen Strom- noch einen Gasversorgungsvertrag abschließen. Alles lief auf den Namen des Vermieters. Niemand konnte ihn mehr aufspüren. Freunde und Verwandte machten sich freilich Sorgen. Um diese Sorgen zu zerstreuen oder vielmehr um in Frieden gelassen zu werden, schickte er eine Sammelmail an alle:
Meine Lieben,
es tut mir sehr leid, dass ich euch Kummer bereite. Die vergangenen Tage waren so hektisch, dass ich nicht dazu gekommen bin, eure Nachrichten zu beantworten. Kein Grund zur Unruhe, bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin unterwegs auf einer langen Reise. Wie ihr wisst, habe ich seit Langem vor, einen Roman zu schreiben, deswegen nehme ich mir jetzt eine einjährige Auszeit. Ich bin ziemlich spontan aufgebrochen, insofern hat es gar keine Abschiedsparty gegeben. Seid mir nicht böse, wenn ich mich von der Welt abkapsle, um meinen Traum zu verwirklichen. Ich bin telefonisch nicht mehr erreichbar. Ich schreibe euch ab und zu eine Mail.
Alles Liebe
Antoine
Manche schrieben zurück, dass sie seinen Entschluss bewunderten, andere hielten ihn für leicht verrückt. Doch vielleicht war es tatsächlich der richtige Moment, diesen Plan umzusetzen, schließlich war er alleinstehend und kinderlos. Viele verstanden ihn. Er las ihre Mails, beantwortete sie nicht. Nur seine Schwester glaubte ihm nicht. Eléonore und Antoine standen sich zu nah, als dass sie sich vorstellen konnte, dass ihr Bruder einfach verschwand, ohne noch einmal zum Essen vorbeizukommen. Ohne seiner Nichte, mit der er so gerne spielte, einen Abschiedskuss gegeben zu haben. Irgendetwas passte da nicht zusammen. Eléonore überhäufte ihn mit Nachrichten: »Bitte sag mir, wo du steckst. Erklär mir, was los ist. Ich bin deine Schwester, ich bin für dich da, bitte lass mich nicht einfach so hängen. Rede mit mir …« Nichts zu machen. Keine Antwort. Eléonore versuchte alles, schlug andere Töne an: »Das kannst du mir nicht antun. Das ist gemein. Die Geschichte mit dem Roman ist Quatsch, ich glaube dir kein Wort!« Sie überschüttete ihn mit noch mehr Nachrichten. Aber Antoine schaltete sein Handy gar nicht mehr ein. Einmal tat er es doch und las die unzähligen Vorwürfe seiner Schwester. Er brauchte ihr nur ein paar beruhigende Worte zu schreiben. Nur ein paar Worte. Warum brachte er das nicht über sich? Eine geschlagene Stunde starrte er den Bildschirm an. Wie blockiert. Eine Art Schamgefühl überkam ihn. Eine Scham, die es ihm unmöglich machte, sich zu äußern.
Endlich antwortete er ihr: »Ich brauche ein wenig Zeit für mich. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Ich melde mich bald wieder. Gib Joséphine einen Kuss von mir. Dein Bruder Antoine.« Er stellte augenblicklich das Handy ab, weil er fürchtete, Eléonore könnte ihn gleich anrufen, wenn sie die Nachricht las. Er nahm auch die SIM-Karte heraus, wie ein Verbrecher, der Angst hatte, ertappt zu werden, und legte sie in eine Schublade. Er war für niemanden mehr erreichbar. Eléonore war erleichtert, als sie die Mitteilung sah. Sie begriff sofort, dass das mit dem Roman gelogen war und dass es Antoine große Mühe gekostet haben musste, diese höflichen Worte zu verfassen. Sie war nach wie vor besorgt. Es ging ihm offenbar schlecht. Sie wunderte sich, dass er mit »Dein Bruder Antoine« unterschrieben hatte. Die Formulierung benutzte er sonst nie, es war, als müsste er sich vergewissern, dass sie Geschwister waren. Sie hatte keine Ahnung, was er durchmachte und warum er sich so verhielt, sie wusste aber immerhin, dass er sich nicht von ihr abwenden würde. Letztlich beruhigte sie seine Nachricht doch nicht, sie bestärkte sie eher in dem Gedanken, dass sie ihn dringend treffen musste. Überraschenderweise sollte ihr das auch gelingen, es nahm jedoch viel Zeit und Energie in Anspruch.
4
Beim Verlassen seiner neuen Wohnung begegnete Antoine einem Nachbarn. Einem alterslosen Herrn zwischen vierzig und sechzig. Er musterte Antoine und fragte dann: »Wohnen Sie hier? Sind Sie der Nachmieter von Thibault?« Antoine stotterte ein Ja und entschuldigte sich, um weiteren Fragen aus dem Weg zu gehen, er sei sehr in Eile. Wieso musste man andauernd Auskunft geben, wer man war, was man machte, warum man gerade hier war und nicht anderswo? Das gesellschaftliche Leben hörte nie auf, das merkte er, seitdem er auf der Flucht war, es war so gut wie unmöglich, die Leute abzuschütteln.
Wenigstens in der Arbeit würde er niemandem auffallen. Museumswärter sind unsichtbar. Man schlendert an ihnen vorbei, den Blick aufs nächste Bild gerichtet. Ein besonderer Beruf, bei dem man ganz allein in der Menge ist. Am Ende des Vorstellungsgesprächs hatte Mathilde Mattel ihm mitgeteilt, er könne nächsten Montag anfangen. An der Türschwelle hatte sie noch hinzugefügt: »Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum Sie sich hier bewerben, aber eigentlich können wir uns ja glücklich schätzen, jemanden wie Sie im Haus zu haben.« Ihre Stimme hatte so herzlich geklungen. Sie war seit über einer Woche der erste Mensch gewesen, mit dem der weltabgewandte Antoine eine richtige Unterhaltung geführt hatte. Auf einmal hatte diese Begegnung für ihn an Bedeutung gewonnen. In den folgenden Tagen hatte er öfter an sie gedacht, als würde er sich auf einen hellen Punkt in der Nacht konzentrieren. War sie verheiratet? Hatte sie Kinder? Wie wird man Personalchefin im Musée d’Orsay? Mochte sie die Filme von Pasolini, die Bücher von Gogol, die Impromptus von Schubert? Indem Antoine sich seiner Wissbegier überließ, spürte er, dass er doch nicht ganz tot war. Die Neugier scheidet die Welt der Lebenden von der der Toten.
In einem unauffälligen Anzug saß er auf seinem Stuhl. Man hatte ihm einen Platz in der Modigliani-Ausstellung zugewiesen. Gegenüber einem Porträt von Jeanne Hébuterne. Was für ein merkwürdiger Zufall. Jeanne Hébuterne, mit deren Leben, mit deren tragischem Schicksal er so vertraut war. An diesem Eröffnungstag drängte eine solche Menschenmenge in die Ausstellung, dass er das Bild gar nicht in Ruhe betrachten konnte. Die Leute standen sich gegenseitig auf den Füßen. Wie wohl der Maler diesen Auflauf empfunden hätte? Es hatte Antoine immer fasziniert, wenn der Erfolg sich erst im Nachhinein einstellte. Wenn Künstler Ruhm, Anerkennung und Geld erwarben, aber zu spät. Ein Knochenhaufen erntete den Lohn. Dieser nachträgliche Wirbel hatte etwas geradezu Abartiges, wenn man wusste, welches Leid und welche Demütigungen Modigliani zu Lebzeiten hatte erdulden müssen. Wer möchte schon posthum die große Liebe erleben? Und Jeanne … ja, die arme Jeanne. Hätte sie sich träumen lassen, dass die Menschen einmal in Scharen herbeiströmen würden, um ein in einen Rahmen gefasstes Bild ihres Gesichts zu sehen? Das heißt vielmehr, um einen kurzen Blick darauf zu erhaschen. Antoine verstand nicht, was für einen Nutzen es hatte, unter solchen Bedingungen in ein Museum zu gehen. Der Schönheit nahe zu sein, war natürlich ein Glück, aber warum musste man es bedrückt und bedrängt im Gewühl erfahren und dabei die Sprüche der anderen Ausstellungsbesucher über sich ergehen lassen? Er bemühte sich, darauf zu achten, was die Leute redeten. Manche waren ehrlich ergriffen und verliehen ihrem Entzücken Ausdruck, Modigliani im Original zu sehen. Und manche gaben katastrophale Kommentare von sich. Von seinem Stuhl aus beobachtete er die gesamte Bandbreite der Gesellschaft. Viele Touristen »besuchten« das Museum nicht, sie meinten: »Das Musée d’Orsay ist jetzt erledigt.« Was einen gewissen sozialen Zwang verriet. Abgehakt, so wie man Dinge auf einer Einkaufsliste abhakt. Der Ausdruck ließ sich auch auf ein ganzes Land anwenden. »Japan haben wir schon letztes Jahr erledigt …« So wird heutzutage eins nach dem anderen erledigt. Fährt man nach Krakau, erledigt man Auschwitz.
Antoines Gedanken waren sicherlich etwas boshaft, aber zumindest machte er sich überhaupt welche. Besser als die Lethargie, in die er seit einer Weile versunken war. Das unaufhörliche Gewimmel half ihm, sich selbst zu entkommen. Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen, an denen ihm jede Minute im Kleid der Ewigkeit erschienen war, verging die Zeit wie im Flug. Als Kunststudent und später als Professor hatte er sein halbes Leben in Museen verbracht. Auch diese Räume, die Räume des Musée d’Orsay, hatte er oft durchschritten, erinnerte er sich. Niemals hätte er gedacht, dass er hier einmal Aufsicht führen würde. Diese Arbeit würde seinen Blick auf den Museumsbetrieb wahrscheinlich völlig verändern. Seine Getriebenheit würde sein Verständnis der Kunstwelt bereichern. Aber wozu sollte er es bereichern? Würde er denn je wieder nach Lyon und in seinen Job zurückkehren? Das war alles andere als gewiss.
Während er über die Unwägbarkeiten des Lebens grübelte, kam ein Kollege auf ihn zu. Er hieß Alain und bewachte die andere Seite des Raums. Im Laufe des Tages hatte er Antoine mehrmals vorsichtig freundliche Zeichen gegeben. Antoine hatte sie mit einem leicht verkrampften Nicken beantwortet. Sitzt man im selben Boot, steht man sich bei.
»Wahnsinn … Was für ein Tag, oder?«, begann er keuchend.
»Ja.«
»Endlich Pause.«
»…«
»Soll ich dir mal sagen, was ich auf dem Weg hierher heute Morgen gedacht habe? Ich habe gedacht, da kommen bestimmt nicht viele Leute zu der Ausstellung. Mir war dieser Modigliani überhaupt kein Begriff. Aber jetzt muss ich echt sagen, Hut ab.«
»…«
»Wie wär’s, wenn wir nachher noch auf ein Bier gehen? So ein Bier wird uns guttun, wir sind doch total alle.«
»…«
Der Klassiker einer ausweglosen sozialen Situation. Wenn Antoine Nein sagte, hielt man ihn gleich für einen Muffel. Man würde Notiz von ihm nehmen, über ihn sprechen, sich ein Urteil über ihn bilden. Er wollte auf keinen Fall Aufsehen erregen. Aber um nicht aufzufallen, war es immer noch das Beste, sich unter die Leute zu mischen, was für ein unerträglicher Widersinn. Der einzige Ausweg wäre gewesen, rasch ein Alibi zu erfinden: eine wichtige Verabredung oder die Familie, die zu Hause wartete. Doch dazu wäre ein gewisses Reaktionsvermögen vonnöten gewesen, eine instinktive Gabe, Ausweichmanöver einzuleiten. Eigenschaften, die Antoine abhandengekommen waren. Je länger man mit der Antwort zögert, desto geringer werden die Fluchtmöglichkeiten. Und so sagte er schließlich, obwohl er eigentlich nur nach Hause wollte: »Sehr gute Idee.«
Zwei Stunden später saßen die beiden Männer in einer Bar am Tresen. Antoine trank mit einem völlig Fremden ein Bier. Das Ganze erschien ihm irgendwie unnatürlich. Selbst das Bier schmeckte eigenartig.* Alain redete unaufhörlich, und das war gut so. Antoine brauchte sich nicht um Gesprächsthemen zu bemühen. Er blickte den anderen an, was zur Folge hatte, dass ihm das meiste von dem, was dieser sagte, entging. Manchen Leuten fällt es schwer, andere Menschen anzusehen und ihnen gleichzeitig zuzuhören. In diese Kategorie gehörte Antoine. Alain war ein stämmiger Kerl, er wirkte wie ein Klotz. Und auch wenn er ein etwas grobschlächtiges Äußeres hatte, waren seine Gesten keineswegs schroff, eher zärtlich. Man spürte, er strengte sich an, ein kultivierter Herr zu sein, ihm fehlte nur das, was man gemeinhin als Charme bezeichnet. Er war nicht hässlich, doch er ähnelte einem Roman, den man gar nicht erst aufschlagen möchte.
»Du bist anders als die anderen«, verkündete er nach einer Weile.
»Ach, wirklich?«, gab Antoine zurück, leicht besorgt bei dem Gedanken, sich von der Masse abzuheben.
»Du machst so einen geistesabwesenden Eindruck. Irgendwie bist du da, aber irgendwie auch nicht.«
»…«
»Ich habe heute öfter mal zu dir hinübergeschaut, und es hat immer ein bisschen gedauert, bis du reagiert hast, wenn ich dir zugewinkt habe.«
»Aha …«
»Ich dachte mir, wahrscheinlich bist du ein Träumer. Es gibt ja kein genaues Anforderungsprofil für diese Stelle. Das macht sie interessant. In unserem Job sind völlig unterschiedliche Leute. Kunststudenten, Künstler, aber eben auch Typen, die überhaupt keinen Bezug zur Malerei haben. Das sind einfach Angestellte, die auf Stühlen sitzen. So wie ich. Früher war ich Nachtwächter auf einem Parkplatz. Irgendwann konnte ich keine vorbeifahrenden Autos mehr sehen. Das Gute an den Bildern ist ja, dass sie wenigstens stillhalten.«
»…«
Alain hob zu einem langen Monolog an, die Art von Monolog, die vielleicht unvermindert fortdauert. Man merkte ihm an, dass er einiges nachzuholen hatte, nachdem er den ganzen Tag stumm dagesessen hatte. Er fing an, von seiner Frau zu erzählen. Sie hieß Odette oder Henriette, der Name ging Antoine zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Alain hatte das Gefühl, dass sie ihn voller Bewunderung ansah, seitdem er im Museum arbeitete. Das gefiel ihm. Er sagte: »Letztlich sucht man doch immer nur die Anerkennung der Menschen, die man liebt …« Seine Rede hatte auf einmal etwas Melancholisches. Womöglich wohnte den Poren dieses wuchtigen Körpers noch Poesie inne. Antoine bekam es mit der Angst zu tun, er war gar nicht mehr bei der Sache. Wieso hatte dieser Mann ihn beobachtet? Was führte er im Schilde? Sicher hatte er nicht ohne Grund mit ihm Bier trinken wollen. Er musste irgendwelche Hintergedanken haben. Antoine konnte sich einfach nicht vorstellen, dass jemand Kontakt zu ihm suchte. Aber das waren ja lauter absurde Spekulationen. Alain arbeitete doch schon länger im Museum. Antoines Vermutungen hatten weder Hand noch Fuß. Trotzdem: Alain hatte nicht lockergelassen, er hatte unbedingt mit ihm ein Bier trinken gehen wollen. Antoine fühlte sich zutiefst verunsichert. Andauernd säte er den Zweifel, selbst in den harmlosesten Situationen.
Er wollte diese Unterhaltung schleunigst beenden und aufbrechen. Aber das war gerade unmöglich. Immer diese unsinnigen Zwänge. Umgänglich sein, um bloß nicht aufzufallen. Und so setzte er, obwohl diese unkontrollierbare Angst in ihm aufstieg, hie und da ein Lächeln auf, das er jedoch an den komplett falschen Stellen unterbrachte. Nach einer Weile wurde er von Alain entlarvt:
»Ich glaube, ich langweile dich mit meinen Geschichten. Du hörst ja gar nicht zu.«
»Nein … du langweilst mich überhaupt nicht.«
»Ich kann auch was Lustiges erzählen.«
»…«
»Weißt du, was man einen Kollege im Louvre mal gefragt hat?«
»Nein.«
»Wo ist denn hier die Mona Lisa von Leonardo DiCaprio?«
»…«
»Die Mona Lisa … von Leonardo DiCaprio! Das ist schon ein starkes Stück. Das ist doch urkomisch, oder?«
»Ja …«, gab Antoine mit düsterer Stimme zu.
Kurz darauf verabschiedeten sie sich voneinander. Auf dem Nachhauseweg beschlich Antoine die Befürchtung, dass der kleine Umtrunk eine Art Kettenreaktion auslösen könnte. Nachdem er sich einmal aus Taktgefühl auf den Unfug eingelassen hatte, würde es nun munter weitergehen. Alain gehörte eindeutig zu der Sorte von Menschen, die einen zum Abendessen einluden und einem ihre Frau vorstellten. Es würde der unvermeidliche Moment kommen, in dem er Fragen stellen würde, zu viele Fragen. Antoine saß in der Klemme. Er musste dringend Ausreden erfinden, eine schlimme Krankheit vielleicht oder ein im Sterben liegendes Elternteil, das Ganze bedurfte jedenfalls einer vorausschauenden Planung. Er konnte den Leuten ja nicht spontan aus dem Weg gehen.
5
Am nächsten Morgen war Antoine etwas früh dran. Er wartete vor den Sicherheitsschleusen auf den Wachdienst. Ein Museumsbesuch ist so ähnlich wie Fliegen. Er legte seine Schlüssel in ein Plastikwännchen und schritt durch den Metallrahmen, ohne den Alarm auszulösen. Er nahm es beruhigt zur Kenntnis, doch der Mann vom Sicherheitsunternehmen fragte:
»Und was ist mit Ihrem Handy?«
»Ich habe keins.«
Er beäugte Antoine misstrauisch. Wie konnte das sein? Kein Handy … Diese Typen von der Saalaufsicht waren schon seltsam. Lebten in der Vergangenheit und bekamen gar nicht mit, dass die Welt sich drehte. Der Mann berichtete einem Kollegen davon, der den Fall mit folgenden Worten kommentierte: »Wundert mich gar nicht. Das sieht man dem Kerl doch schon an, dass ihn kein Schwein anruft!« Sie lachten über Menschen wie Antoine, die nicht ständig erreichbar waren, was für eine abwegige Vorstellung.
Antoine beschloss, das Handy von nun an immer dabeizuhaben, er brauchte es ja nicht einzuschalten. Das war wohl das Beste, wenn er nicht auffallen wollte. Er machte Fortschritte in der Kunst, für andere unsichtbar zu sein. Er betrat die Ausstellung und fand sich allein in dem großen Raum wieder. Ein Augenblick der Ruhe, bevor die Invasion begann. Er näherte sich dem Porträt von Jeanne Hébuterne. Was für ein Privileg, eine Privataudienz bei diesem Meisterwerk. Bewegt murmelte er ein paar Sätze. Er bemerkte gar nicht, wie Mathilde Mattel hereinkam. Sie hielt kurz inne und beobachtete ihren Angestellten, der reglos vor dem Gemälde stand. Diese Reglosigkeit hatte etwas Ansteckendes. Schließlich erkundigte sie sich vorsichtig:
»Reden Sie etwa mit dem Bild?«
Antoine fuhr herum.
»Nein … ach was«, stammelte er.
»Sie können in Ihrem Privatleben tun und lassen, was Sie wollen. Geht mich nichts an«, sagte sie lächelnd.
»…«
»Ich wollte eigentlich nur fragen, wie Ihr erster Tag war.«
»Sehr gut, denke ich.«
»Diese Woche ist bestimmt noch viel Betrieb, aber danach wird es wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Wir hatten gestern einen neuen Besucherrekord. Sie bringen uns anscheinend Glück.«
»…«
»Es ist nicht ganz leicht, sich mit Ihnen zu unterhalten. Sie sagen ja überhaupt nichts.«
»Entschuldigen Sie. Ich weiß eben nicht, was ich sagen soll.«
»Na gut, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag.«
»Danke. Ebenso …«, entgegnete Antoine, doch Mathilde hörte ihn nicht mehr, sie war schon verschwunden. Entweder war sie so schnell gegangen, oder er hatte so lange gebraucht, um eine Antwort zu finden.
Diese Frau hatte recht. Er musste kommunikationsfreudiger werden. Sie meinte es gut mit ihm, sie hatte sich nach ihm erkundigt, und er hatte nur über einem Abgrund gebaumelt. Aber er war nicht imstande, schneller zu handeln. Er befand sich in einer Phase, die man auch als soziale Wiedereingliederungsphase bezeichnen konnte. Er hatte kein kaputtes Knie und kein gebrochenes Bein, er litt an einer Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens. Ihm fiel einfach nichts ein, wenn man etwas zu ihm sagte. Es dauerte lange, bis er am Ende einen kaum hörbaren Satz hervorbrachte. Zögerlich, ungeschickt, unsicher und schwach bildete er in seinem Kopf die Worte, und das führte zu Gesprächspausen. Früher hatte er Vorträge an der Universität gehalten, nun unterzog er sich einer Art Schweigekur. Jede Äußerung stellte ihn auf eine harte Probe, ihn, der es gewohnt war, vor einem großen Publikum zu reden, das ihm gebannt lauschte. Ob er jemals in der Lage sein würde, den Menschen, die ihm nahestanden, zu erklären, was mit ihm geschehen war? Er hatte keine Ahnung, wie viel Zeit seine Wiederherstellung in Anspruch nehmen würde. Zeit war eine unabhängige Größe, die nicht seinem Willen unterlag. Der Körper regierte sein gesamtes Königreich und herrschte über seine Gefühle und seinen Kummer.
Der zweite Tag verlief genauso wie der erste. Antoines Aufgabe bestand hauptsächlich darin, darauf zu achten, dass die Besucher nicht so dicht an die Bilder herangingen. In den Vereinigten Staaten hatte es eine Affäre gegeben, als ein Schüler seine Cola über ein Gemälde geschüttet hatte und die Versicherung mehrere Millionen Dollar zahlen musste. Es galt, Gefahren kommen zu sehen, immer auf der Hut zu sein. Die meisten Touristen wandten sich nur an ihn, wenn sie auf die Toilette mussten. Dutzende Male wies er ihnen den Weg, irgendwann wartete er gar nicht mehr ab, bis sie ihre Frage gestellt hatten: »Die Toiletten befinden sich am Haupteingang.« Häufig sagte er diesen Satz auch auf Englisch, und mit der Zeit eignete er ihn sich in ganz vielen Sprachen an, er wollte ja ein guter Mitarbeiter sein. Daran war ihm am meisten gelegen: dass er seine Pflicht erfüllte. Wer schon einmal ein wenig mit Depressionen zu tun hatte, dem ist dieser Zustand bekannt, in dem die Aufmerksamkeit sich in übertriebener Weise auf etwas Konkretes richtet. Man behandelt seelische Wunden, indem man mechanisch immer wieder dieselben Gesten ausführt, in der Hoffnung, durch irgendwelches, vielleicht sogar lächerliches Tun in die Welt derer zurückzukehren, deren Leben Sinn ergibt.
Um einen besseren Blick auf Jeanne Hébuterne zu haben, hatte Antoine, ohne Erlaubnis einzuholen, seinen Stuhl etwas verrückt. So konnte er sie trotz des Gedränges stundenlang betrachten. Er redete leise mit ihr und stellte sich vor, dass zwischen ihnen ein geheimes Band geknüpft war. Nachts erschien sie ihm manchmal in seinen Träumen, um ihn ihrerseits zu beobachten. Sie verständigten sich sozusagen in einer Sprache der Augen. Antoine fragte sich, ob Jeanne, eingesperrt in einen Rahmen, nicht doch ein sehr trauriges Dasein führte. Ähnlich den Leuten, die an Wiedergeburt oder Seelenwanderung glauben. Aber war der Gedanke, dass von einer auf einem Bildnis dargestellten Person Schwingungen ausgingen, denn so abwegig? Ein Teil von ihr war jedenfalls bei ihm.