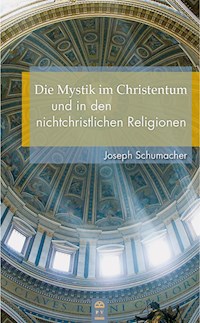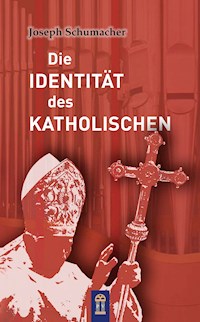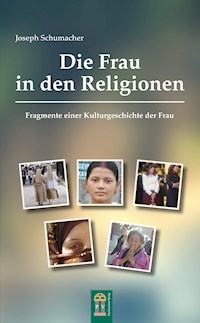
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Patrimonium
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Falsche Vorstellungen und Vorurteile zur Rolle der Frau in den Religionen gibt es zuhauf und viele davon haben sich seit Jahrhunderten nicht verändert. Noch immer werden Frauen unter Berufung auf religiöse Schriften unterdrückt. Dabei hat die Frau stets noch am ehesten in den Religionen einen Anwalt gefunden und besonders das Judentum und das Christentum sie mehr als alle anderen Religionen aus den Fesseln der Versklavung befreit. Auch wenn sie der Frau freilich nicht immer in derselben Weise ihr Wohlwollen geschenkt haben und schenken, so basieren sie auf einer prinzipiellen Anerkennung gleicher Würde von Mann und Frau. Dass die Theorie nicht immer konform geht mit der Praxis und gute Absichten auch negative Auswirkungen haben können, zeigt auch das moderne Gender-Mainstreaming: Während dem Judentum und dem Christentum die Gleichwertigkeit von Mann und Frau zugrunde liegt, wird heute darüber hinaus vielfach deren Gleichartigkeit behauptet und gefordert. Diese Ideologie, die geboren ist aus dem Bestreben, der Frau in letzter Konsequenz gerecht zu werden, zerstört gleichzeitig das Bild der Frau. Ideologien sind Konstrukte. Daher sind sie letztlich immer destruktiv.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 700
Ähnliche
Joseph Schumacher
DIE FRAU IN DEN RELIGIONEN
Joseph Schumacher
Die Frau
in den Religionen
Fragmente
einer Kulturgeschichte der Frau
Patrimonium-Verlag 2015
Impressum
Copyright © 2015
Patrimonium-Verlag
In der Verlagsgruppe Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Erschienen in der Edition »Patrimonium Historicum«
Patrimonium-Verlagsbüro Abtei Mariawald
52396 Heimbach/Eifel
www.patrimonium-verlag.de
Gestaltung, Druck und Herstellung:
Druck & Verlagshaus Mainz GmbH
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
Abbildungsnachweis Umschlag:
www.flickr.com/photos/wonderlane/3105768601/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hardic_Women.jpg
www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=858518
http://en.wikipedia.org/wiki/Sindoor#mediaviewer/File:Meghalaya_Khasi_Woman.jpg
ISBN-10: 3-86417-064-8
ISBN-13: 978-3-86417-064-5
Vorwort
Die vorliegende Studie ist das Ergebnis langjähriger Forschungen über ein Thema, das heute des Öfteren behandelt wird, nicht selten ideologisch aufgeladen. Die Studie ist bemüht, nüchtern Tatsachen und Erkenntnisse vorzulegen, die geeignet sind, nicht wenige Vorurteile zu korrigieren. Der Leser erfährt an dieser Stelle immer wieder, dass die Frau in der Geschichte noch am ehesten in den Religionen einen Anwalt gefunden hat und noch heute findet, wenngleich diese der Frau nicht immer und in gleicher Weise gerecht geworden sind und ihr nicht immer mit dem ihr zukommenden Wohlwollen begegnet sind. Das gilt in gewisser Hinsicht auch für das Judentum und für das Christentum. Nicht zuletzt ist das dadurch bedingt, dass die Theorie nicht immer der Praxis folgt, wenn man einmal davon absieht, dass sich das natürliche Wissen nicht anders als das Wissen aus der Offenbarung Gottes evolutiv entfaltet. Die Wertschätzung der Frau und ihre positive Stellung ist im Judentum größer als in den anderen Religionen, sie wird allerdings noch einmal überhöht durch die Wertschätzung und die positive Stellung, die der Frau im Christentum zuteil wird. Diese zwei Offenbarungsreligionen, die aufeinander hingeordnet sind, lehren nicht eine realitätsfremde Gleichartigkeit von Mann und Frau, wie sie heute vielfach behauptet und gefordert wird, sie lehren vielmehr ihre uneingeschränkte Gleichwertigkeit. Gemäß der biblischen Anthropologie gibt es nämlich zwei Ausformungen oder zwei Gestalten des Menschseins, die im Verhältnis der Komplementarität zueinander stehen. Die vorliegende Studie thematisiert schließlich auch das moderne Gender-Mainstreaming, in dem heute de facto das gottgegebene Bild der Frau weltweit zerstört wird. Es handelt sich bei dem Gender-Mainstreaming um eine Ideologie, die geboren ist aus dem Bestreben, der Frau in letzter Konsequenz gerecht zu werden, die sie in Wirklichkeit jedoch hoffnungslos zugrunde richtet. Ideologien sind Konstrukte. Daher sind sie letztlich immer destruktiv. Und immer treten sie an die Stelle der Religionen. Im Gender-Mainstreaming wird der Frau Gewalt angetan, indem um des Prinzips der Gleichheit willen ihre tiefsten Erwartungen missachtet werden und sie schlechthin durch den Mann instrumentalisiert wird. Mit dem Anspruch der höchsten Gerechtigkeit erfährt sie die tiefste Ungerechtigkeit, wird sie in extremer Weise erniedrigt.
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle meinem Mitarbeiter Herrn Dr. phil. Heinz-Georg Kuttner, der mit viel Mühe und großer Hingabe das Layout des Manuskriptes erstellt hat.
Joseph Schumacher
Freiburg i. Br., am 1. Januar 2015, am Hochfest der Gottesmutterschaft Mariens
I. Kapitel: Einführung.
1. Zur Aktualität des Themas.
In der Gegenwart steht das Thema »Frau« im Mittelpunkt der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und noch mehr in der populärwissenschaftlichen oder nicht mehr wissenschaftlichen, also nur noch populären Publizistik. Dabei wird häufig sehr emotional argumentiert. Das heißt: Nicht selten gleitet man dabei ab in die Ideologie. Das führt dazu, dass man im Rahmen dieser Fragestellung manches behauptet und fordert, was nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt oder was nicht berechtigt ist. Da ist es angemessen, durch nüchternes Informationsmaterial Klarstellungen vorzunehmen, im Positiven wie im Negativen.
Im Raum der Theologie etabliert sich immer mehr die so genannte Feministische Theologie, die nicht einen bestimmten Bereich der Theologie untersuchen will, sondern den Anspruch erhebt, Prinzip der ganzen Theologie zu sein, wie das bei bestimmten Formen der Befreiungstheologie, bei der Politischen Theologie, bei der Theologie der Revolution oder auch bei der Schwarzen Theologie der Fall ist. Man hat hier von den »Genetiv-Theologien« gesprochen.
Was die heute recht intensiv propagierte »Feministische Theologie« angeht, die aus dem Feminismus hervorgegangen ist, aus der Ideologie des Feminismus, sei schon hier darauf hingewiesen, dass sie schlichtweg ein Irrweg ist. Es gibt keine feministische Theologie, wie es keine feministische Philosophie, keine feministische Soziologie, keine feministische Jurisprudenz, keine feministische Medizin und keine feministische Physik gibt. Die Wissenschaft ist auf die Wahrheit hin ausgerichtet, die objektiv ist, und ihrem Selbstverständnis entsprechend geht es ihr darum, dass sie den höchst möglichen Grad an Objektivität erreicht. In der feministischen Theologie begegnet uns eine Ideologisierung der Theologie, eine Ideologisierung, die uns freilich auch in den anderen Wissenschaften, speziell in den Geisteswissenschaften, aber nicht nur in ihnen, in vielfältiger Weise begegnet und gerade heute eine spezifische Versuchung für den Wissenschaftler darstellt. Man kann von feministischer Theologie sprechen, legitimerweise, sofern man die spezifischen Aspekte des Weiblichen in die Theologie einbringt. Aber das müssen auch die anderen Wissenschaften, mutatis mutandis, die meisten anderen Wissenschaften. Denn eine Wissenschaft darf keine Frage ausklammern, die sich ihr im Rahmen ihres spezifischen Sachgebietes stellt. Die grundlegende Frage ist dabei indessen die, was das Weibliche überhaupt ist in seinem Wesen. Schon das ist eine schwierige Frage, die sehr kontrovers beantwortet wird, zumal wenn man sich von dem naturrechtlichen Denken verabschiedet, wenn man sich der »Diktatur des Relativismus« (Papst Benedikt XVI.) verschreibt oder verschrieben hat. Papst Benedikt erklärt in seiner Enzyklika »Spe salvi« vom 30. November 2007: »... der Sieg der Vernunft über die Unvernunft ist auch ein Ziel des christlichen Glaubens«1. Die moderne »Genderforschung« reduziert die Differenz zwischen Mann und Frau auf die sozialen Folgen und versteht die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften als Geschichte von Genderkämpfen im Sinne von Karl Marx († 1883 n. Chr.). Der Begriff »Gender« steht hier für das grammatische Geschlecht, bezeichnenderweise2.
1 Papst Benedikt XVI, Enzyklika »Spe salvi« vom 30. November 2007, Nr. 23.
2 Vgl. Gerd Roellecke, Verprügeln: ja, töten: nein! Nur im Geltungsbereich des Grundgesetzes versteht die Gender-Forschung die Welt nicht mehr: Dorothea Nolde über den Gattenmord, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15. August 2003.
Wir müssen in unserem Zusammenhang wohl unterscheiden zwischen der Frauenfrage als solcher und dem Feminismus, speziell in seiner radikalen Form, zwischen der Forderung der Anerkennung der Gleichwertigkeit von Mann und Frau und der Aufhebung dessen, was man gern als »Geschlechterrollen« bezeichnet, zwischen dem Anspruch universaler Gerechtigkeit und universaler Gleichheit, etwa in einer geschlechtslosen Gesellschaft der Zukunft, in der es keine Natur der Frau und des Mannes mehr gibt, sondern nur noch biologisches Material3. Die Ungleichheit ist nicht als solche der Grund für die Unterdrückung. Und selbst wenn sie es wäre, was wesenhaft verschieden ist, kann nicht identisch werden. Das Geschlecht ist offenkundig mehr als eine Rolle, die man spielt. Das Geschlecht umfasst den ganzen Menschen4.
3 Susanne Kummer, Klassenkampf zu Hause, in: Die Tagespost vom 10. April 2003.
4 Ebd.
Es geht uns in dieser Darstellung nicht um den Feminismus als solchen. Nur am Rande wird er thematisiert oder einschlussweise. Vor allem aber wollen wir Material ausbreiten, das notwendig ist für die Auseinandersetzung mit ihm, speziell auch sofern er sich in der Gestalt der feministischen Theologie artikuliert.
2. Die anthropologische Fragestellung im Kontext
der wachsenden Kritik an Christentum und Kirche.
Die Theologie, speziell die Fundamentaltheologie, der es um die rationale Rechtfertigung des Glaubens, des christlichen Glaubens und – speziell – des Glaubens der Kirche geht, muss alle Fragen aufgreifen, die die Menschen in der jeweiligen Epoche beschäftigen, um sie im Licht des Glaubens vor der Vernunft zu prüfen oder um sie in den Dienst der Glaubensrechtfertigung zu stellen. Es ist die Aufgabe der Fundamentaltheologie, von immer neuen Aspekten aus den christlichen Glauben und den Glauben der Kirche zu fundieren und zu einer vernunftgemäßen Glaubensentscheidung hinzuführen oder die schon vollzogene vorwissenschaftlich begründete Glaubensentscheidung zu einer wissenschaftlich begründeten Glaubensentscheidung zu führen. Dabei müssen aber auch die kritischen Einwände, die von den Ideen und Grundhaltungen einer Epoche ausgehen, die kritischen Einwände gegen das Christentum und gegen die Kirche, aufgegriffen und beantwortet werden. Das apologetische Anliegen muss zwar hinter das positive Anliegen der Fundierung, der rationalen Fundierung des Glaubens in seiner Ganzheit zurücktreten, aber es hat und behält seine Bedeutung, zumal heute, da die Kritik an der Kirche und am Christentum ungeheure Ausmaße angenommen hat, außerhalb wie innerhalb von Kirche und Christentum. Dabei muss man sehen, dass die Kritik heute so total und universell erfolgt, wie das wohl noch nie der Fall gewesen ist und wie das auch so nie möglich gewesen ist. Das hängt zusammen mit der radikalen Säkularisierung unseres Lebens und unseres Lebensgefühls sowie mit der Perfektion der Medienindustrie, der technischen Perfektion der Medienindustrie, der mitnichten eine moralische Perfektion gefolgt ist.
Die »Wertung der Frau« soll in dieser Darstellung auf dem Hintergrund der Religionen behandelt werden, weil die Religionen heute nicht weniger das allgemeine Interesse erregen, als dies bei dem Thema »Frau« geschieht. In den Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt finden sich immer wieder nicht wenige Titel, die sich mit den Religionen beschäftigen, die sie mit dem Christentum vergleichen und ihre wesentlichen Lehren untersuchen.
Die Aktualität des Themas der Religionen unterstreicht die Erklärung der Römischen Kongregation für die Glaubenslehre »Dominus Jesus« vom 6. August 2000, ein Lehrschreiben der römischen Glaubenskongregation, das nicht wenig Staub aufgewirbelt hat und noch heute aufwirbelt, vor allem deshalb, weil es einem relativierenden Trend im Hinblick auf die Erkenntnis der religiösen Wahrheit entgegentritt. In diesem Dokument geht es um das Verhältnis der katholischen Kirche zu den anderen christlichen Konfessionen und um das Verhältnis des Christentums zu den anderen Religionen.
Die beiden Stichworte »Frau« und »Religionen« sind Reizthemen, die oft sehr emotional behandelt werden, auch im Rahmen wissenschaftlicher Analysen. Demgegenüber soll hier ganz nüchtern gefragt werden: Was sagt das Christentum zur Stellung und Wertung der Frau? Was sagen die verschiedenen Religionen dazu? Wie wird die jeweilige Stellungnahme begründet? In den Religionen? Im Christentum? Wir fragen nach den Religionen unter dem Aspekt der Wahrheit. Dabei ist es für uns bedeutsames Ziel, die verschiedenen Positionen in den Religionen mit der christlichen zu vergleichen.
3. Eine fragmentarische Kulturgeschichte der Frau.
Es geht hier um eine Kulturgeschichte der Frau, die allerdings nicht den Anspruch der Vollständigkeit erheben kann. Dafür ist die Thematik allzu weit gespannt.
4. Die besondere Affinität der Frau zur Religion.
In den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts schrieb der österreichische Indologe Moriz Winternitz († 1937): »Die Frau ist immer die beste Freundin der Religion gewesen, die Religion aber keineswegs immer eine Freundin der Frau«5. Ein wenig später erklärte der Marburger Religionswissenschaftler Friedrich Heiler († 1967): »Die Frau genießt in zahlreichen Religionen der Erde ein hohes Ansehen, der Dienst der Frau bildet ein wesentliches Element in ihrem Leben, ja, sie wird geradezu als Trägerin des Heiligen und als Verkörperung des Göttlichen verehrt. In anderen Religionen (wiederum) wird jedoch die Frau gering geschätzt; sie ist vom kultischen Gemeinschaftsleben ganz oder teilweise ausgeschlossen und in den engen Kreis der privaten Frömmigkeit verbannt«6.
5 Moriz Winternitz, Die Frau in den indischen Religionen I: Die Frau im Brahmanismus, Leipzig 1920, 121; vgl. Friedrich Heiler, Der Dienst der Frau in den Religionen der Menschheit, in: Friedrich Heiler, Hrsg., Eine heilige Kirche, Zeitschrift für Kirchenkunde und Religionswissenschaft (vorher: Hochkirche bzw. Religiöse Besinnung), München 1939/40 (Heft 21/22), 1.
6 Friedrich Heiler, Der Dienst der Frau in den Religionen der Menschheit, in: Friedrich Heiler, Hrsg., Eine heilige Kirche, Zeitschrift für Kirchenkunde und Religionswissenschaft (vorher: Hochkirche bzw. Religiöse Besinnung), München 1939/40 (Heft 21/22), 1; vgl. Friedrich Heiler, Die Frau in den Religionen der Menschheit, Berlin 1977, 3 (41982).
Das Religiöse scheint der weiblichen Geistigkeit in besonderer Weise zugeordnet zu sein. Von daher erklärt es sich auch, wenn die Gegner des Religiösen von Celsus im zweiten nachchristlichen Jahrhundert bis zu Friedrich Nietzsche im neunzehnten Jahrhundert der Religion den Vorwurf machen, sie mache weibisch. Der russisch-orthodoxe Theologe Paul Evdokimov († 1970) schreibt in seinem Buch »Die Frau und das Heil der Welt«: »Je weltlicher eine Kultur wird, desto vermännlichter ist sie; je verzweifelter sie ist, desto weiter entfernt sie sich von dem wahrhaft Weiblichen«7. Hier sei auch an den oft zitierten Vers aus Goethes »Faust« erinnert: »Das ewig Weibliche zieht uns hinan«8. Tatsache ist, dass die säkularisierten Kulturen vermännlicht sind und der Frau wenig Bedeutung beimessen. Das gilt ohne Zweifel auch für unsere Gegenwart. Und es scheint so zu sein, dass der Feminismus diese Situation geradezu fördert.
7 Paul Evdokimov, Die Frau und das Heil der Welt, München 1960, 169 bzw. 168f.
8 Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Eine Tragödie, II. Teil, V. Akt: »Das Unbeschreibliche, hier ist’s getan; das Ewig-Weibliche zieht uns hinan« (Chorus mysticus).
Der Atheismus erweist sich von daher als eigentlich männlich, als ein typisch männliches Phänomen. So Evdokimov9. Und es scheint so zu sein, dass die Frau sich in dem Maß in den Dienst dieses Phänomens stellt, in dem sie sich von ihrem Frausein distanziert. Es ist eine Tatsache, dass die säkularisierten Kulturen vermännlicht sind und der Frau wenig Bedeutung beimessen, zuweilen entgegen dem äußeren Anschein. Das gilt auch für die Gegenwart, für unsere westliche Weltzivilisation.
9 Paul Evdokimov, Die Frau und das Heil der Welt, München 1960, 170.
Es ist nicht zu bestreiten, dass die Frau im religiösen Leben der Völker stets eine herausragende Rolle gespielt hat. Es ist die größere Feinfühligkeit der Frau, ihr stärkeres Einfühlungsvermögen und ihre engere Verbundenheit mit der Natur, kurz ihre größere Ursprünglichkeit, wodurch sie einen leichteren Zugang zur Transzendenz findet10.
10 Paula Schäfer, Der Dienst der Frau in der Alten Kirche, in: Friedrich Heiler, Hrsg., Eine heilige Kirche, Zeitschrift für Kirchenkunde und Religionswissenschaft (vorher: Hochkirche bzw. Religiöse Besinnung), München 1939/40 (Heft 21/22), 49.
5. Zwiespältige Stellungnahmen in den Religionen:
Theorie und Praxis.
In modernen Publikationen über die Frau in den verschiedenen Kulturen und Religionen begegnen einem immer wieder vehemente, emotionsgeladene Ausfälle gegen die Unterdrückung der Frau im Christentum, die weitaus erniedrigender gewesen sein soll als die Unterdrückung der Frau selbst im Islam11. Dabei werden erstaunlicherweise die Überwindung der Polygamie und Ehescheidung durch das Christentum, wodurch die personale Liebe und die Würde der Frau geschützt werden, mitnichten als Fortschritt gewertet.
11 Hans Küng, Wiebke Walther u. a.
In diesen Chor stimmen auch immer wieder die islamischen Theologen ein. Sie behaupten heute gern, der Islam sei mit seiner Polygynie frauenfreundlicher als das Christentum, denn eine Frau stehe sich als legitime zweite oder dritte Gattin eines Mannes besser als seine illegale Geliebte. Hier wird völlig außer Acht gelassen, dass es ein wesentlicher Unterschied ist, ob ein Übel legitimiert wird oder ob es wenigstens noch als Übel erkannt oder anerkannt wird.
Andererseits lesen wir bei dem protestantischen Religionswissenschaftler Helmuth von Glasenapp: »So hoch wir die kulturelle und politische Bedeutung Muhameds für das Arabertum auch einschätzen müssen, im Hinblick auf seine Metaphysik und Ethik kann seine Lehre den Vergleich mit den anderen vier großen Religionen nicht aushalten. Denn an ihnen gemessen stellt er an seine Bekenner nur geringe Ansprüche. Besonders zeigt dies ein Vergleich mit Buddhismus und Christentum«12. Das ist in der Tat das erklärte Ziel des Korans, nicht zu hohe Ansprüche zu stellen. In der Sure 54 des Koran lesen wir: »Und fürwahr! Wir haben den Koran leicht gemacht, danach zu handeln und sich mahnen zu lassen«13.
12 Helmuth von Glasenapp, Die fünf Weltreligionen, Bd. II, München 1952 (Neuauflage 1996), 399.
13 Koran, Sure 54, 41.
Die Thematik »Die Frau in den Religionen« ist ideologiegeladen. Das darf man nicht verkennen. Die umfangreiche Literatur, die diesen Gegenstand behandelt, ist nicht immer sehr gerecht und ausgewogen. Nicht gerecht wird sie vor allem weithin der Wertung der Frau im Christentum und in der Geschichte der Kirche. Dabei frisiert man andererseits gern die Wertung der Frau in den Religionen, um die hohe Wertung, die die Frau im Christentum und in der Kirche erfährt, abzuschwächen. Das geschieht nicht nur extra muros, auch intra muros.
Wenn man die vielen Äußerungen zu diesen Fragen liest, so ist man oft erstaunt, wenn nüchterne Wissenschaftler, wenn sie auf die hier anliegende Thematik zu sprechen kommen, oft die der Wissenschaft zukommende Objektivität vergessen.
Nicht nur im profanen, auch im christlichen Raum ist es üblich geworden, die Stellung der Frau in der Vergangenheit in möglichst dunklen Farben zu zeichnen. Solche Unbekümmertheit ist eine Frage an das wissenschaftliche Ethos, die man gegenwärtig immer wieder stellen kann und muss, speziell wenn es um die Geschichte geht. Hier ist auch zu erinnern an die überzeugende Monographie »Die Frau und das Heil der Welt« von Paul Evdokimov14.
14 Paul Evdokimov, Die Frau und das Heil der Welt, München 1960, 195–206.
Die negative Sicht des Christentums, speziell im Hinblick auf seine Wertung der Frau, begegnet uns in der Literatur – zumindest intra muros – erst in den letzten Jahrzehnten. Vor 50 Jahren und mehr stellte sich das Problem noch nüchterner dar. In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts schrieb der bereits zitierte protestantische Religionswissenschaftler Friedrich Heiler († 1967), man könne hinsichtlich der Stellung der Frau die außerchristlichen Religionen, speziell die außerchristlichen Hochreligionen, mit einer Wüste vergleichen, in der sich mehr oder weniger zahlreiche köstliche Oasen befänden, während das Christentum demgegenüber ein unendlich reicher und fruchtbarer Garten sei15.
15 Friedrich Heiler, Der Dienst der Frau in den Religionen der Menschheit, in: Friedrich Heiler, Hrsg., Eine heilige Kirche, Zeitschrift für Kirchenkunde und Religionswissenschaft (vorher: Hochkirche bzw. Religiöse Besinnung), München 1939/40 (Heft 21/22), 36.
Es geht hier um eine wissenschaftliche Darstellung. Das impliziert höchst mögliche Objektivität. In der Wissenschaft geht es nicht um Meinungen, Anmutungen oder Empfindungen, nicht um Vorurteile oder ideologische Fixierungen, sondern um Fakten und Prinzipien und um begründete Theorien, sine ira et studio soll der Wissenschaftler arbeiten. Die Objektivität ist die höchste ethische Forderung an den Wissenschaftler. Er muss die Wirklichkeit offenlegen, und das entscheidende Medium seiner Arbeit ist die Vernunft, die »ratio«. Es soll hier nüchtern und vorsichtig eine Bestandsaufnahme gemacht und gesichertes Faktenmaterial zusammengestellt werden.
Es geht in dieser Abhandlung vornehmlich um die fünf Hochreligionen, um die Religion des Hinduismus, des Buddhismus, des Judentums, des Islam und des Christentums, aber nicht ausschließlich. Auch die anderen Religionen sollen hier wenigstens teilweise berücksichtigt werden, besonders der Konfuzianismus und der Taoismus. Dabei liegt ein gewisser Schwerpunkt auf der Stellung der Frau im Christentum in der Geschichte und in der Gegenwart.
6. Sich durchhaltende Positionen.
Zahlreich sind die Definitionen der Religion. Zu dem, was Religion meint, führt uns von der Sache her am ehesten das religiöse Kernerlebnis, die Begegnung mit dem Göttlichen oder mit dem Heiligen, die sich als ein »mysterium tremendum« und »fascinosum« erweist oder die den Menschen zum »inhorrescere« und zum »inardescere« führt, wie es Augustinus († 430 n. Chr.) in seinen »Bekenntnissen« ausdrückt16. Dieser doppelte Aspekt der religiösen Erfahrung schwingt mit in unserem deutschen Wort »Ehrfurcht«. Die Ehrfurcht hat man treffend definiert als »scheue Liebe und liebende Scheu«. Statt von dem »mysterium tremendum et fascinosum« könnte man auch von den beiden Momenten der Immanenz und der Transzendenz Gottes oder des Göttlichen, von den beiden Momenten der Gottesnähe und der Gottesferne sprechen. Diese beiden Momente müssen im religiösen Erlebnis in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Grundsätzlich muss die Polarität der Gottesfurcht und der Gottesliebe bestehen bleiben, und zwar aktuell, wenn die Religion und das religiöse Leben nicht zerstört werden sollen, wenn nicht Zerrbilder der Religion entstehen sollen. Wird das Gottesverhältnis nur durch das »tremendum« bestimmt, so wird das Göttliche allzu weit von der Welt abgerückt. Das hat zur Folge, dass der Mensch keinen Zugang mehr findet zu Gott oder nur schwerlich. Wird das Gottesverhältnis aber nur durch das »fascinosum« bestimmt, so wird Gott oder das Göttliche immanent, es wird zu einem Teil der Welt oder des Menschen bzw. wird mit der Welt und mit dem Menschen identisch. Wenn es gilt, dass diese beiden Momente in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen müssen, so heißt das nicht, dass es hier nicht Akzentuierungen geben darf. Es gibt hier einen legitimen Spielraum. Durch kleine Verschiebungen der Gewichte, durch konkrete Akzentuierungen, erhalten die verschiedenen Religionen ihre besondere Eigenart und ihre spezifische Färbung. So betont etwa die Religion des Alten Testamentes im Unterschied zu der des Neuen stärker die Transzendenz Gottes, das »tremendum«, während die Religion des Neuen Testamentes stärker die Nähe Gottes zum Menschen hervorhebt, das »fascinosum«17.
16 Augustinus, Bekenntnisse, Buch 1, Kap. 9.
17 Vgl. Rudolf Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, München 21/221952, 31–39.
Wenn es in der christlichen Offenbarung heißt, dass die Liebe die Furcht vertreibt, darf das nicht dazu führen, dass man die Doppelstruktur des religiösen Aktes auflöst oder nicht mehr beachtet. Das Vertreiben der Furcht durch die Liebe muss als ein dynamischer Prozess verstanden werden, als ein Geschehen, das immer neu zu realisieren ist. Liebe und Furcht stehen gewissermaßen immer nebeneinander. Die Liebe lebt von der Überwindung der Furcht.
Die Religion gehört wesentlich zum Menschsein des Menschen dazu. Die Kirchenväter sprechen von der »anima naturaliter religiosa«18. Die Paläontologie wertet die Zeichen der »religiositas« als sichere Kriterien des Menschseins. Die Universalität der Religion ist der Kern des historischen Gottesbeweises. Der moderne Massenatheismus ist ein Novum in der Geschichte, er begegnet uns in dieser Form erst seit der Aufklärung. Bis zur Aufklärung gibt es die theoretische Religionslosigkeit nur inEinzelfällen.
18 Vgl. Tertullian, Apologeticus 17; De testimonio animae 1f.
Immer wieder tritt die religiöse Anlage des Menschen in der Sehnsucht nach dem ganz Anderen19 oder in der Gestalt der metaphysischen Unruhe hervor20. Es ist die passive Grundbefindlichkeit des menschlichen Daseins, die den Menschen immer wieder spontan Ausschau halten lässt nach einer aktiven Seinsquelle.
19 Max Horkheimer, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Ein Interview mit Kommentar von Helmut Gumnior (Stundenbücher, 97), Hamburg 1970, 60ff.
20 Augustinus, Confessiones, Buch 1, Kap. 1.
Der Ursprung der Religion liegt in dem Drang des Menschen, den letzten Grund seines Daseins zu erkennen und zu verehren und in der Hingabe an ihn eine höhere Vollkommenheit zu gewinnen. Der Anknüpfungspunkt dafür ist die Erfahrung der passiven Grundbefindlichkeit der menschlichen Existenz, des Daseins des Menschen und seines Soseins.
Die passive Grundbefindlichkeit des Menschen ruft nach einer aktiven Seinsquelle. Die Erfahrung der Kontingenz, der Nichtnotwendigkeit, der Kreatürlichkeit ruft nach dem Absoluten, nach dem Notwendigen, nach dem Schöpfer. Der Intellekt des Menschen fragt nach dem Grund und nach dem Ziel von allem.
Ganz weit gefasst, kann man die Religion als Offenheit gegenüber dem Unerklärbaren, als Umgang mit dem Geheimnis unseres Anfangs, unserer Tiefen und unseres Endes definieren. Dieses Geheimnis wird stets als das höchst denkbare Ideal verstanden, als das, als das Größeres nicht gedacht werden kann, als der Inbegriff aller Wirklichkeit und Wahrheit und Vollkommenheit, wodurch man das vollkommene Leben und das Heil zu finden hofft.
Der eine Grund für die Entstehung der Religion ist das Fragen des Menschen nach dem aktiven Prinzip seiner passiven Befindlichkeit. Es gibt aber nicht nur den Intellekt des Menschen, der nach dem Grund und nach dem Ziel fragt. Es gibt im Menschen auch das Streben nach dem Guten, das er verwirklichen möchte, und nach dem Glück, das er erreichen möchte, das so weit ausgreift, dass es nur durch das »numinosum« befriedigt werden kann. Von daher hat die Religion ihren Grund nicht nur im Intellekt, sondern auch im Willen und im Affekt. Der Intellekt, der Wille und der Affekt, das Denken, das Wollen und das Streben, sind nach der klassischen Anthropologie die drei grundlegenden Kräfte des Geistes. Die Wurzeln der Gottesidee und der Religion liegen also in der vernünftigen Anlage des Menschen, das heißt in seinem Intellekt, in seiner sittlichen Anlage und in seinem unzerstörbaren Streben nach dem Glück oder nach dem Heil. Die Dreigestaltigkeit des menschlichen Geistes begegnet uns wieder in dessen Hinordnung auf das Wahre, das Gute und das Schöne, worin die Scholastik wesentliche Komponenten alles Seienden erblickt. Der dreifachen Begründung der Religion entsprechen die drei Grundformen der Gottesleugnung aus dem Intellekt, aus dem Willen und aus dem Affekt, sofern man den Atheismus aus intellektuellen, aus willentlichen und aus emotionalen Gründen vertritt.
Diese Überlegungen werden gestützt durch die tragenden Vorstellungen der Religionen und die wichtigsten Gottesbezeichnungen in den Religionen, wenn Gott etwa als Licht, als Kraft oder als Lebensfülle verstanden wird.
Die entscheidenden Ausdrucksformen der Religion sind der Kult, der sich des Wortes, der Sprache, der Symbolzeichen und der Symbolhandlungen bedient, und die Sozialisation. Dabei sind die Ausdrucksformen der Religion nicht nur ein Spiegel der inneren Überzeugungen und Regungen, sie wirken vielmehr auch auf diese zurück, und zwar klärend, festigend, anregend und steigernd.
Mit dem Kult ist es gegeben, dass die Religion in einem besonderen Maß gemeinschaftsgebunden und gemeinschaftsfördernd ist. Und es gibt den Kult, weil die Religion in ihrem Wesen gemeinschaftsbezogen ist. Das religiöse Leben kann sich nur in der Gemeinschaft gestalten und ausbilden. Normalerweise ist es die Gemeinschaft, die den Glauben, das sittliche Leben und den Kult trägt, die ihrerseits wiederum durch den Glauben, das sittliche Leben und den Kult getragen wird. Die Religion knüpft an die Sozialnatur des Menschen an. Gerade in dem Phänomen der Religion wird, geschichtlich betrachtet, die Sozialnatur des Menschen überdeutlich. Die Gemeinschaft gibt dem Einzelnen immer wieder Anregungen, sie ermuntert ihn und schürt seine religiöse Glut. Von daher ist auch das Verhältnis von Meister und Jünger, Vorbild und Nachfolge nicht wegzudenken aus der Religion.
Die Zuordnung der Religion zur Gemeinschaft würde missverstanden, wenn man übersehen würde, dass die religiöse Entscheidung und der religiöse Kernakt des Menschen letztlich individuell sind, dass der Mensch letztlich als Individuum vor der Gottheit steht, denn Kommunikation gibt es immer nur zwischen Personen, nicht zwischen einer Person und einem Kollektiv. Die Gemeinschaft ist nicht mehr als die Summe der einzelnen Individuen.
Äußerer Kult und innere Religiosität, Gemeinschaftsgebundenheit der Religion und religiöse Innerlichkeit, das sind Gegebenheiten, die uns in den Religionen immer wieder, freilich in verschiedener Akzentuierung, begegnen. Dabei ist zu bedenken, dass einerseits die persönliche Religiosität sich nur in und durch die religiöse Gemeinschaft entfalten kann, dass aber andererseits die Wirksamkeit der religiösen Gemeinschaft von der Kraft und Echtheit der individuellen Religiosität gespeist wird, und dass das eigentliche religiöse Erlebnis und die eigentliche religiöse Entscheidung individueller Natur sind, weil das Zentrum der Religion die Begegnung des Einzelnen mit Gott oder mit der Gottheit ist, auch im Kult der Gemeinschaft. Anders ausgedrückt: Die Religion zielt stets auf ein dialogisches Geschehen, in der Religion geht es letztlich immer um Gott und die Seele. Dabei darf man nicht übersehen, dass es Religionen gibt – oder auch Konfessionen, das heißt spezifische Ausprägungen von Religionen –, die stärker zum Spiritualismus neigen und dem äußeren Kult eine geringere Bedeutung beimessen – und umgekehrt.
Im Einzelnen werden wir uns zunächst Gedanken machen über die Wertung der Frau im Hinduismus, im Buddhismus, im Judentum und im Islam. Dabei werden wir notwendigerweise eine Reihe von elementaren, religionsgeschichtlichen Anmerkungen machen müssen bzw. das Phänomen »Religion« würdigen und über die jeweilige Religion einiges sagen müssen. Wir können nämlich beispielsweise nicht über die Stellung des Islam zur Frau reden, ohne einen Blick auf das Wesen und die Geschichte dieser Religion zu werfen. Mit dem Islam werden wir uns übrigens ausgiebiger zu beschäftigen haben als mit den anderen Weltreligionen, weil diese Religion zum einen sehr viel Material zu unserer Frage bietet, weil sie zum anderen gegenwärtig, im Unterschied zum Christentum, einen ungeheuren Aufschwung erlebt. Gerade im Islam ist die Bewertung der Frau zudem äußerst differenziert: auf der einen Seite exzessive Sinnlichkeit, auf der anderen Seite extreme Distanz im Verhalten der Geschlechter zueinander. Wir werden dann aber auch einen Blick auf die Stellung der Frau im altpersischen Parsismus, in der Religion Zarathustras, im Konfuzianismus und Taoismus Chinas, im Shintoismus Japans, in der Religion der Sikhs, einer Mischreligion aus Islam und Hinduismus, die im 15. Jahrhundert entstanden ist, und in den afrikanischen Religionen der Gegenwart werfen müssen.
Bei solchen Betrachtungen und Überlegungen müssen wir unterscheiden zwischen den Prinzipien und den Fakten, zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen früher und heute. Wir werden sehen, dass die Stellung der Frau und ihre Wertung manchmal zwiespältig ist und inkonsequent, dass sie sich wandelt, dass die Theorie manchmal der Frau weniger gerecht wird als die Praxis und umgekehrt. Bevor wir uns dann der Stellung der Frau im Christentum zuwenden, werden wir ihre Stellung noch bei den Germanen, den Kelten, den Griechen und den Römern sowie in den Religionen des Vorderen Orients untersuchen und darstellen, soweit uns hier entsprechendes Material vorliegt. Dabei interessiert uns besonders das Thema »die Frau als Priesterin« und das Thema der Tempelprostitution.
Dann haben wir den geistigen Hintergrund, auf dem sich das Frauenbild des Christentums entfaltet, das im Alten Testament grundgelegt ist und im Neuen Testament seine spezifische Ausformung erhält. Wir werden uns Gedanken machen über die Stellung Jesu zur Frau, über das Verhältnis des Paulus zu den Frauen und über die Beurteilung der Frau in den übrigen Schriften des Neuen Testamentes bzw. über ihre Stellung in der Urgemeinde. Im Zusammenhang mit Paulus interessiert uns dann besonders das Lehrverbot und das Gebot der Unterordnung sowie die Wertung der Jungfräulichkeit und der Ehe.
Weiter geht es dann mit der Frage nach der Bedeutung der Frau in der Alten Kirche. Hier werden wir uns mit dem Witwen- und Diakonenamt der Alten Kirche beschäftigen müssen sowie mit dem Jungfrauenstand. Besondere Aufmerksamkeit möchte ich sodann den zahlreichen Äußerungen der alten Kirchenväter zur Frau, positiv und negativ, widmen.
Schließlich gibt es noch einige Bemerkungen zur Wertung der Frau im christlichen Mittelalter und in der Neuzeit zu machen. Dabei müssen wir wenigstens in einem Exkurs das spätmittelalterliche Hexenunwesen erörtern, das immer wieder eine Quelle von Missverständnissen ist.
Im Anschluss daran sollen noch einige Anmerkungen zur modernen Frauenbewegung gemacht werden, zum Feminismus, zur feministischen Theologie und zur Frauenordination in der katholischen Kirche und in den anderen christlichen Denominationen.
Endlich soll das Thema »die Frau und das Christentum« noch einmal allgemein aufgegriffen und es soll dabei versucht werden, die sich durchhaltenden Gedanken zu formulieren und einige Wesensaussagen über die Frau aus christlichem Verständnis vorzulegen.
Im Jahre 1975 wurde in Mexiko mit einer Weltkonferenz das Jahrzehnt der Frau eröffnet, das 1985 mit einer weiteren Weltkonferenz zu diesem Thema in Nairobi zu Ende ging. Das Jahr 1975 wurde weltweit von den Vereinten Nationen zum »Jahr der Frau« erklärt. Seither sind viele Bücher erschienen, die über das Recht und die Gleichberechtigung der Frau handeln. Das spricht dafür, dass die Würde und das Recht der Frau in unserer Gesellschaft durchaus nicht gewährleistet sind, zumindest nicht in den vergangenen Jahrzehnten. Es geht hier um eine Frage, die von großer Bedeutung ist für die gesamte Menschheit. Die Wege, auf denen man sich dieser Frage zuwendet, sind sehr verschiedenartig. Möglicherweise gibt es dabei nicht wenige Wege – vielleicht gar in guter Absicht –, die das Problem eher verschärfen als lösen.
Schon in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat sich der Feminismus gebildet, der auf eine ganz besondere Art und Weise die Frauenfrage lösen wollte oder will. Ein Ableger davon ist die Feministische Theologie.
Im Jahre 1973 hat die katholische Kirche auf Bitten der kanadischen Bischöfe hin eine päpstliche Kommission eingerichtet mit dem Auftrag, die Stellung der Frau in der Kirche zu untersuchen. Seither ist eine Fülle von Büchern und Artikeln erschienen, die dieses Thema behandeln. Nicht wenige Konferenzen und Tagungen haben sich seither in der Kirche mit der Frauenfrage beschäftigt.
Im September 1955 ließ Papst Pius XII. bereits um eine christliche Lösung der Frauenfrage beten, offenbar aus der Erkenntnis heraus, dass es hier um die Existenz oder Nichtexistenz einer gesunden Gesellschaftsordnung geht. Dieser Sorge liegt die Erkenntnis zugrunde, dass das Frauenbild, das sich von der Schöpfungs- und Erlösungsordnung löst, das absieht von der christlichen Anthropologie, geradezu verhängnisvoll ist in seinen Folgen.
Wiederholt hat bereits Papst Pius XII. in seinen Ansprachen erklärt, dass die Frau die gleiche Würde und die gleiche Berufung zum Apostolat hat wie der Mann. So sagt er etwa den Teilnehmern des »Centro Italiano Feminile« am 14. Oktober 1956 in Loreto: »Worin beruht das Fundament für die Würde der Frau? Es ist genau das gleiche, von dem sich auch die Würde des Mannes ableitet: beide sind Kinder Gottes, sind erlöst von Christus und haben dasselbe übernatürliche Ziel. Wie kann man also reden von einer unvollkommenen Personalität der Frau, von einer Minderschätzung ihres Wesens, von einer sittlichen Unterlegenheit – und dieses alles ableiten von der katholischen Lehre? Kraft dieser gemeinsamen irdischen Bestimmung bleibt der Frau an sich kein menschliches Betätigungsfeld versagt, und so kann sie sich der Wissenschaft, der Politik, der Arbeit, der Kunst, dem Sport widmen, freilich stets in Unterordnung unter die primären Funktionen, die ihr von der Natur vorgeschrieben werden ... Vollkommene Gleichheit also in den grundlegenden persönlichen Werten, aber verschiedene Funktionen, die sich ergänzen und in wunderbarer Weise gleichwertig sind, aus denen aber die verschiedenartigen Rechte und Pflichten der beiden Geschlechter hervorgehen«21. Also Gleichwertigkeit, nicht jedoch Gleichheit oder Gleichartigkeit.
21 Arthur F. Utz, Josef Groner, Hrsg., Soziale Summe Pius XII. Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens, 3 Bde., Freiburg/Schweiz 1954, Nr. 4801 und Nr. 4802.
Das Zweite Vatikanische Konzil forderte im Jahre 1965 in der Pastoralkonstitution »Gaudium et Spes« die Überwindung jeder »Form einer Diskriminierung in den gesellschaftlichen und kulturellen Grundrechten der Person« und verurteilte dabei ausdrücklich jede Form einer ungerechten Behandlung »wegen des Geschlechtes«22. In dem genannten Dokument heißt es wörtlich: »Doch jede Form einer Diskriminierung in den gesellschaftlichen und kulturellen Grundrechten der Person, sei es wegen des Geschlechtes oder der Rasse, der Farbe, der gesellschaftlichen Stellung, der Sprache oder der Religion, muss überwunden und beseitigt werden, da sie dem Plan Gottes widerspricht. Es ist eine beklagenswerte Tatsache, dass jene Grundrechte der Person noch immer nicht überall und unverletzlich gelten: wenn man etwa der Frau das Recht der freien Wahl des Gatten und des Lebensstandes oder die gleiche Stufe der Bildungsmöglichkeit und Kultur, wie sie dem Manne zuerkannt wird, verweigert«23. Anerkennend, nicht nur berichtend, wird dann festgestellt: »Die Frauen verlangen für sich die rechtliche und faktische Gleichstellung mit den Männern, wo sie diese noch nicht erlangt haben«24.
22 Zweites Vatikanisches Konzil: Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute »Gaudium et spes«, Art. 29.
23 Ebd.
24 Ebd., Art. 9.
Die Konstitution begründet die Gleichwertigkeit aller Menschen mit der Gottebenbildlichkeit von Mann und Frau gemäß der Schöpfungsgeschichte und verlangt für die Frau vor allem »das Recht der freien Wahl des Gatten und des Lebensstandes, dazu die gleiche Stufe der Bildungsmöglichkeit und Kultur, wie sie dem Manne zugestanden wird«25.
25 Ebd., Art. 29.
Die katholische Kirche fordert nicht Gleichheit oder Gleichmacherei. Darum erklärt die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils »Gaudium et Spes«: »Die Frauen sind zwar schon in fast allen Lebenslagen tätig, infolgedessen sollen sie aber auch in der Lage sein, die ihrer Eigenart angemessene Rolle voll zu übernehmen. Sache aller ist es, die je eigene und notwendige Teilnahme am kulturellen Leben anzuerkennen und zu fördern«26.
26 Ebd., Art. 60.
Das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils »Über das Apostolat der Laien«, das auch mit den Anfangsworten des Dokumentes »Apostolicam actuositatem« zitiert wird, fordert sodann, dass die Frauen »auch an den verschiedenen Bereichen des Apostolats der Kirche wachsenden Anteil nehmen«27. Wörtlich heißt es da: »Da heute die Frauen eine immer aktivere Funktion im ganzen Leben der Gesellschaft ausüben, ist es von großer Wichtigkeit, dass sie auch an den verschiedenen Bereichen des Apostolates der Kirche wachsenden Anteil nehmen«28.
27 Zweites Vatikanisches Konzil: Dekret über das Laienapostolat »Apostolicam actuositatem«, Art. 9.
28 Ebd.
Die dogmatische Konstitution »Lumen gentium«, ein weiteres Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, vielleicht das bedeutendste, erklärt: »Eines ist (also) das auserwählte Volk Gottes: ›Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe‹ (Eph 4,5), gemeinsam die Würde der Glieder aus ihrer Wiedergeburt in Christus, gemeinsam die Gnade der Kindschaft, gemeinsam die Berufung zur Vollkommenheit, eines ist das Heil, eine die Hoffnung und ungeteilt die Liebe. Es ist also in Christus und in der Kirche keine Ungleichheit aufgrund von Rasse und Volkszugehörigkeit, sozialer Stellung oder Geschlecht; denn es gilt nicht mehr Jude und Grieche, nicht Sklave und Freier, nicht Mann und Frau; denn ›alle seid ihr einer in Christus Jesus‹ (Gal 3,28; vgl. Kol 3, 11)«29.
29 Zweites Vatikanisches Konzil: Dogmatische Konstitution über die Kirche »Lumen gentium«, Art. 32.
Solche Äußerungen haben als Verlautbarungen eines Allgemeinen Konzils einen hohen Rang. Aber sie dürfen nicht isoliert gesehen werden. Wie alle Verlautbarungen des Lehramtes der Kirche müssen sie im Kontext der »Ecclesia universalis loco et tempore« gesehen oder gelesen werden – die Universalität ist hier räumlich und zeitlich zu verstehen –, speziell im Kontext der Aussagen der Päpste Pius XI. und Pius XII., worauf sich ausdrücklich »Gaudium et spes«, aber auch die Enzyklika »Pacem in terris« von 1963, die sich auch mit unserem Thema beschäftigt, mehr als einmal berufen30.
30 Manfred Hauke, Die Problematik des Frauenpriestertums vor dem Hintergrund der Schöpfungs- und Erlösungsordnung, Paderborn 31991 (11982), 55.
Es scheint ein Charakteristikum der gegenwärtigen Theologie zu sein, dass man Einzelaussagen, speziell des Lehramtes, aus dem Zusammenhang heraus nimmt. Das geschieht etwa, wenn die ehemalige US-amerikanische Ordensfrau Mary Daly, eine Exponentin der feministischen Theologie, im Blick auf »Pacem in terris« lapidar feststellt: »Es fehlt die übliche Abwertung der Frauenemanzipation ...« und die »Anspielung auf ›gleiche Rechte und Pflichten für Mann und Frau‹« wird »nicht von einer aufhebenden Äußerung, dass eine ›gewisse Ungleichheit‹ notwendig sei«, ergänzt31. Konsequenterweise wirft sie Papst Paul VI., der die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in einer Erklärung zum »Jahr der Frau«32 deutlich herausgestellt hat, vor, nicht »die notwendigen Folgerungen aus der Ebenbürtigkeit der Frau« gezogen zu haben33. Auch bei der soeben zitierten Aussage der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils »Gaudium et spes« wird übersehen, dass zwei Sätze nach der angeführten Stelle betont wird, dass »zwischen den Menschen berechtigte Unterschiede bestehen«34. Die Gleichheit des Feminismus entspricht nicht dem Konzept der katholischen Kirche. Das wird immer wieder durch die Aussagen des Konzils zur Frauenfrage betont.
31 Mary Daly, Kirche, Frau und Sexus, Olten 1970, 96.
32 Vgl. Acta Apostolicae Sedis 69 (1977), 98ff.
33 Mary Daly, Kirche, Frau und Sexus, Olten 1970, 100.
34 Zweites Vatikanisches Konzil: Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute »Gaudium et spes«, Art. 29.
So wird in »Lumen gentium« die berühmte Stelle Gal 3, 28 nachdrücklich zitiert, und zwar in Art. 32: »Da gilt nicht mehr Jude oder Grieche, Sklave oder Freier, nicht mehr Mann oder Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus« (Gal 3, 28). In Christus und in der Kirche gibt es keine Ungleichheit auf Grund von Rasse und Volkszugehörigkeit, auf Grund der sozialen Stellung oder auf Grund des Geschlechtes. In dem gleichen Artikel heißt es dann aber, dass »gerade die Vielfalt der Gnadengaben, Dienstleistungen und Tätigkeiten«, also die »Verschiedenheit«, »Zeugnis von der wunderbaren Einheit im Leibe Christi«35 ablegt. Zur Einheit, wie sie in Gal 3, 28 hervorgehoben wird, gehört also die Verschiedenheit, wie sie uns in 1 Kor 12 begegnet, wenn da von den verschiedenen Gnadengaben die Rede ist.
35 Zweites Vatikanisches Konzil: Dogmatische Konstitution über die Kirche »Lumen gentium«, Art. 32.
Besonders deutlich tritt die Überzeugung des Konzils von der unterschiedlichen Prägung der Geschlechter in der Erklärung über die christliche Erziehung »Gravissimum educationi« hervor. Dieses Dokument fordert nämlich geradezu dazu auf, den Unterschied der Geschlechter bewusst anzunehmen und auszugestalten. Eltern und Lehrer sollen »in der gesamten Erziehung der Verschiedenheit der Geschlechter und der jedem der beiden Geschlechter in Familie und Gesellschaft eigenen, von der göttlichen Vorsehung bestimmten Zielsetzung Rechnung tragen«36. Hier gilt also nicht Gleichschaltung, die zu überwinden ist, oder Rollenmuster, das obsolet ist, sondern Verschiedenheit, die in der göttlichen Vorsehung verankert ist. Wenn hier ausdrücklich auf die Erziehungs-Enzyklika Pius XI. »Divini illius magistri« vom 31. Dezember 1929 hingewiesen wird, so dürfen wir darin eine Spitze gegen die Koedukation erkennen, die in neuester Zeit auch von Feministinnen in Frage gestellt wird. Wiederholt finden wir in dem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils Hinweise auf die genannte Erziehungsenzyklika Pius XI.
36 Zweites Vatikanisches Konzil: Erklärung über die christliche Erziehung »Gravissimum educationis«, Art. 8.
Man muss hier genau unterscheiden, Überlegenheit oder Unterordnung im Sinne des Unterlegenen, des Minderwertigen, darum kann es nicht gehen. Würde man das aus dem Dokument herauslesen, würde man es falsch interpretieren. Bei den Geschlechtern kann es nicht um Überlegenheit und Unterordnung im Sinne des Unterlegenen gehen, wohl aber um Verschiedenheit. Nicht »excellentia« des Mannes oder »inferioritas« der Frau, wohl aber »differentia« zwischen Mann und Frau37.
37 Manfred Hauke, Die Problematik des Frauenpriestertums vor dem Hintergrund der Schöpfungs- und Erlösungsordnung, Paderborn 31991 (11982), 57–59.
Aus der Sicht der katholischen Kirche hängt das hier angesprochene Problem einerseits zusammen mit der theologischen Anthropologie, andererseits mit der Ekklesiologie. Sofern es sich in beiden Fällen um theologische Disziplinen handelt, ist die Offenbarung maßgebend, die Offenbarung und ihre rechte Interpretation. Dabei ist zu bedenken, dass nach katholischem Verständnis die in sich vieldeutige Schrift ihre Eindeutigkeit durch die Tradition, das heißt durch das Lehramt der Kirche in der Geschichte und durch das aktuelle Lehramt erhält. Was die rechte Interpretation der Offenbarung angeht, spielen hier auch die Vernunft und das Naturrecht eine wichtige Rolle.
7. Die Frauenfrage im Kontext von
Sexualität, Ehe und Familie.
Das Thema »Frau« ist aufs Engste verbunden mit den Themen Ehe, Familie, Sexualität. Wo immer die Sexualität überbetont oder die Ehe als der entscheidende oder gar einzig mögliche oder einzig angemessene Weg der Frau angesehen und propagiert wird, da wird die Frau in Relation zum Mann gesehen, am Mann gemessen, damit aber in ihrer Eigenwürde in Frage gestellt. Daher müsste eigentlich auch ein vernünftiges Bemühen um die Gleichwertigkeit der Geschlechter der Überbetonung der Sexualität entgegentreten.
Von daher dient die besondere Wertung von Ehelosigkeit und Jungfräulichkeit bei den Geschlechtern immer auch einer höheren Wertung der Frau in den Religionen. Das wird allerdings nicht immer so gesehen. In der Literatur heißt es immer wieder einmal, Eheverzicht und Jungfräulichkeit seien ein Ausdruck der Geringschätzung der Frau und der männlichen Überlegenheit ihr gegenüber. Das Gegenteil ist der Fall. Bei solcher Argumentation wird nicht realisiert, dass es sich hier um Askese handelt und dass Gegenstand der Askese doch nur etwas sein kann, das zunächst einmal einen hohen Wert darstellt. Wird das Familienleben hoch geschätzt und hat die Sexualmoral ein hohes Niveau, so führt das auch zu einer höheren Wertung der Frau. Das beweist die Geschichte. Stets gehen in ihr die Missachtung der Frau und die Missachtung der Familie Hand in Hand. Polygamie und Ehebruch setzen die Wertung der Frau herab. Ihre Praxis und ihre Bewertung sind stets wichtige Indikatoren für die Stellung der Frau.
8. Ein kulturgeschichtlicher Rückblick.
Die Stellung der Frau hängt wesentlich mit der Wertung und den Formen der Familie zusammen. Das gilt auch geschichtlich. Durchweg finden wir in den verschiedenen Kulturen die Frau als Mutter der Kinder, gebunden an das Haus und dessen nächste Umgebung. Ihr eigentliches Arbeitsgebiet ist das Hauswesen, die Versorgung der Kinder und später auch die Bearbeitung des Gartens. Bei nicht wenigen primitiven Stämmen muss sie auch für die Errichtung des Hauses oder des Zeltes sorgen, das als ihr Eigentum gilt. Der Mann geht dann auf die Jagd und schützt die Familie durch Kämpfe und Blutfehden. Diese Arbeitsteilung führt schon in ältester Zeit häufig zu einer gewissen Gleichberechtigung der Frau mit dem Mann, wenngleich die Beschränkung der weiblichen Einflusssphäre nicht selten zur sozialen Degradierung der Frau führt. Es gibt freilich auch Kulturen, in denen die Frau eine bevorzugte Stellung innehat. Wir sprechen hier von den mutterrechtlichen Kulturen. Sie begegnen uns immer wieder in der Geschichte. Man kann den Wechsel vom Matriarchat zum Patriarchat jedoch nicht systematisieren, als ob hier eine eindeutige Aufeinanderfolge bestehe im Sinne der Evolution.
Nicht nur in mutterrechtlichen Kulturen hat die Frau eine bedeutende Stellung inne. Auch in nichtmatriarchalen Kulturen hören wir immer wieder von einem außerordentlichen Einfluss der Frauen. So gibt es etwa bei den afrikanischen Völkern immer wieder Königinnen und weibliche Häuptlinge. Ähnliches wird uns auch aus der Südsee berichtet38.
38 Oskar Rühle, Art. Frau I, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. II, Tübingen 21928, 716.
Erheblich verschlechtert sich demgegenüber das Los der Frau im Kulturkreis der nomadisierenden Hirten und Viehzüchter. Wo die Frau aber eine schwache soziale Stellung innehat oder wo sie gar versklavt wird, verbindet sich dieser Zustand mit der Polygamie, was freilich nicht überraschend ist. Hier wird die Frau im Grunde wie eine Sache behandelt und entsprechend ausgebeutet, instrumentalisiert. Damit verbindet sich dann gern auch theoretisch die völlige Rechtlosigkeit der Frau. In solchen Verhältnissen verdankt sie dann bereits ihre Existenz der Gnade und der Willkür des Mannes, ja schon vorher der Gnade und der Willkür des Vaters, der ein Mädchen nach Belieben aussetzen kann. Ausdruck dieser niedrigen Stellung ist auch der Brauch der Witwenverbrennung, dem der Gedanke zugrunde liegt, dass die Frau ihrem Gebieter bis in den Tod folgen muss. Bei den alten Germanen hatte der Ehemann gegenüber der Frau die Gewalt über Leben und Tod. Das gilt aber auch für viele andere Kulturen.
Manchmal ist die Stellung der Frau, wie gesagt, widersprüchlich. So wird uns im alten Babylon bezeugt, dass die Frau Herrscherin über eine Stadt sein konnte, dass sie als rechtsfähige, vertragsschließende Person hervortreten konnte, während andererseits die Polygamie, speziell in der Form der Haremswirtschaft des Orients, dort einen Ort hatte, die ihrerseits eine starke Missachtung der Frau zum Ausdruck bringt39.
39 Ebd., 716f.
Man muss wohl unterscheiden zwischen der rechtlichen und der sozialen Geringschätzung der Frau einerseits und ihrem tatsächlichen Einfluss und ihrer Wertung im praktischen Leben andererseits, also zwischen Theorie und Praxis. Wir beobachten nämlich, dass die Frau – auch wo sie sozial unterdrückt ist – doch oft eine hohe Achtung von Seiten des Mannes genießt. Manche sagen, der Grund dafür liege letztlich darin, dass die Frau in ihrer mütterlichen Bestimmung als Trägerin übernatürlicher Kräfte gilt40.
40 Ebd., 717.
Hinsichtlich der Beurteilung der Geschichte muss man vorsichtig sein. Auch darauf ist in diesen einleitenden Bemerkungen hinzuweisen. Geschichtliche Gegebenheiten müssen aus ihrer Zeit heraus verstanden werden. Wir machen einen methodischen Fehler, wenn wir die Geschichte, die evolutiv voranschreitet, von unserem gegenwärtigen Standpunkt aus beurteilen und abqualifizieren. Das gilt für die Religionen im Allgemeinen, im Besonderen gilt das für das Christentum. Die jüdisch-christliche Offenbarung und ihre tiefere Erkenntnis stehen nicht im luftleeren Raum. Sie stehen vielmehr im Kontext der Geistesgeschichte. Auch hier gilt das fundamental wichtige scholastische Axiom »gratia supponit naturam«, »die Gnade baut auf der Natur auf«. Die Konkretion der Prinzipien der Offenbarung nimmt teil an der Defizienz der Geschichte, an der Situationsenge der jeweiligen Epoche wie auch des konkreten Menschen. Das gilt trotz der Zeichen, trotz der Glaubwürdigkeitskriterien, die Gott mit der Offenbarung verbunden hat und die ihre Einzigartigkeit unterstreichen.
Wir müssen im Übrigen immer unterscheiden zwischen den Prinzipien und ihrer defizitären Anwendung.
Grundsätzlich gilt, dass es keinen Sinn hat, über geschichtliche Fakten zu lamentieren. Sie sind Gegebenheiten, die als solche nicht einmal von Gott ungeschehen gemacht werden können, wenngleich sie uns zum Appell werden können, dafür zu sorgen, dass bestimmte Vorkommnisse nie mehr geschehen können.
Wenn man die Religionen insgesamt betrachtet, so erkennt man, dass ein Volk den Frauen um so mehr gerecht wird, dass es sie um so höher wertet, je religiöser es ist und je mehr es sein Sittengesetz an der ursprünglichen Schöpfungsordnung ausrichtet. Die Kontrolle über das Triebleben, die Hebung des moralischen Niveaus und die Entfaltung einer starken Religiosität bringen der Frau stets größere Wertschätzung ein und verschaffen ihr in allen Fällen mehr Gerechtigkeit. Das zeigt sich in der alttestamentlichen Religion nicht anders als in den übrigen Volks- und Weltreligionen. Es ist bezeichnend: Je weiter wir in der Geschichte des Alten Bundes zurückgehen, umso freundlichere Züge tragen die Frauenbilder, denen wir da begegnen. Je stärker Israel von den umliegenden Völkern beeinflusst ist, um so mehr leidet die Wertschätzung der Frau41.
41 Peter Ketter, Christus und die Frauen, Bd. I: Die Frauen in den Evangelien, Stuttgart 51950, 36.
Allgemein beobachten wir, dass die amtliche Bedeutung der Frau und ihres Dienstes – nicht unbedingt die Wertung der Frau als solche – in den höheren Religionen zurücktritt, dass es beispielsweise Priesterinnen nur in ursprünglicheren Religionen gibt, dass in den Hochreligionen die entscheidende Initiative im äußeren Bereich von den Männern ausgeht und die Leitung der religiösen Organisation in den Händen der Männer liegt. Das heißt in jedem Fall nicht, dass damit unbedingt eine Minderbewertung der Frau verbunden ist. Gleichwertigkeit meint nicht unbedingt Gleichheit. Die Stellung, die der Frau zuerkannt wird, ist in den verschiedenen Hochreligionen recht verschieden, wie wir sehen werden. Gemeinsam ist ihnen weithin, dass sie die religiöse Gleichberechtigung für Mann und Frau oder die Gleichheit von Mann und Frau im Hinblick auf die religiösen Pflichten vertreten und durchsetzen42.
42 Friedrich Heiler, Der Dienst der Frau in den Religionen der Menschheit, in: Friedrich Heiler, Hrsg., Eine heilige Kirche, Zeitschrift für Kirchenkunde und Religionswissenschaft (vorher: Hochkirche bzw. Religiöse Besinnung), München 1939/40 (Heft 21/22), 24.
Gewisse Nachteile erwachsen der Frau ohne Zweifel auch aus der Schwangerschaft. Das ist nicht zu verkennen. Im Kontext der Fortpflanzung trägt die Frau die größere Last, hier ist sie stärker gefordert als der Mann. Diese Tatsache erschwert ihr Wirken in der Öffentlichkeit, zumindest zeitweilig. Deshalb fordert man heute im Feminismus vielfach die Befreiung der Frau von der Schwangerschaft, hat man hier zumindest wenig Sinn für die Mutterschaft. Diese Forderung erhebt etwa auch die Theologin Anita Röper. Auch sie sieht in der Befreiung von der Schwangerschaft die Voraussetzung für ihre Gleichheit. In einem Interview mit dem Theologen Karl Rahner († 1984) stellt sie fest: »Solange menschliche Wesen nicht in der Retorte entstehen, sondern von Frauen zur Welt gebracht werden müssen, so lange bleibt die Frau dem Manne gegenüber von vornherein im Nachteil, der von diesem immer ausgenützt werden wird. So lange bleibt auch Gleichberechtigung ein Traum, der nicht verwirklicht wird«43.
43 Anita Röper, Ist Gott ein Mann? Ein Gespräch mit Karl Rahner, Düsseldorf 1979, 51.
Hier ist auch auf die simplen Konklusionen zu verweisen, die man aus dem Augenschein gezogen hat, etwa im Blick auf die Körpergröße und die physischen Kräfte.
Wenn man in der Vergangenheit vielfach die Vollwertigkeit der Frau gegenüber dem Mann in Frage gestellt hat, so dürfte sich das – wenigstens teilweise – auch daraus erklären, dass man einfach zu wenig wusste über den Beitrag der Frau zur Entstehung eines neuen Menschenwesens. Erst im Jahre 1827 wurde beispielsweise von Karl Ernst von Baer († 1876) die weibliche Eizelle entdeckt. Man glaubte, die Menschennatur werde allein durch den Vater, nicht auch durch die Mutter übertragen. Man war der Meinung, die Mutter liefere gewissermaßen nur die Umweltbedingungen. Man betrachtete den Mutterschoß wie einen Acker, der das Samenkorn des Mannes aufnimmt. Das heißt: Man wusste nichts über die inneren Keimdrüsen, die im weiblichen Organismus nicht weniger wirksam sind als im männlichen und im Vergleich mit ihnen nicht geringer geachtet werden dürfen. Heute ist die Erkenntnis der genetischen und funktionellen Vollwertigkeit der Frau angesichts der Erforschung des menschlichen Entwicklungsvorgangs über alle Zweifel erhaben.
Ein wichtiges Grundprinzip ist in den Religionen die uns immer wieder begegnende Erfahrung der Geheimnishaftigkeit der Frau. Diese führt bei den verschiedenen Völkern zu widersprüchlichen Reaktionen. Entweder bezeichnen sie daher die Frau in ihrer Ganzheit als böse, oder sie verstehen sie schlechthin als heilig. Auf der einen Seite verstehen sie die Frau als dämonisch, auf der anderen Seite als angelisch. Einerseits wird sie divinisiert, andererseits dämonisiert. Auf der einen Seite wird sie als der Inbegriff des Bösen gesehen. Auf der anderen Seite als der Abglanz des Göttlichen. Für beide Vorgänge gibt es eine Fülle von Beispielen in der Kulturgeschichte bzw. in der Religionsgeschichte.
So setzen beispielsweise die Chinesen das weibliche Prinzip des Yin mit dem Dunkeln und Bösen gleich. Deshalb halten viele primitive Stämme Frauen von allen heiligen Zeremonien fern. Auf diesem Hintergrund muss auch der Hexenglaube verstanden werden, der ja nicht christlich, sondern heidnisch ist und sich in der Geschichte bei den verschiedensten Völkern ausgebreitet hat. Dabei ist freilich zu bedenken, dass es nicht nur weibliche, sondern auch männliche Hexen gibt. Dennoch muss man zugeben, dass die Frau hier dominiert.
So begegnet uns oft die Frau als Wahrsagerin und Mantikerin, das heißt: als Priesterin in einem ganz spezifischen Sinne. Bei vielen Naturvölkern holt man gern in wichtigen Entscheidungen den Rat von Frauen ein, weil man ihnen geheimnisvolle seherische Fähigkeiten zuerkennt. In diesen Kontext gehört auch der Brauch bestimmter primitiver Völker, Frauen zu Friedensverhandlungen in das feindliche Lager zu schicken, weil man sie für unantastbar hält.
Bei den Kelten kennen wir die weissagenden Druidinnen. Im Alten Testament begegnen uns Prophetinnen. Das klassische Beispiel der Wahrsagerin ist die griechische Pythia am Orakel zu Delphi. Auch bei den Germanen war das divinatorische Ansehen der Frauen sehr groß. Tacitus († nach 116 n. Chr.) berichtet uns beispielsweise in der »Germania«44, die Germanen seien der Überzeugung gewesen, in ihren Frauen wohnten Heiligkeit und Sehergabe, weshalb sie deren Rat niemals verschmähten. Er nennt in diesem Zusammenhang gar einige berühmte Seherinnen mit Namen. Dieser Wertschätzung der Frau durch die Germanen entspricht es, wenn uns berichtet wird, dass sie das eine Mal nach einem Sieg die Frauen schonten, das andere Mal sie als besonders wertvolle Opfer den Göttern darbrachten45.
44 Publius Cornelius Tacitus, Germania, cap. 8.
45 Oskar Rühle, Art. Frau I, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. II, Tübingen 21928, 717f.
Merkwürdigerweise koexistiert mit solcher Wertschätzung bei den germanischen Völkern und auch sonst nicht selten weitgehend eine rechtliche und soziale Geringschätzung der Frau bis hin zu ihrer völligen Rechtlosigkeit46.
46 Ebd.
Ein nicht unbedeutender Gesichtspunkt unserer Thematik ist demnach die Erfahrung der Geheimnishaftigkeit der Frau durch den Mann, die dazu führt, sie einerseits zu divinisieren, andererseits zu dämonisieren. Für beide Vorgänge gibt es nicht wenige Beispiele in der Kulturgeschichte bzw. in der Geschichte der Religionen, wofür uns in unseren Erörterungen immer wieder Beispiele begegnen werden. Einmal wird die Frau als der Inbegriff des Bösen gesehen, dann wiederum als der Abglanz des Göttlichen.
9. Weltreligionen im engeren und im weiteren Sinne – Volksreligionen – Stammesreligionen – Naturreligionen.
Wenn wir nun unsere Aufmerksamkeit auf die Weltreligionen richten, so werden wir die Volksreligionen nicht ganz außer Acht lassen. Wir sprechen im Allgemeinen von Weltreligionen und von Volksreligionen. Die Weltreligionen sind zwar jeweils auf dem Boden einer Volksreligion entstanden, haben aber im Unterschied zu diesen eine Einzelpersönlichkeit als Stifter und erheben einen universalen Anspruch. In diesem Sinne bezeichnet man als Weltreligionen nur drei, nämlich den Buddhismus, das Christentum und den Islam. Man spricht hier von den Weltreligionen im engeren Sinne. Als Weltreligionen im weiteren Sinne bezeichnet man dann das Judentum und den Hinduismus. Bei diesen Religionen kann man zwar nicht von einem Stifter sprechen, wohl aber erheben sie einen universalen Anspruch, wie die Weltreligionen im eigentlichen Sinne es immer tun.
Gleichbleibend charakteristisch ist in den Weltreligionen im engeren Sinne auch das Motiv der Unheilssituation, in der sich der Einzelne vorfindet, wie immer diese Unheilssituation dann im Einzelnen beschrieben wird. Angesichts dieser Unheilssituation bietet der Religionsstifter dann mit seiner Botschaft Heilung und Heil an. Dabei werden dann zum einen die volksreligiösen Traditionen durchbrochen, und wird dann zum anderen ein absoluter Heilsweg verkündet. Allein, das Unheilsmotiv, die Unheilssituation begegnet uns auch in vielen anderen Religionen, wenn auch nicht so zentral wie in den Weltreligionen im engeren Sinne. Zudem verbindet sich in diesen Weltreligionen mit dem Motiv der Unheilssituation die Idee, dass der Religionsstifter, und nur er, den Einzelnen aus dieser Unheilssituation herausführt durch einen ganz spezifischen Heilsweg. Die Weltreligionen wenden sich schließlich noch stets primär an den Einzelnen, nicht an ein Volk47. Die älteste Weltreligion ist in diesem Sinne der Buddhismus.
47 Gustav Mensching, Allgemeine Religionsgeschichte, Leipzig 1940, 164.
Ein charakteristisches Unterscheidungsmerkmal zwischen den Weltreligionen und den Volksreligionen besteht auch darin, dass sich die Weltreligionen an den Einzelnen wenden, die Volksreligionen sich jedoch jeweils an ein Volk. Ähnlich ist das bei den Naturreligionen. Diese sind im Vergleich mit den Volksreligionen eine noch ursprünglichere Form von Religion. Sie sind stammesgebunden und liegen der Volkwerdung voraus. In diesem Sinne sprechen wir auch von primitiven Religionen. Im einen Fall sind die Träger der Religion Naturvölker, im anderen Fall Kulturvölker.
Man spricht bei dieser Unterscheidung auch von stammesgebundenen Naturreligionen und volksgebundenen Kulturreligionen und bezeichnet sie dann gemeinsam als Volksreligionen. Die Evolution, die geistige Entwicklung, erfolgt also von den stammesgebundenen Naturreligioen über die volksgebundenen Kulturreligionen zu den universalen Weltreligionen. Das Judentum nimmt in diesem Kontext eine Sonderstellung ein. Es ist die Religion eines Volkes, gleichzeitig erhebt es jedoch einen universalen Anspruch, der zunächst sehr latent ist, dann aber in der Geschichte des Alten Testamentes immer deutlicher hervortritt, speziell im Zusammenhang mit der messianischen Erwartung.
II. Kapitel: Die Wertung der Frau im Hinduismus, der ältesten Weltreligion.
1. Die wesentlichen Elemente des Hinduismus.
Wenn wir die Weltreligionen im engeren und im weiteren Sinne zusammennehmen, ist der Hinduismus die älteste Weltreligion. Was ihn charakterisiert, das ist die Tatsache, dass er eine Religion nicht nur ohne einen Stifter ist, dass er darüber auch eine Religion ohne ein Glaubensbekenntnis und ohne eine organisierte Priesterschaft ist. Der Hinduismus ist, allgemein gesprochen, verwirrend in seiner Vielfalt, weshalb man ihn eher als eine Verbindung von Religionen denn als eine einzige Religion mit einem bestimmten Glaubensbekenntnis bezeichnen kann48. Im Grunde ist es angemessener, ihn als eine jahrtausendealte religiöse Kultur zu verstehen denn als eine Religion, wie wir Religionen verstehen. Nicht zu Unrecht hat man den Hinduismus als einen grandiosen Synkretismus bezeichnet. Das ist er in der Tat, ein grandioser Synkretismus. Das gilt für die Vergangenheit nicht weniger als für die Gegenwart49.
48 Carl-Martin Edsmann, Die Hauptreligionen des heutigen Asiens, Tübingen 1976, 70.
49 Ebd.
Der Hinduismus ist synkretistisch. Insider verstehen diesen Tatbestand positiv als Tendenz zur Anpassung und erkennen in ihm gerade die Schönheit, die Größe und den Reichtum dieser Religion50.
50 Ebd.
Der Synkretismus des Hinduismus, den man auch als Anpassung an die jeweilige geistige Umwelt bezeichnen kann, den man zunächst als etwas Negatives bezeichnen würde, wird im Hinduismus, heute nicht selten auch im Abendland und überhaupt in der westlichen Welt, als äußerst positiv empfunden und erlebt. Er entfaltet von daher eine besondere Attraktivität.
Ein erstes Charakteristikum des Hinduismus ist es, dass in ihm die religiösen Formen und Vorstellungsweisen äußerst mannigfaltig sind. Es gibt keine Religion, bei der eine größere Mannigfaltigkeit religiöser Formen und Vorstellungsweisen anzutreffen ist. Zum Teil stehen diese einfach nebeneinander, unvermittelt. Im Blick auf dieses Faktum hat man gesagt, es gebe so viele Arten von Hinduismus wie es Hindus gebe. Dabei erfüllt und bestimmt die Religion in Indien das ganze Leben, mehr als das bei anderen Völkern der Fall ist51.
51 Gustav Mensching, Allgemeine Religionsgeschichte, Leipzig 1940, 31, Ram Adhar Mall, Der Hinduismus. Seine Stellung in der Vielfalt der Religionen, Darmstadt 1997, 1f.
In erster Linie geht es in dieser Religion um die Erlösung. Ihr gegenüber ist der Weg von sekundärer Bedeutung52.
52 Ram Adhar Mall, Der Hinduismus. Seine Stellung in der Vielfalt der Religionen, Darmstadt 1997, 2.
Der Hinduismus ist nicht eine Schöpfung der Arier, die um 2000 v. Chr. nach Indien gekommen sind, wie man früher vielfach gemeint hat, er ist vielmehr das Ergebnis der Vermengung von arischen und nichtarischen Elementen. Als die Arier nach Indien kamen, fanden sie dort nämlich die verschiedensten Rassen vor, die bereits ihre eigene Kultur und ihre eigene Religion hatten53.
53 Josef Neuner, Hrsg., Hinduismus und Christentum. Eine Einführung, Wien 1962, 2.
Für den Hinduismus ist, wie auch für den Buddhismus, das entscheidende Unheil in der Welt nicht die Schuld oder die Sünde, sondern das Gebanntsein in die individuelle Existenz. Von daher werden die Welt und der Mensch im Tiefsten negativ gewertet. Die Verneinung ist hier bestimmend. Den beiden großen Religionen Indiens kommt ein tragischer Grundzug zu54.
54 Gustav Mensching, Allgemeine Religionsgeschichte, Leipzig 1940, 46.
Der Hinduismus ist die dominierende Religion in der Republik Indien, die freilich religionsneutral ist, formell. Von 516 Millionen Einwohnern Indiens gehörten im Jahre 1968 350 Millionen dem Hinduismus an, das sind rund 73 Prozent, 55 Millionen waren Moslems, das sind 18 Prozent. Im Übrigen gab es damals in Indien 12,5 Millionen Christen, das sind 1, 8 Prozent, 9 Millionen Sikhs55