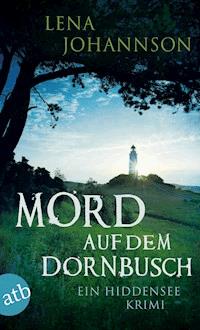9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jungfernstieg-Saga
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal eines Hamburger Unternehmens. Hamburg, 1903: Gerda und Oscar ist mit Leukoplast ein echter Bestseller gelungen. Während Oscar sein gemeinnütziges Engagement verstärkt und damit bei den Hamburger Kaufleuten aneckt, veranstaltet Gerda in ihrer Villa in Eimsbüttel erfolgreiche Kunstsalons. Die Künstlerin Irma steht vor ihrem internationalen Durchbruch, und Antonia hat ihr Glück in der Liebe gefunden. Doch dann soll sie sich nach einem Schicksalsschlag plötzlich um die kleine Tochter ihrer Freundin kümmern. Sie ahnt nicht, welch schwieriger Kampf um das Kind ihr bevorsteht. Zugleich unterstützen die drei Frauen Oscar bei der Entwicklung einer neuartigen Creme, die die Welt der Kosmetik revolutionieren soll – denn auch die Konkurrenz ist dieser Idee auf der Spur. Berührend und authentisch – die große Saga nach dem Vorbild der Geschichte von Beiersdorf
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
1903: Gerdas und Oscars Unternehmen floriert. Mit dem Klebeverband Leukoplast ist ihnen ein Renner gelungen, doch Oscar sieht die Zukunft seiner Firma woanders: Er arbeitet fieberhaft an der Rezeptur für eine völlig neuartige Creme. Gleichzeitig muss er versuchen, seine Marke zu schützen, denn inzwischen gibt es starke Konkurrenz auf dem Markt. Gerda organisiert erfolgreich Kunstsalons, die inzwischen weit über Hamburg hinaus bekannt sind. Der Künstlerin Irma steht eine aufregende Zeit bevor: Ihre Bilder sollen in Marseille ausgestellt werden. Und sie ist schwanger – doch ein Geheimnis trübt ihre Freude darüber. Antonia dagegen scheint endlich ihr persönliches Glück gefunden zu haben. Aber dann will sie sich um die kleine Tochter einer verstorbenen Freundin kümmern, und sie ahnt nicht, was sie dafür aufs Spiel setzen muss.
Über Lena Johannson
Lena Johannson, 1967 in Reinbek bei Hamburg geboren, war Buchhändlerin, bevor sie freie Autorin wurde. Vor einiger Zeit erfüllte sie sich einen Traum und zog an die Ostsee.
Im Aufbau Taschenbuch sind u. a. ihre Bestseller „Die Villa an der Elbchaussee", "Jahre an der Elbchaussee", „Töchter der Elbchaussee“ und "Die Malerin des Nordlichts" sowie der erste Band der Jungfernstieg-Saga „Die Frauen vom Jungfernstieg. Gerdas Entscheidung“ lieferbar.
Mehr zur Autorin unter www.lena-johannson.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lena Johannson
Die Frauen vom Jungfernstieg. Antonias Hoffnung
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1: Toni — Hamburg, im Oktober 1903
2: Gerda — 1903
3: Irma — 1903
4: Gerda
5: Toni
6: Gerda
7: Toni
8: Toni
9: Irma
10: Toni
11: Toni
12: Gerda
13: Irma
14: Toni
15: Gerda — Oktober 1904
16: Toni
17: Gerda — April 1905
18: Toni
19: Irma
20: Gerda
21: Toni
22: Gerda — 1906
23: Irma
24: Irma
25: Toni — 3. Juli 1906
Anmerkung & Nachwort
Glossar
Danksagung
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
1
Toni
Hamburg, im Oktober 1903
Die Sohlen ihrer Schuhe quietschten bei jedem Schritt. Schrecklich laut, fand Toni, aber leise konnte man auf dem blank polierten Linoleumboden einfach nicht gehen. Und Gretels Zimmer lag auch noch am Ende des langen Flurs. Eine Krankenschwester mit Häubchen und weißer Schürze kam ihr mit gesenktem Blick entgegen, gedämpfte Stimmen von irgendwoher. Ein unangenehm scharfer Geruch lag in der Luft. Tonis Finger tasteten nach dem Schal in ihrer Manteltasche. Besser, sie hielt sich den wieder vor Mund und Nase, solange sie bei Gretel war. Zur Sicherheit. So eine Schwindsucht war eine gefährliche Sache. Blöder Name. Gretel würde nicht verschwinden, das kam ja gar nicht in Frage. Was sollte dann aus Ellma werden? Die Lütte war doch erst fünf Jahre alt. Toni atmete noch einmal durch, ehe sie klopfte und das Krankenzimmer betrat. Von Mal zu Mal fiel es ihr schwerer, denn Gretel wurde immer blasser und dünner. Vielleicht passte Schwindsucht doch ganz gut.
»Toni, wie schön«, kam es leise aus dem Bett, das ganz hinten am Fenster stand. Insgesamt lagen sechs Frauen in dem schlichten, weiß gestrichenen Raum. Die meisten öffneten nicht einmal die Augen, als Toni zwischen den beiden Reihen hindurch ging.
»Moin, Gretel, na, wie geht’s dir heute? Siehst schon viel besser aus.« In so einer Situation war Schummeln erlaubt, fand Toni.
Das Gesicht der einstigen Kollegin war bleich, ein dünner Schweißfilm glänzte auf Stirn und Oberlippe. Die blonden Haare klebten in feuchten Strähnen an ihren Wangen und dem Kissen.
»Ich fühle mich auch schon besser.«
»Das ist eine gute Nachricht.«
»Nee, das ist gelogen. Genau wie dein ›Siehst schon viel besser aus‹.« Gretel lächelte gequält und musste husten. »Was macht Ellma, ist sie brav?«
Die Frage kam immer, so sicher wie Sturm im Herbst.
»Deine Tochter ist ein Schatz!« Das stimmte wirklich. Hermann war ganz vernarrt in die Kleine. Nicht nur er, die gesamte Belegschaft von Beiersdorf mochte das Mädchen. Seit Gretel im Krankenhaus Bethanien lag, wurde ihre Tochter von vorne bis hinten betüdelt.
»War Werner denn mal bei ihr?« Gretels Stimme war jetzt noch leiser. Auch diese Frage kam immer mit absoluter Sicherheit.
Toni senkte den Blick. »Ach, Gretel.« Jedes Mal das Gleiche, und nie konnte sie der Ärmsten etwas Schönes sagen. Am liebsten würde sie Werner Hagen links und rechts ’n paar verpassen.
»So ein Mistkerl! Dass man sich dermaßen in einem Menschen täuschen kann. Ich dachte doch wahrhaftig, er hat mich gern.«
Toni sah sie an. Das waren nun aber mal neue Töne. Bisher hatte Gretel den Vater ihres Kindes immer in Schutz genommen.
»Er mag dich schon leiden«, entgegnete sie. »Ganz bestimmt.« Sie seufzte. »Nur ist er eben ein oller Feigling. Er tanzt nach der Pfeife seiner Eltern und seiner Schwiegereltern.«
»Kann sein. Vielleicht hat es ihm auch bloß gefallen, eine Ehefrau und eine Freundin zu haben. Das Kind passte nur nicht zu seiner Ménage zu dritt.«
»Hat er dir wenigstens mal wieder etwas Geld gegeben?«
Gretel verdrehte die Augen. »Schon lange nicht. Weißt du, Toni, das ist das Schlimmste.« Sie hustete schon wieder, länger dieses Mal. Toni reichte ihr ein Glas Wasser. »Danke«, keuchte sie. »Ich dachte, zumindest die Kleine bedeutet ihm etwas. Aber er kümmert sich nicht mal um sein eigenes Fleisch und Blut. Ihm ist völlig egal, wo die Lütte bleibt, während ich hier bin, oder was aus ihr werden soll, wenn ich nicht mehr nach Hause komme.«
»Daran darfst du nicht mal denken.« Toni schluckte den Kloß herunter, der plötzlich in ihrem Hals steckte.
»Als ob ich mir ein Kindermädchen leisten könnte«, sprach Gretel unbeirrt weiter. »Ich kann Herrn Troplowitz gar nicht genug danken, dass Ellma weiter in die Stillstube von Beiersdorf gehen darf.«
»Von wegen. Der Chef will die Lütte sehen, so oft es geht. So sieht’s aus.« Toni zog eine Grimasse und freute sich über Gretels Lächeln. Sie zupfte eine Falte des Lakens glatt und erzählte, was bei Beiersdorf so los war. »Wird Zeit, dass du wieder zur Arbeit kommst. Wir können jede helfende Hand gebrauchen.« Sie pustete sich ihren Pony aus dem Gesicht. »Wir können gar nicht so viel Leukoplast herstellen, wie die Leute haben wollen. Es ist unser Renner.«
»Kannst stolz auf dich sein.«
»Nee, nee, damit hab ich nichts zu tun.«
»Aber klar! Du hast doch damals kurz vor der großen Präsentation ein neues Material für das Pflaster ins Spiel gebracht. Und du leitest die Reklameabteilung.«
»Schön wär’s. Inzwischen verwenden die Herren der Entwicklung schon wieder einen anderen Stoff als das von mir vorgeschlagene Segeltuch. Und Reklame brauchen wir für Leukoplast nun wirklich nicht zu machen. Das verkauft sich von ganz allein.«
»Trotzdem«, beharrte Gretel. »Als wir uns kennengelernt haben, hast du noch Etiketten geklebt. Jetzt bist du Abteilungsleiterin«, sagte sie ehrfürchtig.
»Na ja, Abteilungsleiterin bin ich eigentlich nicht so richtig. Eher Mädchen für alles in der Reklame. Der Direktor mag meine Ideen leiden. Trotzdem stehe ich auch noch oft genug an der Verpackungsmaschine.«
Ein bisschen war dann aber doch etwas dran an dem, was Gretel gesagt hatte. Toni konnte es manchmal selbst noch nicht glauben. Wenn sie darüber nachdachte, dass sie zuerst versucht hatte, Richards alte Rezepturen zu nutzen, um an ihrem Küchentisch Pflaster herzustellen und an Beiersdorf zu verkaufen. Hätte sie gleich wissen können, dass das nicht ewig gut gehen würde. Und dann war sie auch noch so frech gewesen, einen Posten in der Entwicklungsabteilung zu verlangen. Ohne Studium oder sonst eine Ausbildung. Sie hatte sich doch allen Ernstes eingebildet, sie könnte sich mit dem bisschen, was sie von ihrem Mann abgeguckt hatte, selber neue Produkte ausdenken. Dass Herr Troplowitz ihr überhaupt eine Anstellung angeboten und ihr vor drei Jahren auch noch die Chance gegeben hat, mehr aus sich zu machen, das war sehr anständig von ihm. Ihr ging es wie Gretel, sie konnte es ihm gar nicht hoch genug anrechnen.
Gretel fragte nach Hermann und nach Therese Köhler, der von den Mitarbeitern gefürchteten Vorzimmerdame des Direktors.
»Frau Köhler hast du mindestens genauso viel zu verdanken wie Herrn Troplowitz.«
»Kann man wohl sagen. Hättest du gedacht, dass ausgerechnet die das Kind einer Arbeiterin zu sich nimmt?« Toni wusste, dass Gretel keine Antwort erwartete. »Vorübergehend, aber immerhin. Sonst hätte die Lütte bei meiner Mutter und meinen Geschwistern unterkommen müssen. Darf ich mir gar nicht vorstellen.«
Gretels Mutter hatte ihre Tochter zwar nicht gerade verstoßen, als der Babybauch nicht mehr zu übersehen gewesen war, aber sie hatte auch keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung gemacht. Gretel durfte auch nach der Geburt bei ihr wohnen, allein schon, um sich weiter um ihre Brüder und Schwestern zu kümmern. Bloß hatte sie die ständigen Vorwürfe nicht lange ausgehalten. Am Anfang war Werner seiner Unterhaltspflicht noch nachgekommen, und dank der Stillstube konnte Gretel bald zurück an ihren Arbeitsplatz kommen und ihr eigenes Geld verdienen. Davon hatte sie sich ein Zimmer mit Küchenbenutzung gemietet, als Ellma knapp ein Jahr alt war. Wäre nicht gutgegangen, wenn das arme Ding vier Jahre später zurück zu seiner Oma hätte ziehen müssen.
»Ich wünschte trotzdem, Ellma könnte bei euch wohnen«, sagte Gretel. War nicht das erste Mal, dass sie davon sprach.
»Wir würden sie zu gerne bei uns haben, und das weißt du auch«, versicherte Toni ihr. »Aber wir haben doch so schon kaum Platz. Und die Köhler hat drei Zimmer ganz für sich allein. Sagt sie.« Tonis Meinung über die Sekretärin des Chefs hatte sich gründlich geändert. Bei ihrer ersten Begegnung und auch in den ersten Monaten hatte Toni immer Respekt vor ihr gehabt, um nicht zu sagen: Angst. Allerdings hatte es immer mehr Situationen gegeben, in denen Frau Köhler, die Toni insgeheim wegen ihrer Kleidung »die Graue« nannte, ein großes Herz und einen feinen Humor bewiesen hatte. Schon drollig, nun arbeitete Toni bereits seit Jahren dort, sah die Graue täglich, und doch wusste sie nichts von ihr. War sie verheiratet, hatte sie Kinder? Wo lebte sie überhaupt? So ging es wohl den meisten Beiersdorflern. Kein Wunder, dass alle von den Socken waren, als die Köhler verkündet hatte, Ellma zu sich zu holen.
»Tagsüber ist sie bestens versorgt, es handelt sich also nur um eine Schlafgelegenheit«, hatte sie in ihrer Art erklärt, die keinen Widerspruch duldete. »Ich kann sie morgens mitbringen. Praktischer geht es doch wohl nicht.«
»Ellma fehlt mir so«, sagte Gretel. »Kann sie mich nicht mal besuchen? War nur Spaß«, fuhr sie fort, ehe Toni protestieren konnte. »Ich weiß ja, dass das viel zu gefährlich ist. Aber ich würde sie so gerne mal wieder sehen.«
»Dann musst du eben ganz schnell gesund werden.«
Nicht lange, dann fielen Gretel die Augen zu. Toni blieb noch ein paar Minuten sitzen.
»Tschüss, bis zum nächsten Mal«, flüsterte sie dann und schlich aus dem Zimmer.
Auf dem Heimweg von der Martinistraße kam sie am Eimsbütteler Park vorbei. Der kleine Weiher, an dem sie so gern ihre Mittagspause verbrachte, würde bald wieder zugefroren sein. Zu dumm, auf den letzten Metern fing es an zu regnen. Toni musste lächeln. Sie verdiente anständig und musste die Miete nicht mehr allein berappen. So hatte sie sich einen schicken Hut geleistet, und einen neuen Mantel trug sie auch. Sie schlug den Kragen hoch. Selbst dem Wetter war es nicht gleichgültig, ob man arm war oder nicht.
Im Hausflur schüttelte sie sich, ehe sie die Treppe in den ersten Stock hinauf lief. In geschwungenem Gusseisen eingefasst, stand nur ihr Name an der Wand neben der Wohnungstür. Ging niemanden etwas an, dass sie mit einem Mann hier in wilder Ehe lebte, wie man so sagte. Es war ja auch nicht für lange. Jedenfalls hatten sie das beide gedacht, als Hermann eingezogen war.
»Ich bin wieder da«, rief sie, während sie aus den Schuhen schlüpfte.
»Ich freue mich«, kam es aus der Stube zurück.
Toni ging das Herz auf. Am liebsten wäre sie sofort zu ihm gerannt, das fühlte sich noch an wie am ersten Tag. Aber Ordnung musste sein. Sie brachte den Mantel ins Badezimmer und hängte ihn über die Wanne.
»Kuss!«, verlangte Hermann und breitete die Arme aus, als sie die Stube betrat.
»Sehr wohl, der Herr!« Sie ließ sich schwungvoll auf seinen Schoß fallen und erstickte seinen überraschten Protest mit ihren Lippen. »Zufrieden?«, fragte sie, als sie sich endlich von ihm löste.
»Für den Moment.« Er schob sie von seinen Schenkeln. »Später könnte ich mir durchaus einen kräftigen Nachschlag vorstellen.« Seine Augen blitzten.
»Vielfraß«, tadelte sie ihn scherzhaft. »Gutes Stichwort, es ist Sonntag. Wofür habe ich heute Morgen Kuchen gebacken? Zeit für eine schöne Tasse Bohnenkaffee mit Bienenstich.« Sie wollte aufstehen, doch er hielt sie fest.
»Wie geht es Gretel?«
»Sie ist ziemlich schwach.« Toni zögerte. »Trotzdem hatte sie die Kraft, ein böses Wort über Werner zu sagen.« Sie lächelte schwach. »Zum ersten Mal überhaupt«, ergänzte sie leise.
»Wurde auch Zeit.«
Toni zog die Augenbrauen hoch.
»Ist doch wahr. Wenn ich ihn in seinem Kontor sitzen sehe, könnte ich ihn jedes Mal schütteln. Tut so, als ob Ellma ihn nichts anginge. Dabei sieht er sie regelmäßig. Ich könnte das nicht. So ein süßes Kind, ich würde sie am liebsten ständig knuddeln. Wäre ich ihr Vater, ich könnte sie auf keinen Fall der Obhut von Fremden anvertrauen.« Er schüttelte ärgerlich den Kopf. »Neulich habe ich gehört, wie Werner einem Kollegen verraten hat, was er seiner Frau zu Weihnachten schenken will. Friede, Freude, Eierkuchen.« Er schnaufte wütend. In der nächsten Sekunde veränderte sich seine Miene. »Apropos Kuchen, hattest du eben nicht etwas von Bienenstich gesagt?«
»Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Dachte, du bist krank, wenn du was anderes im Kopf hast als Kaffee und was Süßes.« Sie gab ihm noch einen Kuss, ehe sie in die Küche ging.
Während sie die Bohnen in die Kaffeemühle gab, wanderten Tonis Gedanken in die Vergangenheit. Sie hatte Hermann vom ersten Moment gern gehabt. War irgendwie drollig, wie schusselig und unbeholfen er manchmal sein konnte. Und dann wieder nahm er Dinge ganz selbstverständlich in die Hand, fand Lösungen und half, wo er nur konnte. Er würde sein Kind niemals im Stich lassen, wenn er eins hätte. Zu schade, dass er nie Vater geworden war. Wenn sie nur früher zusammen gekommen wären, dann hätte das klappen können mit so einem kleinen Butscher. Bloß war Toni noch gar nicht lange Witwe gewesen, als sie sich kennenlernten. Es wäre ihr komisch vorgekommen, so fix einen Neuen zu haben. Außerdem dachte sie eine Weile, Hermann hätte ein Auge auf Gretel geworfen. Also war die Zeit verstrichen, ein paar dumme Missverständnisse hatten ein Übriges getan. Erst als die Produktion der Pflaster um ein Haar schiefgegangen wäre, da hatten sie endlich zueinandergefunden. Der Duft der gemahlenen Bohnen stieg Toni in die Nase. Passte gut zu dem wohligen Gefühl, das die Erinnerung in ihr auslöste. Toni hatte damals vorgeschlagen, Segeltuch als Trägermaterial zu probieren. Mit Stoff kannte sie sich schließlich ein büschen aus, weil sie mal Näharbeiten für das feine Modehaus Baumann erledigt hatte. Segeltuch hatte die Eigenschaften, die Herr Troplowitz suchte, da war sie ziemlich sicher gewesen. Nur hatte der sich schon für Cretonne entschieden und war außerdem im Begriff gewesen, mit seiner Frau Gerda zu verreisen. Er konnte sich um keine weiteren Versuche mehr kümmern, denn es sollte ja schon produziert werden, während er unterwegs war. Mensch, wie die Zeit verging. Das war alles so lange her. Sie goss einen Schwall kochendes Wasser in den Filter. Irgendjemand hatte damals eine Maschine manipuliert. Hätte Hermann die damals nicht über Nacht repariert, wäre die schöne Präsentation mit Pauken und Trompeten ins Wasser gefallen. Bis heute wusste Toni nicht, wer hinter der bösen Falle gesteckt hatte, die glücklicherweise nicht zugeschnappt war. Werner Hagen, der vorher alles Mögliche unternommen hatte, um Toni und Herrn Troplowitz zu schaden, hatte Stein und Bein geschworen, er habe nichts damit zu tun. Glaubte sie ihm auch irgendwie. Schließlich war er es gar nicht selbst gewesen, der ihnen Böses wollte. Er hatte das Dierksen zuliebe gemacht, diesem Mistkerl. Hagen hatte sich entschuldigt und erklärt, er würde alles tun, um sich das Vertrauen von Herrn Troplowitz neu zu verdienen. Und der hatte ihm natürlich eine zweite Chance gegeben. So war er eben, der Herr Direktor. Schön und gut, blieb aber trotzdem die Frage, wer die Pflastermaschine manipuliert hatte.
Die letzten Tropfen Kaffee sickerten durch den Filter in die Kanne. Zeit, den Bienenstich aufzuschneiden. Hermann hatte damals in letzter Sekunde die Produktion und damit Herrn Troplowitz und natürlich Toni gerettet. Danach hatten sie sich endlich ausgesprochen und all die blöden Missverständnisse aus dem Weg geschafft. Nie wäre Toni drauf gekommen, dass er mit seiner Mutter und seiner Schwester unter einem Dach lebte und deshalb hin und wieder so wenig gesellig gewesen war. Hermanns Mutter war vor Jahren schwer krank geworden, von seinen fünf Brüdern hatte sich keiner bereit gefunden, sich um sie zu kümmern. Hermann wollte sie unter keinen Umständen in eine Pflege- und Siechenanstalt geben, hatte er Toni erklärt. Von seiner jüngeren Schwester Elfi hatte er vorher noch nie gesprochen, Toni war platt, dass es ein Mädchen zwischen all seinen Brüdern gegeben hatte. Mutter Krause war eigentlich schon aus dem Alter heraus gewesen, aber trotzdem noch mal schwanger geworden. Die Geburt war kompliziert, Hebamme und Arzt hatten kaum für möglich gehalten, dass das Kind den ersten Geburtstag erlebte. Doch die kleine Elfi hatte sie alle überrascht, wuchs und entwickelte sich. Ein büschen langsamer als andere, und so ganz vorneweg würde sie geistig nie sein, aber das machte nichts. Jedenfalls hatte Hermann sie von Herzen gern.
»Meine Mutter hat ihre Hände immer schützend über Elfi gehalten, meine Schwester wäre sonst in dem Männerhaushalt untergegangen«, hatte er mal gesagt. »Meine Brüder dachten wohl immer, sie wird sowieso nicht alt, und wenn, ist sie nur eine Last. Kein Mann würde sich je bereit erklären, für sie zu sorgen. Weil sie fleißig war, beim Putzen und Kochen geholfen hat, haben sie sie halbwegs akzeptiert.« Einer von Hermanns Brüdern hatte angeboten, Elfi zu sich zu nehmen, als die Mutter krank geworden war. »Als Hausmädchen hätte sie bei ihm ein Bett und zu essen bekommen«, erzählte Hermann, seine Augen funkelten böse. »Aber sie ist doch keine Magd, sondern unsere Schwester.« Mensch, war Hermann wütend gewesen, wenn er nur davon sprach. Jedenfalls hatte er seine Mutter und Elfi schließlich zu sich geholt. Tagsüber sah eine Schwester des Ordens von der heiligen Elisabeth nach den beiden und unterstützte Elfi bei der Pflege. Am Abend und in der Nacht war Hermann da. Das war der Grund dafür, dass er manches Mal so wenig Zeit gehabt hatte. Und darum hatte das auch nie so recht mit einer Frau geklappt.
»Was meinst du, wie es bei den Damen ankommt, wenn ein gestandenes Mannsbild noch mit seiner Mutti zusammenwohnt?«, hatte er damals gefragt und sehr traurig ausgesehen. Bei Toni kam die Neuigkeit gut an. Das hieß doch wohl, dass er ein sehr anständiger Kerl war, auf den man sich auch an schlechten Tagen verlassen konnte. Außerdem bedeutete es, dass er nicht dauernd wechselnde Liebschaften hatte, wie in der Firma schon gemunkelt wurde. Toni war rundum glücklich, und sie freute sich, dass sie Mutter Krause noch kennenlernen konnte. Nicht lange danach war sie nämlich gestorben, und wieder ein halbes Jahr später war Hermann zu Toni gezogen. Elfi, die Toni von der ersten Sekunde ins Herz geschlossen hatte, war in seiner alten Wohnung geblieben. Man musste hin und wieder nach ihr sehen, groß zu sorgen brauchte man sich um sie nicht. Und die Ordensschwester war ja auch noch da. Irgendwann wollten Toni und Hermann sich gemeinsam etwas anderes suchen, etwas Größeres mit einem Extra-Zimmer für Elfi. Irgendwann.
Toni stellte Kaffeegeschirr, Kanne und Kuchen auf das Tablett und seufzte. Sie war zweiunddreißig, Hermann schon Ende dreißig. Er wollte sich erst etwas Eigenes aufbauen, als Abteilungsleiter vielleicht oder sogar als Chef einer Niederlassung, ehe er Toni heiraten würde und sie in eine größere Wohnung zögen. Jedenfalls hatte er das ’n paarmal angedeutet, so richtig deutlich mit der Sprache rausgerückt war er noch nie. Immer musste sie bei ihm zwischen den Zeilen lesen. War ein büschen anstrengend auf die Dauer. Aber nützte nix, man musste jeden nehmen, wie er war.
Hermann stürzte sich mit Begeisterung auf den Kuchen. Toni beobachtete ihn lächelnd. Die nackte Stelle auf seinem Kopf wurde immer größer. Haare hatte er in den letzten Jahren eingebüßt, seinen Appetit nicht.
»Hast du gehört, dass der Bruder von Frau Troplowitz an der Gründung eines Verbandes von Fabrikanten beteiligt sein soll?«, fragte er.
»Nein, was denn für ein Verband?«
»Ein Zusammenschluss von Herstellern von Markenartikeln. Markenrecht ist schließlich sein Spezialgebiet.«
»Guck an, und ich dachte, er ist Schauspieler oder so etwas Ähnliches.«
»Wie kommst du denn darauf?«
»Gerda hat so etwas erwähnt. Sie spricht nicht viel über private Sachen, aber daran erinnere ich mich. Ihr Bruder muss gerade nach Altona gekommen sein, als sie es erzählte.« Toni dachte darüber nach, wie selbstverständlich sie inzwischen von Gerda Troplowitz sprach. Sie war so etwas wie eine Freundin geworden, dabei war sie die Frau vom Chef! Seit der sich hatte einfallen lassen, dass Gerda, Irma und Toni sich zu dritt um Ideen für neue Produkte und um die Reklame dafür kümmern sollten, sahen sich die drei regelmäßig und unterhielten sich längst nicht mehr nur über das Geschäft.
»Soweit ich weiß, ist er Jurist«, sagte Hermann in ihre Gedanken.
Toni zuckte mit den Achseln. »Noch ein Stückchen?«
Seine Augen strahlten. »Gern auch ein großes Stück. Du kannst aber auch zu gut backen. Und kochen natürlich auch.«
»Außerdem habe ich eine gute Stellung bei Beiersdorf. Ich bin ’ne ziemlich lohnende Partie.« Sie legte den Kopf schief. »Pass bloß auf, dass mich dir keiner wegschnappt.«
»Ach was, du lässt dich nicht wegschnappen, das weiß ich doch. Dafür hast du mich viel zu gern.«
Toni trank einen Schluck Kaffee, um nicht antworten zu müssen. Dass er sich seiner Sache mit ihr so sicher war, gefiel ihr nicht besonders. Wär netter, wenn er wenigstens ein bisschen um sie werben würde.
»Jedenfalls ist dieser Verband eine gute Idee«, meinte er. »Gerade bei Arzneimitteln und auch bei kosmetischen Artikeln ist Vertrauen so wichtig. Das geht aber immer mehr verloren, weil die Produktion ständig gesteigert wird. Jetzt gibt es schon so viel Massenware. Wenn darauf nicht ein Zeichen zu finden ist wie der Äskulapstab von Beiersdorf, der den Kunden sagt, woher etwas kommt, sind die doch völlig verunsichert. Das Emblem steht für Qualität, das weiß jeder.«
»Was willst du mir damit eigentlich sagen, Hermann?«
»Dass ein Verband wichtig ist, der existierende Marken stärkt und sie bei den Menschen noch bekannter macht. Das wär auch was für mich.«
»Du willst in diesem Verein arbeiten?« Sie runzelte die Stirn. »Was wird Herr Troplowitz dazu sagen?«
»Nein, ich meine doch, dass das später etwas für mich ist, wenn ich einen eigenen Betrieb habe und meine eigenen Marken aufbaue.«
Sie seufzte leise.
»Oder zumindest einen eigenen Bereich, so was wie einen Tochter-Betrieb. Ich möchte, dass auch mit dem Namen Krause eine Marke verbunden ist, die alle Hamburger schätzen«, erklärte er ihr feierlich.
»Die Leute kaufen das, wo Beiersdorf draufsteht. Und du bist bei Beiersdorf Prokurist. Ist das etwa nicht genug?«
Auch am nächsten Tag war dieser Markenverband Gesprächsthema Nummer eins im Betrieb.
»Das ist wirklich eine feine Sache«, sagte Herr Troplowitz gerade zu Frau Köhler, als Toni sein Vorzimmer betrat. Sie wollte die neuen Anzeigen mit ihm abstimmen, ehe sie die an die Zeitungen gab. »Guten Morgen, Fräulein Antonia. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Organisation, die da gerade in Berlin entstanden ist, auch für Ihre Arbeit noch einige Bedeutung haben wird.« Sie folgte ihm in sein Kontor. »Eine Marke ist im Geschäftsleben das, was in der Musik der Name eines berühmten Komponisten ist«, erklärte er, während er sich hinter seinem Schreibtisch niederließ. »Hört man, dass ein Stück von Johannes Brahms ist, kann man sich einer gewissen Qualität sicher sein.« Er sah sie erwartungsvoll an.
»Geschmackssache.« Toni zuckte mit den Achseln. »Ich kann nicht ganz verstehen, dass um Brahms so viel Trara gemacht wird. Selbst jetzt noch, wo er längst tot ist.«
Herr Troplowitz lachte. »Schön, trotzdem ist Ihnen klar, dass mit dem Namen ein bestimmtes handwerkliches Können verbunden ist.« Sie nickte. »Sehen Sie, so ist das mit den großen Namen. Wer Zahnpasta von Beiersdorf kauft, kann sich darauf verlassen, dass das Rezept von klugen Wissenschaftlern ausgetüftelt wurde und die Herstellung höchsten Ansprüchen genügt. Unser Äskulapstab vermittelt den Käufern diese Sicherheit auf einen Blick.«
Toni hatte keinen Schimmer, worauf er bloß hinaus wollte.
»Was gut ist, wird verkauft und bringt anständige Einnahmen. Leider gibt es skrupellose Geschäftemacher, die selbst nichts zustande bringen und von dem Ruf der Markenhersteller profitieren wollen. Neulich erst sah ich in einer kleinen Apotheke eine Brandsalbe, auf deren Schachtel ein Äskulapstab mit einer Schlange abgebildet war.«
»Naja, so einen Stab darf doch bestimmt jeder als Kennzeichen verwenden. Und um unseren winden sich zwei Schlangen«, wandte Toni ein. »Dieser Unterschied lässt sich doch leicht erkennen.«
»Richtig. Auf den ersten Blick war das Bild unserem jedoch so ähnlich, dass selbst ich reingefallen bin. Der Stil, die Farben … Genau darum geht es dem Hersteller. Er gestaltet sein Emblem dem unseren so ähnlich, dass unsere Kunden versehentlich seine Produkte kaufen.«
»Und wenn die dann nichts taugen, denken die Leute womöglich, wir hätten Murks verkauft«, dachte Toni laut.
»Ganz genau. Sehr ärgerlich.«
»Und wie soll dieser neue Verband das verhindern?«
»Das wird nicht einfach.« Ein Stapel Papiere begann bedrohlich zu schwanken, als Herr Troplowitz ihn zur rechten Seite schob. »Aber gemeinsam ist man immer stärker. Ganz gleich, zu welcher Branche ein Unternehmen gehört, die Probleme sind gleich. Als Gemeinschaft können wir Juristen beschäftigen, die sich nur um den feinen Unterschied kümmern, was noch gerade erlaubt oder bereits verboten ist. Stellen wir fest, dass die Gesetze nicht reichen, um uns vor Diebstahl zu schützen, können wir zusammen dafür sorgen, dass sie verbessert oder neue beschlossen werden.« Er schob auch den Papierberg, der sich zu seiner Linken türmte, vorsichtig an den Rand seines Tisches.
Toni nahm an, dass er Platz schaffte, um sich endlich die Anzeigenentwürfe anzusehen. Sie breitete ihre Unterlagen vor ihm aus.
»Interessant ist doch auch die Frage, ob jemand behaupten darf, seine Pflaster wären so gut wie Leukoplast«, sagte er, lehnte sich vor und klopfte auf ihre Skizzen. »Das gilt selbstverständlich auch umgekehrt. Vielleicht fällt Ihnen ein netter Vergleich ein. So etwa: Gesichtscreme von Hugo Lesser? Die von Beiersdorf ist sehr viel besser!« Er lachte. »Womöglich bekämen wir dafür eine Menge Ärger. Wäre es nicht gut, wenn ein Verband derartige Fragen klären würde, damit auch Sie eine gewisse Sicherheit haben, in welcher Form Sie werben dürfen?«
»Ja, schon. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.« Weil er sie noch immer erwartungsvoll ansah, ergänzte sie: »Die Gründung ist bestimmt interessant, nur meine ich, dass es erst mal wichtigere Dinge gibt.«
»Zum Beispiel?«
Der Herr Direktor schaffte es aber auch immer wieder, sie zu überraschen. Meistens war er in Eile und wollte Besprechungen rasch erledigen. An diesem Tag war er anscheinend in Plauderlaune. »Wollen Sie denn nicht die Entwürfe sehen?«
»Eins nach dem anderen. Was halten Sie für wichtiger? Wie ich Sie kenne, denken Sie an etwas Bestimmtes, Fräulein Antonia.«
»Ehe man soweit ist, eine Marke zu beschützen, muss man doch die Chance haben, überhaupt ein eigenes Geschäft zu betreiben. Wissenschaftler, die etwas wirklich Sinnvolles entwickeln, kosten Geld. Genauso jemand, der einem so ein schickes Emblem malt, das alle auf Anhieb erkennen und zuordnen. Von den ganzen teuren Zutaten will ich erst gar nicht anfangen.« Jetzt redete sie schon wie Hermann. Ein kleines bisschen konnte sie ihn ja auch verstehen. Bloß war ihr eben klar, dass er ein Träumer war. Wie wollte er je einen eigenen Betrieb auf die Beine stellen? Das war nahezu unmöglich. »Selbst der klügste Kontorbeamte, der studiert und richtig was auf dem Kasten hat, kriegt das niemals hin, wenn er nicht reich geboren wurde oder in eine wohlhabende Familie heiratet«, sagte sie mehr zu sich selbst. Herr Troplowitz sah sie an und spitzte die Lippen. Toni kannte diesen Blick. Er dachte gründlich nach.
»Ja, das ist nun einmal so. Ein großzügiger Schwiegervater, der einem die benötigte Summe leiht, ist ein Segen.« Er schmunzelte.
»Den hat bloß nicht jeder. Schon gar kein einfacher Arbeiter. Selbst wenn … Wie sollte er das je zurückzahlen? Das heißt, auch wenn einer noch so viel weiß und jede Menge gute Ideen hat, kann er nie ein Geschäft übernehmen, so wie Sie das getan haben. Das ist doch nicht in Ordnung.«
»So wenig wie das Wahlrecht. Leider gibt es noch immer große Unterschiede, Fräulein Antonia, das steht außer Frage. Ob sich das je ändern wird?« Er seufzte. Dann zwinkerte er ihr verschwörerisch zu. »Ich fürchte, es ist noch viel zu tun, ehe jeder in der Welt die gleichen Bedingungen und Chancen genießt. Wir beide kümmern uns darum, was?«
Er lachte freundlich. Toni fragte sich, wie sie früher nur so schlecht von ihm hatte denken können. Sie hatte ihn für den typischen Pfeffersack gehalten, der nur an sein Vermögen und seine Vorteile dachte. Dabei war er ganz anders. Oscar Troplowitz wollte die Welt besser machen. Nur ein wenig, aber überall, wo es ihm möglich war. Dafür hatte sie ihn von Herzen gern. Dass er dabei auch selbst profitierte, tat der Sache in ihren Augen keinen Abbruch.
Sein Lachen erstarb. »Sie sprechen hoffentlich nicht von Hermann Krause, oder?«
»Wie kommen Sie denn darauf?« Sie spürte die Hitze in ihre Wangen schießen. Schöner Schiet, bestimmt war es Hermann gar nicht recht, wenn Herr Troplowitz meinte, sein Prokurist wollte dem Unternehmen den Rücken kehren.
»Na, wie wohl? Hat er Ihnen eigentlich noch immer keinen Antrag gemacht? Manchmal weiß ich wirklich nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Dass er Sie lieb hat, sieht doch ein Blinder. Er könnte eine patente und kluge Frau an seiner Seite gebrauchen. Das sage ich ihm schon lange.« Er zupfte seine Weste zurecht und setzte die Brille auf die Nase. »Wenn Sie mich fragen, wird es höchste Zeit, dass er Ordnung in sein Leben bringt. Aber seine Zukunftspläne gehen mich natürlich nichts an. Solange er nicht am Ende meine Firma übernehmen will.« Er zog Tonis Unterlagen zu sich heran. »Dann zeigen Sie mal her!«
2
Gerda
1903
Gerda hatte ihren Bruder Otto Hanns lange nicht gesehen. Eine Mischung aus Vorfreude und Aufregung verursachte ihr eine unangenehme innere Unruhe. Um sich abzulenken, griff sie zur Zeitung. Mal sehen, was es in der Provinz Posen Neues gab. Je mehr sie las, desto mehr vergaß sie tatsächlich ihre Nervosität. Noch immer kam es in ihrer alten Heimat wieder und wieder zu Schulstreiks. Seit bestimmt schon zwei Jahren. Dass man aber auch keine Einigung finden konnte.
»Nun hör dir das an«, sagte sie und schlug mit dem Handrücken auf das Blatt.
Oscar hatte am Fenster gestanden und auf die Straße geblickt. Er wandte sich überrascht zu ihr um.
»Sie prügeln die Kinder, weil die einfach nicht Deutsch sprechen wollen, sondern ihre Muttersprache«, erklärte Gerda ihm. »Die meisten wachsen polnisch auf, es ist doch nicht einzusehen, dass sie in der Schule eine fremde Sprache sprechen sollen.«
»Prügeln ist ein weiter Begriff. Wir bekamen von unseren Lehrern auch mal eins mit dem Rohrstock, wenn wir nicht aufmerksam waren oder mit unserem Nachbarn geflüstert haben. Posen ist nun einmal Teil des Deutschen Kaiserreichs, Mutzl. Selbstverständlich müssen die Kinder in der Amtssprache lernen.«
»Du weißt, dass es lange Zeit auch anders ging. Es hat irgendwann angefangen, dass die polnischen Bewohner gedrängt wurden, Deutsch zu sprechen und die Behörden nur noch eine Sprache akzeptierten. Auch die polnische Kultur wurde nach und nach verdrängt. Niemand darf sich wundern, dass die Menschen dagegen rebellieren.« Wenn sie sich vorstellte, man würde ihnen heute ihre Literatur, ihre Musik, ihr Theater nehmen und alles durch fremde Künstler und deren Werke ersetzen, wurde ihr mulmig. Kein Volk konnte das aushalten. »Außerdem geht es gar nicht darum. Nicht nur. Im Grunde ist es doch ein politisches Problem, das seit Jahren ungelöst ist. Die ursprünglich polnische Region wurde preußisch und wird seither von der Regierung unterdrückt. Es darf nicht sein, dass die Kinder mit in dieses hässliche Spektakel gezogen werden. Gerade in der Hauptstadt leben fast nur Polen. Ich finde, eine politische Einigung muss endlich her, damit die Schüler sich richtig verhalten können, ohne zwischen den Stühlen zu sitzen.«
»Ich befürchte, das kann dauern. Was in den letzten Jahrzehnten nicht geregelt wurde, wird sich auch so bald nicht lösen lassen.« Plötzlich veränderte sich Oscars Blick. »In einem Punkt stimme ich dir voll und ganz zu. Kinder sollten keinesfalls in Auseinandersetzungen von Regierungen hineingezogen werden. Jemand, der sich mit dem Schulwesen auskennt, sollte einen Weg finden, dass wenigstens in diesem Bereich Frieden einkehrt.«
»Da sagst du etwas.« Sie nickte nachdenklich. »Bloß kann ich mir nicht vorstellen, dass die Herren der Regierung sonderlich gut darüber Bescheid wissen.«
»Genau aus diesem Grunde hat Hamburg seine Deputierten. Eine kostbare Einrichtung, wenn du mich fragst. Jeder Senator hat eine stattliche Zahl solcher Berater an seiner Seite, die Erfahrungen in seinem Arbeitsfeld haben und darin womöglich noch aktiv sind. Lehrer oder gar Schuldirektoren können sicher oft praktikablere Lösungen finden als ein Senator, der nur theoretisch mit einem Thema vertraut ist.«
»Genau das meine ich. Den Kindern ihre Muttersprache ausprügeln zu wollen, kann jedenfalls nicht richtig sein.«
»Sicher nicht.« Er blickte wieder aus dem Fenster. »Wo wir gerade beim Thema sind … Wen in der Bürgerschaft müsste ich wohl überzeugen, mich in eine Deputation zu berufen, in der ich mich um das Wahlrecht, um die Stadtplanung und um Finanzierungshilfen für mittellose kluge Köpfe kümmern kann, die ein Unternehmen gründen wollen?«
Gerda hoffte, sich verhört zu haben. Wann würde Oscar endlich einsehen, dass er sich nicht um alles kümmern konnte? Schon gar nicht gleichzeitig?
»Ich schätze, du müsstest die Bürgerschaft davon überzeugen, dass du in sämtlichen Deputationen ein Wörtchen mitreden willst.«
Er lachte leise. »Wenn es nach mir ginge, auch mehr als ein Wörtchen.« Dann sagte er: »Es könnte sein, dass Hermann Krause mit dem Gedanken spielt, uns zu verlassen.«
»Wie kommst du denn darauf?«
»Fräulein Antonia hat bemängelt, dass kluge Männer noch immer nur selten einen eigenen Betrieb gründen können, wenn sie nicht aus reichem Hause stammen. Und da hat sie zweifellos recht.«
»Kluge Männer wie Hermann Krause. Das wäre zu schade.«
»In der Tat, das wäre es. Nichtsdestotrotz ist es wahr, was sie sagt. Und das muss sich ändern. Ich glaube aber nicht, dass sich die Bürgerschaft oder der Senat darum kümmern werden.«
»Also nimmt Oscar Troplowitz das selbst in die Hand«, stellte Gerda fest.
»Wie? Ach so, nun ja, ich habe zumindest eine Idee. Man müsste jungen talentierten Männern eine Möglichkeit bieten, ihr kleines Geld gewinnbringend anzulegen, damit es zu einem Grundstock gedeihen kann. Außerdem müssen sie an einen Kredit herankommen, den sie auch zurückzahlen können. Wenn auf der einen Seite Geld und Einfluss vererbt werden, auf der anderen Armut oder zumindest Benachteiligung, wird das die Gesellschaft auf Dauer zerstören. Je mehr Menschen es aus eigener Kraft zu etwas bringen, desto größer der Wohlstand insgesamt, und desto mehr kaufkräftige Kunden habe ich.« Er lächelte zufrieden. »Ich muss darüber noch gründlicher nachdenken.«
Von draußen tönte das Klappern von Hufen und das Rumpeln einer Kutsche auf dem Kopfsteinpflaster zu ihnen herauf, wurde lauter, bis es abrupt verstummte. Oscar sah hinaus.
»Ich glaube, dein Bruder ist da.«
Wenige Momente später schloss Gerda Otto in die Arme. Und sofort fühlte sie sich wieder wie die große Schwester, die ihren kleinen Bruder durch die Diele direkt in die Waschküche lotste, wenn er dreckstarrend von einer seiner Erkundungstouren durch den Wald nach Hause kam. Im Nachhinein war ihr klar, dass ihre Eltern mitbekommen haben mussten, was da vermeintlich hinter ihrem Rücken vor sich ging. Denn Ottos Hosen verloren nie wieder den verräterischen grünen Schleier, nachdem er damit auf Bäume geklettert und durchs Unterholz gekrochen war. Auch die Schrammen, die er meist davontrug, konnten niemandem verborgen geblieben sein. Otto war ein Draufgänger gewesen, mutig und neugierig. Beide Eigenschaften hatten sich stets in Luft aufgelöst, wenn Vater ihn mit strenger Stimme zu sich zitierte. Dann schlotterte Otto, während er darauf wartete, ob Vater ihm den Hintern versohlen würde, oder welche Strafe er sich dieses Mal für ihn überlegt hatte. Als Otto älter wurde, umgab er sich mit jungen Männern, die in den Augen ihrer Eltern nicht der richtige Umgang waren. Vor allem, wenn ein Zirkus in der Stadt war, konnte niemand Gerdas Bruder halten. Er lungerte um das Zelt herum, verschaffte sich Zugang zu mehr als einer Vorstellung und trank mit den Artisten Bier und Schnaps. Als er das erste Mal sturzbetrunken nach Hause kam, war Gerda seine Rettung gewesen. Er hatte Steinchen an ihr Fenster geworfen, denn natürlich hatte er riesige Angst, seinen Eltern in dem Zustand gegenüber zu treten. Gerda hatte sich ins Erdgeschoss geschlichen und ihn hereingelassen. Nie würde sie vergessen, wie sehr sie gefürchtet hatte, ihr Vater könnte sie hören. Otto stieß gegen einen Tisch, jaulte auf, kicherte im nächsten Augenblick. Es grenzte an ein Wunder, dass sie ihn in sein Bett bugsieren konnte, ohne ertappt zu werden. Auch sie hätte sich sonst auf etwas gefasst machen können.
»Gut siehst du aus, Schwesterherz.«
»Du auch, mein lieber Otto. Der Bart steht dir.«
»Ich habe die Hoffnung, damit seriös zu wirken.«
»Das gelingt dir, mein lieber Schwager.« Oscar nahm ihn in den Arm und klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Sehr schön, dass du dich mal wieder blicken lässt. Gerda hatte bereits große Sehnsucht.«
Sie fing einen fragenden Blick ihres Bruders auf.
»Bitte, setz dich!« Oscar deutete auf das Sofa. Otto ließ sich darauf nieder, streckte die Beine auf den Polstern aus, seine Füße auf der Armlehne. »Was können wir dir anbieten?«
»Ein Cognac würde nach der langen Fahrt guttun.«
Während Oscar nach Rosa rief, nahm Gerda auf ihrem Sessel Platz. Sie schämte sich ein wenig, denn von großer Sehnsucht konnte keine Rede sein. Sie freute sich über Ottos Besuch, gewiss, mehr aber auch nicht. Obwohl sie nur zwei Jahre auseinander waren, hatten sie kein besonders enges Verhältnis mehr. Vielleicht, weil sie sich zu unterschiedlich entwickelt hatten. Gerda hatte liebend gern Zeit mit Vater in dessen Labor verbracht oder in der Apotheke all die Tiegel und Fläschchen aufgeräumt. Hätte Otto solches Interesse gezeigt, hätte das ihrem Vater sicher noch mehr Freude gemacht, nur war er für Pharmazie partout nicht zu begeistern.
»Und, Oscar, hat sich deine Meinung über die noblen Hanseaten inzwischen geändert?«
»Ich hatte nie eine schlechte Meinung von ihnen. Sie sind eben ein wenig speziell in mancherlei Hinsicht.«
Otto lachte. »Sehr vornehm ausgedrückt. Sie sind feine Pinkel, so sieht es aus.«
»Also bitte, Otto.« Gerda mochte es nicht, wenn er so sprach. Schon gar nicht, wenn Rosa gerade den Cognac servierte. Was sollte sie von den Herrschaften halten?
Oscar hob das Glas. »Trinken wir auf das Wohl deiner Schwester«, sagte er, als Rosa wieder gegangen war. »Und jetzt musst du mir von dem Gründungstreffen in Berlin erzählen. Wer war alles dabei?«
Die Männer hatten ihre Gläser in einem Zug geleert, Gerda hatte nur genippt. Sie entschuldigte sich und ging, um Rosa Anweisungen für das Abendessen zu geben. Oscar hatte ihr schon mehr als einmal von diesem Markenverband erzählt, dessen Geburtsstunde Otto beigewohnt hatte. Sie hielt die Einrichtung für eine kluge Sache, die sie allerdings nicht weiter interessierte. Schon gar nicht die Einzelheiten, die Otto, der sich mit dem Markenrecht bestens auskannte, und Oscar gewiss diskutieren würden. Es war ein Segen gewesen, dass sich ihr Bruder, nachdem er ein Pharmaziestudium kategorisch abgelehnt hatte, der Juristerei zugewandt hatte. Wenn sich die Hoffnung ihrer Eltern, er würde dadurch endlich ehrgeizig, zielstrebig und solide, auch nicht erfüllt hatte. Wenigstens hatte er etwas, womit er seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte.
»Können wir endlich zu interessanten Dingen kommen?«, fragte Otto gerade, als Gerda wieder in das Wohnzimmer zurückkam. »Wo gehe ich hin, wenn ich etwas erleben will? Gibt es ein neues Etablissement, das es mit denen in Berlin aufnehmen kann?«
»Da siehst du mal wieder, warum ich nie viel Zeit mit meinem Bruder verbracht habe, Oscar.« Gerda zwinkerte amüsiert. »Mein Vater wollte mich vor seinem schlechten Einfluss bewahren.«
»Die Wahrheit ist wohl eher, dass du keine Lust hattest, deinen kleinen Bruder am Rockzipfel zu haben.«
»Sprichst du von Ballett oder Oper?«, wollte Oscar von ihm wissen.
»Wohl eher von Wein, Weib und Gesang«, antwortete Gerda an Ottos Stelle.
»Dagegen habe ich nie etwas einzuwenden.« Otto streckte demonstrativ die Arme aus, als hätte er sie um zwei Damen gelegt. »Was man so hört, sind die Hamburger für die leichte Unterhaltung zu steif.«
»Was macht dein Hang zur Bühne?«, fragte Gerda ihn. »Quälst du Vater weiter mit der Tatsache, einen Gaukler hervorgebracht zu haben?«
»Wenn es die große Opernbühne wäre oder das Staatstheater, hätte unser Herr Vater wohl nichts gegen meine Ambitionen.« Er seufzte. »Aber Kabarett? Das quält ihn wirklich.«
»Eine interessante Kombination«, stellte Oscar fest. »Kabarett und Markenrecht.«
»Manchmal liegen Jura und unsere Bühnenprogramme gar nicht so weit auseinander.« Otto erzählte vom Überbrettl, einem Kleinkunsttheater mit gehobenem Anspruch an Texte und Musik, wie er betonte. »Was kann man von einer Kunst erwarten, die von Spielleitern abhängig ist, die wiederum nur auf möglichst viele ausverkaufte Vorstellungen schielen? Davon wollten wir uns befreien.«
»Ihr spielt lieber vor leeren Rängen?« Oscar schmunzelte.
Otto ignorierte die kleine Spitze. »Leider ja. Was allerdings nicht an der Qualität unserer Vorstellungen liegt. Aber nachdem wir in die viel zu protzig sanierten neuen Räume im Südosten Berlins gezogen sind, ging es abwärts. Der wirtschaftliche Druck hat auch uns erwischt.« Er verdrehte theatralisch die Augen. »Vom literarischen Kabarett zur Lustspielbude, welch ein Abstieg.«
»Gehört nicht auch Detlev von Liliencron zu eurem Ensemble?« Gerda sah ihn neugierig an »Er hat nun wirklich einen guten Ruf.«
»Der war nicht lange dabei. Sobald seine Geldsorgen Geschichte waren, hat er uns den Rücken gekehrt.«
»Wir sollten dich mit Fritz Schumacher bekanntmachen. Er ist ein junger Architekt, den wir vor Jahren kennengelernt haben«, erzählte Gerda. »Er hat ein Theaterstück geschrieben, das in Leipzig aufgeführt wurde. Vielleicht könnte ich euch zusammenbringen.« Die Idee gefiel ihr sehr gut. Ihre Kunstsalons hatten inzwischen einiges Ansehen erreicht. Nicht nur unbekannte Neulinge, auch etablierte Künstler folgten ihren Einladungen gerne. Warum sollte sie sich nicht auch um Literaten und Schauspieler kümmern, damit die in Hamburg Aufmerksamkeit bekamen? Gerda sah alles genau vor sich: Kluge, spritzige Dichter lasen aus ihren Werken, das Publikum lauschte gespannt. Womöglich ließen sich sogar kleine Szenen zeigen. Ihr eigener Bruder in ihrem Salon auf der Bühne. Es wäre nett, gemeinsam etwas auszutüfteln, etwas völlig Neues, zumindest in ihrer Veranstaltungsreihe. Sie musste unbedingt Irma davon erzählen.
»Gerda, Liebes?«
Sie blickte in zwei fragende Mienen.
»Bitte entschuldigt, ich war in Gedanken.«
»Das war nicht zu übersehen«, entgegnete Otto amüsiert.
»Ich erzählte gerade, dass Fritz bei einer Ausstellung des Bildhauers Max Klinger plötzlich vor uns stand«, sagte Oscar.
Otto machte große Augen. »Ich kann nicht glauben, dass der verschrobene alte Steinklopper in Hamburg ausgestellt hat.«
»Er ist mit Lichtwark bekannt, dem Direktor der Kunsthalle. Ein feiner Mensch übrigens«, sagte Gerda.
»Oho, ihr kennt die Hamburger Bohème persönlich.«
»Was denkst du denn?« Oscar drückte das Kreuz durch und lächelte stolz. »Die wichtigsten Herrschaften gehen in den Salons deiner Schwester ein und aus. Es ist jedes Mal ein Ereignis, du solltest endlich mal dabei sein.«
»Warum nicht?« Otto hielt die Hand vor den Mund und gähnte. »Wer weiß? Am Ende stehe ich noch im berühmten Troplowitz-Salon auf der Bühne und spiele Stücke von diesem Schumacher.«
»Daran habe ich auch schon gedacht«, sagte Gerda eifrig.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fritz für das Überbrettl schreiben will«, wandte Oscar ein.
»Nimm’s dir nicht zu Herzen, lieber Schwager. Wir paar verbliebenen Kabarettisten, die noch ab und zu über die Lande ziehen, brauchen ihn nicht, wir haben Morgenstern und Arthur Schnitzler im Repertoire. Außerdem komme ich ohnehin nur noch selten zum Spielen, weil du mich mit deinen rechtlichen Fragen beschäftigst und ich hin und wieder in Altona als Hilfsrichter tätig bin, wie du weißt. Damit kann ich unmöglich aufhören, das würde Vaters Nerven zu sehr strapazieren.«
»Was kümmert mich dein ulkiges Brettl oder deine Bühnenkarriere?« Oscar schüttelte den Kopf, als wollte er eine Fliege loswerden. »Nichts für ungut, Otto. Mich ärgert, dass Schumacher nicht nach Hamburg gekommen ist. So ein guter Mann, den könnten wir in der Hansestadt brauchen.«
Otto gähnte erneut.
»Du willst dich sicher vor dem Abendessen ein wenig ausruhen«, sagte Gerda und erhob sich. »Rosa hat dir das Gästezimmer zurechtgemacht. Komm, ich bringe dich hinauf.«
Otto blieb eine Woche. Gerda beschlich das Gefühl, zwei Brüder in einer Person zu haben. Mal ging er allein aus, blieb die ganze Nacht fort und verschlief am anderen Morgen das Frühstück. Dann begleitete er Oscar schon in aller Frühe in das Kontor oder diskutierte sachkundig mit ihnen über verschiedenste Formen der aktiven Beteiligung an Politik.
»Ist es nicht typisch Hamburg, dass ihr hier neben den Bürgervereinen auch noch Deputationen habt? Das ist mir von keiner anderen Stadt bekannt«, sagte Otto spöttisch.
»Auch Bremen hat Deputierte«, widersprach Oscar. »Der große Unterschied ist, dass die Bürgervereine lokal aktiv, die Deputationen dagegen für ganz Hamburg tätig sind. Es macht mir Freude, mich auf kommunaler Ebene zu engagieren. Jeder Stadtteil hat andere Sorgen und Bedürfnisse, ich halte es für klug, sich vor Ort darum zu kümmern. Aber ich möchte für alle Hamburger etwas bewirken, nicht nur für Eimsbüttel.«
»Dazu wärst du bestimmt geeignet«, sagte Gerda und lächelte ihn an. »Nur hast du ein Unternehmen zu leiten, das ständig wächst. Woher willst du die Zeit für alles nehmen, was dich interessiert?« Sie wandte sich an Otto. »Er besitzt jetzt schon ein Notizbuch, in dem alle Verbände, Vereine und was sonst noch alles aufgeführt sind, an denen er sich in irgendeiner Form beteiligt.« Sie verdrehte die Augen.
»Jemand muss der Pilot sein, die Richtung bestimmen und den Kurs halten. Wohin treibt unser Schiff, wenn niemand diese Verantwortung übernimmt?« Ein warmes Gefühl durchströmte Gerda. »Außerdem kann ich mir sonst nicht alle meine Mitgliedschaften merken«, setzte er leise hinzu.
»Kein Wunder«, sagte Gerda lachend. »Soll ich aufzählen?« Sie streckte die rechte Hand vor und hielt nacheinander Daumen, Zeigefinger und die restlichen Finger in die Höhe. »Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte, Gesellschaft zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten, Deutscher Apotheker-Verein, das versteht sich von selbst. Von seinen Vorträgen im Dermatologicum will ich gar nicht reden.«
Otto sah amüsiert aus. »Trägst du bei Beiersdorf nicht genug Verantwortung?«, fragte er ihn. »Das Unternehmen wächst so schnell, dass es mir den Atem verschlägt.« Er ging ans Fenster. »Sieh dir nur diese Anbauten an. Mir scheint, du hast mindestens alle zwei Jahre mehr Räumlichkeiten geschaffen. Zur Krönung dein eigener Speicher, der mit jenen unten am Hafen in jeder Hinsicht mithalten kann. Und nicht nur dieses Imperium gehört dazu, sondern auch die vielen Kunden in aller Welt. Hast du je darüber nachgedacht, in den wichtigsten Ländern Geschäftsstellen einzurichten?«
»Das habe ich in der Tat. Der Außendienst hierzulande wächst beständig, das soll auch international der Fall sein. So ein Schritt bedarf allerdings einer guten Vorbereitung.«
»Und der Beratung eines guten Juristen.« Otto kam zum Tisch zurück und setzte sich wieder. »Ich bin interessiert, falls du dir vorstellen kannst, hin und wieder auf deinen Schwager zu hören.«
Gerda traute ihren Ohren kaum. Wollte Otto etwa doch noch sesshaft werden und eine feste Stellung annehmen? Das wäre schön, nicht nur für ihre Eltern.
»Aber gewiss, mein Lieber! Höre ich etwa nicht auf dich, wenn es um das Markenrecht geht?«
»Eins von Oscars Lieblingsthemen, wie du weißt«, fiel Gerda ihm amüsiert ins Wort.
»Unbedingt! Gute Erfindungen sind an sich schon kostbar. Aber als Marke sind sie ein wahrer Schatz«, bestätigte Oscar.
»Und doch bist du dem Markenverband nicht beigetreten. Du solltest noch einmal darüber nachdenken. Auf eine Mitgliedschaft mehr kommt es doch auch nicht an.«
»Nicht nötig, so viel ich der Sache auch abgewinnen kann, wie Gerda sehr richtig sagt. Durch dich weiß ich meine Interessen auch so bestens vertreten, Otto.«
»Schön, und lass es mich rechtzeitig wissen, wenn du deine Schätze von London, Paris oder New York aus vertreiben willst. Es wird mir eine Freude sein, vor Ort die rechtlichen Weichen zu stellen.« Otto zwinkerte ihm zu.
So viel dazu, dass ihr Bruder sich womöglich in der Hansestadt niederlassen und gar eine Familie gründen würde.
3
Irma
1903
Irma tupfte Weiß über das leuchtende Orange. Sie atmete ruhig und vermied es, einen Laut von sich zu geben. Als könnte sie die eigentümliche Stille damit stören, die dem Beginn eines jeden Tags innewohnte. In Wirklichkeit senkte sich bereits der Abend über die Stadt, doch auf ihrer Leinwand dämmerte gerade erst der Morgen. Wenn sie malte, war Irma stets mehr in ihrem Bild zu Hause als in der wahren Welt. Zwei Eichen auf einem Feld wie zwei Schattenwesen. Auch um sie herum fehlte noch Weiß. Nicht zu dick, sondern durchscheinend wie ein Hauch. Sie tauchte den Pinsel in das Wasserglas, als sie das vertraute Klirren des Türschlosses hörte. Eine sanfte warme Welle rollte durch ihren Körper. Eckart kam von der Senatssitzung nach Hause. Irma strich die Borsten über ein Stück Stoff, ehe sie ihr Werkzeug beiseitelegte, den Blick auf die weit geöffnete Tür ihres Ateliers gerichtet.
»Guten Abend, gnädiger Herr«, hörte sie Helenes Stimme, dann das typische Rascheln, als sie ihm den Mantel abnahm, schließlich seine Schritte, die immer zuerst zu Irma führten.
»Guten Abend, Herr Senator«, begrüßte sie ihn.
»Guten Abend, Frau Künstlerin.« Er trat zu ihr und küsste sie. Sofort schmiegte sie sich an ihn. Er duftete nach einem Ratstag, nach Tabak, Kaffee und nach Papier.
»Du siehst müde aus. War der Stapel der Druckvorlagen höher als eine Flasche Wein, oder wollte die Finanzdeputation mal wieder zu jeder Sache gehört werden?«
Eckart spielte mit ihrem Haar. »Beides.« Er schnitt eine Grimasse. »Nein, die Sitzung war in Ordnung«, sagte er. »Es gab nur einen neuen Referenten, der eine Sachlage allzu ausführlich geschildert hat. Der Vorsitzende musste ihn schließlich darauf aufmerksam machen, dass seine Abschweifungen zu nichts führen, außer dazu, dass die älteren Senatoren einnicken könnten.« Eckart lächelte.
»War es seine erste Rede vor dem Senat?«, wollte Irma wissen. Er nickte. »Armer Kerl.«
»Könnte ich vielleicht auch etwas Mitleid bekommen?«
Seine zerknirschte Miene brachte Irma zum Lachen.
»So viel du willst«, entgegnete sie und küsste ihn wieder.
Eckart war nur noch an den drei Ratstagen außer Haus, an allen anderen Tagen nutzte er sein Arbeitszimmer in der Villa. Wie viel sich verändert hatte. Wenn Irma ihn zu Empfängen begleitete, spielte sie die Senatorengattin und benahm sich so, wie er es von ihr erwarten konnte. Ganz Hamburg wusste, dass sie nicht nur irgendeine Künstlerin, sondern die skandalumwitterte Mynona war. Das gab ihr die Freiheit, sich ohnehin mehr herauszunehmen, als üblich gewesen wäre. Sie lehnte es beispielsweise strikt ab, mit langweiligen Ehefrauen über Dinge zu sprechen, die sie nicht interessierten. Um sie sich vom Hals zu halten, setzte sie einen überheblichen Blick auf und machte eine ironische Bemerkung. Das reichte meist, um wieder ihre Ruhe zu haben. Inzwischen hatte sie festgestellt, dass unter den Damen durchaus einige waren, die sich mit Kultur und Politik beschäftigten. Gespräche mit ihnen konnten ein Gewinn sein. Das war für sie unvorstellbar gewesen, als sie Eckart geheiratet hatte. Damals war sie der festen Überzeugung, niemand könnte sie je verstehen und keiner der blasierten Hanseaten, in denen sie nur Abbilder ihrer Eltern gesehen hatte, wäre es wert, sich auf ihn einzulassen. Wie sehr Vorurteile einen doch in die Irre leiten konnten.
Noch etwas hatte sich verändert: Irma malte jetzt meist bei geöffneter Tür und schloss diese nur noch, wenn sie etwas völlig Neues ausprobieren wollte, wobei Eckart sie nicht ablenken sollte. Dafür hatte er nämlich ein großes Talent. Er sah ihr über die Schulter, massierte ihren Nacken, küsste ihren Hals. Schon waren Pinsel und Ölfarbe vergessen. Irma genoss diese Ablenkungen, doch manches Mal brauchte sie einfach ihre Ruhe.
An diesem Abend aber hatte sie bereits ungeduldig darauf gewartet, dass Eckart nach Hause käme.
Er löste sich etwas von ihr, seinen Arm um ihre Taille gelegt, betrachtete er das Bild, das beinahe fertig war.
»Sehr schön. Es sieht aus, als würden die Bäume im Nebel ertrinken. Du hast die Stimmung eines Sonnenaufgangs perfekt eingefangen«, sagte er und strich ihr gedankenverloren über den Arm.
»Es ist ein Sonnenuntergang«, sagte sie knapp. Er hob die Augenbrauen. Irma lachte. »Das war ein Scherz, du hast natürlich recht. Danke für das Lob.«
»Nun ja, um ehrlich zu sein, finde ich diese Stimmung ein wenig kitschig. Aber vielen wird es gefallen«, entgegnete er ruhig.
Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Er konnte nicht jedes ihrer Bilder lieben, das war in Ordnung, trotzdem ärgerte sie seine Bemerkung. Kitsch war nun wirklich das Letzte, was sie produzieren wollte. Plötzlich entdeckte sie ein Zucken seiner Mundwinkel.
»Du hast mich auf den Arm genommen«, stellte sie empört fest.
»Wie du mir, so ich dir.« Er zog sie fester an sich und gab ihr einen Kuss.
»Ich dachte, Retourkutschen fahren heute nicht«, erwiderte sie spitz und legte ihren Kopf an seine Schulter.
»Es ist sehr gelungen«, sagte er. »Man kann den Tau auf den Blättern sehen, die Spinnenweben auf der Haut spüren, obwohl das alles nicht da ist.«
»Das klingt schon besser.« Sie seufzte zufrieden.
»Du bist einfach mit einer großen Begabung gesegnet. Ich beneide dich darum.« Wieder standen sie eine Weile still beieinander. »Ganz gleich, ob Mynona oder Irma Behn, die Ergebnisse sind immer außergewöhnlich. Allerdings bin ich überrascht, dass hier gerade nicht Mynona am Werk ist. Wollte Teske nicht neue Bilder von ihr?«
»Ja, er sagt, sie hängen nie lange in seiner Galerie. Sofern er mit mir über geschäftliche Dinge redet. Er würde es noch immer vorziehen, sie mit dir zu verhandeln.«
Sie löste sich endgültig von ihm und machte sich daran, Farben, Pinsel und Palette aufzuräumen.
»Nicht zu glauben, dass er sich nicht langsam daran gewöhnt hat. Wie kann man so rückständig sein?«
Sie zuckte mit den Achseln. »Jedenfalls weißt du ja, wie Mynona ist. Sie lässt sich nicht drängen.« Irma sah ihn kurz an und ließ eine Augenbraue in die Höhe schnellen.
»Das macht sie richtig.«
»Im Ernst, ich produziere nicht am Fließband, nur weil Herr Teske meine Bilder gut verkaufen kann.«
»Es wäre auch nicht klug, wenn in jedem Hamburger Wohnzimmer ein Gemälde von dir hinge. Die Leute würden nur allzu schnell das Interesse verlieren, weil sie nicht mehr das Gefühl hätten, etwas Besonderes zu besitzen.«
»Keine Gefahr«, entgegnete sie unbekümmert. »Teske sagt, meistens sind es Kunden aus Berlin, München oder sogar aus England und Frankreich, die ihm meine Werke aus den Händen reißen. Die Hanseaten glänzen durch die ihnen eigene Zurückhaltung.« Sie verzog höhnisch die Lippen. »Die Wahrheit ist: Sie trauen sich nicht.«
»Was ist mit diesem Sonnenaufgang hier? Für wen hast du ihn gemalt?«
»Für niemand Speziellen. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich ein Käufer finden wird. Die anständigen Gemälde der Senatorengattin sind nämlich durchaus begehrt in der feinen hanseatischen Gesellschaft.«
»Sehr gut, verdiene du nur viel Geld, dann kann ich mich bald zur Ruhe setzen. Über zehn Jahre im Senat sind mehr als genug.«
Sie schüttelte amüsiert den Kopf. »Es ist eine reine Fingerübung, um meine Technik zu verbessern.«
»Das hast du doch gar nicht nötig.« Sie fing einen Blick auf, den sie sehr mochte, ein wenig anzüglich und sehr leidenschaftlich.
»Heißt es nicht, man lernt ein Leben lang?«, raunte sie und ließ ihre Finger seinen Nacken entlang gleiten.
»Allerdings, so heißt es.«
»Wollen wir unsere Lektion jetzt sofort lernen?« Sie schenkte ihm einen Augenaufschlag.
»Ich hätte durchaus Appetit«, erwiderte er und küsste sie allzu harmlos auf die Nasenspitze. »Aber zuerst will ich etwas essen, ich komme um vor Hunger.«
Beinahe auf den Tag genau vor sechs Jahren hatte Irma verstanden, was Glück war. Nach ihrer für alle völlig überraschenden Offenbarung, dass hinter dem geheimnisvollen Maler Mynona Frau Irmgard Behn steckte, hatte Eckart sie nicht fortgejagt, sondern er hatte ihre schwache Stunde, aufgewühlt von verschiedensten Emotionen, ausgenutzt, ihren Panzer für immer zu sprengen. Einen Panzer, den sie sich als kleines Mädchen zugelegt hatte. Eckart hatte ihr wahrhaftig die Augen geöffnet, dass sie selbst den Cocktail mischte, der sie langsam vergiftete. Irma hatte sich in diesem Moment in ihren eigenen Ehemann verliebt. Gereizt hatte er sie mit seiner Ausstrahlung, dem zur Schau gestellten Selbstbewusstsein, von der ersten Sekunde, doch erst fünf Jahre, nachdem sie geheiratet hatten, war sie sich ihrer Liebe klar geworden. Sollte sie sich nicht längst an ihr neues Leben gewöhnt haben, in dem nicht mehr alles schrecklich kompliziert und düster war? So ganz würde ihr das anscheinend nie gelingen. Noch immer überkam Irma während alltäglicher Situationen und ohne Ankündigung ein solches Glücksgefühl, dass sie kurz nach Luft ringen musste. Es passierte, wenn sie mit Eckart zu Tisch saß oder wenn sie mit Hella die Speisenfolge für ein bevorstehendes Herren-Diner durchging. Es geschah auch, wenn sie mit Gerda Troplowitz und Antonia Peters zusammen war. Sie würde die beiden ohne Zögern Freundinnen nennen. Auch das war eine Neuheit in ihrem Leben. In diesem Fall noch dazu eine Freundschaft, die gegen alle gesellschaftlichen Regeln verstieß und Irma dadurch umso besser gefiel.
Nie würde sie vergessen, dass Oscar Troplowitz sie im Januar 1898 in sein Kontor gebeten hatte. Sie zeichnete Reklamebilder für ihn, das Beiersdorf-Markenzeichen stammte aus ihrer Feder. War es auch meistens seine Frau Gerda gewesen, die Irma nach neuen Motiven fragte, hatte sie sich doch nichts dabei gedacht. Umso größer die Überraschung, ihn nicht allein anzutreffen. Gerda war bei ihm. Und Toni. Als wäre die Konstellation das Normalste der Welt, hatte Oscar sie wissen lassen, dass sie künftig zusammenarbeiten sollten. Direktorengattin, Arbeiterin und Künstlerin. Er war der festen Überzeugung, dass weibliche Mitarbeiter mit ihren ganz eigenen Sichtweisen einem Unternehmen nur guttun konnten. Und er hatte sich in den Kopf gesetzt, dass die drei am besten wüssten, welche Produkte Frauen schmerzlich vermissten, was seine Chemiker folglich entwickeln sollten. Eine kluge Erkenntnis, denn natürlich kümmerten sich Frauen um die Pflege der Haut, um aufgeschürfte Knie, um die Platzwunde am Kopf. Wer wüsste besser als sie, was gebraucht wurde? Seit dem denkwürdigen Treffen in seinem Kontor sahen die drei Frauen sich regelmäßig, tauschten Einfälle aus, diskutierten Vor- und Nachteile neuer Produkte und überlegten gemeinsam, wie diese am besten an den Kunden oder eben an die Kundin gebracht werden konnten.
So war es auch an diesem grauen Oktobernachmittag. Irma, Gerda und Toni saßen im Salon der Troplowitz-Villa, wo Maler, Bildhauer, Sänger und Komponisten ein und aus gingen. Etwa viermal im Jahr fanden hier außerdem Ausstellungen statt, die einen ausgezeichneten Ruf weit über Hamburgs Grenzen hinaus genossen. Irma war noch immer ein bisschen stolz, dass die erste Schau ihr gegolten hatte. Dabei hatte sie das Geheimnis um Mynona gelüftet. Kein Wunder, dass sie in diesem Raum immer in Hochstimmung war.
»Zahnpasta ist ja nun nicht direkt eine Neuheit«, hörte sie Toni gerade sagen.
»Das nicht. Was mir vorschwebt, ist etwas, das besonders lange für frischen Atem sorgt. Zahncreme und Mundspülung in einem. Das wäre nicht nur für die Anwender ein Segen.« Gerda seufzte, ihr schien etwas eingefallen zu sein. »Ich fürchte allerdings, die lange Wirkung allein ist nicht genug. Es müsste etwas geben, das man zwischen den Gängen eines Diners lutschen oder schlucken kann, um den Geruch von Zwiebel oder Fisch zu beseitigen. Gerade neulich musste ich wieder unter einer äußerst gewagten Duftkombination aus Scholle, Speck und Wein leiden.« Sie verzog das Gesicht, als hätte sie auf ein Pfefferkorn gebissen.
»Du sprichst nicht zufällig von der Dame aus Bremen?« Irma schmunzelte, als sie Gerdas Grimasse sah. Sie beugte sich zu Toni hinüber und flüsterte ihr zu: »Bei der Senatszusammenkunft der drei Hansestädte werden auch die wichtigsten Männer aus Wirtschaft und Kultur eingeladen. Zu Gerdas großer Freude, wie du siehst.«