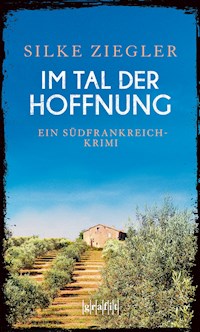9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mehr als 1000 Kilometer liegen zwischen Emma und ihrer Vergangenheit, als sie die Nachricht vom Schlaganfall ihres Vaters erreicht. Seit einem Streit vor einigen Jahren hat sich der Kontakt zwischen ihnen auf Telefonate beschränkt, entsprechend gemischt sind ihre Gefühle, als sie in ihre südfranzösische Heimat reist. Als wäre das nicht genug, trifft Emma nach ihrer Ankunft am Strand auf ihre erste große Liebe – und bemerkt, wie sehr sie Léon all die Jahre vermisst hat. In der Pâtisserie, in der sie kurzfristig aushilft, findet sie Briefe einer Mutter an ihre Tochter, die 1942 in einem Internierungslager zur Welt gekommen sein muss. Das Schicksal dieser Frau, die bereits wusste, dass sie ihre Tochter nie würde aufwachsen sehen, geht ihr nahe und lässt sie ihre eigenen Entscheidungen überdenken. Kann sie sich mit ihrer Vergangenheit aussöhnen, ehe es zu spät ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Frauen von der Purpurküste – Claires Schicksal
Die Autorin
SILKE ZIEGLER lebt mit ihrer Familie in Weinheim an der Bergstraße. Zum Schreiben kam sie 2013 durch Zufall, als sie während eines Familienurlaubs im Süden Frankreichs auf ihre erste Romanidee stieß. Wenn sie nicht gerade in ihre französische Herzensheimat reist, liest und schreibt sie sich die traumhafte Kulisse einfach herbei.Von Silke Ziegler ist in unserem Haus erschienen:Die Frauen von der Purpurküste - Isabelles GeheimnisDie Frauen von der Purpurküste - Julies Entscheidung
Silke Ziegler
Die Frauen von der Purpurküste – Claires Schicksal
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage März 2021 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © FinePic®, München; © alamy images (Macaron-Laden)E-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-8437-2270-4
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Epilog
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Widmung
Prolog
Ende August 1942Internierungslager Rivesaltes, Südfrankreich
Jeanne starrte auf den staubigen Boden. Am liebsten hätte sie diesen unheilvollen Ort auf der Stelle verlassen. Ihre Schwesternschürze abgelegt, ihre Tasche genommen und den Weg Richtung Tor eingeschlagen, ohne sich noch ein einziges Mal umzudrehen. Sie war am Ende ihrer Kräfte. Was ihr zu Beginn als erfüllende, bereichernde und wertvolle Aufgabe erschienen war, hatte sich im Laufe der Monate zu einem schrecklichen Albtraum entwickelt. Wie sollte sie diese Zeit jemals vergessen können? Jeder Häftling, jedes Gesicht dieser armen Menschen würde sie auf ewig verfolgen. Obwohl sie keine Weisungsbefugnis hatte und nicht das Geringste an dem Schicksal der Leute ändern konnte, fühlte sie sich zutiefst schuldig.
Jeanne liebte ihren Beruf. Menschen zu helfen, ihnen Trost zu spenden, sie auf ihrem Genesungsweg zu begleiten war der Hauptgrund gewesen, warum sie sich vor fünf Jahren für diese Aufgabe entschieden hatte. Und als sie vor zehn Monaten gefragt wurde, ob sie im Lager von Rivesaltes arbeiten, sich um die Kranken, Alten und Schwachen unter den Internierten kümmern wolle, erschien ihr diese Herausforderung verantwortungsvoll und wichtig.
»Schwester Jeanne?«
Sie drehte sich um und musterte die Mitarbeiterin, bei der sie vor zwei Stunden ihre Forderung vorgebracht hatte. »Ihr Antrag wurde abgelehnt. Es tut mir leid.«
Jeanne schloss kurz die Augen. Der Boden unter ihr begann zu wanken. »Aber …« Sie musste sich zusammenreißen, um nicht laut loszuschluchzen. »Die beiden Frauen haben Babys. Die Kleinen befinden sich seit einigen Wochen außerhalb des Lagers. Wie …?« Ihre Stimme versagte.
Die Dame schüttelte bekümmert den Kopf. »Es tut mir sehr leid. Die Anweisung war eindeutig. Alle Versammelten werden noch heute zum Bahnhof gebracht und nach …« Sie unterbrach sich. » … in andere Lager verlegt. Vichy hat zugestimmt.«
Jeanne fuhr sich mit der rechten Hand übers Gesicht. Nur zwei Frauen hatte sie retten wollen. Zwei von mehreren Hundert Menschen. Doch selbst das war ihr nicht gelungen. Ihr Kopf begann zu schmerzen.
»Nehmen Sie es nicht persönlich. Wir müssen die Gesetze befolgen.« Mit diesen Worten drehte die Frau sich um und verschwand wieder im Inneren der Baracke.
Jeanne wischte sich eine Träne weg. Bis zuletzt hatte sie gehofft, obwohl sie wusste, dass ihr die Zeit davonlief. Sie sah zu den Menschen, die dicht an dicht auf der Freifläche standen. Vor einer der Baracken hatte sich eine lange Zweierreihe gebildet.
Jeanne musste den Blick abwenden, da sie das Schicksal dieser Leute kaum mehr ertragen konnte. Nicht nur Jeanne, auch die Häftlinge wussten, was ihnen bevorstand. Dass ihre Abreise sie geradewegs in den Tod führen würde.
Jeanne ballte eine Hand zur Faust. »Nein.« Erneut kämpfte sie mit den Tränen. »Nein, nein, nein.«
Warum ließ die Vichy-Regierung das Sterben unschuldiger Menschen zu? Jeanne kannte viele der Internierten. Die meisten waren vor Jahren schon aus Deutschland, Belgien, Holland oder auch Polen nach Frankreich geflohen, vorzugsweise in die unbesetzte Zone, die zumindest offiziell noch nicht von Hitlerdeutschland regiert wurde.
Es war der dritte Transport nach Osten innerhalb weniger Wochen. Viele dieser Menschen waren erst vor Kurzem aus anderen Lagern wie Gurs oder Vernet nach Rivesaltes verlegt worden. Das Lager war ein Umschlagplatz für die Deportationen geworden. Jeannes Aufgabe war zu einer Farce verkommen. Was konnte sie für diese Leute tun, die von oberster Stelle bereits dem Tod geweiht waren? Als sie die Proviantpakete verteilt hatten, die aus Brot, Mortadella, Käse, Sardinen, Tomaten und Früchten bestanden, musste Jeanne an sich halten, um nicht laut loszuschreien. Das karge Mahl stellte nichts anderes als die Henkersmahlzeit für die Internierten dar. Der Rat ihrer Kolleginnen, sie solle sich die Schicksale dieser Menschen nicht zu sehr zu Herzen nehmen, erschien Jeanne zynisch. Sie war Krankenschwester, um Kranken zu helfen. Nicht, um sie bis zu ihrer Abfahrt in den Tod zu betreuen.
Sie zwang sich, sich umzudrehen, und ließ den Blick über die Gefangenen wandern. Es gab unzählige kleinere Kinder, die Schutz suchend neben ihren Müttern standen, deren Beine umklammerten, ihre Köpfe an deren Oberschenkel drückten. Was musste den Frauen in diesem Moment durch den Kopf gehen? In einigen Gesichtern las Jeanne pure Verzweiflung, während andere völlig apathisch ins Leere starrten. Ihnen allen war klar, dass sie ihre Kinder nicht würden retten können, dass diese dem Unausweichlichen, das auf sie zukommen würde, nicht würden entrinnen können.
Jeanne entdeckte die Familie Blumberg in der Schlange vor der Baracke. Mit Margot Blumberg, der Mutter, hatte sie in den letzten Wochen oft gesprochen. Die beiden Töchter Irene und Judith litten seit Längerem unter einer hartnäckigen Lungenentzündung. Jetzt standen sie bei der Mutter, eingeschüchtert und stumm, und blickten sich suchend um. Irene war elf Jahre alt, Judith vierzehn. Der Vater war in Gurs inhaftiert. Die Familie war direkt nach ihrer Verhaftung auseinandergerissen worden. Margot hatte Jeanne erzählt, dass sie bereits 1936 aus Deutschland geflohen waren. Die drei sprachen mittlerweile sehr gut Französisch. Der Vater hatte in einer Schlosserei gearbeitet, während Margot in einem kleinen Lebensmittelgeschäft angestellt gewesen war. Die Mädchen hatten eine französische Schule besucht und waren unter den Klassenbesten gewesen. Bis sie eines Tages mitten in der Nacht in ihrer Wohnung verhaftet und interniert worden waren.
Warum?, fragte sich Jeanne zum wiederholten Mal. Warum musste so etwas geschehen? Was hatten diese Menschen getan, um solches Leid ertragen zu müssen?
Hinter den Blumbergs standen zwei Jugendliche, die vor Monaten allein ins Lager gekommen waren. Die Eltern der beiden waren bereits auf der Flucht erschossen worden. Daniel und Bernhard waren gute Sänger. Jeanne musste an einen Vormittag denken, als einige Insassen ein kleines Konzert gegeben hatten. Alle hatten gelauscht. Die beiden Jungen hatten mit ihren wunderschönen Stimmen mehrere hebräische Volkslieder vorgetragen, die die Zuhörenden zu Tränen gerührt hatten. Jetzt warteten sie auf ihre Abreise. Jeanne schluckte. Viele der Inhaftierten waren ihr ans Herz gewachsen. Sie unterschied nicht nach Nationalität oder Religion. Für sie waren alle Menschen. Menschen mit Gefühlen, mit einer Vergangenheit, mit Angehörigen, die sich um sie sorgten, mit einem Leben.
Im nächsten Moment fiel Jeannes Blick auf Rachel Haas, die verloren etwas abseits der Menge stand. Die junge Deutsche hatte Anfang Juni ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Jeanne hatte im Vorfeld mehrfach versucht, Rachel in die Geburtsklinik nach Elne verlegen zu lassen, doch ihr Ersuchen war genauso oft abgelehnt worden. Letztlich hatte die Jüdin ihre Tochter hier im Lager entbunden.
Glücklicherweise war die Geburt ohne größere Komplikationen verlaufen. Da die geschwächte und unterernährte Rachel nicht genügend Milch für den Säugling hatte und die Kleine stetig an Gewicht verlor, hatte einer der Ärzte schließlich bewilligt, dass das Baby in ein Kinderheim verlegt werden durfte. Ein kleiner Erfolg, dachte Jeanne nun beklommen. Was würde dieses Kind erwarten? Rachel hatte ihr nie erzählt, was mit dem Vater ihrer Tochter geschehen war, und Jeanne hatte nicht gefragt. Zu schmerzlich waren für viele dieser Menschen die Erinnerungen an alte Zeiten. An ein Leben, das sie in dieser Form nie wieder würden führen dürfen. Nein, diese Schuld würde Jeanne nie wieder loswerden. Hätte sie nicht mehr versuchen müssen? Viel mehr? Die wenigen, die sie freibekommen hatte, wogen die Masse, die sie nicht hatte retten können, in keiner Weise auf.
»Jeanne?«
Überrascht bemerkte sie, dass Rachel neben sie getreten war und ihr ein kleines weißes Päckchen hinhielt.
»Rachel.« Jeanne berührte die Frau am Unterarm.
»Kannst du mir einen Gefallen tun?« Die eingefallenen Wangen der jungen Frau betonten auf erschreckende Weise die großen blauen Augen.
»Rachel …« Was sollte sie ihr sagen? Der Antrag war abgelehnt worden. Es gab nichts mehr, was Jeanne für die junge Frau tun konnte.
»Das ist … meine Geschichte, mein Leben.« Rachel hob das Päckchen etwas an.
»Was meinst du?«
»Bitte, gib das meiner Tochter. Ich möchte, dass sie erfährt, wer ihre Mutter war. Und ich möchte, dass sie weiß, wie sehr ich sie geliebt habe.« Sie zögerte. »Immer lieben werde, egal, was passiert.«
Jeanne rang um Fassung. »Rachel …«
»Bitte.« Die Gefangene nickte. »Bitte gib es ihr.«
Aus einem Impuls heraus streckte Jeanne die Arme aus und zog die junge Frau an sich. »Du kannst dich auf mich verlassen.«
»Ich weiß«, murmelte Rachel an ihrem Ohr. »Du bist eine von den Guten.«
Im nächsten Moment ertönte hinter ihnen ein schriller Ton.
»Ich muss jetzt gehen.« Rachels Augen nahmen wieder diesen stumpfen Ausdruck an, nachdem sie sich von Jeanne gelöst hatte. »Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Auf Wiedersehen.«
Jeanne presste die Lippen aufeinander und hob die Hand. Erwidern konnte sie nichts, der Kloß saß ihr zu tief im Hals. Rachel drehte sich um und reihte sich hastig in die Schlange der Menschen ein, die sich nach der Aufforderung langsam in Bewegung gesetzt hatten.
Weinend verfolgte Jeanne, wie die Inhaftierten auf den Ausgang zusteuerten, wo schwarze Lastwagen darauf warteten, sie zum Bahnhof zu bringen. Sechshundert Menschen, dachte Jeanne bitter, sechshundert Schicksale auf einer Reise ins Ungewisse.
1
»Was meinen Sie?« Emma hielt den Atem an, während sie von der Alpakastute zu Frau Doktor Linde sah.
Die Tierärztin lächelte. »Sie hat das Schlimmste überstanden.«
Emma schloss die Augen und schnaufte tief durch. »Gott sei Dank.«
Frau Doktor Linde trat an das Waschbecken, zog die Latexhandschuhe aus und wusch sich die Hände.
»Wahrscheinlich war es eine gewöhnliche Magenverstimmung. Wenn sie jedoch weiterhin nichts gefressen hätte …« Sie beendete den Satz nicht.
»Was hast du dir nur eingefangen?« Liebevoll tätschelte Emma Wilmas flauschigen Hals.
»Das werden wir wohl nie erfahren.« Die Tierärztin stellte sich neben sie und betrachtete das Alpaka, bevor sie Emma musterte. »Sie sehen müde aus.«
Emma winkte ab. Dass sie die ganze Nacht bei Wilma verbracht hatte, wollte sie der Ärztin nicht auf die Nase binden. »Es geht schon. Die Sorge um Wilma hat mir die letzten Tage einfach keine Ruhe gelassen. Aber wenn sie wieder die Alte ist«, sie lächelte erleichtert, »kann ich auch wieder beruhigt schlafen.«
»Es ehrt Sie, wie Sie sich um Ihre Schützlinge kümmern«, setzte die Veterinärin an. »Aber vergessen Sie darüber nicht sich selbst.«
»Es macht mir Spaß«, erklärte Emma achselzuckend. Seit sie denken konnte, standen ihr Tiere näher als Menschen. Wegen der Allergien ihres Vaters hatte sie in ihrer Kindheit und Jugend keine Haustiere halten dürfen, doch das Erste, was sie sich nach ihrem Wegzug von zu Hause zugelegt hatte, war ein fünf Monate alter schwarzer Königspudelrüde. Mittlerweile war Balou sieben Jahre alt.
»Tiere können uns viel geben«, stimmte Frau Doktor Linde zu, während sie ihren Koffer von der Bank hob. »Ich liebe meinen Beruf über alles. Aber Abstand ist sehr wichtig.«
»Das ist mein Leben. Die Tiere sind jeden Tag um mich. Ich kenne sie, kann an ihrem Verhalten sehen, wie es ihnen geht. Und sie sind dankbar, sie erwarten nichts. Wollen nur gut behandelt werden.«
»Und pünktlich ihr Futter bekommen«, ergänzte die Ärztin grinsend.
Emma lachte. »Ja, das ist sehr wichtig.«
»Ich wollte Sie nicht kritisieren. Es müsste viel mehr Menschen wie Sie geben.«
»Ich arbeite gern hier. Die Wilhelma ist ein wunderschöner Zoo. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jeden Tag mehrere Stunden am Schreibtisch verbringen …« Emma schüttelte den Kopf. »Das wäre nichts für mich.«
»Für mich auch nicht.« Frau Doktor Linde streckte Emma die Hand hin. »Ich muss weiter, Frau Duvalle. Das kleine Elefantenbaby wartet.«
Emma verabschiedete sich von ihr und kehrte dann zu Wilma zurück. »Bin ich froh, dass es dir wieder gut geht«, flüsterte sie dem Alpaka ins Ohr. »Du hast mir einen gehörigen Schrecken eingejagt.« Sie gähnte.
»Und, was macht unser Sorgenkind?« Emmas Kollege Peter Bechtold tauchte vor der Box auf.
»Es geht ihr wieder gut«, erwiderte Emma und fuhr mit ihrer Hand über das dicke Rückenfell des Tiers.
»Wann werden sie geschoren?«
Sie zuckte mit den Achseln. »Ich weiß es nicht. Am besten fragen wir Anja, ob sie schon einen Termin vereinbart hat.« Müde fuhr sie sich über die kurzen Locken.
Peter deutete auf ihren Kopf. »Du hast Stroh im Haar.«
Sie verzog den Mund und verließ die Box. Am Waschbecken wandte sie den Kopf und betrachtete sich im Spiegel. Vorsichtig entfernte sie die Strohhalme, die sie nach dem Aufwachen übersehen haben musste.
»Warum gehst du nicht nach Hause?«
»Ich habe noch Dienst bis vier.«
»Durch deinen Nachtdienst hast du mindestens zwölf Überstunden«, entgegnete er ungerührt. »Geh nach Hause, ich spreche mit Martina.«
Martina Eismann war ihre Vorgesetzte.
»Sieht man mir an, dass …?«
Peter lachte. »Wie lange kennen wir uns mittlerweile?«
»Sieben Jahre?«, brachte Emma unsicher hervor.
»In dieser Zeit ist es nicht das erste Mal, dass eines der Tiere krank war. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass du dein Nachtlager neben oder in der Box aufgeschlagen hast.«
»Ich kann nicht anders.«
»Ich weiß.« Er lächelte gutmütig. »Aber du siehst wirklich erschöpft aus. Und ich muss dir nicht sagen, dass unseren Schützlingen unsere Verfassung nicht entgeht.«
»Du hast recht«, gab Emma schließlich klein bei.
»Ich kümmere mich um alles. Steht heute irgendetwas an, was ich wissen sollte?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, Frau Doktor Linde war schon da, ansonsten wird es eher ein ruhiger Tag.«
»Gute Nacht, Emma.«
»Danke, Peter.«
Auf dem Weg zu den Personalumkleiden knackte ihr Funkgerät. »Ja?«
»Emma, kannst du bitte gleich bei mir vorbeikommen?« Es war Martina.
Emma seufzte stumm. »Klar, bin schon auf dem Weg.«
Anstatt sich umzuziehen, schlug sie fünf Minuten später den Weg zu Martinas Büro im Verwaltungstrakt ein.
»Emma, das ging ja schnell.« Martina saß hinter ihrem Schreibtisch und zeigte auf den Stuhl vor sich.
»Peter meinte, ich solle Feierabend machen. Er wollte deswegen noch mit dir sprechen.«
Martina runzelte die Stirn.
»Ich war über Nacht …« Emma verdrehte die Augen. »Ich habe bei Wilma übernachtet.«
»Dem kranken Alpaka?«
Sie nickte. »Ich weiß, dass es nicht erlaubt ist. Aber ich …«
»Schon gut, Emma«, unterbrach Martina sie. »Du kannst eben einfach nicht aus deiner Haut.« Sie lächelte.
»Du bist nicht sauer?«
»Nein. Wenn es nicht zum Dauerzustand wird.«
Emma lehnte sich entspannt zurück. »Sie ist wieder gesund.«
»Das heißt, die nächste Nacht verbringst du wieder in deinem eigenen Bett.«
»Denke schon«, entgegnete Emma. »Sonst beschwert sich auch Balou, wenn ich ihn zu oft bei Mireille lasse.«
Mireille Weinmann war Emmas Tante, die Schwester ihrer Mutter. Sie lebte mit ihrem deutschen Mann nur drei Straßen von Emma entfernt. Wenn Emma arbeiten musste, kümmerte sich Mireille um den Königspudel und ging mit ihm Gassi.
»Ach, Emma, ich bewundere dein Engagement.« Martina legte die Hände aneinander. »Und deshalb möchte ich dich auch etwas fragen.«
Emma horchte auf.
»Anja geht doch demnächst in Mutterschutz.«
»Wie lange hat sie noch?«
»Knapp zwei Monate«, erklärte Martina. »Und daher habe ich gedacht, dass du während ihrer Abwesenheit die Leitung der Südamerikaanlage übernehmen könntest.« Sie beugte sich vor. »Du kennst dich bestens aus, und ich traue dir auch zu, dass du die organisatorischen Aufgaben gut bewältigst.«
Ein Glücksgefühl durchströmte Emma. »Wow! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber warum ich? Peter arbeitet doch schon viel länger hier.«
Martina zögerte. »Peter ist ein engagierter und verlässlicher Mitarbeiter. Aber ich glaube, er ist mit seinen Aufgaben ganz zufrieden.«
»Das bin ich auch«, erklärte Emma hastig.
Martina nickte. »Ich weiß, aber du bist jung. Viele unserer Abteilungsleiter sind aufgrund ihres Alters nur noch wenige Jahre da, bevor sie in den Ruhestand gehen werden. Und da dachte ich, es sei eine gute Gelegenheit für dich, in den Aufgabenbereich der Organisation hineinzuschnuppern. Es wäre ja erst mal nur für zwei Jahre. Danach will Anja wiederkommen. Ich kann dir also nichts versprechen.«
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
Martina lachte. »Lass es dir in Ruhe durch den Kopf gehen und schlaf eine Nacht drüber.« Sie machte eine Pause. »Übrigens wäre die Aufgabe auch mit einer höheren Gehaltsstufe verbunden.« Sie zwinkerte. »Und jetzt geh nach Hause und ruh dich aus.«
Emma erhob sich. Als sie das Büro verlassen wollte, klingelte ihr Handy. Eilig verabschiedete sie sich von ihrer Vorgesetzten und verließ den Raum. »Ja?«
»Emma, ich bin es, Olivier.«
Emma schloss die Augen. Ihr Bruder. Wann hatte er sie das letzte Mal angerufen? Sie räusperte sich. »Bonjour, Olivier. Wie geht es dir?«
»Mir geht es gut, Emma. Aber Papa … Du solltest schnellstens nach Collioure kommen.«
Als mit einem Mal alle Erinnerungen an ihr altes Leben zurückkamen, wurde Emma schwindlig. »Was ist mit Papa?«
»Er liegt im Krankenhaus. Du solltest dich wirklich beeilen. Die Ärzte meinen, es sähe nicht gut aus. Papa hatte heute Morgen in der Kanzlei einen Schlaganfall.«
2
»Senna, komm her. Lass die Kugel liegen.« Léon richtete sich auf und verfolgte kopfschüttelnd, wie die Hündin an der Boulekugel schnüffelte.
»Vielleicht solltest du deine Erziehungsmethoden noch mal überdenken.« Tristan Marveilles lachte neben ihm.
Léon zog eine Grimasse. »Welche Erziehungsmethoden? Dieser Hund ist völlig neben der Spur.«
»Der Hund, ja?« Wieder lachte sein Freund. »Ich habe eher das Gefühl, dass hier das Herrchen das Problem ist.«
Léon winkte ab.
»Die Frauen und du, irgendetwas passt da nicht.«
Léon blickte über den Bouleplatz. Tristan hatte recht, die letzten Jahre waren beziehungstechnisch nicht gut gelaufen für ihn. Beruflich hatte er sich seinen lang gehegten Traum zwar erfüllt, aber wirklich glücklich war er trotzdem nicht. Er steckte in einer Krise, der er sich über kurz oder lang würde stellen müssen. Seine Arbeit gab ihm nicht mehr das, was er sich einmal erhofft hatte. Er schlief schlecht, war oft fahrig. Sein Privatleben war eine einzige Katastrophe. Seit … Er verdrängte die aufkeimenden Gedanken.
»Los, du bist dran.«
Léon blickte auf die Kugel in seiner Hand und warf. Als sie Tristans zuvor geworfene Kugel direkt neben die Zielkugel schob, fluchte er.
»Scheint nicht dein Tag zu sein, Kumpel«, frotzelte Tristan, bevor er die letzte Kugel warf und damit gewonnen hatte.
Léon pfiff die Pudelhündin zu sich, die sofort schwanzwedelnd auf ihn zustürmte. Seufzend streichelte er ihr über den Kopf. »Pause?«
Tristan blickte ihn mit hochgezogenen Brauen an. »Oh, là, là! So schlimm? Es ist Wochenende, Léon. Kein Grund, Trübsal zu blasen.«
»Keine Ahnung, was mit mir los ist«, brummelte Léon vor sich hin, während er auf die Sitzgruppe zusteuerte.
»Du denkst an das Turnier in ein paar Tagen?«
Léon ließ sich mit einem Schnaufen auf einen der Holzstühle fallen.
»Senna, dein Herrchen macht mir wirklich Sorgen«, merkte Tristan mit ernster Stimme an, während er die Hündin, die sich vor ihn gesetzt hatte, kraulte.
»Vielleicht befinde ich mich in der Midlife-Crisis«, mutmaßte Léon mit düsterer Stimme.
Tristans Gesicht nahm einen verblüfften Ausdruck an. »Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Junge, du bist Ende zwanzig und stehst in der Blüte deines Lebens! Hör mir auf mit Midlife-Crisis.«
»Letzte Woche war ein Banker aus Perpignan bei mir«, begann Léon zögernd. »Du kannst dir nicht vorstellen, was dieser Mann jährlich an Kohle macht. Nicht nur sein Vorstandsgehalt, nein, da kommen dann Honorare für diverse Beratertätigkeiten, Vorträge und, und, und dazu.« Er schüttelte den Kopf.
»Und deswegen bist du so schlecht drauf?« Tristan sah ihn prüfend an, bevor er sich erhob und im Inneren des kleinen Vereinsheims zwei Flaschen Bier holte. »Bist du neidisch?«
Léon schnaubte verächtlich. »Neidisch? Auf so einen? Ganz sicher nicht. Ich frage mich nur …« Er brach ab, als er an ein Gespräch denken musste, das er vor vielen Jahren geführt hatte und das er bis heute bereute.
»Du fragst dich nur …?« Tristan beugte sich vor und sah ihn abwartend an.
»Dieser Mann verdient Millionen. Millionen, Tristan. Verstehst du?«
»Ja, ich verstehe. Soll vorkommen.«
»Der Mann hat mehr Geld, als er je ausgeben kann. Und trotzdem versucht er, den Staat zu besch…« Er biss sich auf die Zunge. » … zu betrügen.«
»Du bist Steueranwalt, Léon. Was erwartest du? Die Guten benötigen deine Dienste nicht, oder?«
»Ja, das habe ich mittlerweile auch kapiert. Ist dir aufgefallen, wie marode unsere Straßen sind, die Spielplätze, die ganze Gegend? Und das nur, weil die Reichen sich weigern zu zahlen. Und ich bin ihnen dabei auch noch behilflich.«
»Bist du krank, Léon?« Tristan verengte die Augen. »Was ist denn mit dir los? Seit ich dich kenne«, er unterbrach sich und überlegte, »also seit mehr als zwanzig Jahren, hast du davon geredet, dass du Jura studieren und Anwalt werden wolltest.« Er hob eine Hand und reckte den Daumen in die Höhe. »Du verdienst super«, er streckte den Zeigefinger, »bist ein absoluter Charmebolzen, wenn du nicht gerade deinen Moralischen hast.« Grinsend reckte er noch den Mittelfinger in die Höhe. »Und drittens könntest du glatt als Männermodel für Designermode durchgehen. Was genau ist dein Problem, mein Lieber?«
»Scheint, dass Männermodels und Charmebolzen bei der Frauenwelt momentan nicht allzu gefragt sind.« Senna trabte um den Tisch herum zu Léon und legte den Kopf auf seine Oberschenkel. »Anwesende ausgeschlossen«, ergänzte er schwach lächelnd.
»Trauerst du ihr etwa immer noch hinterher?« Tristan nahm einen Schluck aus seiner Flasche. »Mann, das ist sieben Jahre her.«
»Sieben Jahre sind eine verdammt lange Zeit«, stimmte Léon zu. Natürlich wusste Tristan, um wen es ging. Die beiden Männer kannten sich seit der ersten Klasse, hatten ihre Kindheit und Jugend gemeinsam verbracht. Die Jahre hatten ihrer Freundschaft nichts anhaben können. Bis heute war Tristan der Mensch in Léons Leben, der ihn am besten kannte. Nicht ganz, verbesserte er sich sofort. Bis auf Emma. Die schlaksige Frau mit den dunklen kurzen Haaren und der Vorliebe für bunt geringelte Leggings tauchte vor seinem geistigen Auge auf. Es war müßig, in alten Erinnerungen zu schwelgen. Die Zeit blieb nicht stehen, und er …
»Léon?«
Tristans Stimme riss ihn aus seinem Grübeln. »Hm?«
»Du wolltest doch gestern zum Arzt gehen.«
Er nickte. »Ja, war ich auch.«
»Und?«
Léon lachte bitter. »Treiben Sie Sport. Sorgen Sie dafür, dass Sie sich mehr bewegen. Reduzieren Sie Ihren Arbeitstag, und gönnen Sie sich mehr Freizeit.«
»Das heißt, er hat nichts gefunden.«
Léon schüttelte den Kopf. »Nein, die Schlafstörungen und das Herzrasen wären Anzeichen von Stress und Überarbeitung.«
»Vielleicht solltest du ein wenig kürzertreten.«
»Kürzertreten.« Léon kaute an seiner Unterlippe. »Sagtest du eben nicht selbst, ich sei noch zu jung für eine Midlife-Crisis?«
»Léon, du sitzt sechs Tage die Woche in der Kanzlei. Wie viele Stunden verbringst du in deinem Büro? Zwölf, dreizehn?«
Léon wandte den Blick ab und betrachtete den Oleander, der neben dem Bouleplatz blühte.
»Nimm dir doch wenigstens den Samstag frei.«
»Wenn ich heute nicht gearbeitet hätte …« Léon musste daran denken, wie er seinen Chef am Vormittag zusammengekauert in dessen Büro aufgefunden hatte. Wäre der Krankenwagen nicht rechtzeitig alarmiert worden, hätte die Situation für Roger Duvalle böse enden können.
»Wie geht es ihm denn?«
»Olivier ist sofort ins Krankenhaus gefahren. Er wollte mich informieren, sobald er Näheres weiß.« Léon hob den Kopf und blickte Tristan fest an. »So möchte ich nicht enden.«
»Duvalle ist starker Raucher und hat Übergewicht«, setzte dieser an. »Er befindet sich doch in einer ganz anderen körperlichen Verfassung als du. Der Mann hat Tag und Nacht gearbeitet. Dass ein solcher Lebenswandel auf Dauer nicht gut gehen kann, ist doch klar. Du hast mir immer wieder erzählt, dass er kaum Zeit für seine Familie hat.«
Léon nickte gedankenverloren. »Ja, vielleicht.«
»Vielleicht? Léon, du bist jung. Warum überlegst du dir nicht mal in Ruhe, was dich momentan so runterzieht? Geh mit Senna spazieren, lass dir den Wind um die Nase wehen. Du wirst sehen, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus.«
»Und du? Bist du glücklich?« Léon musterte das Gesicht seines Freunds, dessen rote Locken, die Lachfältchen um die Augen, die leicht gekrümmte Nase mit den unzähligen Sommersprossen.
»Mein Gehalt als kleiner Lehrer kommt nicht annähernd an deins heran. Sieh mich an, ich bin eben eher der Durchschnittstyp. Aber ich habe Bernadette, wir führen eine gute Beziehung. Meine Arbeit macht mir Spaß.« Er hielt inne. »Ja, ich glaube, ich kann behaupten, dass ich glücklich bin.«
»Das ist gut«, erwiderte Léon gedehnt. »Das freut mich sehr. Ehrlich.«
»Lass dich nicht hängen, Léon. Wir haben alle mal Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Das wird schon wieder.«
Léon starrte in den wolkenlosen Himmel. Die Sonne brannte schon intensiv und kündete vom baldigen Sommer. »Was für ein tiefsinniges Gespräch an solch einem schönen Märztag.«
Tristan lachte, bevor er sich erhob. »Also gut. Dann wollen wir mal wieder etwas mehr Leichtigkeit pflegen. Auf geht’s, die nächste Runde wartet. Und diesmal akzeptiere ich dieses Rumgeeiere von vorhin nicht mehr, sondern erwarte höchstes Engagement.«
Grinsend folgte ihm Léon zur Boulebahn, Senna folgte ihm dicht auf den Fersen.
3
Mit tränenverschleiertem Blick starrte Emma in den trüben, grauen Märzhimmel, während sie darauf wartete, dass die Tür geöffnet wurde.
»Emma!« Mireille Weinmann erschien im Rahmen. »So früh hatten wir gar nicht …« Sie stockte. »Was ist passiert?«
Emma wischte sich übers Gesicht. »Olivier hat angerufen …«, stammelte sie aufgelöst. »Papa …«
»Komm erst mal rein.« Ihre Tante packte sie sanft an der Schulter und schob sie in den Flur des kleinen Bungalows.
»Wo ist Balou?«
»Im Garten«, erklärte ihre Tante und zeigte zur Terrassentür.
In diesem Moment kam der schwarze Königspudel auch schon schwanzwedelnd angetrabt und schleckte seinem Frauchen über die nasse Hand. Emma ging in die Hocke und umarmte den Rüden.
»Magst du einen Kaffee?«
Emma schüttelte den Kopf. »Ich muss ins Bett. Und mit dem Koffein …« Sie winkte ab. »Dann kann ich nicht schlafen.«
Mireille musterte Emma stumm, während die ihre Wange an Balous Kopf drückte.
»Komm.«
Als Emma sich erhob und die braune Ledercouch ansteuerte, folgte ihr Balou und setzte sich mit hoch erhobenem Kopf neben ihre Füße. Ganz offensichtlich spürte er den unruhigen Zustand seines Frauchens.
»Was ist mit Olivier? Und deinem Vater?«, wollte Mireille mit ruhiger Stimme von ihrer Nichte wissen.
Emma schluckte und merkte erneut, wie sie die Fassung zu verlieren drohte. Sie fuhr sich mit der Zunge über die Oberlippe.
»Geht es Wilma schlechter?«
»Nein, Wilma geht es wieder besser. Die Tierärztin war da und meinte, sie sei über den Berg.«
»Was haben dann dein Vater und Olivier damit zu tun?«
Emma schloss kurz die Augen. »Olivier hat vor einer Stunde angerufen. Papa hatte einen schweren Schlaganfall.«
»Oh Gott«, rief Mireille aus, während sie eine Hand vor den Mund schlug.
»Die Ärzte sagen, es sähe nicht gut aus.«
»Ein Schlaganfall«, wiederholte Mireille bedächtig. »Das ist sehr ernst.«
»Olivier meinte, ich solle so schnell wie möglich kommen.«
Mireille nickte.
»Aber ich will nicht nach Collioure!«, stieß Emma aufgebracht hervor. »Du weißt, was er mir vorgeworfen hat. Von wegen ›schwarzes Schaf der Familie‹. Erst hat er Maman vertrieben und dann mich …«
»Emma, das ist sehr lange her. Vielleicht solltest du dir überlegen, die Situation von damals endlich zu klären. Wenn Olivier dich bittet, schnell zu kommen …«
»Klären«, wiederholte Emma verächtlich. »Dieser Mann akzeptiert nur seine eigene Sichtweise. Das Leben besteht aus Arbeit und Geldscheffeln. Dass es Menschen gibt, die ihre Prioritäten anders setzen möchten, versteht er doch gar nicht.« Sie musste daran denken, wie Roger Duvalle ausgeflippt war, als sie ihm erklärte, dass sie ihr Jurastudium hingeschmissen hatte. »Wenn er sich noch immer so aufregt, wundere ich mich nicht, dass er einen Schlaganfall bekommen hat.« Im nächsten Moment bereute Emma ihre Worte. War es möglich, dass er wirklich sterben könnte? Ein Schauer durchlief ihren Körper. Sie musste an die Streitigkeiten zwischen ihren Eltern denken. Ihre Mutter hatte die Familie verlassen, als Emma zwölf Jahre alt war. Margaux Duvalle war Künstlerin. Sie malte viel und arbeitete mit Ton. Ihr Vater hatte während der gesamten Beziehung nie Verständnis oder gar Respekt für die Kunst seiner Frau aufgebracht, hatte ihr immer wieder gesagt, dass sie sich einen »ordentlichen Job« suchen solle, statt ihrem ertraglosen Hobby nachzuhängen. Irgendwann hatte sie ihre Sachen gepackt und war gegangen.
»Ob Maman davon weiß?«
»Sicher hat dein Bruder sie informiert«, erwiderte ihre Tante, während sie sich aus dem Sessel erhob und sich neben Emma setzte. Behutsam legte sie einen Arm um die Schultern ihrer Nichte. »Du solltest jetzt bei ihnen sein.«
Emma hob den Kopf und sah Mireille an.
»Bei deiner Familie. Bei Olivier, deinem Vater.«
»Und bei ihr.«
Missbilligend verzog ihre Tante das Gesicht. »Camille ist die Frau deines Vaters.«
»Ja«, bestätigte Emma düster. »Leider.«
»Emma«, begann Mireille eindringlich. »Du leidest schon so furchtbar lange unter dieser traurigen Situation. Du kennst nicht einmal deine Schwägerin und deine beiden Nichten.«
»Na und?« Emma zuckte mit den Schultern, obwohl ihr die Worte ihrer Tante einen Stich versetzten.
»Fahr nach Collioure.«
Sie verdrehte die Augen.
»Fahr nach Frankreich und sprich mit ihnen.«
»Sicher will er mich überhaupt nicht sehen.«
Ihre Tante schüttelte leicht den Kopf. »Das glaube ich nicht. Du bist sein Kind, seine einzige Tochter.«
»Das hat ihn die letzten Jahre auch nicht interessiert.«
»Du kennst doch deinen Vater. Roger war noch nie der Typ Mensch, der eigene Fehler zugeben würde. Er kann nicht aus seiner Haut, aber du fehlst ihm sicher sehr.«
»Ich kann nicht«, erklärte Emma halbherzig. Und ich will nicht, ergänzte sie im Stillen.
»Doch, du kannst. Ich habe diesbezüglich nie etwas gesagt. Aber die Ehe deiner Eltern …« Mireille seufzte. »Zu einer Trennung gehören immer zwei.«
»Maman konnte nichts dafür«, widersprach Emma trotzig und fuhr mit dem Finger das geringelte Muster ihrer Leggings nach. »Er hat sie aus dem Haus getrieben.«
»Emma, ganz so war es nicht. Deine Mutter …«
»Lass Maman aus dem Spiel«, unterbrach Emma sie wütend. »Denkst du, sie hätte uns verlassen, wenn sie einen anderen Ausweg gewusst hätte?«
»Du warst noch ein Kind. Manchmal erscheinen uns Dinge anders, wenn wir erwachsen sind und ein wenig mehr Distanz zu den Ereignissen haben.«
Emma verengte ihre Augen. »Was willst du damit andeuten?« Ihre Stimme klang gefährlich leise. Balou, der sich in der Zwischenzeit neben Emma auf den Boden gelegt hatte, hob den Kopf und spitzte die Ohren.
Mireille schwieg einige Sekunden, bevor sie den Kopf schüttelte. »Nichts, Emma. Ich möchte gar nichts andeuten.«
»Sie wäre beinahe erstickt an seiner Seite«, beharrte Emma weiter.
»Die Ferienwohnung über der Patisserie steht momentan leer. Es ist ja noch keine Saison. Du könntest dort unterkommen und müsstest nicht im Haus deines Vaters wohnen«, schlug Mireille vor.
»Hast du mich nicht verstanden? Ich möchte nicht nach Collioure.«
»Er ist dein Vater, Emma. Egal, was passiert ist oder was er dir an den Kopf geworfen hat. Es ist möglich, dass er die nächsten Tage nicht überlebt. Nutze die Chance, und geh zu ihm. Wenn du es nicht tust, kann es sein, dass du es dein Leben lang bereust.«
Emma blickte zu Balou, der jetzt wieder friedlich neben ihr lag und die Augen geschlossen hatte. »Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wieder dort zu sein. Die Erinnerungen an damals … Das kommt mir vor wie ein anderes Leben.«
»Du warst sieben Jahre nicht dort.«
»Er hat nie etwas gesagt, wenn er mich am Geburtstag oder an Weihnachten angerufen hat. Nie!«
»Weil er stur ist.«
»Es ist so viel passiert damals. Und Léon …« Sie musste an ihren Ex-Freund denken, der sie so bitterlich im Stich gelassen hatte, als sie dringend seine Unterstützung benötigt hätte.
»Léon war deine große Liebe«, entgegnete Mireille lächelnd, während sie Emma über die Wange strich.
»Ja, er war meine große Liebe«, bestätigte sie versonnen. »Es ist so unglaublich lange her.«
»Was willst du jetzt tun?« Susanne Seiderer schaukelte weiter den Kinderwagen, als sie stehen blieben.
Während Balou ausgiebig an einer Laterne schnüffelte, blickte Emma ihre Freundin leidvoll an. Susanne und sie kannten sich seit mehreren Jahren. Vor acht Monaten war ihre Freundin und Kollegin zum ersten Mal Mutter geworden. Und seitdem hatte es sich eingebürgert, dass die beiden sich zweimal die Woche zu einem Abendspaziergang mit Hund und Baby im Stadtgarten von Stuttgart trafen.
»Ich muss wohl nach Frankreich.«
Susanne nickte. »Er ist dein Vater.«
Emma zögerte. »Damals hat er mir sehr wehgetan. Nie war ich ihm gut genug. Und er hat absolut kein Verständnis für Menschen, denen Karriere und ein großes Haus nichts bedeuten.« Lächelnd sah sie ihren Hund an. »Tiere kann er auch nicht leiden.«
»Das tut mir leid. Gerade weil du ja auch zu deiner Mutter ein eher kompliziertes Verhältnis hast.«
Emma schüttelte den Kopf. »Nein, unser Verhältnis ist überhaupt nicht kompliziert. Mein Vater hat sie aus dem Haus getrieben, als Olivier und ich noch Kinder waren. Es ist allein seine Schuld.«
»Aber hätte sie euch denn nicht mitnehmen können?« Susannes Miene nahm einen zweifelnden Ausdruck an. »Wenn ich mir vorstelle …« Sie blickte in den Kinderwagen, in dem ihr kleiner Sohn friedlich schlief. »Ich könnte Tibor niemals allein lassen.«
»Es ist so lange her«, entgegnete Emma ungehalten. »Sie hatte einfach nicht die finanziellen Mittel. Außerdem ist sie damals nach Paris gegangen, weil sie von einer renommierten Galerie ein Angebot bekommen hat. Wie hätte sie das mit zwei Kindern allein bewerkstelligen sollen?«
»Dein Vater war doch auch mit euch allein«, warf ihre Freundin ein, während sie weiterschlenderten.
»Das war etwas anderes«, beharrte Emma. »Sie wollte uns nachholen. Das hat sie uns am Telefon immer wieder gesagt, aber …« Sie schnaufte.
»Aber sie hat es nie getan«, beendete Susanne den Satz.
»Es ging eben nicht. Papa ist an allem schuld.« Emma verzog das Gesicht. »Aber Olivier meinte, es sieht nicht gut aus. Wenn er …« Doch sie brachte die Worte nicht über die Lippen.
»Ich denke, es ist gut, dass du nach Hause fährst. In einer solchen Situation sollte die Familie zusammenstehen.«
Emma betrachtete die steinernen Skulpturen. »Eine Familie, wie du sie dir vorstellst, existiert bei uns nicht. Mein Bruder ist seit einigen Jahren verheiratet und hat zwei eigene Kinder. Und mein Vater lebt nur für seine Arbeit. Seine neue Frau …« Sie winkte ab. »Mireille und Gernot sind mir mehr Familie, als es meine Eltern je waren.«
»Das tut mir leid, Emma. Wirklich. Das klingt furchtbar traurig.«
Sie zuckte mit den Achseln. »Es geht mir gut. Ich fühle mich wohl hier in Deutschland. Und ich habe den besten Freund, den ich mir überhaupt wünschen kann.« Behutsam tätschelte sie den Kopf des Pudels.
»Wann fährst du?«
Emma blickte auf ihre Uhr. »In zwei Stunden. Ich habe den ganzen Tag geschlafen. Nach der Nacht in Wilmas Box …« Sie grinste. »Ich war ganz schön kaputt. Mir war gar nicht bewusst, dass Alpakas nachts so einen Lärm veranstalten.«
»Du bist einfach unverbesserlich.« Auch Susanne lachte. »Wollen wir uns kurz setzen?« Sie zeigte auf eine Bank in der Nähe des ausladenden Springbrunnens.
»Es kommt mir vor, als seien Frankreich und Collioure unendlich weit weg von meinem jetzigen Leben.«
»Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlen muss, seine Familie so lange Zeit nicht zu sehen.« Susanne bewohnte mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn eine große Wohnung im Haus ihrer Eltern. Wenn sie in wenigen Monaten aus der Elternzeit in den Zoo zurückkehrte, würden ihre Eltern tagsüber auf das Baby aufpassen. Eine solche Unterstützung hatte Emma nie erfahren. Schon immer hatte sie viele Dinge mit sich selbst ausgemacht. Auch als ihre Mutter noch bei ihnen gewohnt hatte, war diese meist in ihrem Atelier gewesen und hatte oft nicht gestört werden wollen. Und ihr Vater hatte seine Tage in der Kanzlei verbracht. Emmas Erinnerungen überwältigten sie. Gab es denn überhaupt keine schönen Erlebnisse, die sich in ihr festgesetzt hatten?
»Eine lange Strecke«, warf Susanne in diesem Moment ein.
»Das schaffe ich schon«, entgegnete Emma leichthin. »Wobei mir schon irgendwie mulmig zumute ist. Collioure ist in mancher Hinsicht ein Dorf. Es wird sicher nicht einfach, gewissen Personen auf Dauer aus dem Weg zu gehen.«
»Wie lange willst du denn bleiben?« Susanne sah sie von der Seite an.
»Nicht länger als nötig.«
Ihre Freundin schüttelte den Kopf. »Hast du nicht gesagt, der Ort liegt direkt am Mittelmeer?«
Emma nickte. »Doch.«
»Was würde ich dafür geben, mir ein wenig die mediterrane Frühlingssonne auf die Nase scheinen zu lassen? Den sanften Wind zu spüren, die Weite des Meeres zu genießen. Wenn ich dich reden höre, klingt es, als ob man dich aufs Schafott führe.«
Emma lachte. »An dir ist ja eine Romantikerin verloren gegangen. Aber so idyllisch ist Collioure nun auch nicht. Es ist …« Sie stockte. Ja, was symbolisierte das kleine Örtchen an der Purpurküste für sie eigentlich? Immerhin war dort ihre Heimat, ihre Familie. Auch wenn ihr Verhältnis nicht das beste war, so spürte sie tief in ihrem Inneren doch eine starke Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Zugehörigkeit. Sie räusperte sich. »Vielleicht hast du recht. Da ich schon lange nicht mehr dort wohne, sollte ich meinen Aufenthalt vielleicht als eine Art Kurzurlaub sehen.«
Ihr Handy klingelte. »Das ist Olivier«, raunte sie Susanne zu. »Da muss ich drangehen.«
»Natürlich.«
»Ja?«
»Emma, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Hast du es dir überlegt?«
»Ich fahre in zwei Stunden los.« Ihre Hände zitterten. »Wie geht es Papa?«
Ihr Bruder seufzte am anderen Ende. »Sein Zustand ist momentan stabil. Aber er ist nicht ansprechbar.«
»Was sagen die Ärzte?«
Sie hörte ihn schnaufen. »Sie meinen, es sei noch zu früh. Sie müssten weitere Tests machen und können oder wollen noch nichts sagen.«
»Ich denke, ich bin irgendwann morgen früh in Collioure. Ich melde mich nach meiner Ankunft bei dir.«
»Ich freue mich sehr, dass du kommst, Emma. Die Mädchen sind schon ganz gespannt auf ihre Tante. Und ich kann es kaum abwarten, dir meine Familie vorzustellen.«
Emma spürte einen Kloß im Hals. Seine Familie. Damit meinte er seine Frau und seine Töchter. Nicht sie, Emma.
»Und ich freue mich wirklich unglaublich, dich endlich wiederzusehen, kleine Schwester. Bitte, fahr vorsichtig.«
Emmas Augen wurden feucht. »Ja, mache ich«, presste sie mit erstickter Stimme hervor. Zu mehr war sie nicht in der Lage, da ihre Gefühle sie zu überwältigen drohten. Hastig beendete sie das Telefonat.
»So schlimm?«, wollte Susanne in mitfühlendem Ton wissen.
Emma schüttelte schweigend den Kopf und wischte sich eine Träne weg. Ihr Bruder sorgte sich um sie. Aber was hatte sie erwartet? Olivier und sie hatten sich schon immer sehr nahegestanden. Vielleicht hätte auch sie sich ab und zu mal bei ihm melden sollen. Sie atmete tief durch.
»Sag mal, Emma, hattest du vorhin nicht etwas von Macarons gesagt?«, versuchte Susanne die Stimmung etwas aufzuheitern. »Du weißt, dass ich für deine Backkünste sterben könnte.«
Emma zog lächelnd ihre Tasche hervor und suchte nach der Lunchbox, in der sie das kleine Gebäck verstaut hatte. »Das sind die letzten vom Wochenende.«
»Wow!«, entfuhr es ihrer Freundin, als Emma den Deckel öffnete und ihr die hellgrünen Macarons präsentierte. »Süße, die sehen fantastisch aus.«
»Bitte, nimm dir welche.«
Nachdem Susanne sich den ersten in den Mund gesteckt hatte, nahm ihr Gesicht eine verzückte Miene an. »Emma, ich sage es dir bestimmt zum hundertsten Mal. Du hast definitiv den Beruf verfehlt.«
4
Obwohl sie den Schlaf der letzten Nacht nachgeholt hatte, spürte Emma, wie die Müdigkeit langsam in ihr emporkroch. Es war kurz vor sechs. Die Dämmerung hatte noch nicht eingesetzt. Balou gab hinten im Kofferraum keinen Ton von sich. Wahrscheinlich schlief er. Emma riss ihre Augen auf und bemühte sich, wach zu bleiben. Doch als ein Autobahnschild zehn Minuten später eine Raststätte mit Tankstelle ankündigte, beschloss sie, eine längere Pause einzulegen. Alles andere wäre zu gefährlich gewesen.
Nachdem sie den Wagen auf einen der Parkplätze gelenkt hatte, schaltete sie den Motor aus, verließ den Wagen und befreite Balou aus dem Kofferraum. Der Rastplatz war nur etwa zur Hälfte belegt, der Bereich für die Lastwagen jedoch heillos überfüllt, wie Emma aus der Ferne erkennen konnte. Sie befestigte die Leine am Halsband des Pudels und steuerte mit ihm den Grünstreifen vor dem Toilettenhäuschen an. Während der Rüde ausgiebig am Randstein schnüffelte, hüpfte Emma auf und ab. Ihre Beine schmerzten, und ihre Schultern waren völlig verspannt. Erinnerungen über Erinnerungen stürmten auf sie ein, während sie mit Balou den Rastplatz ablief. Ob Olivier ihre Mutter ebenfalls über den Schlaganfall informiert hatte? Wann hatte Emma das letzte Mal mit ihr gesprochen? Weihnachten? Sie konnte sich an kein weiteres Telefonat erinnern. Seit ihre Mutter in New York lebte, telefonierten sie noch seltener als vorher. Was war nur passiert, dass die Familie derart auseinandergerissen worden war? Emma musste an ihren zwölften Geburtstag denken, den letzten, den sie zu viert gefeiert hatten. Ihre Mutter hatte wieder einmal eine wichtige Tonarbeit zu beenden und keine Zeit gehabt, Emma einen Geburtstagskuchen zu backen. Ihr Vater war abends um sieben nach Hause gekommen, in der einen Hand seine Aktentasche, in der anderen einen Karton mit kleinen Schokotörtchen, so wie Emma sie sich gewünscht hatte. Ihre Mutter, die gerade dabei war, ein aufwendiges Abendessen zuzubereiten, war ausgeflippt. Ob Roger mal auf die Uhr gesehen hätte? Wer würde denn um diese Uhrzeit noch Kuchen essen? Wofür stünde sie den halben Nachmittag in der Küche, wenn dann doch niemand mehr Appetit habe? Sie war weinend aus der Küche gerannt und hatte sich im Schlafzimmer eingeschlossen. Ihr Vater hatte nicht einmal mehr den Versuch unternommen, die Wogen zwischen ihnen zu glätten. Stattdessen hatte er Emma und Olivier in seinen Wagen verfrachtet und war mit ihnen zu einer der zahlreichen Buchten gefahren, um dort mit ihnen die Schokotörtchen zu essen. Nach wie vor war Emma der Ansicht, ihr Vater hätte seine Frau nicht so vor den Kopf stoßen dürfen. Er hätte versuchen müssen, sie zum Mitkommen zu bewegen. Ein Geburtstag ohne ihre Mutter … Nun, daran hatte sie sich in den folgenden Jahren gewöhnen müssen, nachdem ihr Vater seine Frau aus dem Haus getrieben hatte.
Abwesend beobachtete Emma, wie neben ihrem Auto ein weiteres Fahrzeug parkte. Ein junges Pärchen stieg aus und eilte Richtung Gaststätte. Emma schloss die Augen und hörte in sich hinein. Frankreich hatte ihr gefehlt. Erst jetzt spürte sie, wie sehr. Sie verfrachtete Balou in den Kofferraum, ging zur Toilette und holte sich im Anschluss einen Kaffee und zwei Croissants. Danach kehrte sie zu ihrem Auto zurück und setzte sich hinein.
»Es geht gleich weiter.« Genüsslich biss sie in das erste Blätterteighörnchen und genoss das fluffige Gefühl im Mund. Mit geschlossenen Augen lehnte sie den Kopf gegen den Sitz. Wie würde es sein, wenn sie ihre Familie wiedersah? Olivier, ihren Vater? Ihre Nichten, die sie noch nicht mal kannte, genauso wenig wie ihre Schwägerin. All die Jahre wäre sie nicht auf die Idee gekommen, nach Collioure zurückzukehren. Zu schmerzhaft war der Bruch mit ihrem Vater, nachdem sie ihm eröffnet hatte, dass sie ihr Studium abbrechen würde. Und Léon? Anstatt zu ihr zu stehen, hatte er ins gleiche Horn geblasen. Welche Möglichkeiten sie zerstört habe. Dass sie ihre gemeinsame Zukunft verraten habe. Ihre Augen begannen zu brennen. Nach all den Jahren schafften die Erinnerungen an die beiden es noch immer, sie traurig zu stimmen.
Aber war sie mit ihrem jetzigen Leben nicht glücklich? Konnte sie nicht endlich über den damaligen Ereignissen stehen? Es war so lange her. Seither war viel passiert. Emma hatte sich ein neues Leben aufgebaut, ohne Hilfe, ohne sich von anderen beeinflussen zu lassen. Darauf konnte sie stolz sein. Sie öffnete wieder die Augen und ließ den Motor an. Und sie würde sich nichts anderes einreden lassen. Auch wenn es ihrem Vater gesundheitlich sehr schlecht ging, hatte er nicht das Recht, über sie zu urteilen. Sie musste niemandem etwas beweisen. Mit grimmiger Entschlossenheit umfasste sie das Lenkrad fester und verließ den Parkplatz.
Fünf Stunden später schlenderte Emma am Uferkai von Collioure entlang. Gedankenverloren ließ sie den Blick über die stille Bucht wandern. Was hatte sie erwartet? Ein Empfangskomitee? Trommelwirbel und Posaunenklänge? Seht her, die verloren gegangene Tochter ist zurückgekehrt. Emma musste schmunzeln. Nein, spektakulär fühlten sich die ersten Minuten in ihrem Heimatort weiß Gott nicht an.
»Lass uns gehen, Balou.« Sie zog ihren Hund weiter. »Ich bin wirklich da.« Emma schüttelte den Kopf und stellte sich dicht an die Kante über dem Wasser.
Der blaue Himmel war wolkenlos, Sonnenstrahlen glitzerten auf dem Meer. Emma atmete tief ein und bemerkte den Geruch von Tang und Algen. Hier war ihre Heimat. Der Ort, an dem sie neunzehn Jahre ihres Lebens verbracht hatte. Es gab wohl kaum eine Ecke in Collioure, die sie nicht mit irgendeiner Erinnerung an ihre Kindheit oder Jugend verband. Sie drehte sich um und starrte auf den kleinen Stadtstrand, der sich vor der Uferpromenade erstreckte. Dort drüben auf der Mauer neben den hohen Palmen hatten Léon und sie gesessen, als sie sich zum ersten Mal geküsst hatten. Ein Schauer durchlief ihren Körper, als sie an den innigen Moment an einem heißen Juliabend dachte. Sie hatte den zwei Jahre älteren Léon schon lange vom Sehen gekannt und ihn heimlich angehimmelt. Als sie eines Abends kurz vor den Sommerferien mit Nicolette auf eine Strandparty in Argelès-sur-Mer gegangen war, war sie fast in Ohnmacht gefallen, als sie ihren Schwarm inmitten des Partyvolkes ausgemacht hatte. Und nachdem er sie ebenfalls erkannt hatte und sie tatsächlich fragte, ob sie nicht auch aus Collioure komme, hatte sie ihr Glück nicht fassen können. Sie verbrachten den kompletten Abend gemeinsam und trafen sich in der folgenden Woche zum Schwimmen und Boulespielen. Und keine zwei Wochen später saßen sie an eben jenem Abend auf besagter Mauer, unterhielten – und küssten sich.
Emma schloss die Augen und seufzte. Damals war sie siebzehn gewesen, Léon neunzehn. Die folgenden zwei Jahre konnte sie auch nach so langer Zeit immer noch als die schönsten ihres Lebens bezeichnen. Léon war ihr erster fester Freund gewesen. Alles, was zwischen ihnen geschehen war, hatte sich aufregend und richtig angefühlt. Damals hatte sie geglaubt, dass Léon der Mann ihres Lebens sei. Er hatte für sie alles verkörpert, wovon sie je geträumt hatte. Seine stahlblauen Augen, die jedes Mal aufblitzten, wenn er sie ansah. Seine sinnlichen Lippen, das markante Kinn. Er hatte es geschafft, sie zum Lachen zu bringen, wenn es ihr schlecht ging. Er war witzig, charmant, liebevoll. Wie oft hatte er ihr ihre geliebten Schokoladentörtchen mitgebracht, wenn sie sich trafen? Oder ein Duftsäckchen mit Lavendel, da er wusste, wie sehr sie den Geruch liebte. Er war immer für sie da gewesen, wenn sie ihn brauchte. Solange sie seinen Träumen gefolgt war, solange sie ihrer beider Entscheidungen nicht hinterfragt hatte.
An dem Abend, als sie ihrem Vater von dem abgebrochenen Studium erzählt und er ihr daraufhin die furchtbarsten Dinge an den Kopf geworfen hatte, war sie wutentbrannt zu Léon gefahren, in der Hoffnung, dass zumindest er sie verstünde und ihr den Rücken stärken würde. Damals war ihr bewusst geworden, dass sie sich bitterlich in ihrem Freund getäuscht hatte. Léon ging es genau wie ihrem Vater nur um Prestige und Ansehen, Geld und Karriere.
Balous Gewinsel unterbrach ihre Gedanken. »Du hast recht. Es bringt nichts, der Vergangenheit nachzutrauern. Was passiert ist, ist passiert.« Während sie weiterlief, erblickte sie die majestätische Wehrkirche. Entschlossen steuerte Emma auf den Steg zu und setzte sich auf einen Mauervorsprung. Während Balou den Weg abschnüffelte, beobachtete Emma drei Möwen, die auf den Felsen im Wasser mehrmals ihre Flügel öffneten und wieder anlegten. Die Märzsonne war zu schwach, um den frischen Wind abzumildern. Emma zog ihre Strickjacke enger um sich. Auf einmal kam sie sich allein und verloren vor. Sie hatte keine Ahnung, wie sie ihrer Familie gegenübertreten sollte. Sie hatte viel verpasst. Die Geburt ihrer Nichten, Oliviers Hochzeit. Ihr Vater hatte sie nie verstanden, und auch ihr Bruder lebte das Leben, das sich alle erfolgreichen Männer wünschten. Ein gut bezahlter Job, eine Familie, die zu Hause auf ihn wartete, wenn er Feierabend hatte.
Während sie den Wellen lauschte, die gegen den Kai schlugen, stieg Wehmut in ihr auf. Die mächtige Kulisse des Château Royal erinnerte sie an ihre Mutter. Wie oft hatte sie sich an den zahlreichen Motiven, die die Festung hergab, versucht? Emma konnte sich nicht daran erinnern, dass ihre Mutter jemals mit dem Ergebnis zufrieden gewesen wäre.
Emma beobachtete, wie eine kleine Jacht die Bucht verließ und auf das offene Meer zusteuerte.
Zu ihrem achtzehnten Geburtstag hatte Léon ebenfalls ein Motorboot gemietet und war mit ihr die Purpurküste entlanggeschippert. Er hatte einen Picknickkorb gepackt, und Emma hatte Macarons gebacken. Als sie sich erneut in ihren Erinnerungen zu verlieren drohte, stand sie verärgert auf. Sie wollte nicht an ihren Ex-Freund denken. Nicht jetzt und nicht hier. Das Aufeinandertreffen mit ihrem Vater würde alle Kräfte kosten, die sie noch mobilisieren konnte. Warum belastete sie sich mit diesen Erinnerungen?
Hastig erhob sie sich, packte Balous Leine fester, schlug den Weg in die Altstadt ein und beschloss, noch eine Kleinigkeit zu essen, bevor sie die Ferienwohnung aufsuchte. Einige Gassen sahen noch genauso aus wie vor sieben Jahren. Einige Querstraßen vom Elternhaus ihrer Mutter entfernt entdeckte sie eine kleine Baguetterie, in deren Schaufenster mehrere Baguettes kunstvoll aufeinandergestapelt lagen. Dieser Laden musste neu sein. Soweit sich Emma erinnern konnte, hatte das Haus einer älteren Frau gehört, die das Backen irgendwann aufgegeben hatte, als Emma noch ein kleines Kind war. Zumindest meinte sie, sich zu erinnern, dass ihr Vater das erzählt hatte. Gleich morgen früh würde sie sich dort ein Brot holen, beschloss Emma, während sie einige neu renovierte Dorfhäuser erblickte, die sie ebenfalls anders in Erinnerung hatte. Die lila und blau gestrichenen Fensterläden hoben sich strahlend von den grauen und gelben Fassaden ab. Erste Frühlingsblumen linsten aus braunen Holzkästen. Eine weiße Bank stand vor einem der Häuser, daneben ein kleiner Olivenbaum. In der nächsten Quergasse entdeckte Emma eine Crêperie, die ebenfalls neu sein musste. Auf einer Tafel waren mehrere Crêpesvariationen aufgelistet. Schon beim Lesen lief Emma das Wasser im Mund zusammen.
»Bonjour«, erklang es im nächsten Moment hinter ihr. »Ich öffne gleich.«
Als Emma sich umdrehte, sah sie eine junge blonde Frau mit einem Korb in der Hand. Der Mann neben ihr hauchte ihr einen Kuss auf den Mund und strich ihr kurz über die Wange. »Bis heute Abend.« Bevor er sich entfernte, nickte er Emma freundlich zu.
»Bonjour.«
Die Blondine schloss die Tür auf und blickte Emma fragend an. »Möchten Sie gleich mit reinkommen? Draußen ist es wohl noch zu frisch. Die Sonne schafft es zu dieser Jahreszeit noch nicht über die Häuser.«
»Ich möchte Ihnen keine Mühe machen«, erwiderte Emma verwirrt. »Wenn Sie noch geschlossen haben …«
Die Frau lachte. »Haben Sie Hunger?«
»Ja«, entgegnete Emma grinsend.
»Und Ihr Hund hat Durst.«
Emma blickte zu Balou. »Wir waren ziemlich lange unterwegs.«
»Nehmen Sie Platz.« Die Ladenbesitzerin zeigte auf einen Tisch neben der Theke. »Ich stelle die Einkäufe ab. Dann komme ich gleich zu Ihnen.«
Interessiert schaute Emma sich um. Vor einer breiten Glastheke befanden sich sechs runde Tische mit bunten Mosaiksteinchen. Die Eisenstühle mit den dicken geblümten Sitzkissen verliehen dem Raum Gemütlichkeit. Nachdem Emma sich gesetzt hatte, lehnte sie sich zurück und bedeutete Balou, sich hinzulegen.
Kurz darauf kam die Besitzerin zurück, schob Balou eine Schüssel voll Wasser hin und stellte sich dann vor Emmas Tisch. »So, jetzt bin ich für Sie da. Was möchten Sie denn?«
»Was können Sie mir empfehlen?«
»Da es noch etwas früh fürs Mittagessen ist, schlage ich einen Crêpe mit karamellisierten Äpfeln vor.«
»Das klingt gut«, erwiderte Emma. »Und bitte einen Kaffee dazu.«
»Sehr gern«, erwiderte die junge Frau lächelnd und kehrte an die Theke zurück.
»Wie lange führen Sie die Crêperie schon?«, wollte Emma wissen.
»Seit letztem Herbst«, entgegnete die Blondine bereitwillig. »Das war alles …« Sie unterbrach sich. »Das ist eine lange Geschichte. Eigentlich bin ich Kunsthistorikerin.«
Emma sah sie verblüfft an. »Das klingt nach einer sehr interessanten Geschichte.«
Die Frau lachte. »Eine Geschichte, wie sie das Leben manchmal schreibt. Bis zum letzten Jahr habe ich in Deutschland gelebt und in einer Kunstgalerie gearbeitet. Als dann im Sommer meine Mutter gestorben ist und ich erfahren habe, dass mein Vater möglicherweise hier lebt …« Sie winkte ab. »Es ist kompliziert, die Zusammenhänge zu verstehen.«
»Ich lebe auch seit sieben Jahren in Deutschland«, erklärte Emma beherzt.
»Aber Sie sind Französin, oder? So, wie Sie sprechen?« Die Blondine bereitete den Teig hinter dem Tresen vor.
Emma nickte. »Ich komme aus Collioure, meine Familie lebt auch noch hier. Mein Vater hatte einen Schlaganfall, und ich …« Sie brach ab. »Es ist auch kompliziert.«
Wieder lachte die Ladenbesitzerin. »Mit komplizierten Geschichten kenne ich mich bestens aus.«
Als sie Emma den Kaffee brachte, streckte sie ihr die Hand hin. »Ich bin Lara.«
»Emma.«
»Als ich letztes Jahr herkam, dachte ich, es sei nur für wenige Wochen. Bis ich meinen Vater gefunden habe.«
»Ich bin definitiv nur für kurze Zeit hier. Bis es meinem Vater besser geht. Ich habe einen tollen Job in Deutschland.«
Als Lara sie abwartend ansah, fuhr Emma fort: »Ich bin Tierpflegerin in Stuttgart in der Wilhelma.«
»Das klingt wirklich schön«, sagte Lara. »Ich hatte in Bremen gerade meinen Job verloren. Meine Großeltern leben noch dort, aber hier …«
»Der junge Mann von eben war wohl nicht ganz unschuldig an Ihrer Entscheidung.« Emma lächelte.
»Nein, das war er nicht«, erwiderte Lara versonnen. »Ganz und gar nicht.«
»Meine Erinnerungen an Collioure sind leider weniger schön.« Emma nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. »Aber wie gesagt, mein Aufenthalt wird nicht länger als nötig andauern.«
»Das haben schon andere gesagt«, erklärte Lara schmunzelnd, während sie wieder hinter den Tresen trat. »Eine kluge Frau erklärte mir vor nicht allzu langer Zeit, Collioure sei das beste Allheilmittel gegen jeglichen Kummer.«
»Collioure war vor langer Zeit der Auslöser meines größten Kummers«, widersprach Emma kaum hörbar und presste die Kiefer fester aufeinander. Was würde sie erwarten? Wie sollte sie ihrem Vater gegenübertreten? Fragen über Fragen, auf die sie noch keine Antwort wusste.
»Bonjour, Madame Montagnon«, begrüßte Emma eine Stunde später die Konditorin, die die kleine Patisserie im Erdgeschoss des Elternhauses ihrer Mutter und ihrer Tante gemietet hatte. »Ich bin Emma Duvalle, Mireille Weinmanns Nichte.«
Die rothaarige Frau, die Emma auf Mitte fünfzig schätzte, lächelte ihr freundlich entgegen. »Mireille hat Sie schon angekündigt. Willkommen in Collioure. Ich hoffe, die Reise war nicht zu beschwerlich.«
Emma stellte ihre Tasche ab und bedeutete Balou, sich hinzulegen. »Die Fahrt steckt mir schon in den Knochen, aber das Licht hier …« Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaube, ich hatte ganz vergessen, wie hell Südfrankreich strahlt.«
Die Konditorin lachte. »Ich komme aus Rouen. Die Sonne und dieses unglaubliche Blau des Himmels waren auch das Erste, was mir hier aufgefallen ist.«
»Wie lange führen Sie die Konditorei schon?« Als Emma noch in Collioure wohnte, stand das Erdgeschoss des Hauses leer. Nur die Ferienwohnung wurde im Sommer vermietet, wenn Mireille sie nicht selbst genutzt hatte.
»Seit fünf Jahren.«
»Wenn ich mir Ihre Auslage ansehe, läuft mir das Wasser im Mund zusammen.«
Das Gesicht von Madame Montagnon nahm einen bekümmerten Ausdruck an. »Wenn das mal alle Kunden so sehen würden …«
Emma wusste nichts zu erwidern.
»Sie kennen die Wohnung?«, wechselte die Konditorin unvermittelt das Thema.
»Von früher, ja.« Wenn Mireille und Gernot ihre Urlaube hier verbracht hatten, waren Emma und Olivier oft bei ihnen gewesen. Ihre Tante hatte die Wohnung jedoch vor vier Jahren komplett renovieren lassen und sie im Anschluss neu möbliert, deshalb war sie gespannt, wie die Räume nun aussahen.
»Seit der Renovierung ist sie ja praktisch dauervermietet«, erwiderte Madame Montagnon. »Zumindest in der Hauptsaison. Der März ist noch kein wirklicher Urlaubsmonat.«
»Mein Glück. Und ich bin heilfroh, dass sich die Touristenströme noch in Grenzen halten.«
»Fürs Geschäft ist die Situation natürlich nicht allzu glücklich.«
»Ich glaube, ich nehme mir so ein leckeres Schokotörtchen mit«, überlegte Emma laut, während sie das Sortiment betrachtete. »Ich liebe Schokolade.« Sie grinste.
»Das sieht man Ihnen aber nicht an«, entgegnete Madame Montagnon, während sie das Gebäckstück verpackte.
»Nennen Sie mich doch Emma«, schlug Emma vor.
»Ich bin Zoé.« Die Konditorin reichte ihr das Törtchen.
»Danke.« Nachdem sie bezahlt hatte, zeigte Emma nach oben. »Dann werde ich mich mal einrichten.« Sie berichtete der Frau noch kurz vom Grund ihres Besuchs und dem Zustand ihres Vaters, bevor sie mit dem Törtchen in der einen Hand und Leine und Tasche in der anderen die Patisserie verließ und hinter das Haus trat, wo sich der Eingang zur Ferienwohnung befand. Sie löste die Leine von Balous Halsband und scheuchte ihn vor sich die Treppe hinauf. »Da wären wir.« Gespannt schloss sie die Tür auf und drückte sie mit einem Fuß auf.
Der Flur war nicht wiederzuerkennen. Die alten dunklen Holzmöbel, die auf Emma als Kind bedrückend und einschüchternd gewirkt hatten, hatten einen hellen Anstrich erhalten und waren durch eine weiße Hochglanzgarderobe im skandinavischen Stil ergänzt worden.
»Wow!«, entfuhr es ihr überrascht. Sie stellte ihre Reisetasche ab und inspizierte die anderen Zimmer. Mireilles Handwerker hatten ganze Arbeit geleistet. Die Wohnung war hell und freundlich. Eine graue Stoffcouch verströmte im Wohnzimmer heimelige Gemütlichkeit. Die uralten dunkelgrünen Küchenmöbel waren durch eine moderne weiße Einbauküche ersetzt worden, die keine Wünsche offenließ. Auch das Bad war neu. Emma ließ ihre Hand über die großen hellgrauen Fliesen gleiten. Wo sich früher eine kleine Badewanne befunden hatte, war nun eine italienische Dusche eingebaut worden. Auch das Schlafzimmer mit dem breiten Boxspringbett, der geräumigen Kommode und den cremefarbenen Vorhangschals war ein einziger Traum. Emma zog ihre dunkelroten Doc Martens aus und ließ sich aufs Bett plumpsen. Die Arme weit von sich gestreckt, schloss sie für einen Moment die Augen und genoss die Ruhe um sich herum. War es wirklich erst gestern gewesen, dass Olivier sie angerufen hatte? Die lange Fahrt verzerrte Emmas Zeitgefühl.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.
Widmung
Für Mama und Papa