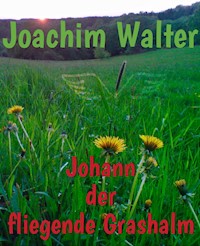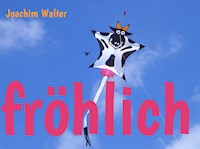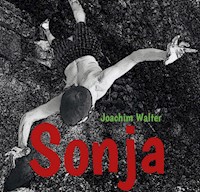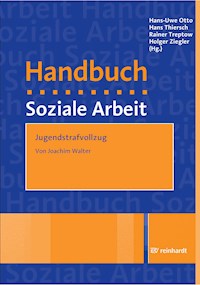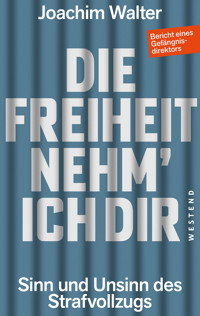
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Menschen hinter Gittern: Wie leben sie? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was genau geschieht im Gefängnis "im Namen des Volkes"? Wollen wir überhaupt wissen, was aus den Menschen wird, nachdem sie als Straftäter verurteilt und weggesperrt worden sind? Und was ist mit den Frauen und Männern, die als Personal in den Anstalten Dienst tun - oft ebenfalls lebenslänglich? Joachim Walter war u.a. stellvertretender Leiter der Strafvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim und Leiter des Jugendstrafvollzugs in Pforzheim und Adelsheim. Aus seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung erzählt er lebendige, aber immer wahre Geschichten über die Menschen im Gefängnis - Gefangene wie Bedienstete - und überlässt es den Leserinnen und Lesern, sich selbst ein Urteil über Sinn und Unsinn des Strafvollzugs zu bilden. Mit Zahlen und Fakten zum deutschen Strafvollzugssystem, die wir alle kennen sollten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ebook Edition
Joachim Walter
Die Freiheit nehm’ ich dir
Sinn und Unsinn des Strafvollzugs
Impressum
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-98791-305-1
1. Auflage 2025
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Lektorat: Luca Groß
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Titelbild
Vorwort
1. Das Tagebuch
2. Bewerbung
3. Strafrapport
4. Der Hammer
5. Versuchte Bestechung
6. Ein Kindermörder
7. Stammheim, Siebzigerjahre
I. Die Todesnacht und ihre Folgen für mich
II. Der Hungerstreik
8. Hände hoch!
9. Heiko Holzbruck
10. BleicherMax
11. Extrawürste
I. Markus Hahn
II. Bernd Fröhlich
III. Baldur Breit
IV. Die indischen Zwillinge
12. Ausbruch
13. Geiselnahme
14. Ministerbesuch
15. Ein Vollblutpädagoge oder: Das Lernen lernen
16. Moses Karame
17. Viechereien: Von Mäusen, Katzen, Ratten und dem kleinen Fuchsbandwurm
19. Waidmannsheil!
19. Gernot Baum
20. Diebes Reue
21. Das Tief am Nachmittag
22. Eislinger Vierfachmord
23. Hinter Leonberg – nur ein halbes Wunder!
24. Eine Filmvorführung beim Jugendgerichtstag
Navigationspunkte
Titelbild
Inhaltsverzeichnis
Für meine Enkel Vera, Paul, Dario und Ella
Vorwort
Menschen hinter Gittern – egal, ob sie Gefangene sind oder zum Personal gehören – unterscheiden sich nicht grundsätzlich von anderen Menschen. Das ist meine Erfahrung aus mehr als 35 Jahren im deutschen Strafvollzug. Und doch verhalten sie sich, den besonderen Umständen geschuldet, oft anders. Deshalb erzähle ich die nachfolgenden Geschichten, die alle um das Gefängnis kreisen. Obwohl jede in sich abgeschlossen ist, haben einige auch Querverbindungen untereinander. Alle sind wahr in dem Sinne, dass ich sie so erlebt habe. Sie stellen meine subjektive Sicht dar. Trotzdem möchte ich nicht ausschließen, dass sie, wie jede menschliche Erinnerung, rückschauend der Veränderung unterlagen.
Im Auftrag internationaler Organisationen wie der Europäischen Union und dem Europarat hatte ich die Gelegenheit, auch zahlreiche Gefängnisse im Ausland zu besuchen, in Aserbaidschan, Chile, Georgien, Russland, Singapur, der Türkei und fast allen europäischen Ländern. Die dabei gewonnenen Eindrücke sind teilweise Hintergrund für die Beurteilung unseres deutschen Strafvollzugs geworden und somit auch von Bedeutung für meine Sicht auf diesen.
Soweit es sich nicht um Personen der Zeitgeschichte handelt, habe ich alle Namen geändert; oft auch andere Merkmale, die eine Identifizierung ermöglichen könnten. Personenbezeichnungen im Plural (zum Beispiel »die Gefangenen«) beziehen sich in der Regel auf alle Geschlechter. Allerdings sind im deutschen Strafvollzug rund 95 Prozent der Gefangenen männlich – ein Missverhältnis, das von der kriminologischen Forschung und der Rechtspolitik wenig beachtet wird.
In den zahlreichen Reden, die ich als Anstaltsleiter gehalten habe, ebenso wie in meinen publizierten Wortmeldungen zum Thema Strafvollzug, habe ich da jemals mein Lieblingslied zitiert? Es ist ein Volkslied aus dem 17. Jahrhundert: »Wer jetzig’ Zeiten leben will, muss haben ein tapferes Herze …«
Nein, das habe ich nie erwähnt; es erschien mir zu pathetisch. Nachdem ich fast ein ganzes Berufsleben im Gefängnis zugebracht habe und angesichts meiner dort gemachten Erfahrungen, sehe ich dies, rückblickend, inzwischen etwas anders. Vielleicht passt diese Devise für ein Leben im Strafvollzug doch ganz gut.
Auf Anregung des Verlages habe ich den Geschichten einige Informationen und Daten angefügt. Damit soll der Situation und Problematik des heutigen Strafvollzuges Rechnung getragen werden.
Joachim Walter
In den 172 Justizvollzugsanstalten Deutschlands befanden sich am 30. Juni 2022 insgesamt 56 557 Gefangene und Verwahrte. Nach jahrelangem Rückgang, zum Teil bedingt auch durch die COVID-19-Pandemie, ist die Zahl zuletzt wieder gestiegen. Der größte Teil davon waren Strafgefangene und Sicherungsverwahrte, das heißt: Verurteilte, die in einer Justizvollzugsanstalt eine Freiheits- oder Jugendstrafe verbüßen oder sich in Sicherungsverwahrung befinden. Nur 5,8 Prozent aller Inhaftierten sind Frauen.
Die meisten Strafgefangenen verbüßen eine eher kurze Strafe unter zwei Jahren – nur jeder vierte hat mehr als zwei Jahre zu verbüßen. Trotzdem ist der Anteil der zu lebenslangem Freiheitsentzug verurteilten Gefangenen in den Justizvollzugsanstalten mit insgesamt 1 770 Personen relativ hoch. Sie sammeln sich dort an, können im günstigsten Fall frühestens nach 15 Jahren Haft entlassen werden. Im Durchschnitt geschieht dies allerdings erst nach mehr als 18 Jahren. Als Extremfall hat es auch schon eine Vollstreckung von mehr als 58 Jahren gegeben.
Daneben befanden sich 11 663 Personen in Untersuchungshaft.
Die Netto-Haftkosten sind in den Bundesländern unterschiedlich hoch. Bei einem Bundesdurchschnitt von 109,38 Euro pro Tag und inhaftierte Person ergibt sich eine Belastung für den Fiskus von monatlich 3 281,40 Euro.
Wer über die Entwicklung der Kriminalität in Deutschland Genaueres wissen möchte, findet alle wichtigen Daten und Analysen im »Konstanzer Inventar Sanktionsforschung« und im »Konstanzer Inventar Kriminalitätsentwicklung«, die beide von Prof. Dr. Wolfgang Heinz verantwortet werden (http://www.ki.uni-konstanz.de/kis/).
1. Das Tagebuch
Zelleneinschluss im Heilbronner Gefängnis. Ein riesiger Radau: Lautsprecher knarzen, pfeifen und plärren los, schwere Eisentüren schlagen, Schlüssel rasseln, Kommandos erschallen, Stiefel stampfen, ein gewaltiges Wirrwarr von Stimmen. Man kann unmöglich angeben, woher die vielen lauten und hallenden Geräusche kommen. Offenbar von überall her. Weil es so viele Flure und Türen im Gefängnis gibt: Außentüren, Innentüren, Schleusentüren, Zellentüren, Stockwerksabschlusstüren. Es kommt einem so vor, als ob sie alle gleichzeitig geräuschvoll geöffnet und wieder zugeknallt werden. Menschenmassen drängen ins Gebäude, zu den Treppenaufgängen, trampeln über die Gänge und Galerien. Das sind die typischen Geräusche eines deutschen Gefängnisses zu Anfang der Siebzigerjahre beim Einschluss.
Das Zellengebäude der JVA Heilbronn, in der ich nun seit einigen Monaten tätig bin, besteht aus vier langen Flügeln, jeder von ihnen drei Stockwerke hoch, die sich, ähnlich der Vierung einer gotischen Kathedrale, in einem Zentralbau treffen. Jeder Flügel ist vom Erdgeschoss bis zum dritten Obergeschoss offen. Man nennt das panoptische Bauweise. Denn so kann von der verglasten Zentrale im Kreuzungspunkt aus jeder der davon abgehenden Flügel vollständig überblickt werden, sogar von einem einzigen Aufsichtsbeamten. Im zentralen Aufsichtsbereich kann man über Wendeltreppen alle Stockwerke erreichen.
Ein solches Gefängnis ist innen offen, vom Erdgeschoss bis zum Dach, welches mit seinen zahlreichen Fensterfeldern für Tageslicht sorgt. Es gibt keine Zwischendecken zwischen den Stockwerken. Oft werden die Flügel deshalb auch als Hallen bezeichnet. Der Zugang zu den in jedem Flügel auf beiden Seiten angeordneten Hafträumen erfolgt über schmale eiserne Galerien, die an der Innenwand des jeweiligen Stockwerks hängend angebracht sind. Sie vereinigen sich im Zentralgebäude und erschließen so mehrere Hundert Zellen, in denen die Gefangenen untergebracht sind. Aufgrund des Mangels jeder Trittschalldämpfung führen diese metallenen Laufgänge zum hohen Lärmpegel beim Einrücken.
Diese eisernen Galerien auf den Stockwerken sind so schmal, dass zwei Personen dort nur mit Mühe aneinander vorbeikommen. Das ist Absicht. Ist auch nur eine der nach außen schwenkenden Zellentüren geöffnet, ist der Durchgang vollends versperrt. Bis die Tür mittels eines langen Hebels, senkrecht stehend und dreimal so lang wie eine normale Türklinke, wieder geschlossen wird. So wird die Vereinzelung beim Zelleneinschluss vieler Gefangener garantiert und darüber hinaus im Gebäude ein Davonrennen praktisch unmöglich gemacht. Bei der täglich dreimal stattfindenden Essenausgabe hat der Essensausteiler daher große Mühe, mit seinem schmalen Schiebewagen und den darauf geladenen Kübeln mit Muckefuck, Suppe oder Eintopf überhaupt durchzukommen. Der ihn begleitende Beamte öffnet deshalb immer nur eine Zellentüre nach der anderen. Ansonsten droht Blockade.
Im offenen Luftraum zwischen diesen mit hohen Geländern versehenen Laufgängen sind in den oberen Stockwerken Sprungnetze gespannt, damit keiner, um sich das Leben zu nehmen, über das Geländer in die Tiefe springen kann. Der Lärm der schwer ins Schloss fallenden Türen, aber auch sonst alle Geräusche, die beim Zelleneinschluss von Hunderten in ihre Hafträume zurückströmenden Gefangenen und zahlreichen Wachbeamten verursacht werden, können sich also im ganzen Gebäude ungehindert ausbreiten.
Neben dem lauten Türenschlagen tragen zum enormen Lärm des Einschlusses ebenso bei: das Trampeln der Schritte auf den eisernen Treppen und Galerien, das Rasseln der Schlüsselbünde der Beamten, wenn sie die Türschlösser betätigen, und ihre Kommandos. Und natürlich die lautstarken Rufe der Männer, wenn es sein muss auch über Stockwerke hinweg, mit denen sie den allgemeinen Krach zu übertönen versuchen, um einen Kumpel oder einen Neuzugang zu kontaktieren. Alles noch verstärkt durch den Nachhall. Denn das Einzige, was den Lärm dämpfen kann, ist die Kleidung der Gefangenen und der Uniformträger. Ansonsten gibt es nur Mauerwände, Stahl und Glas.
Ein solcher Auf- oder Einschluss findet mehrmals täglich statt: morgens Abrücken zur Arbeit, mittags Einrücken zum Mittagessen, das in der Zelle eingenommen wird. Danach erneutes Abrücken zur Arbeit, sodann wieder Einschluss im Haftraum und Vollzähligkeitskontrolle. Am späteren Nachmittag Abrücken zum Hofgang und danach für heute letzter Einschluss in den Haftraum samt erneuter Zählkontrolle, versteht sich. Es sei denn, der Gefangene darf ausnahmsweise abends zu einer Freizeitveranstaltung gehen.
Und jedes Mal ist das ganze Gefängnis in Bewegung, jedes Mal geht es zu wie im Ameisenhaufen: Hunderte von Gefangenen, alle einheitlich in fadenscheinigem graublauen Drillich, strömen aus mehreren Richtungen über die engen Treppen und Galerien durch das Haus zu ihren Abteilungen. Das verursacht überall Stauungen und dauert seine Zeit. Schließlich steht jeder wartend vor seiner Zellentüre, bis sie ihm einer der Aufsichtsbeamten öffnet und sofort nach dem Betreten wieder verschließt.
Fast genauso wie der enorme Lärm beeindruckt den Neuling der typische Knastgeruch, der alles durchdringt. Er hat sich in die Kleidung und das Bettzeug der Gefangenen eingenistet und wabert durch das ganze große Gebäude. Eine Mischung aus Männerschweiß, kaltem Zigarettenrauch, schlecht gelüfteten Hafträumen und dem Mief abgestandenen Essens – undefinierbar, aber unverwechselbar. Er kann einem buchstäblich den Atem rauben. Mehrfach ist es vorgekommen, dass Besucher von außerhalb im Zellenbau ohnmächtig geworden sind und an die frische Luft gebracht werden mussten.
Nach Beendigung des abendlichen Einschlusses, letztem Türenschlagen und Schlüsselrasseln scheint es ruhig zu werden im Zellenbau. Mittlerweile haben die Gefangenen über die Essenklappe in der Zellentür auch das Abendessen in Empfang genommen: lauwarmen Kräutertee, zwei bis drei Scheiben Graubrot, etwas Wurst oder Käse. Allerdings fangen nach dem Essen schon wieder einige an, sich vom Zellenfenster aus gegenseitig die letzten Neuigkeiten zuzurufen. Das ist zwar verboten, aber einfach, weil jeder von seiner Zelle aus eine Vielzahl von potenziellen Gesprächspartnern im gegenüberliegenden Flügel findet. Es dauert deshalb lange, bis das Stimmengewirr abebbt. Einzelne Zurufe und Unterhaltungen von Fenster zu Fenster gibt es aber noch lange.
Wann kehrt denn endlich Ruhe ein? Das dauert, je nach Jahreszeit und Witterung. In warmen Sommernächten, wo in den schlecht belüfteten Zellen kaum einer Schlaf findet, sind einzelne Stimmen, manchmal auch unartikulierte Schreie noch bis spät in die Nacht zu hören. Außerdem stören die grellen Scheinwerfer, die bei Dunkelheit alle Gebäudeteile in helles Licht tauchen und zu jedem Fenster hereinleuchten.
Herrscht dann lange nach Mitternacht Frieden, kann ein einzelner Rufer den ganzen Bau wieder wecken. Dann kann es vorkommen, dass die Gefangenen anfangen, wütend mit ihren Löffeln gegen die blechernen Essgeschirre zu schlagen oder mit den Fäusten gegen die Zellentüren zu hämmern und mit den Füßen dagegenzutreten. Der ganze Knast gerät dann in Aufruhr: ein ohrenbetäubender Lärm und wüstes Spektakel. Nervenzerfetzend kann das sein – und soll das auch sein! Bambule machen, nennen die Gefangenen das. Ein ohnmächtiger Protest derer, denen kein anderes Mittel zur Verfügung steht, ihrer Wut und Empörung Ausdruck zu verleihen.
Sollte nun noch irgendwo einer der zahlreichen, an vielen kritischen Stellen angebrachten Alarmmelder eingeschlagen werden – Blau für Sicherheit, Rot für Feuer –, dann schrillen in allen Flügeln und Stockwerken die extrem lauten elektrischen Alarmglocken. Auf großen rot oder blau blinkenden Tableaus wird den losrennenden Beamten angezeigt, an welchem Ort der Alarm ausgelöst wurde. Gleichzeitig fährt die Alarmbeleuchtung hoch: Mit zahlreichen zusätzlichen Scheinwerfern wird die Anstalt in ein gleißend helles Licht getaucht. Jetzt ist endgültig die Hölle los!
Solcher Art dürften meine ersten prägenden Eindrücke und Erfahrungen im Heilbronner Gefängnis in der Steinstraße gewesen sein. Beeindruckend, bisweilen beklemmend, manchmal sogar furchterregend. In jedem Falle so ungewöhnlich, dass einem die ersten Wochen in einem solchen geschlossenen Männergefängnis wohl immer unauslöschlich im Gedächtnis bleiben werden.
Kein Wunder also, dass ich meine ersten Monate als stellvertretender Leiter der Justizvollzugsanstalt Heilbronn als sehr belastend in Erinnerung habe. Mit den täglich gemachten bedrückenden Erfahrungen konnte ich oft kaum klarkommen. Nur in dieser Zeit, nie zuvor und auch niemals mehr danach in meinem Leben, habe ich deshalb Tagebuch geschrieben und diesem meine Erlebnisse, Belastungen und Verletzungen anvertraut. Es war ein Versuch, die auf mich einstürzenden Eindrücke zu verarbeiten und dabei einigermaßen das psychische Gleichgewicht zu halten. Eine Art Selbst-Supervision.
Leider ist das Tagebuch bei einem meiner Umzüge verloren gegangen, sodass ich heute auf diese authentischen Texte nicht mehr zurückgreifen kann und auf meine Erinnerung angewiesen bin.
Was waren meine größten Probleme, womit konnte ich nicht zurechtkommen? Es war nicht der Lärm beim Einschluss und auch nicht der Knastgeruch, so sehr beides dem Knastneuling imponieren wird. Ebenso wenig das Zusammentreffen mit den verurteilten Straftätern oder die Zusammenarbeit mit den manchmal etwas ruppigen Vollzugsbeamten. An all das gewöhnt man sich.
Womit ich freilich nicht gerechnet hatte und überhaupt nicht klarkam, war, dass im Gefängnis ganz überwiegend sehr junge Männer inhaftiert waren, nicht etwa ausgewachsene, gestandene Kriminelle, wie ich das aus Romanen und Filmen kannte. Es waren fast nur junge Männer unter 30, so wie ich selbst einer war. Ganz offensichtlich waren das keine gefährlichen Gangster oder Berufsverbrecher, sondern junge Menschen wie du und ich!
Das Durchschnittsalter der Gefangenen lag damals im Heilbronner Gefängnis bei 28 Jahren. Das bedeutet, dass sehr viele der Inhaftierten noch erheblich jünger gewesen sein müssen, um diesen Altersdurchschnitt zu bewirken. Die meisten waren in meinem Alter oder sogar noch jünger. Sie standen am Anfang ihres Lebens – und hatten schon fast keine Zukunft mehr! Denn in dieser Anstalt waren nur Gefangene mit langen Strafen untergebracht, auch viele Lebenslängliche.
Wie wohl die meisten meiner Zeitgenossen hatte ich bis dahin geglaubt, dass in den Strafvollzug nur wirklich unverbesserliche Kriminelle kommen: Schwerverbrecher oder notorische Wiederholungstäter. Das in den Massenmedien gezeichnete Bild des Kriminellen ist ja durch spektakuläre Gewaltverbrechen geprägt: Menschen, die sich mehr oder weniger bewusst gegen die Rechtsordnung entschieden haben, die alle ihre Chancen nicht genutzt haben und für die es deshalb in unserer Gesellschaft keine Alternative zum Freiheitsentzug gibt. Davon, warum sie so geworden sind, ist in den Medien nur selten die Rede.
Nun erlebte ich täglich und hautnah, dass die Gefangenen fast ausschließlich recht junge Männer waren, in der Blüte ihres Lebens stehend, die ohne jede Ausnahme aus schwierigen sozialen Verhältnissen, aus armen und zerstörten Familien stammten. Mit einem Wort: aus der Unterschicht. Getretene, Gezeichnete, Proleten. Junge Männer, von denen die allermeisten nie eine Chance zu einer gedeihlichen Entwicklung hatten, ja nicht einmal die Chance auf eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben! Ganz überwiegend verurteilt nicht etwa wegen schwerer Gewaltdelikte, sondern zu weit über zwei Dritteln wegen Eigentums- und Vermögensdelikten, meist sogar nur wegen Diebstahls.
Auch war mir aus Untersuchungen und aus meiner Referendarzeit bekannt, dass die Richter, ganz im Gegensatz zu den Verurteilten, niemals aus der Unterschicht stammten, sondern ausnahmslos aus der Mittel- oder Oberschicht. Auch aus den schriftlichen Urteilen in den Akten wurde dies in vielen Fällen erkennbar. Nämlich dann, wenn sich das Gericht zu herabsetzenden Bezeichnungen der sozialen Herkunft der Verurteilten wie »sittlich total verwahrloste Familie« hinreißen ließ. Dann wurde schon aus der mitschwingenden Verachtung deutlich, dass im Gerichtssaal zuweilen eine Straflust waltet, die auf Vorurteilen und Unduldsamkeit gegenüber Minderheiten beruht, gegen »die da unten«. Klassenjustiz, wie es ein hoher Richter damals schonungslos benannte.
Verurteilte aus »besseren Kreisen«, die Söhne von Ärzten, Lehrern, Richtern oder Unternehmern, sind mir im Heilbronner Gefängnis nie unter die Augen gekommen. Da ich selbst in dieser Stadt aufgewachsen und ins Gymnasium gegangen war, hätte ich die als Schulkameraden ja auch kennen müssen oder ich hätte wenigstens ihre Familiennamen schon einmal gehört. Ob die alle tatsächlich niemals etwas Strafbares angestellt haben?
Davon abgesehen, dass also, wie mir täglich vor Augen geführt wurde, nur ein geringer Teil der Bevölkerung beste Aussichten hatte, im Gefängnis zu landen, nämlich diejenigen aus den untersten Schichten, erschien mir auch die Institution Vollzugsanstalt selbst als eine ziemlich unbarmherzige Maschinerie. In erster Linie bestimmt zur Disziplinierung der ungebärdigen, unangepassten männlichen Jugend mittels abgenötigter und deshalb selten echter Reue und erzwungener »guter Führung«. Weil der Resozialisierungsgedanke noch sehr umstritten war und gerade erst begann, in den fortschrittlichsten Köpfen Einzug zu halten, war das Gefängnis auch noch nicht der gesellschaftliche »Reparaturbetrieb«, zu dem es sich später, unter dem Resozialisierungsgrundsatz, zumindest in Teilen entwickeln sollte.
Vielmehr ging es damals, im Jahre 1973, noch ganz überwiegend um Vergeltung für »böse Taten«. Dieser in der Gesellschaft herrschenden Meinung entsprach auch die innere Einstellung der allermeisten Vollzugsbeamten. Kein Wunder, gehört doch das Bewusstsein, dass die Verurteilten »ganz unten« sind, zur Psychohygiene der Normalbürger, und zu diesen zählen sich die Vollzugsbeamten natürlich auch. Dass Gefangene Mitbürger sind, die Rechte haben und diese auch geltend machen dürfen, war damals nicht die Grundlage der Theorie oder Praxis des Strafvollzugs. Zwar hatte das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1972 entschieden, dass auch Strafgefangene im Justizvollzug Rechte haben. Doch war das noch nicht ins allgemeine Bewusstsein gedrungen oder gar für die Praxis bestimmend geworden. Das begann erst 1977, nach dem Erlass eines Strafvollzugsgesetzes, und brauchte auch danach noch lange Jahre.
Bis dahin sprach man bezeichnenderweise vom »besonderen Gewaltverhältnis« als Grundlage des Strafvollzugs. Das bedeutet, dass Eingriffe in Freiheitsrechte über den Freiheitsentzug hinaus, wie zum Beispiel Fesselung oder Isolation, ohne besondere gesetzliche Ermächtigung erlaubt waren. Die Behörden hatten sehr weite Handlungs- und Entscheidungsspielräume. Folglich waren eigentlich alle Vollzugsbeamten – weibliche Beschäftigte gab es damals nur im Schreibdienst –, vom Anstaltsleiter über die Geistlichen bis hin zum untersten Hilfsaufseher, der Meinung, dass »die Spitzbuben«, wie man in Heilbronn sagte, für ihre Untaten im Vollzug zu büßen haben, und zwar mit einem weit abgesenkten Lebensstandard. Man sollte ihnen also auf keinen Fall entgegenkommen oder ihnen gar das Leben in der Haft erleichtern wollen. Dies hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt: Ich wollte als Jurist der Gerechtigkeit dienen, nicht überkommenen Ressentiments!
Dafür will ich ein Beispiel aus den ersten Monaten meiner Tätigkeit geben: Zur Anstaltsleitersprechstunde, die ich häufig stellvertretend für den Chef abgehalten habe, meldet sich der Gefangene Schuller mit einer Beschwerde, die er auch noch schriftlich übergibt. Er ist ein von Kopf bis Fuß tätowierter Mensch, Ende 20, mittelgroß, muskulös, mit mehreren Narben im Gesicht und auf dem Kopf, sodass entsprechende Lücken im sehr kurzen dunklen Haar zu sehen sind. Das Musterbild eines »Knackis«.
Er riecht stark nach Tabakrauch. An beiden Händen sind die ersten drei Finger gelb-braun verfärbt. Hier rauchen fast alle – weil es am billigsten ist, selbstgedrehte Zigaretten. »Schwarzer Krauser« heißt das grauslich stinkende scharfe Kraut. Im Gefängnis und im Schützengraben denkst du eben nicht viel an deine Gesundheit und an die Zukunft, sondern an die Gegenwart, ans bloße Überleben!
Schuller hat sein Handtuch mitgebracht. Es ist aus dem üblichen blau-schwarz gewürfelten dünnen Baumwollstoff gefertigt. Frotteehandtücher waren damals noch nicht zugelassen. Dieses Handtuch war offensichtlich in der Anstaltsschneiderei x-mal repariert worden. Vermutlich war es mehrfach zerlöchert gewesen. Nun weist es noch etwa die Größe von 30 mal 20 cm auf; gerade mal Waschlappengröße also.
»Das ist das einzige Handtuch, das man mir gegeben hat. Und damit soll ich mich nach dem Duschen abtrocknen! Mein Stockwerksbeamter hat nur die Achseln gezuckt und mir gesagt, dass jeder Gefangene nur ein Handtuch bekommt. Dieses sei nun halt meines.«
Das geht natürlich nicht. Die Beschwerde des Gefangenen ist zweifellos berechtigt. Allerdings gilt Schuller als Querulant, der sich ständig über alles und jeden beschwert. Der zuständige Beamte der Effektenkammer habe sich mit der Bemerkung »Wo kämen wir da hin?« geweigert, ein anderes Handtuch mit normaler Größe herauszugeben, sagt er.
Es bleibt mir nichts anderes übrig, als einen förmlichen Abhilfebescheid zu verfassen. In solch einer schriftlichen Verfügung der Anstaltsleitung wird festgestellt, dass der Gefangene ein Recht auf ein vorschriftsgemäßes Handtuch hat. Er erhält von mir eine Kopie des Schriftstücks. Zugleich wird die Hauswirtschaftsverwaltung angewiesen, dafür zu sorgen, dass Schuller ein Handtuch erhält, wie es der entsprechende Paragraf der Bekleidungsordnung vorsieht. Unterschrieben und in den Geschäftsgang gegeben. Damit ist die Sache für mich erledigt.
Einige Tage später komme ich in anderer Angelegenheit in das Büro des Hauswirtschaftsverwalters. Anfangs wundere ich mich, warum die zwei jungen Beamtenanwärter, die außer ihm dort sitzen, so hinterhältig grinsen. Da fällt mein Blick auf die Innenseite der Zimmertüre. Dort ist meine dienstliche Verfügung mit Tesafilm in Augenhöhe angepinnt und mit dickem rotem Filzstift mit mehreren Ausrufungszeichen versehen. Da hängt sie, umgesetzt wurde sie selbstredend nicht.
»Sie müssen noch viel lernen, Herr Assessor«, sagt mir der Chef der beiden Jungspunde, der ergraute Amtsinspektor Baumann. »Wo kommen wir hin, wenn uns die Spitzbuben auf dem Kopf herumtanzen dürfen? Schließlich ist der Schuller der Verbrecher und nicht ich! Abhilfebescheid! So was haben wir noch nie gehört!« Die anderen beiden feixen weiter und beobachten die Szene. Ich argumentiere eine Zeit lang, bitte um Verständnis für die missliche Situation des Gefangenen, bemühe Rechtsvorschriften, aber ohne Resonanz – und im Ergebnis ohne Erfolg.
Dann kündige ich an: »Ich werde mir den Gefangenen Schuller holen und ihm auf der Effektenkammer ein nagelneues und somit vorschriftsmäßiges Handtuch aushändigen lassen. Auch wenn das eigentlich Ihre Aufgabe ist, Herr Baumann! Sollte so etwas noch einmal vorkommen, könnte ich gezwungen sein, unter Einbeziehung dieses Vorfalls Maßnahmen der Dienstaufsicht zu ergreifen. Meinen so hübsch verzierten Abhilfebescheid nehme ich schon mal mit.«
Ich löse das Schriftstück von der Tür ab und wünsche einen guten Tag. Soweit ich mich erinnern kann, sind ähnliche ärgerliche Querschüsse aus der Verwaltung danach kaum noch vorgekommen. Weniger offensichtliche allerdings schon; beispielsweise indem man eine Angelegenheit einfach versanden ließ.
Ebenfalls eine negative Einstellung zu den Gefangenen, jedoch in etwas anderer Ausprägung, hatte unser Oberlehrer Schurkowsky, genannt Ben Schur: ein kleiner, pummeliger Endvierziger, glatzköpfig, sehr beweglich, redselig, etwas distanzlos, eigentlich immer gut gelaunt und braun gebrannt, Kunde bei einem der damals neu in Mode gekommenen Sonnenstudios. Er behauptete, Karatemeister zu sein, und vollführte zur Demonstration seiner Fähigkeiten drollige Luftsprünge, von einem Pfiff durch die Zähne begleitet. Jeden Gefangenen, der ihn angreifen würde, tönte er, würde er sofort mit beiden Füßen anspringen und so mit Leichtigkeit abwehren und zu Fall bringen. Erfreulicherweise musste er das niemals unter Beweis stellen.
Ihm war als Faktotum ein uniformierter Beamter des Aufsichtsdiensts beigeordnet, im Anstaltsjargon »der Unterlehrer« genannt: ein vorgealterter Tattergreis, den man wegen seiner Gebrechlichkeit im Aufsichtsdienst nicht mehr einsetzen wollte. Wofür waren die zwei eigentlich da? Keiner wusste es genau, denn Unterricht erteilten beide nicht. Aber halt: Der Oberlehrer war für die Gefangenenbücherei zuständig, wenngleich diese hauptamtlich von einem Lebenslänglichen gemanagt wurde. Der hatte früher einmal angefangen, Philosophie zu studieren, dann aber seine Freundin ermordet. Aufgrund seiner Vorbildung galt er als für die Bücherei besonders geeignet.
Eines betrachtete Ben Schur aber doch als seine Pflicht: nämlich, die ausgeliehenen Bücher nach ihrer Rückgabe vom Lebenslänglichen genauestens auf Beschädigungen überprüfen zu lassen. Waren solche festzustellen, wurden die Bücher der hauseigenen Buchbinderei zur Reparatur zugeleitet. Die Kosten dafür bekam der letzte Entleiher vom Oberlehrer in Rechnung gestellt und von seinem Arbeitslohn abgezogen. Der betrug damals für eine Stunde meist stumpfsinniger Gefängnisarbeit, wie Gartenstühle mit Plastikschnüren bespannen, nur wenige Pfennige am Tag. Diese Entscheidungen persönlich zu treffen, ließ sich Ben Schur nicht nehmen.
Einmal war einem Gefangenen ein Taschenbuch über das Schachspiel so ins Klo gefallen, dass es, weil total verquollen, auch in unserer Buchbinderei nicht mehr repariert werden konnte. Totalschaden also. Wegen der vom Oberlehrer aufgestellten und dem Gefangenen vom Hausgeld abgezogenen Rechnung beschwerte dieser sich bei mir. Sie lautete: Neupreis des rororo-Taschenbuches: 1,80 DM, plus Reparaturkosten in den vier Vorjahren: 6,10 DM, in diesem Jahr: 3,20 DM, zusammen also 11,10 DM.
Ich versuchte, Ben Schur zu erklären, dass der Schaden dem Gefangenen so nicht in Rechnung gestellt werden kann.
»Aber Herr Walter, das sind die tatsächlich der Anstalt entstandenen Kosten! Anschaffungspreis plus mehrere Reparaturen, das ergibt den Gesamtschaden.«
»Das Buch war doch alt und gebraucht, aus der billigsten Taschenbuchreihe! Und die früheren Reparaturen können diesem Gefangenen ja nicht zur Last gelegt werden, weil nicht er, sondern andere sie verursacht haben. Außerdem haben Sie diese Kosten bereits früher von anderen Gefangenen eingezogen.«
»Ich bleibe dabei, das Buch hatte inzwischen einen Wert von 11,10 DM. Es war zwar alt, war aber seit der letzten Reparatur nicht mehr nur kartoniert, sondern mit einem neuen Buchrücken versehen. Diesen Betrag muss ich ihm berechnen und von seinem Konto abbuchen lassen.«
»Bei jedem Schadensersatz muss es einen Abzug geben«, erwiderte ich, »wenn die beschädigte Sache schon längere Zeit gebraucht und sogar mehrfach repariert ist. Wäre es anders, müssten Sie für Ihren neun Jahre alten VW-Käfer, für den Sie neu ca. 9 800 DM bezahlt haben, wegen der vielen Reparaturen auf dem Gebrauchtwagenmarkt glatt das Doppelte des Anschaffungspreises bekommen. Das ist aber bekanntlich nicht so. Kein Gericht würde Ihnen im Falle eines Totalschadens 20 000 DM Schadensersatz, also Neupreis plus alle Reparaturkosten, für die alte Kiste zusprechen.«
Alles Argumentieren half nichts, der Oberlehrer war nicht zu überzeugen. Ich musste deshalb den von dem Gefangenen zu leistenden Schadensersatz nach meinem Ermessen festsetzen: halber Neupreis, demnach 0,90 DM. Zahlstelle mit der Bitte um entsprechende Buchung.
Ben Schur hatte ein Geheimnis, wie sich später herausstellte. Einmal im Jahr ging er auf Betteltour bei einer großen ortsansässigen Fabrik, die Schulartikel und Schreibwaren herstellte. Dort erbat und erhielt er »für die armen Gefangenen« jedes Mal Spenden in Form von Schulheften in allen Größen, Zeichenblöcken, Schreibstiften, Wasserfarbenkästen, Zirkelsets, Rechenschiebern et cetera. Nur: Er gab diese Spenden nie an die Gefangenen weiter, sondern hortete all dieses Material in einem abgelegenen Lagerraum.
Als wir nun infolge Überbelegung einer benachbarten Justizvollzugsanstalt vierzig jugendliche Untersuchungsgefangene übernehmen mussten, fiel mir die Aufgabe zu, für diese eine besondere Abteilung einzurichten. Weil viele von ihnen noch schulpflichtig waren, hatte ich diese auch mit einem ausgewogenen Angebot von Unterricht, Arbeit und Freizeit auszustatten. Auf der Suche nach Material und Möglichkeiten kam ich ihm durch Hinweise von Kollegen auf die Schliche und fand sein Depot. Darauf angesprochen, dass das Beiseiteschaffen von Spenden sogar strafbarer Betrug sein könnte, erklärte Ben Schur treuherzig: »Diese Sachen sind viel zu schade für die Gefangenen. Die machen nur alles kaputt. Denen kann man so etwas nicht geben. Brauchen Sie vielleicht etwas für Ihre Kinder?«
Aber alles Jammern wie auch sein Angebot für meine Kinder half ihm nichts. Auf mein Geheiß musste der Unterlehrer alles auf zwei Plattenwagen laden und an meine jungen Untersuchungsgefangenen ausgeben. Es versteht sich, dass mir Ben Schur diese Aktion lange Zeit sehr übel genommen hat. Als ich eineinhalb Jahrzehnte später Leiter der Jugendstrafanstalt in Adelsheim war, erschien er eines Tages von sich aus dort und brachte, sozusagen als nachträgliche Sühneleistung, einen großen Karton mit Spenden dieser Firma mit. Dieses Mal beteiligte er sich selbst freudig an der Verteilung an die Jugendlichen.
In meiner mehrmals wöchentlich abgehaltenen Sprechstunde haben sich zahllose Gefangene über Ungerechtigkeiten, Einschränkungen, abgelehnte Anträge und vieles andere beschwert. Das war der Normalfall. Aber nur ein einziges Mal hat sich ein Gefangener nicht über irgendwelche tatsächlichen oder empfundenen Beschwernisse beklagt, sondern über das Gegenteil: über zu lockere Verhältnisse in der JVA Heilbronn!
Gerd Schwarzkopf, ausnahmsweise schon ein Mann Ende 30 und angelernter Maler, war wegen der brutalen Tötung einer Prostituierten im Laufe eines Streits zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Da man keine günstige Kriminalprognose erkennen konnte, war er in die für solche Gefangenen vorgesehene JVA Bruchsal eingewiesen worden. Nachdem er dort einige Jahre verbüßt hatte, wurde auf seinen Antrag hin die Sache noch einmal überprüft – mit dem Ergebnis, dass man ihm nun eine sogenannte »Erprobungsprognose« stellte. So wurde er zur Prüfung, ob nicht doch eine günstige Prognose bejaht werden könnte, ins Heilbronner Gefängnis verlegt. Wenige Tage danach erscheint er in meiner Sprechstunde und beklagt sich:
»Das ist ein wüstes Kuddelmuddel hier, nicht auszuhalten! Viel zu laut, alle rennen durcheinander, keine Ordnung beim Abrücken zur Arbeit, das volle Chaos beim Hofgang. Freizeit jeden Tag bis abends; und danach wird noch bis in die Puppen Lärm gemacht. Das halte ich nicht aus! Ich beantrage meine sofortige Rückverlegung nach Bruchsal. Dort habe ich wenigstens Ordnung und meine Ruhe.«
Ich bin überrascht und erkundige mich nach den offenbar noch etwas altväterlichen Verhältnissen in Bruchsal, einem ehemaligen Männerzuchthaus. »Dort herrschen noch Zucht und Ordnung und eiserne Disziplin«, berichtet er. »Wer nicht spurt, fliegt in den Bunker.« Nach längerer Diskussion des Für und Wider rigider Ordnungsvorschriften mache ich ihm den Vorschlag:
»Herr Schwarzkopf, Sie schauen sich die Verhältnisse hier in unserer Anstalt jetzt einmal drei Wochen lang an. Solange mache ich nichts. Danach können Sie sich wieder zu meiner Sprechstunde melden. Und wenn Sie bei Ihrer Ansicht geblieben sind, werde ich sofort Ihre Rückverlegung nach Bruchsal veranlassen. Einverstanden?« Nach einigem Zögern antwortet er: »Okay, wenn Sie meinen …«
Nach drei Wochen erscheint Herr Schwarzkopf wieder und sagt: »Danke für Ihren Vorschlag. Ich bleibe hier, habe mich nun doch ganz gut eingewöhnt. Es winkt mir ja jetzt auch schon Arbeit als Maler außerhalb der Anstalt, wenn auch zunächst unter Aufsicht. Die Chance für eine solche Lockerung möchte ich mir nicht entgehen lassen.«
Einige Jahre später, nach seiner vorzeitigen Entlassung zur Bewährung, ist Herr Schwarzkopf sogar ein Freund unserer Familie geworden und einige Male bei uns zu Gast gewesen. Solche manchmal auch amüsanten Begebenheiten bedeuten freilich nicht, dass meine Probleme in den ersten Gefängnismonaten schon ihre Lösung gefunden hätten. Im Gegenteil: Der größte Schock sollte erst noch kommen.
Die meisten Leiterinnen oder Leiter einer Justizvollzugsanstalt haben die Befähigung zum Richteramt, das heißt die beiden juristischen Staatsexamina. Viele sind früher bei Gericht oder Staatsanwaltschaft tätig gewesen. Eine Minderheit besitzt einen psychologischen, medizinischen, soziologischen oder pädagogischen Hochschulabschluss.
2. Bewerbung
»Aus welchem Grund bist du eigentlich in den Strafvollzug gegangen«, hat mich einmal einer meiner Freunde gefragt, und zwar mit besonderer Betonung auf dem Du, »und bist also eine Art akademischer Gefängniswärter geworden, der Zerberus vom Knast«?
Das war im Rahmen einer hitzigen politischen Debatte, in der ich wohl einen seiner Auffassung widersprechenden, womöglich etwas rigiden Standpunkt eingenommen hatte. Worum es in dieser Diskussion überhaupt ging, erinnere ich heute nicht mehr. Dass mich aber die in seiner spitzigen Frage enthaltene Unterstellung eines sublimen Sadismus getroffen hat, weiß ich noch gut. Ich hatte die einschlägige psychoanalytische Literatur zum Strafrecht und seinen Vertretern durchaus studiert. Mir war deshalb bewusst, dass die Identifizierung mit der strafenden Gesellschaft vielen Juristen das Ausleben von Aggressionen in erlaubter Form ermöglicht. Kurz: Ich ärgerte mich, dass er mit dieser doppelt vergifteten Frage nicht nur meine berufliche Stellung abwerten, sondern mich auch noch in die repressive Ecke stellen wollte.
Ja, warum bin ich als hoffnungsvoller junger Jurist eigentlich im Strafvollzug gelandet? Zufall oder Berufung oder beides? Wenn man das im Nachhinein so genau sagen könnte … Wie es dazu gekommen ist, lässt sich aber leicht rekonstruieren.
Schon während meiner Zeit als Gerichtsreferendar habe ich immer nebenher in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, zwecks Aufbesserung des Familieneinkommens. Schließlich hatten wir schon zwei Kinder. Nach bestandenem zweitem Staatsexamen war es daher zunächst meine Absicht, weiter als Anwalt tätig zu sein, am liebsten als Strafverteidiger. Dazu fühlte ich mich nach den ersten gemachten Erfahrungen berufen: der notorischen Straflust im Justizapparat entgegenarbeiten, den Verfolgten beistehen. Von den renommierten Heilbronner Anwaltskanzleien lagen mir beste Angebote vor. Andererseits will der Leiter der Arbeitsgemeinschaft für Gerichtsreferendare, ein Vorsitzender Richter am Landgericht, mich gerne für den Staatsdienst gewinnen und spricht mich deshalb an:
»Ich halte Sie für eine Tätigkeit im Justizdienst für überdurchschnittlich gut geeignet. In Anbetracht Ihrer praktischen Begabung dürfte im Beruf noch eine deutliche Leistungssteigerung zu erwarten sein. Deshalb habe ich für Sie einen kurzfristigen Termin im Justizministerium arrangiert, beim Chef der Strafvollzugsabteilung. Auch wenn Sie, wie ich weiß, zum Anwaltsberuf tendieren, sollten Sie den Termin ganz unverbindlich wahrnehmen. Der Herr Ministerialdirigent Reuschenbach ist aktuell auf der Suche nach einem Stellvertreter des Direktors der Justizvollzugsanstalt Heilbronn. Kommenden Montag um 11:00 Uhr erwartet er Sie in Stuttgart zu einem unverbindlichen Gespräch.«
Nun ja, wenn schon alles vorbereitet ist, warum nicht ein solches doch reizvolles Angebot prüfen, sagte ich mir nach ausführlicher Diskussion mit meiner Frau – und bestätigte den Termin.
Wenige Tage später, an einem herrlichen Junitag, fahren Moni und ich, selbstverständlich ordentlich gekleidet, nach Stuttgart. Gegenüber dem Schloss, im noblen Königsbau mit seiner eindrucksvollen Säulenfassade, ist die Strafvollzugsabteilung des Justizministeriums standesgemäß untergebracht. »Wird nicht lange dauern«, sage ich zu Moni, »es ist ja nur ein Informationsgespräch. Du kommst doch mit, oder?«
»Nein, wenn es nicht lange dauert, kann ich ja auch noch ein paar Geschäfte anschauen und warte dann hier draußen auf der Treppe.«
Ich melde mich also im Vorzimmer von Herrn Ministerialdirigent Reuschenbach und werde sofort hereingebeten. Er ist ein sehr höflicher und jovialer Mann, mittelgroß, spärliche graue Haare, Endfünfziger. Einst wohl schlank und sportlich, nun ein wenig aus der Form geraten, aber keineswegs verlebt, sondern ein resoluter Mann in den besten Jahren, wie man so sagt. Gepflegtes Äußeres, dunkelblauer Anzug und Krawatte. Ein hoher Ministerialbeamter, der sich bei aller Verbindlichkeit knapp und präzise auszudrücken weiß. Im Zweiten Weltkrieg war er, wie ich später von Kollegen erfahre, Offizier, Kommandant einer Rotte von Kampfpanzern. Das scheint in seiner Art zu sprechen noch nachzuwirken. Erfreulicherweise stellte er sich später aber keineswegs als rückwärtsgewandter Oldtimer heraus, sondern im Gegenteil als mutiger Strafvollzugsreformer.
Er erkundigt sich nach meiner Familie, dem bisherigen beruflichen Werdegang, meinen Wünschen und Vorstellungen. Insgesamt ist es eine angenehme und angeregte Unterhaltung. Natürlich hat er von dem Leiter unserer Arbeitsgemeinschaft schon einige Informationen über mich eingeholt. Er weiß, dass ich politisch engagiert bin und links stehe. Zu meiner Verwunderung scheint ihn das aber nicht im Geringsten zu stören. Irgendwie muss er einen Narren an mir gefressen haben. Jedenfalls ist er im höchsten Maße an mir interessiert.
»Und wie ist das zweite Staatsexamen ausgefallen, ich meine, welche Note haben Sie erreicht, wenn man fragen darf?«
»Befriedigend.«
»Dann ist ja alles in bester Ordnung! Ich würde Sie gerne zum 1. August einstellen. Sie sind dann sofort stellvertretender Leiter der Justizvollzugsanstalt Heilbronn, die Nummer zwei unter 170 Mitarbeitern. Der dortige Chef, Herr Graf, freut sich, wenn er wieder einen zweiten Mann für die Anstaltsleitung bekommt.«
»Herr Reuschenbach, ginge das vielleicht auch schon zum 15. Juli?«, frage ich etwas verlegen und gestehe, dass bei uns inzwischen Ebbe im Portemonnaie herrscht, weil nach dem Examen kein Geld mehr von der Landesoberkasse kommt.
»Überhaupt kein Problem«, sagt er. »Wissen Sie was, das machen wir sofort fertig! Ich rufe den Oberamtsrat Schulz, der soll Ihnen gleich hier Ihre Bewerbung schreiben, und Sie fangen am 15. Juli in Heilbronn an. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.«
Ich bin baff, denn ich wollte alles erst noch mal ausführlich mit Moni besprechen, sage aber kurz entschlossen: »Ja, einverstanden.« Er nimmt den Telefonhörer ab, ruft Herrn Schulz herein und informiert ihn kurz über die Einzelheiten. Nach sehr freundlicher Verabschiedung folge ich diesem in sein Büro. Vorher gehe ich noch einmal hinaus und berichte meiner Frau, die auf der Treppe sitzt und wartet, dass es noch etwas dauern wird: »Stell dir vor, ich soll hier sofort meine Bewerbung einreichen!« Dann wieder hinein.
Herr Schulz ist ein altgedienter Verwaltungsmann, wohl kurz vor dem Ruhestand. Grauer Anzug, graues schütteres Haar, graue Haut, runzeliges Gesicht, welke Wangen und Tränensäcke unter den graublauen Augen, fast keine Brauen, eine zweigeteilte Hornbrille auf der porigen Nase, ein leicht leidender Zug um den zerknitterten Mund. Zum Erscheinungsbild des typischen Subalternbeamten fehlen eigentlich nur noch die Ärmelschoner. Er sieht also ziemlich verwittert und verdorrt aus, spricht andererseits aber wie einer, der genau weiß, was zu tun ist. Etwas umständlich spannt er einige Blätter samt Kohlepapier in seine altertümlich wirkende mechanische Schreibmaschine ein, ein bejahrtes Adler-Behördenmodell. Im Zweifingersuchsystem legt er los, tippt aber erstaunlich schnell.
Er schreibt unter meinem Namen und meiner Adresse meine Bewerbung an das Justizministerium (»Um Einstellung in den höheren Justiz- und Verwaltungsdienst bei der JVA Heilbronn«). Und das macht er zwar etwas betulich, aber gekonnt: Personaldaten aufnehmen, dabei laut formulieren und gleichzeitig in die Maschine tippen, nächste Frage, und so weiter. Nachdem alle persönlichen Daten aufgenommen sind, schreibt er als Schlusssatz des Bewerbungsschreibens: »Meine Vermögensverhältnisse sind geordnet.« Fertig und Unterschrift.
Gerade will er die Papiere aus der Maschine ziehen, da interveniere ich: »Das können wir so nicht ausdrücken«, sage ich kleinlaut und werde unwillkürlich rot, »unser Konto ist zurzeit mit fast 1 000 DM überzogen.«
»Und sonst keine Schulden?«, fragt er.
»Nein, nein, natürlich nicht, aber …«, stottere ich.
»Um Himmels willen, junger Mann! Was glauben Sie, wie viele Schulden andere haben! Machen Sie sich keine Sorgen, da sind Ihre Vermögensverhältnisse immer noch bestens geordnet!«, erklärt er amüsiert und zieht meine fertige Bewerbung aus der Maschine. Er lässt mich alles noch einmal durchlesen, zeigt mir, wo ich unterschreiben muss, und gibt mir zum Schluss eine Kopie meiner schriftlichen Bewerbung. Perfekt!
»Was muss ich jetzt noch machen?«, frage ich.
»Bloß noch die in der Bewerbung aufgeführten Unterlagen nachreichen, also Zeugnisse für die beiden juristischen Staatsexamina, den Vorbereitungsdienst und ein polizeiliches Führungszeugnis.«
Beim Stichwort Führungszeugnis zucke ich erst mal zusammen. Aber dann fällt mir wieder ein, dass ich ein solches schon vor Jahren für die Ernennung zum Gerichtsreferendar vorlegen musste und dass es zu meiner Erleichterung blütenrein war. Ein Eintrag aus dem Jahre 1961 war bereits getilgt. Im zarten Alter von 16 Jahren war ich nämlich beim Jugendgericht angeklagt und verurteilt worden, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den Führerschein bekommt man mit 16 ja auch dann nicht, wenn man, wie ich seinerzeit, tadellos und absolut unfallfrei Auto fährt – und zwar mit Vaters schickem Haifischflossenford, um bei den Mädels anzugeben. Aber ich war halt nicht nur von diesen gesehen worden, sondern auch von der männlichen Konkurrenz, und die zeigte mich an …
»Alles andere veranlassen wir«, ergänzt Herr Schulz noch. »Und natürlich am 15. Juli morgens in der JVA Heilbronn Ihren Dienst antreten. Herzlichen Glückwunsch und einen guten Anfang! Auf Wiedersehen, Herr Walter.«