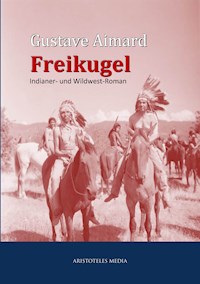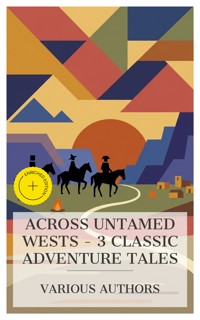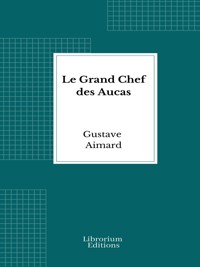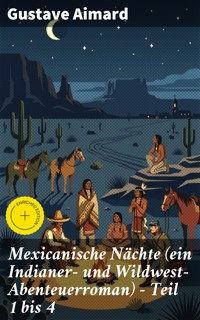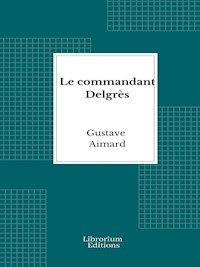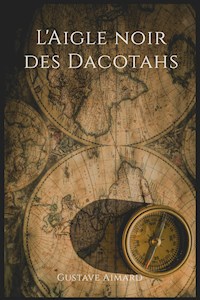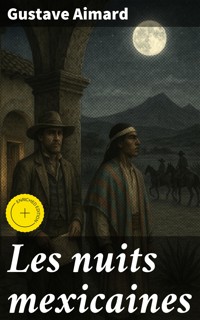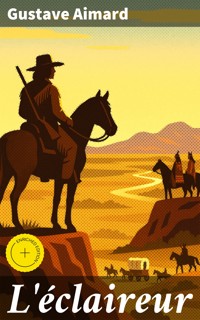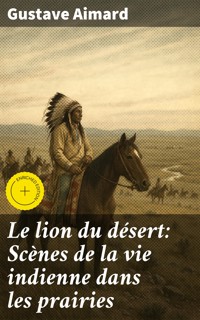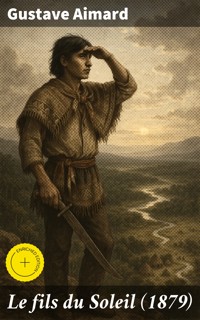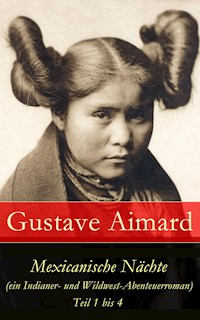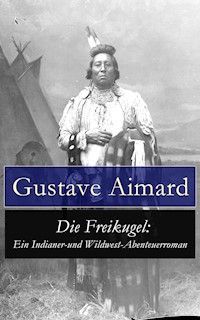1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In "Die Freikugel: Ein Indianer- und Wildwest-Abenteuerroman" entführt Gustave Aimard seine Leser in die rauen Weiten des amerikanischen Westens. Der Roman schildert packende Abenteuer, geprägt von den Konflikten zwischen den amerikanischen Ureinwohnern und den stetig vorrückenden Siedlern. Mit einem lebendigen, actiongeladenen Schreibstil gelingt es Aimard, die komplexe Beziehung zwischen Natur, Mensch und Kultur eindringlich darzustellen. Die Entwicklung des Protagonisten, seine moralischen Dilemmata und der oft tragische Ausgang seiner Konflikte sind zentrale Themen, die den Leser in einen tiefen literarischen Kontext eintauchen lassen. Aimard, ein französischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, war bekannt für seine tiefen Kenntnisse der amerikanischen Landschaft und der indianischen Kulturen, die er durch seine eigenen Reisen und Erlebnisse erworben hatte. Sein facettenreiches Werk spiegelt das Gewirr aus Mythen und der Realität einer turbulenten Epoche wider, die von Expansion und kulturellen Begegnungen geprägt ist. Diese persönliche Erleuchtung und seine Leidenschaft für den Wilden Westen sind die Triebfedern hinter "Die Freikugel". Dieses Buch ist nicht nur für Liebhaber von Abenteuerromanen unverzichtbar, sondern auch für alle, die ein feines Gespür für die historische und kulturelle Tiefe der Ureinwohner Amerikas entwickeln möchten. Aimards eindringliche Schilderungen und seine Fähigkeit, das Gefühl von Freiheit und Gefahr einzufangen, machen "Die Freikugel" zu einem fesselnden Leseerlebnis. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die Freikugel: Ein Indianer-und Wildwest-Abenteuerroman
Inhaltsverzeichnis
Einführung
An der brüchigen Grenze zwischen Gesetz und Gesetzlosigkeit entscheidet eine einzige Handlung über Loyalität, Ehre und Überleben. Die Freikugel führt in jene Spannungszone, in der Menschen am Rand der bekannten Welt miteinander handeln, verhandeln und ringen. Der Roman inszeniert den klassischen Gegenraum zur Zivilisation: offen, gefährlich, von Möglichkeiten und Risiken zugleich erfüllt. Dabei entsteht ein Konfliktfeld, das nicht nur körperliche Gewandtheit, sondern auch moralische Standfestigkeit verlangt. Von Beginn an schwingt die Frage mit, wie weit man gehen darf, um das Eigene zu schützen, und was es kostet, ein Versprechen zu halten, wenn die Ordnung prekär und das Recht weit entfernt ist.
Gustave Aimard (1818–1883), französischer Autor zahlreicher Abenteuerromane, wurde im 19. Jahrhundert besonders für seine Erzählungen aus dem „Indianer- und Wildwest“-Milieu bekannt. Die Freikugel: Ein Indianer-und Wildwest-Abenteuerroman steht in diesem Kontext und verortet seine Handlung in den nordamerikanischen Grenzräumen. Wälder, Prärien und Flussläufe bilden die Kulisse, in der Reisende, Trapper, Soldaten und indigene Gemeinschaften aufeinanderstoßen. Der Roman ist Teil jener populären Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die oftmals im seriellen oder verlegerischen Umfeld massenhaft kursierte und bald in mehrere Sprachen, darunter Deutsch, übertragen wurde. Er verbindet Schauwert, Tempo und das Versprechen exotischer Ferne.
Die Ausgangssituation führt unterschiedliche Gruppen zusammen, deren Wege sich unter riskanten Umständen kreuzen und ein unübersichtliches Spiel aus Bündnissen, Täuschungen und Bewährungsproben eröffnen. Ohne vorzugreifen, lässt sich sagen: Ein Ereignis von besonderer Tragweite setzt die Kette der Entscheidungen in Gang. Aimards Erzählweise setzt auf rasche Szenenwechsel, klare Bewegungsachsen und körperlich spürbare Landschaften. Das Leseerlebnis oszilliert zwischen alarmierter Aufmerksamkeit in Momenten akuter Gefahr und ruhigen Passagen, in denen Gespräche, Lagerfeuer und Fährtenlesen Atmosphäre und Hintergrund vertiefen. Der Ton bleibt dabei erzählerisch souverän, gelegentlich pathetisch, doch immer auf Verständlichkeit, Spannung und Anschaulichkeit ausgerichtet.
Zentrale Themen sind Grenzüberschreitungen im wörtlichen wie übertragenen Sinn: die Suche nach Zugehörigkeit, das Ringen um Gerechtigkeit jenseits fester Institutionen und die Frage, welche Regeln gelten, wenn der Boden unter den Füßen wechselhaft wird. Identität und Loyalität stehen auf dem Prüfstand, ebenso Vertrauen und Verrat. Gewalt erscheint als Mittel, aber nie ohne Konsequenzen. Der Titel lädt ein, über Entscheidung und Zufall, Können und Schicksal nachzudenken – über jene eine Handlung, die alles wendet. Dabei wird die Natur nicht nur zur Kulisse, sondern zum Prüfstein: Wetter, Terrain und Distanz wirken wie zusätzliche Figuren, die den Ausgang offener Konflikte mitbestimmen.
Erzählerisch arbeitet der Roman mit einem überwiegend allwissenden Blick, der Handlungslinien bündelt und sinnfällig strukturiert. Aimard setzt auf Zuspitzungen am Kapitelende, die zum Weiterblättern drängen, und auf kontrastreiche Figurenzeichnungen: markante Helden- und Gegenfiguren, flankiert von Nebenrollen, die das Spannungsfeld weiten. Wo die Handlung beschleunigt, verdichten sich Dialoge und Aktionen; wo sie innehält, treten topografische Details und Beobachtungen hervor. Diese Wechselwirkung verleiht dem Text eine rhythmische Dynamik. Stilistisch trägt die historische Sprache der Entstehungszeit dazu bei, eine eigenständige Atmosphäre zu schaffen, die heutigen Leserinnen und Lesern gleichsam fremd und doch unmittelbar anschaulich erscheinen kann.
Für ein heutiges Publikum bietet Die Freikugel zweierlei: den Reiz eines zupackenden Abenteuerromans und das Dokument einer literarischen Imagination des 19. Jahrhunderts. Der Text spiegelt Perspektiven und Begriffe seiner Zeit, die aus heutiger Sicht kritisch befragt werden können – insbesondere in der Darstellung indigener Gruppen und interkultureller Begegnungen. Wer den Roman als historische Quelle liest, erkennt, wie populäre Erzählungen Bilder vom „Westen“ prägten, lange bevor Kino und moderne Massenmedien diese Motive weitertrugen. Zugleich öffnet die Geschichte Fragen nach Recht, Verantwortung und Gemeinschaft, die über ihren Entstehungsmoment hinaus aktuell bleiben.
Diese Einleitung lädt dazu ein, Die Freikugel als doppelte Erfahrung zu lesen: als bewegte Reise durch gefährliche Landschaften und als Reflexion über Entscheidungen unter Druck. Wer Abenteuerliteratur schätzt, findet Tempo, klare Konflikte und das suggestive Bild eines Grenzraums, der Menschen auf das Wesentliche zurückwirft. Wer historische Erzählweisen erkunden möchte, kann die literarische Konstruktion von Fremde, Nähe und Moral nachzeichnen, ohne dass die Handlung vorweggenommen wird. So eröffnet der Roman eine Lektüre, die Spannung und Nachdenklichkeit verbindet – und die zeigt, wie stark die Imagination eines Zeitalters in seinen Geschichten fortlebt.
Synopsis
Die Erzählung eröffnet im weiten Grenzland zwischen Prärie, Wüste und Bergwäldern, wo Siedler, Trapper und indigene Nationen in einem fragilen Gleichgewicht koexistieren. Gerüchte über eine geheimnisvolle Freikugel, deren Schuss nie fehlgeht, kursieren unter Jägern und Desperados. Diese Legende schürt Misstrauen und Ehrgeiz zugleich, denn sie verspricht Macht in einer Welt, die vom Zufall des Augenblicks beherrscht wird. Vor diesem Hintergrund setzt die Handlung ein: ein scheinbar zufälliges Zusammentreffen verschiedener Reisender führt zu einer Weggemeinschaft, die von Handelsinteressen, privaten Hoffnungen und unklaren Motiven zusammengehalten wird.
Früh geraten die Figuren in einen Konflikt, der die Spielregeln des Grenzlandes deutlich macht: Ein Streit um Jagdgründe und Beute eskaliert, wobei List und Ortskenntnis wichtiger sind als rohe Gewalt. Der Ruf eines außergewöhnlich treffsicheren Schützen macht die Runde, und die Legende der Freikugel erhält erstmals Gewicht. Zugleich zeigt sich, dass hinter offenen Auseinandersetzungen verborgene Interessen stehen. Ein erfahrener Scout mahnt zur Vorsicht, ein junger Jäger sucht Anerkennung, und reisende Kaufleute wollen ihre Ware sicher durchbringen. Das Spannungsfeld aus Ehre, Gewinn und Überleben bildet den Motor der kommenden Entscheidungen.
Eine Etappe führt in eine Grenzsiedlung, wo Versorgung, Nachrichten und Gerüchte zusammentreffen. Hier verdichtet sich das Ziel der Gruppe: eine heikle Passage durch umkämpftes Gebiet, bei der Führung, Kundschaft und Diplomatie gefragt sind. Ein Hinweis auf verschwundene Lasten und dubiose Zwischenhändler weckt Verdacht, dass mehr hinter jüngsten Überfällen steckt als bloße Hungerzüge. Verträge werden geschlossen, provisorische Allianzen geschmiedet, und Regeln für den Marsch festgelegt. Zugleich wächst der Schatten der Freikugel: Wer sie besitzt oder beherrscht, könnte den Verlauf der kommenden Begegnungen bestimmen, ob als Schutz oder als Drohung.
Der Zug bricht in die Wildnis auf. Wechselnde Landschaften fordern Ausdauer und Umsicht: Trockentäler, Büffelpfade und enge Pässe. Begegnungen mit unterschiedlichen Stämmen zeigen, dass die Prärie politische Linien kennt, die nicht auf Karten stehen. Scout und Wortführer versuchen, Signale zu deuten, Geschenke klug einzusetzen und Missverständnisse zu vermeiden. Aus Spuren im Sand und Spähzeichen im Gras entsteht das Bild einer Unsichtbaren Hand, die Überfälle lenkt und Spuren verwischt. Die Idee der Freikugel wandelt sich vom bloßen Aberglauben zu einem Symbol für gezielte, unsichtbare Einflussnahme, gegen die rohe Kraft wenig ausrichten kann.
Ein erster großer Prüfstein folgt als Hinterhalt, der nicht zur erwarteten Stunde zuschnappt. Frühwarnzeichen, Disziplin und das Gespür der Kundschafter verhindern das Schlimmste. Doch der Angriff legt Schwächen offen: Uneinigkeit über Marschordnung, unklare Zuständigkeiten, persönliche Rivalitäten. In entscheidenden Momenten zeigt sich die Wirkung einer Kugel, die wie vom Schicksal gelenkt scheint. Ob es Können, Zufall oder Legende ist, bleibt unklar, doch die Gruppe rückt enger zusammen. Der Weg wird härter, die Vorräte knapper, die Verantwortung größer. Das Geschehen lenkt die Handlung von offenen Straßen in Schluchten, in denen Irrtum und Erkenntnis nah beieinander liegen.
Ein Vertrauensbruch erschüttert die Gemeinschaft. Zwischen Weggefährten treten alte Rechnungen zutage, und die Frage, wer wessen Spur kreuzt, erhält eine persönliche Färbung. In nächtlichen Gesprächen kommen Beweggründe ans Licht: Stolz, Verlust, Ehrgeiz und die Suche nach Zugehörigkeit. Gleichzeitig tauchen Belege für ein Netzwerk auf, das Handel, Gewalt und Informationen verknüpft. Das Motiv der Freikugel wird hier zur Prüfung moralischer Grenzen: Ist ein sicherer Schuss ein Segen, wenn er falschen Zwecken dient, oder eine Gefahr, wenn er die Verantwortung der Handelnden überdeckt? Aus der Krise erwächst der Entschluss, aktiv die Fäden zu entwirren.
Die Verfolgung führt die Gruppe in ein Gebiet, das nur mit Ortskenntnis zu durchdringen ist. Späher lauschen auf Hufschlag, prüfen Asche und lesen Grasbruch. Ein wackliger Waffenstillstand mit lokalen Verbündeten ermöglicht Aufklärung ohne offenen Kampf. Stück für Stück fügen sich Hinweise zusammen: Treffpunkte, geheime Routen, Zeichen an Felsen. Der Gegensatz zwischen alter Gesetzlichkeit der Wildnis und der neuen Ordnung der Siedlungen tritt schärfer hervor. Zugleich bereiten beide Seiten ihre Züge vor. Die Legende der Freikugel wirkt als psychologisches Druckmittel, das Mut stärkt oder Furcht sät, je nachdem, wer an sie glaubt und wie sie erzählt wird.
Mehrere Fäden laufen aufeinander zu: eine Wagenkolonne nimmt eine riskante Abkürzung, ein Stoßtrupp setzt auf Überraschung, und Gegner ziehen sich scheinbar grundlos zurück. In der Zuspitzung zeigt sich, dass Taktik, Zeit und Gelände über Leben und Verlust entscheiden. Schüsse fallen, doch nicht jeder Treffer erklärt sich. Ein geheim gehaltenes Motiv tritt an den Rand des Sichtfelds, ohne sich vollständig zu offenbaren. Die Auseinandersetzung bleibt überschaubar und doch exemplarisch, denn sie spiegelt das größere Ringen um Wege, Regeln und Vorrang. Der unmittelbare Ausgang wird nicht ausformuliert, aber die Konsequenzen zeichnen sich in Gesichtern und Entscheidungen ab.
Im Nachhall ordnen sich Wege neu. Bündnisse werden bestätigt oder gelöst, offene Rechnungen teils beglichen, teils vertagt. Die Grenzstadt wirkt wieder alltäglich, doch die Legende der Freikugel hat ihre Gestalt verändert: weniger ein Zauberschuss als Sinnbild für Verantwortung, Konzentration und die Gefahr blinder Gewissheit. Die Erzählung hebt den Wert von Umsicht, Respekt und vermittelnder Stärke hervor, ohne die Härte der Landschaft zu verharmlosen. Ihre zentrale Aussage richtet den Blick auf Maß und Mitte: Mut ohne Übermut, Gerechtigkeit ohne Rache und die Einsicht, dass die Wildnis Regeln kennt, die man lesen muss, bevor man sie zu ändern versucht.
Historischer Kontext
Zeitlich und räumlich lässt sich die Handlung in die nordamerikanischen Grenzräume der 1830er bis 1870er Jahre einordnen, vor allem zwischen dem Rio Grande, Texas und den damaligen US-Territorien New Mexico und Arizona sowie den angrenzenden mexikanischen Provinzen Sonora und Chihuahua. Es ist die Epoche der Frontier, in der Posten wie Santa Fe und Forts am Arkansas oder Rio Grande spärlich besiedelte Prärien, Canyons und Mesas sichern. Indigene Räume der Comanche, Apache und Pueblo-Nationen überlagern sich mit Siedlungsachsen wie dem Santa-Fe-Trail. Der Roman nutzt diese Kulisse aus Grenzstädten, Ranchos, Missionsdörfern und Wildnisrouten, um Begegnungen, Konflikte und wechselnde Rechtsordnungen zu dramatisieren.
Zentral ist die Ideologie des Manifest Destiny (geprägt 1845 von John L. O’Sullivan), die die Expansion der Vereinigten Staaten nach Westen als geschichtliche Mission deutete. Politisch flankiert wurde sie durch Landpolitik wie den Homestead Act von 1862 und durch militärische Präsenz an der Frontier. Historisch führte dies zu massiver Migration, Landnahmen und zur Verdrängung indigener Gesellschaften. Das Buch spiegelt diese Dynamik, indem es Figuren über Siedlungsgrenzen hinausführt, Grenzkonflikte erzählerisch verdichtet und die Spannung zwischen staatlicher Ordnung und selbsthilflicher Gewalt zeigt, die den Alltag in den Grenzräumen prägte und die Handlung motivisch antreibt.
Die texanische Revolution (1835–1836) gegen die Herrschaft von Antonio López de Santa Anna, Schlachten wie das Alamo (Februar–März 1836) und San Jacinto (21. April 1836), sowie die Gründung der Republik Texas (1836–1845) und ihre US-Annexion 1845 schufen eine militarisierte Grenzgesellschaft. Die Texas Rangers (in Vorformen seit 1823) wurden zu symbolischen Akteuren des Grenzraums. Diese Umbrüche etablierten Mustersituationen – Patrouillen, Überfälle, Vergeltungszüge –, die der Roman als Kulisse für Jagden, Spurenlesen und Lagerfeuerverhandlungen nutzt. Der Wechsel von mexikanischer zu US-Souveränität begründete zudem ambivalente Loyalitäten, die sich in zwiespältigen Allianzen und Figurenkonflikten niederschlagen.
Der Mexikanisch-Amerikanische Krieg (1846–1848) unter Präsident James K. Polk, mit Feldzügen von Zachary Taylor am Rio Grande und Winfield Scott bis nach Mexiko-Stadt (September 1847), endete im Vertrag von Guadalupe Hidalgo (2. Februar 1848). Mexiko trat Alta California und New Mexico ab; die Grenze wurde neu gezogen und 1853 durch den Gadsden-Kauf ergänzt. Diese Neuordnung veränderte Handelsrouten, Rechtsräume und Machtverhältnisse. Grenzbanditentum, Guerilla-Gewalt und die Verschiebung von Eigentumsrechten lieferten dramatische Konstellationen, die das Buch thematisiert: Figuren bewegen sich durch umkämpfte Landschaften, wo Papiere, Abzeichen oder Uniformen ihren Schutzwert je nach Seite und Tag verlieren.
Wirtschaftlich prägte der Fernhandel die Region: Der Santa-Fe-Trail (seit 1821) verband Missouri mit New Mexico; Handelsposten wie Bent’s Fort (1833 gegründet) wurden Drehscheiben zwischen US-Händlern, mexikanischen Kaufleuten und Cheyenne- sowie Comanche-Gruppen. Die Ära der Mountain Men und Fallensteller erlebte in den 1820er–1840er Jahren einen Höhepunkt, bevor Pelzpreise sanken und der Handel sich wandelte. Aimards Stoffe greifen typische Praktiken dieser Welt auf – Fährtenlesen, Übersetzerdienste, Vertragsrituale und Brüche –, um Figuren als Scouts, Trapper oder Grenzführer zu positionieren. Das Nebeneinander von Warenzirkulation und Gewalt bildet den historischen Resonanzraum für riskante Karawanenreisen und Hinterhalte.
Konflikte um Land, Jagdgründe und Souveränität führten zu anhaltenden Kriegen gegen indigene Nationen. Für die Southern Plains sind die Comanche-Kriege (1830er–1870er) und später der Red-River-Krieg (1874–1875) markant; im Südwesten kulminierten Auseinandersetzungen im Navajo-Feldzug und dem „Long Walk“ (1864) nach Bosque Redondo. Verträge wie jene von Medicine Lodge (1867) versprachen Frieden, etablierten aber Reservate und neue Abhängigkeiten. Der Roman reflektiert diese Konstellationen, indem er Überfälle, Geleitschutz und fragile Verhandlungen zeigt. Er stellt zugleich die Diskrepanz zwischen formaler Vertragspolitik und der Realität von Raubzügen, Rache und gebrochenen Abkommen an der Frontier erzählerisch aus.
Massive Migrationen veränderten den Westen: Der kalifornische Goldrausch (ab 1848) zog bis 1855 Hunderttausende an, schuf Boomstädte, Vigilantentum und neue Märkte. Die Fertigstellung der transkontinentalen Eisenbahn 1869 beschleunigte Mobilität, Militärlogistik und Warenflüsse. Im Amerikanischen Bürgerkrieg erreichten Konfrontationen auch den Südwesten (Konföderiertenfeldzug in New Mexico 1861–1862; Schlacht am Glorieta Pass, März 1862). Zugleich erschütterte die zweite französische Intervention in Mexiko (1862–1867) die Grenzregion; Kaiser Maximilian I. und Benito Juárez standen für konkurrierende Ordnungen. Das Buch nutzt diese Überlagerung von Kriegsfolgen, Migration und Infrastruktur, um unsichere Loyalitäten und eine „durchlässige“ Grenze dramaturgisch zu entfalten.
Als gesellschaftlich-politische Kritik macht das Buch die Kosten von Expansion, Grenzgewalt und Opportunismus sichtbar. Es zeigt, wie private Bereicherung, Schmuggel und Korruption Rechtsräume aushöhlen, wie militärische und vigilante Akteure Macht substituieren und wie indigene Gemeinschaften durch Verträge, Vertreibungen und Gewalt marginalisiert werden. Indem es Konflikte um Land, Arbeit und Sicherheit in alltägliche Entscheidungen von Scouts, Händlern und Soldaten übersetzt, kritisiert es soziale Ungleichheit und die Instrumentalisierung von Recht. Zugleich spiegelt es europäische Blicke auf US- und mexikanische Politik, wodurch koloniale Logiken, Grenznationalismus und die Ambivalenz von Zivilisation und Gewalt im 19. Jahrhundert problematisiert werden.
Die Freikugel: Ein Indianer-und Wildwest-Abenteuerroman
1
Ein Jägerlager
Inhaltsverzeichnis
Amerika ist das Land der Wunder![1q] Alles gelangt dort zu einer so gewaltigen Entwicklung, daß die Phantasie davor erschrickt und der Verstand stillsteht. Die Berge, Flüsse, Seen und Ströme sind nach einem erhabenen Muster gebildet.
Hier erblicken wir einen Strom des nördlichen Amerika, der nicht mit der Rhône, der Donau oder dem Rhein zu vergleichen ist, deren Ufer mit Städten, Anpflanzungen oder alten, durch die Länge der Zeit verwitterten Schlössern bedeckt, deren Nebenflüsse unbedeutende Gewässer sind und deren in ein zu enges Bett gezwängte Strömung hastig dem weiten Weltmeer entgegenbraust. Sein Wasser ist tief und geräuschlos, seine Breite gleicht einem Meeresarm, sein Anblick ist stolz und streng wie die wahre Größe, und seine Fluten, die unzählige Nebenflüsse geschwellt haben, gleiten majestätisch dahin und benetzen sanft den Rand der tausend Inseln, die sich aus seinem Schlamm gebildet haben.
Jene Inseln, die mit hohen Bäumen bedeckt sind, strömen einen würzigen und herrlichen Duft aus, den die Luft weiterträgt. Ihre Einsamkeit wird durch keinen anderen Laut als den sanften und klagenden Ruf der Taube oder das heisere und durchdringende Geheul des Jaguars unterbrochen, der sich unter den Schatten des Waldes lagert.
Hier und da sammeln sich die Bäume, die entweder durch die Zeit verwittert oder vom Sturm entwurzelt worden sind, auf dem Wasser; dort verbinden sie sich teils durch die Gewinde der Schlingpflanzen, teils durch den Schlamm, der sich dazwischen festsetzt, und bilden schwimmende Inseln; junge Bäumchen fassen auf ihnen Wurzel, der Peitia und die Wasserlilie öffnen ihre gelben Blüten dort, Schlangen, Vögel und Alligatoren wählen jene grünen Fähren zu ihrem Tummelplatz oder Ruhepunkt und werden mit ihm vom Weltmeer verschlungen.
Jener Strom hat keinen Namen!
Andere, die unter derselben Breite liegen, heißen Nebraska, Platte, Missouri.
Jener Strom trägt einfach den Namen Mécha-Chébé, der alte »Vater der Wässer«, der Strom der Ströme, mit einem Wort: der Mississippi! Sein Lauf ist so ausgedehnt und unbegreiflich wie die Unendlichkeit; seinen Ruf umgibt wie den Ganges und den Irawadi ein geheimnisvolles, unheimliches Dunkel, doch ist er für die zahlreichen indianischen Volksstämme, die seine Ufer bewohnen, das Urbild von Fruchtbarkeit, Unendlichkeit, Ewigkeit!
Am 10. Juni des Jahres 1834 saßen zwischen zehn und elf Uhr morgens drei Männer am Ufer des Stromes, ein wenig unterhalb der Stelle, wo er sich mit dem Missouri vereinigt, und verzehrten ihr Frühstück, das aus einem Stück gebratenen Hirschfleisches bestand. Die Stelle, an der sie sich niedergelassen hatten, war eine der malerischsten, die man sich vorstellen kann. Der Strom bildete dort eine anmutig geschwungene Biegung, die von Hügeln eingefaßt war, die im reichsten Blumenschmuck prangten. Die Unbekannten hatten die Spitze des höchsten Hügels zum Ruhepunkt gewählt, von wo aus der Blick ein prachtvolles Panorama umfaßte.
Zunächst breiteten sich dichtbewaldete Haine vor ihnen aus, die beim Hauch des Windes auf und ab zu wogen schienen; während sich auf den Inseln des Stromes unzählige Herden rotgeschwingter Flamingos auf ihren langen Beinen wiegten, Regenvögel und Kardinäle von Zweig zu Zweig hüpften und sich ungeheure Alligatoren träge im Schlamm wälzten. Zwischen den Inseln spiegelten sich die Sonnenstrahlen in den silbernen Fluten. Inmitten jenes blendenden Lichtscheins tummelten sich allerhand Fische auf der Oberfläche des Wassers und zogen schimmernde Furchen. Endlich zeigten sich, soweit der Blick reichen konnte, die Gipfel der Bäume, die die Prärie einfaßten und die ihre dunkelgrünen Spitzen nur wenig am fernen Horizont zeigten.
Die drei Männer aber, die wir schon erwähnten, waren viel zu sehr damit beschäftigt, ihren heißhungrigen Jägermagen zu befriedigen, um sich im geringsten der Naturschönheiten zu erfreuen, die sie umgaben.
Ihre Mahlzeit war übrigens nach wenigen Minuten beendet, und als die letzten Bissen verschlungen waren, zündete der eine seine indianische Pfeife an, während der andere eine Zigarre aus der Tasche zog. Hierauf streckten sie sich auf den Rasen und überließen sich mit jener Behaglichkeit, die den Rauchern eigen ist, dem Genuß einer guten Verdauung, indem sie mit träumerischen Blicken dem bläulichen Rauch folgten, der bei jedem Zug, den sie taten, in langen Säulen emporwirbelte. Der dritte hingegen lehnte sich mit dem Rücken gegen einen Baumstamm, kreuzte die Arme über die Brust und schlief höchst prosaisch ein.
Wir wollen die kurze Frist benutzen, die uns die Jäger lassen, um sie dem Leser vorzustellen und ihn näher mit ihnen bekannt zu machen.
Der erste war ein Kanadier von gemischter Abkunft, der etwa fünfzig Jahre alt sein mochte; er nannte sich Freikugel. Er hatte sein ganzes Leben in der Prärie und unter den Indianern zugebracht und war mit allen ihren Schlichen genau vertraut.
Freikugel war wie die Mehrzahl seiner Landsleute von hoher Gestalt, denn er maß über sechs englische Fuß; seine Glieder waren hager und dürr, seine Arme großknochig, aber mit stahlharten Muskeln versehen. Sein knochiges gelbes, dreieckiges Gesicht trug den Charakter ungewöhnlicher Offenheit und Munterkeit, und seine kleinen grauen, blitzenden Augen leuchteten voll Verstand. Seine vorspringenden Backenknochen, seine Nase, die über den breiten Mund herabhing, aus dem lange und weiße Zähne schimmerten, und sein spitzes Kinn bildeten zugleich das seltsamste und ansprechendste Ganze, das sich denken läßt.
In seiner Kleidung wich er in nichts von der Tracht der übrigen Waldläufer ab, d. h. sein Anzug bildete ein seltsames Gemisch indianischer und europäischer Mode, die sämtliche Jäger und weißen Trapper der Prärie angenommen haben.
Seine Waffen bestanden aus einem Messer, einem Paar Pistolen und einer amerikanischen Büchse, die gegenwärtig neben ihm im Gras, aber doch im Bereich seiner Hand lag.
Sein Gefährte war ein Mann von dreißig, höchstens zweiunddreißig Jahren, der jedoch kaum fünfundzwanzig zu zählen schien und hochgewachsen und Wohlgestalt war. Seine blauen Augen, deren sanfter, träumerischer Blick etwas Weibisches hatte, sowie die dicken Locken blonder Haare, die sich unter den breiten Rändern seines Panamahutes hervorstahlen und nachlässig auf seine Schultern wallten, und die weiße Farbe seiner Haut, die gegen die olivenfarbene, sonnengebräunte Färbung des Jägers grell abstach, deuteten an, daß er nicht unter dem warmen Himmel Amerikas geboren war.
Jener junge Mann war ein Franzose, hieß Charles Eduard de Beaulieu und stammte von einem der ältesten Geschlechter der Bretagne ab.
Die Grafen de Beaulieu haben zwei Kreuzzügen beigewohnt. Charles de Beaulieu verbarg aber unter der etwas weibischen Außenseite den Mut eines Löwen, der sich durch nichts abschrecken oder einschüchtern ließ. Er war nicht nur in allen Leibesübungen bewandert, sondern besaß überdies eine überraschende Kraft, und unter der feinen Haut seiner weißen, aristokratischen Hände schwellten sich eiserne Muskeln.
In einem von jeder Zivilisation so abgeschnittenen Land hätte jedermann, der sich die Zeit genommen hätte, darüber nachzudenken, die Kleidung des Grafen sehr auffallend finden müssen. Er trug einen mit Tressen besetzten grünen Jagdrock nach französischem Schnitt, der über der Brust zugeknöpft war; safrangelbe, hirschlederne Hosen, die mittels eines Gürtels aus Glanzleder um die Hüften befestigt waren, in dem ein Paar prachtvolle Kuchenreutersche Pistolen, eine Patronentasche und ein Jagdmesser in einem Futteral von gebräuntem Stahl mit kunstvoll gearbeitetem Heft steckten; seine Reiterstiefeln reichten ihm bis über die Knie herauf. Seine Büchse mit gezogenem Lauf lag gleich der seines Gefährten auf Armeslänge neben ihm im Gras; jene reichverzierte Waffe war mit dem Namen »Lepage's« bezeichnet und mußte eine unermeßliche Summe gekostet haben.
Der Graf de Beaulieu, dessen Vater den Prinzen in die Verbannung gefolgt und ihnen vorerst in der Condéschen Armee[2] und dann in allen royalistischen Umtrieben eifrig gedient hatte, die während der Kaiserzeit unablässig im Gang waren, bekannte sich seiner politischen Gesinnung nach zu den Ultraroyalisten. Frühzeitig verwaist und Herr eines bedeutenden Vermögens, trat er zuerst unter den Musketieren und später unter der Leibgarde in militärischen Dienst.
Nach dem Sturz Karls X[1]. empfand der Graf, der seine Karriere vernichtet sah, eine tiefe Mutlosigkeit und einen unüberwindlichen Lebensüberdruß. Europa war ihm verhaßt geworden, und er beschloß, es auf immer zu meiden. Er übertrug einem zuverlässigen Mann die Verwaltung seines Vermögens und schiffte sich dann nach den Vereinigten Staaten Nordamerikas ein.
Aber das enge, egoistische, kleinliche Leben in Amerika sagte ihm nicht zu, und der junge Mann konnte ebensowenig die Amerikaner begreifen wie sie ihn. In seinem Durst nach Abenteuern und mit einem Herzen, das sich von den unzähligen Niederträchtigkeiten und Treulosigkeiten, die er die Nachkommen der Pilger von Plymouth täglich begehen sah, tief verletzt fühlte, beschloß er eines Tages, sich dem traurigen Schauspiel, das sich seinen Blicken stündlich bot, dadurch zu entziehen, daß er in das Innere des Landes eindrang und die ungeheuren Steppen und Prärien durchstreifte, aus denen die Ureinwohner vertrieben worden waren, die den Verrätereien und Bübereien ihrer ränkesüchtigen Eroberer weichen mußten.
Der Graf hatte aus Frankreich einen alten Diener mit herübergebracht, dessen Vorfahren bereits seit Jahrhunderten im Dienste der Familie Beaulieu gestanden hatten. Ehe sich der Graf einschiffte, teilte er Ivon Kergollec seine Pläne mit und stellte ihm frei, ob er zurückbleiben oder ihm folgen wolle; der Diener schwankte nicht lange in seiner Wahl, sondern antwortete einfach, daß sein Herr das Recht habe, zu tun, was ihm beliebe, ohne seinen Diener deshalb zu befragen, und da es andererseits unzweifelhaft die Pflicht des letzteren sei, ihm überallhin zu folgen, werde er sich dieser auch nicht entziehen. Als aber der Graf beschloß, die Prärien zu durchstreifen, hielt er es für angemessen, seinen Diener davon in Kenntnis zu setzen; er erhielt aber dieselbe Antwort wie früher.
Ivon war ungefähr vierzig Jahre alt, und seine Erscheinung bot einen ziemlich vollendeten Typus des kecken, zugleich arglosen und schlauen Bauern aus der Bretagne. Sein Wuchs war klein und untersetzt, seine Glieder aber waren wohlgebildet, seine Brust breit, und sein Bau verriet überhaupt tüchtige Kraft. Sein ziegelrotes Gesicht wurde durch ein paar schlau blitzende Augen belebt, die wie Funken leuchteten.
Ivon Kergollec, dessen Leben bisher in den glänzenden Räumen des Palastes der Familie Beaulieu friedlich verflossen war, hatte die ruhigen, regelmäßigen Sitten des Dieners eines vornehmen Hauses angenommen; und da er nie in die Lage gekommen war, Proben seines Mutes abzulegen, wußte er nicht, ob ihm diese Eigenschaft zu Gebote stehe. Obwohl er seinem Herrn bereits seit mehreren Monaten auf dessen Reisen folgte und sich mitunter in einer gefährlichen Lage befunden hatte, waren seine Zweifel noch keineswegs beseitigt; er zweifelte nämlich an sich selbst und war sogar fest überzeugt, daß er nicht mehr Mut habe als ein Hase. Es war daher merkwürdig genug zu sehen, wie Ivon nach einem Zusammentreffen mit den Indianern, bei dem er mit dem Mut eines Löwen gekämpft und wahre Wunder der Tapferkeit vollbracht hatte, sich demütig bei seinem Herrn entschuldigte, daß er sich so schlecht benommen habe, da er noch nicht daran gewöhnt sei, sich zu schlagen.
Es versteht sich von selbst, daß ihm der Graf unter ausgelassenem Gelächter verzieh und ihn damit zu trösten suchte, denn der arme Teufel fühlte sich über seine vermeintliche Feigheit ernstlich unglücklich, hoffend, daß er wahrscheinlich beim nächstenmal besser bestehen und sich mit der Zeit an ein Leben gewöhnen werde, das so verschieden von demjenigen sei, das er bisher geführt hatte.
Bei solchen Tröstungen schüttelte der würdige Diener traurig den Kopf und antwortete mit tiefer Überzeugung: »Nein, nein, Herr Graf, ich werde mir nie Mut aneignen können; ich fühle es, der Mangel an Mut ist mir angeboren, und ich bin ein unheilbarer Feigling, das weiß ich nur zu gut.«
Ivon Kergollec trug eine vollständige Livree, doch war er in Anbetracht der Umstände ebenso vollständig bewaffnet wie seine Gefährten, und seine Büchse lag ebenfalls zur Hand neben ihm im Gras.
Drei prächtige Pferde voll Feuer und Ungeduld standen wenige Schritte von den Reisenden, die wir eben geschildert haben, angepflockt und verzehrten sorglos ihre Mahlzeit, die aus grünen Erbsenblättern und dem jungen Bewuchs der Bäume bestand.
Wir haben vergessen, zwei seltsame Gewohnheiten zu erwähnen, die Herrn de Beaulieu eigen waren. Die erste bestand darin, daß er fortwährend ein niedliches Lorgnon[3], das an einer schwarzen Schnur um seinen Hals hing, im rechten Auge eingeklemmt trug; zweitens trug er ständig Glacéhandschuhe, die, wie wir bekennen müssen, zum großen Bedauern des jungen Herrn anfingen, bedeutend an Glanz und Frische zu verlieren.
Wie kam es, und welcher seltsame Zufall hatte es gefügt, daß Menschen, die sich durch Geburt, Gewohnheiten und Erziehung so bedeutend unterschieden, sich in einer Einöde, die über sechshundert Meilen von jedem zivilisierten Wohnort entfernt war, und am Ufer eines – wenn auch nicht völlig unbekannten, doch bisher noch unerforschten – Stromes freundschaftlich nebeneinander auf dem Rasen gelagert hatten und eine mehr als einfache Mahlzeit brüderlich miteinander teilten?
Das wollen wir nun dem Leser mit wenigen Worten erklären, indem wir ihm einen Auftritt mitteilen, der sich sechs Monate früher, ehe unsere Erzählung beginnt, zugetragen hatte.
Freikugel war ein entschlossener Mann, der außer der Zeit, in der er im Dienst der Pelzwarengesellschaft stand, immer allein gejagt und getrappt hatte, denn er verachtete die Indianer zu tief, um sie zu fürchten, und es gewährte ihm einen Genuß, den der Tapfere begreifen wird, ihnen allein Trotz zu bieten, und ein unwillkürlicher Reiz trieb ihn immer wieder, sich ohne anderen Schutz als den des Allmächtigen immer neuen, noch unbekannten Gefahren auszusetzen.
Die Indianer kannten und fürchteten ihn seit langer Zeit. Häufig hatten sie sich mit ihm gemessen und sich seinen Händen fast immer mit schweren Verwundungen und unter Zurücklassung einer nicht unbedeutenden Anzahl von Toten entrissen. Sie hatten daher dem Jäger einen echt indianischen Haß, den nichts versöhnen kann, geweiht, und nur der qualvolle Tod des Opfers vermochte ihrer Rache zu genügen.
Weil sie aber wußten, welch einen Mann sie vor sich hatten, und kein Verlangen trugen, die Zahl der Opfer zu vermehren, die unter seiner Hand bereits gefallen waren, beschlossen sie mit jener Geduld, die ihrem Volk eigen ist, auf einen günstigen Augenblick zu warten, um sich ihres Opfers zu bemächtigen, und sich bis dahin damit zu begnügen, seine Bewegungen zu beobachten, damit er ihnen auf keinen Fall entgehe.
Freikugel jagte gegenwärtig längs der Küsten des Missouri. Weil er sich beobachtet wußte und unwillkürlich vor einem Hinterhalt auf der Hut war, traf er alle Vorsichtsmaßnahmen, die ihm sein erfinderischer Geist und seine neue Kenntnis der indianischen Hinterlist eingaben.
Eines Tages, als er die Küste des Flusses durchforschte, schien es ihm, als ob in einem in geringer Entfernung stehenden Gebüsch eine unmerkliche Bewegung wahrzunehmen sei. Er blieb stehen, streckte sich auf den Boden und kroch langsam auf das Gebüsch zu. Plötzlich schien der Wald bis in seine innersten, unerforschten Tiefen zu erbeben, ein Schwarm Indianer schien aus dem Boden zu wachsen, sprang von den Gipfeln der Bäume, tauchte hinter den Felsen auf, und der Jäger, buchstäblich unter seinen Feinden begraben, sah sich zu vollständiger Wehrlosigkeit verdammt, ehe er eine Bewegung hatte machen können, um sich zu verteidigen.
Freikugel wurde im Nu entwaffnet; hierauf trat ein Häuptling zu ihm, reichte ihm die Hand und sagte kaltblütig: »Mein Bruder kann aufstehen, die roten Krieger erwarten ihn.«
»Schon gut«, antwortete der Jäger brummend; »wir sind noch nicht zu Ende, Indianer, und ich werde mich zu rächen wissen.«
Der Häuptling lächelte. »Mein Bruder gleicht dem Spottvogel«, antwortete er höhnend; »er redet zuviel.«
Freikugel biß sich auf die Lippen, um einen Fluch zu unterdrücken, der ihm auf der Zunge schwebte; er stand auf und folgte seinen Bezwingern.
Er war der Gefangene der Piekanns, des kriegerischsten Stammes der Schwarzfüße. Der Häuptling, der sich seiner bemächtigt hatte, war sein persönlicher Feind.
Jener Häuptling nannte sich Natah-Otann, d. h. »Grauer Bär«. Es war ein Mann von höchstens fünfundzwanzig Jahren, und sein feines, intelligentes Gesicht trug das Gepräge der Ehrlichkeit. Sein hoher Wuchs, seine wohlgebildeten Glieder und sein kriegerischer Anblick machten ihn zu einem bedeutenden Mann. Sein langes schwarzes, sorgfältig gescheiteltes Haar fiel nachlässig auf seine Schultern herab.
Er trug wie alle ausgezeichneten Krieger seines Volkes ein Hermelinfell am Hinterkopf und um den Hals ein Band aus Bärenklauen und Bisonzähnen – dieser sehr kostspielige Schmuck wird bei den Indianern in hohen Ehren gehalten. Sein Hemd bestand aus Bisonfell, hatte kurze Ärmel und war am Halsausschnitt mit einer Art Überschlag von scharlachrotem Tuch versehen, der mit Stacheln des Stachelschweins besetzt war; die Nähte jenes Kleidungsstückes waren mit Menschenhaaren, die den geraubten Skalps entnommen waren, bestickt; das Ganze vervollständigte eine Ausschmückung, die aus kleinen Streifen Hermelinpelz bestand. Seine Mokassins, von denen jeder eine andere Farbe hatte, prangten in der feinsten Stickerei. Sein Mantel aus Bisonfell war innen mit einer Unzahl buntfarbiger, ungestalteter Figuren bedeckt, die die Heldentaten des jungen Kriegers darstellen sollten.
In der rechten Hand trug Natah-Otann einen Fächer, der aus dem vollständigen Flügel eines Adlers bestand, und am Handgelenk hing an einer Schlinge die kurze Peitsche mit langen Riemen, die den Indianern in der Prärie eigen ist; über der Schulter hingen sein Bogen und ein Köcher aus Jaguarfell, in dem seine Pfeile steckten; an seinem Gürtel hingen seine Jagdtasche, sein Pulverhorn, sein langes Jagdmesser und seine Streitaxt. Sein Schild hing über die linke Hüfte herab. Sein Flinte lag quer über dem Hals seines Pferdes, das statt des Sattels ein prachtvolles Jaguarfell trug. Das ungebändigte Kind der Wälder bot mit seinem wallenden Mantel und seinen langen, wehenden Federn auf dem ungezähmten Roß, das der Indianer gewandt zu tummeln verstand, einen ebenso ergreifenden wie großartigen Anblick.
Natah-Otann war der erste Sachem seines Stammes. Er winkte dem Jäger, ein Pferd zu besteigen, das einer seiner Krieger am Zügel hielt, worauf die ganze Truppe im Galopp nach dem Lager des Stammes davonsprengte.
Natah-Otann jagte zu der Zeit den Bison in den Ebenen des Missouri. Er hatte die Dörfer seines Volkes nebst 150 auserlesenen Kriegern bereits vor zwei Monaten verlassen.
Der Weg wurde schweigend zurückgelegt. Der Häuptling schien sich keineswegs um seinen Gefangenen zu kümmern. Obgleich sich letzterer scheinbar unbeobachtet sah und ein vortreffliches Pferd ritt, versuchte er kein einziges Mal zu entfliehen. Er hatte seine Lage auf den ersten Blick erkannt und bemerkt, daß ihn die Indianer nicht aus den Augen verloren und ihn, wenn er flüchten wollte, sofort wieder einfangen würden. Die Piekanns hatten ihr Lager auf dem Abhang eines bewaldeten Hügels aufgeschlagen.
Während zweier Tage schienen sie ihren Gefangenen vollständig vergessen zu haben, den sie mit keinem Wort anredeten. Am Abend des zweiten Tages wandelte Freikugel gleichmütig auf und ab und rauchte gelassen sein Kalumet.
Natah-Otann trat zu ihm. »Ist mein Bruder bereit?« sagte er zu ihm.
»Wozu?« antwortete der Jäger, indem er stehenblieb und eine gewaltige Rauchwolke von sich blies.
»Zu sterben«, erwiderte der Häuptling lakonisch.
»Vollkommen.«
»Gut, mein Bruder wird morgen sterben.«
»Meint Ihr?« erwiderte der Jäger sehr kaltblütig.
Der Indianer blickte ihn einen Augenblick verwundert an, dann wiederholte er: »Mein Bruder wird morgen sterben.«
»Ich habe es sehr wohl verstanden, Häuptling«, antwortete seinerseits der Kanadier lächelnd, »und ich wiederhole Euch: Meint Ihr?«
»Mein Bruder kann sehen«, fügte der Sachem mit bedeutsamer Gebärde hinzu.
Der Jäger schüttelte den Kopf. »Bah!« sagte er gleichgültig. »Ich sehe wohl, daß alle Vorbereitungen getroffen – und zwar gewissenhaft getroffen – sind; was ist aber damit bewiesen? Vorläufig bin ich, wie mir scheint, noch am Leben.«
»Ja, aber bald wird mein Bruder tot sein.«
»Wir werden ja morgen sehen«, antwortete Freikugel achselzuckend. Hierauf ließ er den Häuptling verblüfft stehen, streckte sich in den Schatten eines Baumes und schlief ein.
Der Schlaf des Jägers war so wenig erheuchelt, daß die Indianer am anderen Tag gezwungen waren, ihn zu wecken. Der Kanadier öffnete die Augen, gähnte zwei- bis dreimal aus Herzensgrund und stand auf. Die Rothäute führten ihn zum Marterpfahl und banden ihn dort fest.
»Nun«, wandte sich Natah-Otann hohnlachend zu ihm, »was denkt mein Bruder jetzt?«
»Wie?« versetzte Freikugel mit jener unerschütterlichen Zuversicht, die sich keinen Augenblick verleugnete. »Glaubt Ihr denn, daß ich schon tot bin?«
»Nein, aber in einer Stunde wird mein Bruder tot sein.«
»Bah«, erwiderte der Kanadier gleichmütig, »in einer Stunde kann sich manches ereignen.«
Natah-Otann entfernte sich, innerlich entzückt über die unerschrockene Haltung seines Gefangenen. Nachdem er sich einige Schritte entfernt hatte, besann er sich anders und kehrte zu Freikugel zurück. »Mein Bruder höre«, sagte er; »ein Freund redet zu ihm.«
»Redet, Häuptling«, antwortete der Jäger, »ich bin ganz Ohr!«
»Mein Bruder ist ein starker Mann, sein Herz ist groß«, fuhr Natah-Otann fort; »er ist ein furchtbarer Krieger.«
»Darüber könnt Ihr einigermaßen urteilen, nicht wahr?« antwortete der Kanadier.
Der Sachem unterdrückte eine Äußerung des Mißmuts. »Das Auge meines Bruders ist unfehlbar und seine Hand sicher«, fuhr er fort.
»Sagt lieber gleich, was Ihr bezweckt, Häuptling, und ergeht Euch nicht in so vielen indianischen Umschweifen.«
Der Häuptling lächelte. »Freikugel ist allein«, sagte er mit sanfter Stimme; »seine Kämpfe sind einsam. Warum hat ein so großer Krieger keine Gefährtin?«
Der Jäger blickte sein Gegenüber durchdringend an. »Was kümmert es Euch?« antwortete er.
Natah-Otann fuhr fort: »Das Volk der Schwarzfüße ist mächtig; die jungen Frauen des Stammes der Piekanns sind schön.«
Der Kanadier fiel ihm lebhaft ins Wort: »Genug, Häuptling!« sagte er. »Trotz der Winkelzüge, deren Ihr Euch bedient habt, um mir Euren seltsamen Antrag zu machen, habe ich Euch doch durchschaut.«
Natah-Otann runzelte die Brauen.
Der Jäger fuhr fort: »Ich werde niemals eine indianische Frau zu meiner Gefährtin wählen. Ihr könnt Euch daher fernere Anträge ersparen, die doch zu keinem befriedigenden Resultat führen würden.«
Der Häuptling stampfte zornig mit dem Fuß und schrie: »Hund von einem Bleichgesicht! Heute abend sollen meine jungen Leute Kriegspfeifen aus deinen Knochen machen, und ich selbst will Feuerwasser aus deinem Schädel trinken!«
Nach dieser furchtbaren Drohung verließ der Häuptling den Jäger, der ihm achselzuckend nachblickte und in sich hineinmurmelte: »Das entscheidende Wort ist noch nicht gesprochen! Es ist nicht das erstemal, daß ich mich in einer verzweifelten Lage befinde, und bis jetzt bin ich stets davongekommen; ich wüßte nicht, weshalb ich diesmal weniger glücklich sein sollte! Ich will es mir zur Lehre dienen lassen und ein andermal vorsichtiger sein!«
Der Häuptling hatte unterdessen Befehl gegeben, die Vorbereitungen zur Todesmarter zu betreiben, und diese schritten ihrer Vollendung entgegen.
Freikugel folgte den Bewegungen der Indianer so neugierig und unbefangen, als handle es sich um jemand ganz anderen als ihn. »Jaja, ihr Burschen«, sagte er, »ich sehe euch wohl; ihr bereitet alle Marterwerkzeuge vor: dort ist das grüne Holz, das bestimmt ist, mich einzuräuchern wie einen Schinken; jetzt schnitzt ihr die kleinen Pflöcke, die ihr unter meine Nägel zwängen wollt. Aha«, fügte er mit vollkommen befriedigter Miene hinzu, »ihr wollt mit dem Flintenschießen anfangen; laßt sehen, ob ihr geschickt seid! Was wird das für ein Fest für euch! Wie werdet ihr euch unterhalten, einen wackeren weißen Jäger zu Tode zu martern! Der Teufel mag wissen, welche verrückten Einfälle euch noch durch den Kopf fahren werden. Beeilt euch aber, sonst könnte es sein, daß ich euch entwischte!«
Während dieses Monologs hatten einige der geschicktesten Krieger des Stammes ihre Flinten erfaßt und sich ungefähr zwanzig Schritte vom Gefangenen entfernt aufgestellt. Das Schießen begann. Sämtliche Kugeln schlugen wenige Linien vor dem Gefangenen auf den Boden, und der Jäger schüttelte nach jedem Schuß den Kopf wie ein durchnäßter Pudel, was den Anwesenden zum besonderen Vergnügen gereichte.
Diese Unterhaltung währte bereits einige Minuten und versprach sich noch viel länger auszuspinnen, denn die Schwarzfüße fanden zu entschiedenes Vergnügen daran; plötzlich aber sprengte ein Reiter in die Mitte der Waldlichtung und zerstreute die Indianer, die ihm in den Weg traten, mit Peitschenhieben. Hierauf nützte er die durch seine unerwartete Ankunft entstandene Bestürzung, eilte auf den Gefangenen zu, sprang vom Pferd, zerschnitt ruhig seine Fesseln, gab ihm ein Paar Pistolen und stieg wieder auf sein Tier. Das alles hatte sich in wesentlich kürzerer Zeit ereignet, als wir gebraucht haben, um es zu erzählen.
»Bei Gott«, rief Freikugel vergnügt aus, »ich wußte wohl, daß ich diesmal noch nicht sterben würde!«
Die Indianer lassen sich durch kein Gefühl – welcher Art es auch sein mag – lange beherrschen; nachdem sich der erste Schrecken gelegt hatte, umringten sie die beiden Männer mit Geschrei, geschwungenen Waffen und wütenden Gebärden.
»Platz gemacht! Fort mit euch Schurken!« rief der Neuangekommene in befehlendem Ton, indem er diejenigen scharf mit der Peitsche züchtigte, die unvorsichtig genug waren, in seinen Bereich zu kommen. »Kommt jetzt!« fügte er, zum Jäger gewandt, hinzu. »Ich bin zufrieden«, antwortete dieser; »doch scheint mir die Sache nicht eben leicht.« »Bah! Versuchen wir unser Heil«, erwiderte der Unbekannte, indem er gelassen das Lorgnon ins rechte Auge klemmte.
»Versuchen wir unser Heil!« antwortete Freikugel. –
Jener Unbekannte, der von der Vorsehung bestimmt zu sein schien, den Jäger zu befreien, war kein anderer als der Graf Charles Eduard de Beaulieu, den der Leser ohne Zweifel bereits erkannt hat.
»Holla!« rief der Graf mit lauter Stimme aus. »Komm hierher, Ivon!« »Hier bin ich, Herr Graf!« antwortete eine Stimme aus dem Wald.
Ein zweiter Reiter kam hierauf in die Waldlichtung gesprengt und stellte sich kaltblütig neben den ersten. Der zuletzt Angekommene war Ivon Kergollec, der Kammerdiener des Grafen.
Die drei Männer, die kaltblütig in der Mitte der Indianer standen, die sie heulend umringten, boten einen seltsamen Anblick. Der Graf saß mit dem Lorgnon im Auge stolz aufgerichtet auf seinem Pferd, und indem er einen hochmütigen Blick um sich warf und die Oberlippe verächtlich aufwarf, untersuchte er das Schloß seiner Büchse. Freikugel hielt in jeder Hand eine Pistole und war entschlossen, sein Leben teuer zu verkaufen, während der Diener gelassen auf den Augenblick wartete, wo er Befehl erhalten würde, auf die Wilden einzustürmen.
Die Indianer, die die Unerschrockenheit der Weißen zur höchsten Wut reizte, forderten sich gegenseitig durch Gebärden und Geschrei auf, eine schnelle Rache an den Unbesonnenen zu nehmen, die sich so unvorsichtigerweise in ihre Hände geliefert hatten.
»Die Indianer sind ausnehmend häßlich«, bemerkte der Graf. »Jetzt sind Sie frei, mein Freund, wir haben folglich nichts mehr hier zu suchen und können gehen.« Er schickte sich an, sich Bahn zu brechen.
Die Schwarzfüße schritten vor.
»Sehen Sie sich vor!« rief Freikugel aus.
»Was fällt Ihnen ein?« erwiderte der Graf achselzuckend. »Die Schlingel werden es sich doch nicht etwa einfallen lassen, mir den Weg versperren zu wollen?«
Der Jäger blickte ihn auf eine Weise an, die auszudrücken schien, daß er Zweifel habe, ob er einen Verrückten oder ein mit Vernunft begabtes Wesen vor sich habe, so unerhört kam ihm die Äußerung des Grafen vor.
Der Graf gab seinem Pferd die Sporen.
»Zum Teufel!« brummte Freikugel in sich hinein. »Er wird sich umbringen lassen; aber er ist trotzdem ein unerschrockener Patron, und ich werde ihn gewiß nicht verlassen.« Der Augenblick war allerdings entscheidend, denn die Indianer hatten sich in dichten Massen zusammengeschart und waren im Begriff, einen verzweifelten Angriff auf die drei Männer zu wagen. Ein solcher Angriff wäre auf jeden Fall entscheidend gewesen, denn die Europäer entbehrten jeden Schutzes und mußten sich vollständig den Hieben ihrer Feinde preisgeben, denen zu entkommen sie nicht hoffen konnten.
Seit der Ankunft des Grafen schien der indianische Sachem wie vor Schreck gelähmt zu sein, denn er hatte sich nicht gerührt, sondern starrte vor sich hin und schien heftig bewegt zu sein. Plötzlich, als die Schwarzfüße teils ihre Flinten anlegten, teils ihre Bogen mit Pfeilen versahen, schien Natah-Otann einen Entschluß gefaßt zu haben; er stürzte vor, schwang seinen Bisonmantel in der Luft und schrie mit lauter Stimme: »Halt!«
Die Indianer leisteten dem Befehl ihres Häuptlings augenblicklich Folge.
Hierauf trat der Sachem drei Schritte vor, verneigte sich ehrerbietig vor dem Grafen und sagte in unterwürfigem Ton: »Mein Vater wolle seinen Kindern vergeben, sie kannten ihn aber nicht; mein Vater ist groß, seine Macht ist unermeßlich, seine Güte unendlich, und er wird vergessen, was Beleidigendes in ihrem Benehmen gelegen hat.«
Freikugel hörte die Anrede verwundert an und verdolmetschte sie dem Grafen, indem er unumwunden gestand, daß ihm die Sache unbegreiflich wäre.
»Es wird nichts weiter sein«, antwortete der Graf lächelnd, »als daß sie Furcht bekommen haben.«
»Hm«, brummte der Jäger, »das ist nicht wahrscheinlich, dahinter steckt etwas anderes. Wie dem auch sei – wir müssen eine List gebrauchen.« Er wandte sich hierauf zu Natah-Otann und sagte: »Der große bleiche Häuptling ist mit der Ehrerbietung zufrieden, die seine roten Kinder für ihn hegen, und verzeiht ihnen.«
Natah-Otann legte seine Freude an den Tag.
Die drei Männer schritten durch die Reihen der Indianer, die bereitwillig zur Seite traten, und begaben sich in den Wald, ohne daß man ihren Rückzug zu hindern suchte.
»Gott sei Dank!« rief Freikugel aus, sobald er sich in Sicherheit sah. »Aber«, fügte er kopfschüttelnd hinzu, »darunter steckt etwas, das ich nicht begreifen kann.«
»Jetzt, mein Freund«, sagte der Graf, »steht es Ihnen frei, zu gehen, wohin Sie wollen.« Der Jäger bedachte sich einen Augenblick. »Hören Sie«, antwortete er nach einer Weile, »ich verdanke Ihnen das Leben; und obwohl ich Sie nicht kenne, scheinen Sie doch ein guter Kamerad zu sein.«
»Sie beschämen mich«, erwiderte der Graf lächelnd.
»Wahrlich nicht; ich sage, was ich denke. Wenn es Ihnen recht ist, wollen wir wenigstens so lange beisammen bleiben, bis ich meine Schuld abgetragen und Ihnen gleichfalls das Leben gerettet habe.«
Der Graf reichte ihm die Hand und antwortete bewegt: »Ich danke Ihnen, mein Freund, und nehme Ihr Anerbieten an.«
»Es gilt!« rief der Jäger vergnügt aus, indem er die dargereichte Hand herzlich drückte. Der Bund war geschlossen.
Freikugel, der sich anfangs aus Dankbarkeit dem Grafen angeschlossen hatte, empfand bald eine wahrhaft väterliche Zuneigung für ihn, doch war ihm das Benehmen des jungen Mannes, der stets so handelte, wie er es in Frankreich getan haben würde, auch in der Folge ebenso unbegreiflich wie am ersten Tag, und die kecke Entschlossenheit und kräftige Handlungsweise des jungen Grafen spotteten der alten Erfahrung des Jägers. Ja es ging so weit, daß der Kanadier, der wie alle rohen Naturen abergläubisch war, sich schließlich für überzeugt hielt, daß das Leben des jungen Grafen gefeit sei, weil er wohlbehalten aus Gefahren hervorging, in denen jeder andere untergegangen wäre. Infolgedessen dünkte ihm in Begleitung eines solchen Gefährten kein Ding unmöglich, und die seltsamsten Vorschläge des Grafen erschienen ihm um so einfacher, als unbegreiflicherweise und wider alle Erwartung alle ihre Unternehmungen glückten.
Die Indianer schienen sich stillschweigend entschlossen zu haben, nicht nur nicht mehr gegen sie zu kämpfen, sondern sogar jede Begegnung mit ihnen zu vermeiden. Sooft sie einem Wilden begegneten – gleichviel, von welchem Stamm –, erschöpfte er sich in Äußerungen der Ehrerbietung vor dem Grafen, den sie nur mit einer Mischung von Schrecken und Liebe anredeten. Den Grund dafür suchte der Jäger vergebens zu erforschen, weil sich nie eine Rothaut dazu verstanden hätte, ihm Rede zu stehen. –
So standen die Dinge bereits sechs Monate vor dem Tag, wo wir die drei Männer am Ufer des Mississippi beim Frühstück getroffen haben. Wir nehmen den Faden unserer Erzählung wieder an der Stelle auf, wo wir ihn verlassen haben, und schließen hiermit die eingeschaltete Erklärung, die zum Verständnis der folgenden Ereignisse unerläßlich war.
2
Die Entdeckung einer Fährte
Inhaltsverzeichnis
Unsere drei Jäger würden wahrscheinlich ihre beschauliche Ruhe noch lange genossen haben, wenn nicht ein leises Geräusch, das vom Fluß herkam, sie plötzlich und etwas unsanft an die notwendige Wachsamkeit gemahnt hätte, die ihre Lage erforderte.
»Was ist das?« fragte der Graf, indem er mit den Fingerspitzen die Asche von seiner Zigarre stieß.
Freikugel schlich ins Gebüsch, schaute sich kurze Zeit um und nahm dann gelassen seinen früheren Platz wieder ein. »Nichts«, sagte er, »als zwei Alligatoren, die im Schlamm miteinander schäkern.«
»So«, antwortete der Graf.
Es folgte eine Pause, während der der Jäger stillschweigend die Länge der Schatten, die die Bäume auf den Boden warfen, berechnete. »Es ist zwölf Uhr vorüber«, sagte er.
»Glauben Sie?« erwiderte der Graf.
»Ich glaube es nicht, sondern bin dessen gewiß, Herr Graf.«
Herr de Beaulieu richtete sich auf. »Lieber Freikugel«, sagte er, »ich habe Sie schon wiederholt gebeten, mich weder ›Herr‹ noch ›Graf‹ zu nennen. Wir stehen hier doch wahrlich nicht in Paris oder in einem Salon des Faubourg Saint-Germain[4]. Wozu sind wir in der Wildnis, umgeben von jener großartigen Natur, wenn mich der aristokratische Titel bis hierher verfolgen soll? Wenn mich Ivon Herr Graf nennt, so finde ich es natürlich, denn einem so alten Diener würde es schwerfallen, eine so langjährige Gewohnheit abzulegen. Mit Ihnen ist es aber etwas anderes, Sie sind mein Freund und Genosse; nennen Sie mich daher Charles oder Eduard, nach eigener Wahl; nur verbitte ich mir künftig zwischen uns den Grafen.«
»Gut«, antwortete der Jäger, »ich werde mir Mühe geben, Herr Graf.«
»Hol Sie der Teufel! Da fangen Sie schon wieder an!« rief der junge Mann lachend aus. »Sie können, wenn es Ihnen zu schwer fällt, mich bei meinem Taufnamen zu rufen, mich auch so nennen, wie es die Indianer tun.«
»Welcher Einfall!« versetzte Freikugel abwehrend.
»Wie heißt denn gleich der Ehrentitel, den sie mir beigelegt haben, Freikugel? Ich habe es schon vergessen.«
»Ach, Herr, ich werde mir nie erlauben –«
»Was?«
»Eduard, wollte ich sagen –«
»Gut, das klingt schon besser«, erwiderte der junge Mann lächelnd; »ich bestehe aber auf jenem Beinamen.«
»Man nennt Sie ›Gläsernes Auge‹.«
»Richtig, Gläsernes Auge«, antwortete der junge Mann mit herzlichem Lachen. »Man muß gestehen, daß jene Indianer ganz originelle Einfälle haben.«
»Die Indianer«, erwiderte Freikugel, »sind nicht so arglos, wie Sie glauben, sondern besitzen eine wahrhaft teuflische Arglist.«
»Ach, schweigen Sie doch, Freikugel; ich habe Sie stets im Verdacht gehabt, eine kleine Schwäche für die Rothäute zu hegen.«
»Können Sie das von mir behaupten, der ich ihr unversöhnlichster Feind bin und bereits seit beinahe vierzig Jahren mit ihnen kämpfe?«
»Das ist ja, weiß Gott, der einfache Grund, weshalb Sie Ihre vierzigjährigen Feinde in Schutz nehmen.«
»Wie meinen Sie das?« fragte der Jäger, den diese Antwort überraschte, die er keineswegs erwartet hatte.
»Mein Gott, der Grund ist einfach genug! Will doch niemand mit einem Feind zu tun haben, der seiner unwürdig ist; und es ist daher natürlich, daß Sie die Ehre derjenigen retten wollen, die Sie Ihr Leben lang bekämpft haben.«
Der Jäger schüttelte den Kopf. »Mein Herr Eduard«, sagte er bedächtig, »die Rothäute sind Leute, die man erst nach langen Jahren kennenlernt. Sie vereinigen in sich nicht nur die Schlauheit des Opossums ihrer Wälder, sondern auch die Vorsicht der Schlange und den Mut des Jaguars; in einigen Jahren werden Sie sie nicht mehr verachten.«
»So Gott will, Kamerad«, entgegnete der Graf lebhaft, »habe ich die Prärie vor Ablauf des Jahres verlassen. Jaja, ich bin ein Freund der Zivilisation und sehne mich nach den Pariser Boulevards, Bällen, Festen und der großen Oper. Die Wildnis ist keineswegs für mich gemacht.«
Der Jäger schüttelte wieder den Kopf und fuhr in einem schwermütigen Ton, der dem Grafen unwillkürlich auffiel, fort, mehr mit sich selbst redend als dem Grafen antwortend. »Jaja, so sind die Europäer; sobald sie in der Wildnis anlangen, sehnen sie sich nach dem Leben der zivilisierten Welt, denn die Vorzüge der Einöde lernt man erst allmählich schätzen; wenn man aber den Wohlgeruch der Steppen eingeatmet, während langer Nächte das Geflüster der hundertjährigen Bäume und das Geheul der wilden Tiere in den Urwäldern gehört, die unerforschten Pfade der Prärie betreten und die großartige Natur bewundert hat, die keiner Kunst ihren Reiz verdankt, sondern allenthalben das Gepräge der Hand Gottes trägt, dessen Walten sich in unauslöschlichen Zügen ausspricht; wenn man endlich den erhabenen Schauspielen beigewohnt hat, die sich dem Auge hin und wieder darbieten, faßt man allmählich eine Zuneigung zu jener geheimnisvollen Welt voll seltsamer Abenteuer, die Augen öffnen sich für die Wahrheit, und man wird unwillkürlich gläubig; und nachdem man die Lügen der Zivilisation abgestreift, durch alle Poren die reine Luft der Berge und Prärien eingesogen hat und völlig umgewandelt ist, lernt man Gefühle kennen, die einen bisher unbekannten Reiz besitzen, erfreut sich berauschender Genüsse und erkennt keinen anderen Herrn an als den Gott, vor dessen Größe man so klein erscheint. Man vergißt alles, um für immer ein Wanderleben zu führen und in der Wildnis bleiben zu können, denn nur dort fühlt man sich frei und glücklich, wird mit einem Wort zum Menschen! Ja, reden Sie, was Sie wollen, Herr Graf; was Sie auch immer tun – Sie sind jetzt der Wildnis verfallen. Sie haben deren Freuden und Leiden empfunden und können ihr nicht mehr entfliehen! Sie werden weder Frankreich noch Paris so bald wiedersehen, denn die Wildnis hält Sie wider Willen gefangen.«
Der junge Mann hörte die lange Rede des Jägers mit einer Bewegung an, deren er sich nicht erwehren konnte. Er erkannte innerlich, daß der Waldläufer zwar übertreibe, im Grunde aber doch recht habe, und war fast erschrocken, das so unbeschränkt einräumen zu müssen. Er wußte nicht, was er antworten sollte, und mußte sich stillschweigend für besiegt erklären; er brach daher den Gegenstand der Unterhaltung plötzlich ab. »Sie sagten, mein Freund«, bemerkte er, »daß es zwölf Uhr vorüber sei.«
»Ungefähr ein Viertel auf eins«, antwortete der Jäger.
Der Graf zog seine Uhr. »Ganz recht«, erwiderte er.
»Ja«, fuhr der Jäger fort, indem er mit dem Finger auf die Sonne deutete, »das ist die einzig untrügliche Uhr, die nie vorgeht oder zurückbleibt, denn Gott selbst hat sie geordnet.«
Der junge Mann nickte bejahend mit dem Kopf. »Wollen wir wieder aufbrechen?« fragte er.
»Warum denn jetzt?« antwortete der Kanadier. »Es drängt uns ja nichts.«
»Das ist wahr; sind Sie aber auch gewiß, daß wir uns nicht verirrt haben?«
»Verirrt?« rief der Jäger verwundert aus und hatte fast Lust, sich zu ereifern. »Nein, nein, das ist unmöglich, und ich stehe Ihnen dafür, daß wir den Itascasee noch vor acht Tagen erreichen werden.«
»Entspringt der Mississippi wirklich aus jenem See?«
»Ja, denn trotz aller Gegenbehauptungen ist der Missouri nur der Hauptarm des Stromes, und die Gelehrten würden besser getan haben, sich zuvor selbst davon zu überzeugen, ehe sie aussprengten, daß der Missouri und der Mississippi zwei verschiedene Ströme seien.«
»Wir werden es nicht ändern können, Freikugel«, antwortete der Graf lachend, »daß sich die Gelehrten aller Zeiten und Länder stets gleichbleiben werden. Da sie alle von Natur sehr bequem sind, verläßt sich fortwährend einer auf den anderen, und daraus entstehen die unzähligen Albernheiten, die sie mit bewunderungswürdiger Zuversicht verbreiten. Wir müssen uns drein ergeben.«
»Die Indianer lassen sich nicht täuschen.«
»Ganz recht; die Indianer sind aber keine Gelehrten.«
»Nein, sie begnügen sich, selbst nachzusehen, und behaupten nur, was sie wissen.«
»Das meine ich eben«, antwortete der Graf.
»Wenn Sie meinem Rat folgen, Herr Eduard, so bleiben wir noch einige Stunden hier, um die stärkste Hitze abzuwarten, und brechen erst wieder auf, wenn die Sonne anfängt zu sinken.«
»Vollkommen einverstanden; fahren wir also fort zu ruhen. Ivon scheint übrigens unsere Ansicht zu teilen, denn er hat sich noch nicht von der Stelle gerührt.«
Der Bretone schlief in der Tat tief und fest.
Der Graf war aufgestanden, und ehe er sich wieder hinstreckte, warf er unwillkürlich einen Blick auf die Ebene, die sich still und majestätisch zu seinen Füßen ausbreitete. »Schau«, rief er plötzlich aus, »was geht denn da unten vor sich? Sehen Sie doch, Freikugel!«
Der Jäger stand auf und blickte nach der vom Grafen angedeuteten Richtung.
»Nun? Sehen Sie nichts?« fuhr der junge Mann fort.
Freikugel legte die Hand vor die Augen, um die Sonnenstrahlen abzuwehren, und blickte, ohne zu antworten, aufmerksam in die Ferne.
»Nun?« fragte der Graf wieder nach einer Weile.
»Wir sind nicht mehr allein«, entgegnete Freikugel; »es sind Menschen da.«
»Wieso Menschen? Wir haben ja keine indianische Fährte gefunden.«
»Ich habe nicht gesagt, daß es Indianer wären«, antwortete Freikugel.
»Nun, auf solche Entfernung dürfte es Ihnen vermutlich schwerfallen, zu sagen, wer es ist.«
Freikugel lächelte. »Sie legen fortwährend Ihren Maßstab aus der zivilisierten Welt an, mein Herr Eduard«, antwortete er.
»Was soviel heißt...?« fragte der junge Mann, der sich durch die Bemerkung innerlich verletzt fühlte.
»Was soviel heißt, als daß Sie sich fast immer irren.«
»Bei Gott, lieber Freund, Sie werden mir – abgesehen von meinem Unglauben – wohl zugestehen, daß es auf eine solche Entfernung unmöglich ist, irgendeinen Gegenstand zu unterscheiden; besonders wenn man nichts sieht als etwas weißlichen Rauch!«
»Und ist das nicht genug? Glauben Sie denn, daß der Rauch immer das gleiche Ansehen habe?«
»Das scheint mir ein subtiler Unterschied zu sein, und ich muß bekennen, daß in meinen Augen jede Rauchwolke der anderen gleicht.«
»Darin liegt eben der Irrtum«, antwortete der Kanadier mit großer Kaltblütigkeit. »Und wenn Sie erst einige Jahre in der Prärie verlebt haben werden, lassen Sie sich gewiß nicht mehr auf solche Weise täuschen.«
Herr de Beaulieu blickte ihn scharf an, denn er war überzeugt, daß sich der Jäger über ihn lustig mache.
Jener fuhr gelassen fort: »Was wir dort unten sehen, ist weder ein Indianer- noch ein Jägerfeuer, sondern rührt von Weißen her, die an das Leben der Prärie noch nicht gewöhnt sind.«
»Das werden Sie mir erklären, nicht wahr? Denn es klingt unglaublich.«
»Ich bin zufrieden, und Sie werden bald zugeben müssen, daß ich recht habe. Merken Sie wohl auf, Herr Eduard, denn der Gegenstand ist wichtig.«
»Ich höre, mein Freund.«
»Es wird Ihnen jedenfalls bekannt sein«, fuhr der Jäger mit unerschütterlicher Ruhe fort, »daß das, was man die Wildnis nennt, sehr bevölkert ist.«
»Gewiß«, antwortete der junge Mann lächelnd.
»Nun wohl, aber die schlimmsten Feinde in den Prärien sind nicht die reißenden Tiere, wohl aber die Menschen. Die Indianer und die Jäger wissen das auch so gut, daß sie eifrig bemüht sind, die Spuren ihrer Gegenwart zu vertilgen und ihre Nähe zu verbergen.«
»Das gebe ich zu.«
»Wohlan; wenn also die Rothäute oder die Jäger genötigt sind, ein Feuer anzubrennen – entweder um ihre Nahrungsmittel zu bereiten oder sich vor der Kälte zu schützen –, so wählen sie sorgfältig das Holz, dessen sie sich bedienen wollen, und gebrauchen die Vorsicht, nur trockenes Holz zu verbrennen.«
»Warum das lieber als jedes andere, das sehe ich nicht ein.«
»Sie werden es sogleich begreifen. Das trockene Holz gibt nur einen bläulichen Rauch, der sich leicht mit dem Blau des Himmels verbindet, wodurch er selbst in geringer Entfernung unsichtbar bleibt. Das nasse Holz hingegen entwickelt einen weißlichen, dicken Rauch, der die Nähe derjenigen, die es angezündet haben, schon von weitem verrät; daher konnte ich aus dem bloßen Rauch bestimmen, wie ich es eben getan habe, daß jene Leute dort unten Weiße sind, und zwar solche Weiße, die die Prärie nicht kennen, sonst hätten sie nicht versäumt, sich des trockenen Holzes zu bedienen.«
»Das ist wahrlich merkwürdig genug, und ich muß mich selbst davon überzeugen.«
»Was denken Sie zu tun?«
»Nun, ich will ganz einfach sehen, welche Leute das sind, die jenes Feuer angezündet haben.«
»Weshalb sollten Sie sich die Mühe geben, da ich es Ihnen sage?«
»Wohl möglich; ich tue es aber zu meiner eigenen Überzeugung, denn seitdem wir beisammen sind, mein Freund, erzählen Sie mir so ungewöhnliche Dinge, daß ich ein für allemal wissen möchte, was ich davon zu halten habe.«