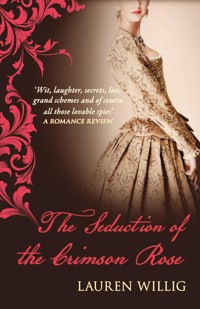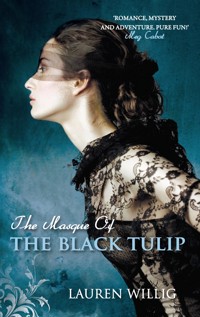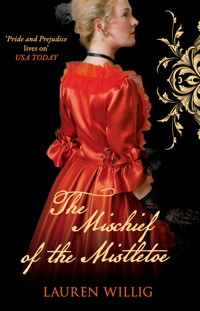9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Zwei Schwestern, zwei Leben. Durch ein Schicksal verbunden. England, 1927: Als Rachel das Cottage ihrer verstorbenen Mutter ausräumt, stößt sie auf einen mysteriösen Zeitungsausschnitt. Graf Ardmore heißt der Mann, der mit Frau und Tochter auf dem Foto posiert. Und er sieht Rachels Vater zum Verwechseln ähnlich. Nur dass ihr Vater, angeblich ein mittelloser Botaniker, seit 20 Jahren tot sein soll. Fest entschlossen, das Rätsel ihrer Herkunft zu ergründen, reist Rachel nach London. Doch als sie schließlich ihrer Halbschwester Olivia begegnet, gibt sie sich nicht zu erkennen. Denn Rachel fühlt sich magisch zu Olivias Verlobtem John hingezogen. Und lässt sich auf ein Spiel ein, über das sie bald die Kontrolle verliert … Große Gefühle vor der aufregenden Kulisse der Roaring Twenties: der packende neue Roman von Bestsellerautorin Lauren Willig: für alle Leserinnen von Katherine Webb oder Lucinda Riley.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Ähnliche
Lauren Willig
Die fremde Schwester
Roman
Aus dem Englischen von Mechtild Sandberg-Ciletti
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Zwei Schwestern, zwei Leben. Durch ein Schicksal verbunden.
England, 1927: Als Rachel das Cottage ihrer verstorbenen Mutter ausräumt, stößt sie auf einen mysteriösen Zeitungsausschnitt. Graf Ardmore heißt der Mann, der mit Frau und Tochter auf dem Foto posiert. Und er sieht Rachels Vater zum Verwechseln ähnlich. Nur dass ihr Vater, angeblich ein mittelloser Botaniker, seit 20 Jahren tot sein soll. Fest entschlossen, das Rätsel ihrer Herkunft zu ergründen, reist Rachel nach London. Doch als sie schließlich ihrer Halbschwester Olivia begegnet, gibt sie sich nicht zu erkennen. Denn Rachel fühlt sich magisch zu Olivias Verlobtem John hingezogen. Und lässt sich auf ein Spiel ein, über das sie bald die Kontrolle verliert …
Über Lauren Willig
Inhaltsübersicht
Für meinen Vater, Kenneth C.H. Willig, der mir Geschichte und Geschichten nahegebracht hat.
Kapitel 1
«Dürfen wir gucken, dürfen wir gucken?» Die achtjährige Amelie fasste Rachel bei der Hand und versuchte, sie zur Treppe zu ziehen.
«Ich verstehe nicht, was dich an einem Fest interessiert, zu dem du nicht eingeladen bist», sagte die dreizehnjährige Albertine hochnäsig.
«Englisch, bitte», mahnte Rachel automatisch.
Die Mädchen sollten mit ihr stets englisch sprechen, darauf hatte die Gräfin ausdrücklich bestanden. Wenn Albertine sich nicht an dieses Gebot halten wollte, sagte sich Rachel, die es selbst nicht unbedingt konsequent befolgte, etwas scheinheilig, musste sie eben still sein. Das tat manchmal ganz gut.
«Les robes sont tellement jolies.» Die zehnjährige Anne-Marie seufzte sehnsüchtig.
«Englisch bitte», spottete Albertine in einem Englisch mit starkem französischem Akzent.
Rachel strich Anne-Marie über die Haare. «Du hast ganz recht, Ammie. Die Kleider sind wirklich schön. Ich glaube, wir können ruhig ein bisschen gucken, Hauptsache, wir lassen uns nicht sehen.»
Es war der alljährliche Osterball auf Château de Brillac, Sitz der Grafen von Brillac seit Menschengedenken, auch wenn den Brillacs das herzlich wenig bedeutete. Sie zogen das Leben in Paris vor, wo der Graf sich seinen Amouren widmen konnte und die Gräfin ihre engen persönlichen Beziehungen zu diversen Modeschöpfern der Haute Couture pflegte, die um die Ehre buhlten, ihren knochigen Körper mit gefälligen Roben auszustatten.
Wenn der Graf und die Gräfin sich dennoch hin und wieder zu einem Besuch in Brillac bequemten, so reisten sie stets mit einem exotischen Gefolge von Damen und Herren der glanzvollen Pariser Welt an. Zimmer und Säle wurden gelüftet, die Möbel von den Tüchern befreit, die sie vor Staub schützen sollten, und Amelie, Anne-Marie und Albertine schlichen sich hinunter zu ihrem bevorzugten Ausguck hinter der fünften Geländersäule links auf der Galerie.
Eine strengere Aufsichtsperson hätte den Mädchen dieses Abenteuer vielleicht verwehrt und sie in ihre Kinderzimmer verbannt. Doch Rachel sah nicht ein, weshalb sie ihren Schützlingen solche kleinen Freuden nicht gönnen sollte. Wenn es sie glücklich machte, auf ein Gewoge wohlfrisierter Köpfe hinunterzusehen, warum nicht? Beim kleinsten Anzeichen von Unfug würde sie sie einsammeln und zurück ins Kinderzimmer verfrachten.
Sie bezweifelte, dass es so weit kommen würde. Weder bei Anne-Marie noch bei Amelie brauchte man zu fürchten, dass sie Wasserbomben warfen, und Albertine, die Älteste, neigte eher zu kleinen Boshaftigkeiten als zu handfesten Streichen. Nach sieben Jahren praktischer Erfahrung als Erzieherin in diversen Kinderstuben meinte Rachel, sich auf ihr Urteil verlassen zu können.
Anne-Marie und Amelie kauerten dicht ans Geländer gedrückt nebeneinander; Albertine hielt vornehm Abstand und gab sich desinteressiert, konnte aber, wie ihre Blicke verrieten, ihre Neugier doch nicht ganz bezähmen. Rachel betrachtete die drei Mädchen einen Moment lang lächelnd, bevor sie sich zu ihnen gesellte und so ungeniert wie sie ins festliche Getümmel hinunterspähte.
Der Graf und die Gräfin, er im Abendanzug, sie in großer Toilette mit funkelnden Brillanten, standen am Fuß der breiten, mit Blumen geschmückten Marmortreppe und empfingen ihre Gäste. Die große Vorhalle, in der Amelie an regnerischen Tagen gern auf Strümpfen hin und her schlitterte, war erfüllt von Gelächter und Stimmengewirr, dem Geklingel kostbarer Armreifen und Colliers, dem Glanz militärischer Orden.
Rachel wusste, dass im Ballsaal eine Musikkapelle wartete, die nach dem Festessen im Speisesaal zum Tanz aufspielen würde; intime Salons boten den Gästen Gelegenheit, sich nach dem Mahl zum Plaudern, Rauchen oder Kartenspielen zurückzuziehen. Doch Einblick in diese Räume war den heimlichen Beobachtern auf der Galerie verwehrt.
«Wenn ich groß bin», erklärte Amelie ganz von sich überzeugt, «gehe ich jeden Abend auf einen Ball.»
Rachel unterdrückte ein Lachen. «Das kann ich mir gut vorstellen. Vergiss nur nicht, dir immer schön die Ohren zu waschen. Eine Gräfin muss saubere Ohren haben.»
Amelie straffte ein wenig die Schultern. «Als ob ich das nicht wüsste», erwiderte sie so erhaben, als hätte sie nicht erst gestern Abend bei der ersten Berührung des verhassten Waschlappens Zeter und Mordio geschrien. «Und viel Schmuck muss sie haben.»
«Rubine oder Smaragde?», erkundigte sich Rachel, deren gesamter Schmuck aus einer kleinen goldenen Uhr bestand, einem Geschenk ihrer Mutter zum Schulabschluss. Sie wollte gar nicht daran denken, wie viele zusätzliche Klavierstunden ihre Mutter dafür hatte geben müssen, wie oft sie auf den Zucker im Tee verzichtet hatte.
«Blaue», erklärte Amelie entschieden. «Sie passen am besten zu Sophies Schärpe.»
Sophie war Amelies Lieblingspuppe; einst chic wie eine Pariser Dame, war sie mittlerweile recht ramponiert von dem rauen Leben, das sie bei Amelie führte.
«Ja, das sieht sicher hübsch aus», meinte Rachel lächelnd. Die drei Mädchen taten ihr manchmal leid. So verwöhnt sie waren, so sehr fehlte es ihnen offensichtlich an Wärme. Sie schienen einzig darauf gedrillt, die gesellschaftlichen Erwartungen zu erfüllen: eine standesgemäße Heirat, mit einem Stadtpalais in Paris und einem Schloss auf dem Land. Ob sie den Mann, der zu dieser ganzen Pracht gehörte, liebten, spielte dabei allem Anschein nach eine untergeordnete Rolle. Diesen Eindruck jedenfalls hatte Rachel in den letzten sieben Jahren ihrer Tätigkeit bei verschiedenen reichen Familien gewonnen.
Manchmal kam sie sich vor wie eine Forscherin, die die Sitten und Gebräuche eines exotischen Stammes studierte.
Rachel hatte immer gewusst, dass sie später einmal würde arbeiten müssen. Sie und ihre Mutter waren nicht arm, sie hatten ein Dach über dem Kopf, und sie hatten zu essen, doch für Extrawünsche war nie Geld da. Ihre Mutter schlug sich mit Klavierstunden durch, eine nach allgemeiner Auffassung angemessene Tätigkeit für eine in Not geratene Witwe aus besseren Kreisen, nicht unvereinbar mit dem Freitagabend-Sherry beim Pastor und der Ausrichtung des Wohltätigkeitsbasars beim alljährlichen Frühlingsfest.
Wäre es nach Rachel gegangen, so hätte sie nach der Schule einen Sekretärinnenkurs besucht und sich danach in die schöne neue Welt der Bürokräfte gestürzt. Aber es gab Momente, da konnte ihre Mutter ihre viktorianische Erziehung nicht verleugnen. Sobald sie von dem Sekretärinnenkurs hörte, sagte sie nein und ließ nicht mehr mit sich reden. Undenkbar, dass Rachel außer Haus zur Arbeit ging und sich täglich den mehr oder weniger aufdringlichen Aufmerksamkeiten fremder Männer aussetzte.
Alle Proteste und Vorhaltungen Rachels, dass es bei den Frauen von heute ganz normal sei, arbeiten zu gehen, prallten an ihr ab.
Eine Anstellung in einer guten Familie, erklärte ihre Mutter beharrlich, das sei die geeignete Tätigkeit für eine junge Dame.
Als Rachel entgegnete, die Welt habe sich seit Jane Eyre ein Stück weitergedreht, meinte ihre Mutter nur nachsichtig: «Es ist ja nicht alles Thornfield Hall. Würdest du denn nicht gern etwas von der Welt sehen? Du könntest reisen. Du könntest im Ausland arbeiten. Das ist doch viel besser als so ein muffiges Büro.»
Rachel hätte widersprechen, hätte – wie sie das bei anderer Gelegenheit erfolgreich getan hatte – sich auf die Hinterbeine stellen können, doch sie hatte den Verdacht gehabt, dass es hier weniger um ihre jungfräuliche Tugend ging als um Geld. Der Sekretärinnenkurs war zwar nicht übermäßig teuer, dennoch wäre die Ausgabe für ihr mageres Budget eine Belastung gewesen.
Und wenn sie dafür ihre goldene Uhr verkauft hätte, so wäre das für ihre Mutter schlimmer gewesen als ein Schlag ins Gesicht. Es hätte sie daran erinnert, was sie sich alles nicht leisten konnten. Es wäre einem Vorwurf an ihre Mutter gleichgekommen, die sich seit dem Tod von Rachels Vater Tag und Nacht abrackerte, um sich und Rachel über Wasser zu halten.
Rachel hatte also alle Einwände hinuntergeschluckt und war nach Frankreich gegangen. Und Frankreich hatte wirklich einiges für sich. Staunend hatte sie all das Neue und Fremde, das ihr dort begegnete, aufgesogen; gewiss, der Krieg hatte Narben hinterlassen, doch das Land war immer noch beeindruckend in der Vielfältigkeit seiner Landschaft und seiner besonderen Lebensart. Und Paris, diese schillernde Stadt, schien seinen früheren Glanz uneingeschränkt wiedergewonnen zu haben.
Sie hätte nicht gesagt, dass sie nach sieben Jahren Aufenthalt diesen Glanz nicht mehr wahrnahm, doch er war ihr mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden. Louis-quinze-Sessel und goldgerahmte Porträts alter Meister gehörten zur Kulisse wie zu Hause das Klavier ihrer Mutter und das alte Schachspiel ihres Vaters. Den Mittelpunkt ihres Lebens jedoch bildeten die Kinder, mit denen sie lernte und übte, die ihre eigenen kleinen Kämpfe ausfochten, manchmal Trost und manchmal, besonders an Regentagen, Unterhaltung brauchten.
Über Marmorböden zu schlittern, war eine herrliche Möglichkeit, einen Regentag totzuschlagen. Allerdings nicht, wenn die Gräfin zu Hause war.
«Miss?»
Rachel, die mit den drei Mädchen am Geländer kauerte, drehte sich um und stand auf. Zu Hause wurde sie Rachel genannt oder Miss Woodley, je nachdem, doch im Haus de Brillac wurde sie stets ‹Miss› gerufen.
«Ja?» Sie strich ihren Rock glatt. Manon, das Dienstmädchen, das für die Kinderzimmer zuständig war, kam leise und sichtlich bedrückt auf sie zu. «Ach, du lieber Gott. Nicht schon wieder das heiße Wasser?»
Die sanitären Anlagen im Schloss, die noch aus einer Zeit stammten, als eine heiße Badewanne Luxus gewesen war, hatten ihre Launen. Im Allgemeinen lieferten sie genug heißes Wasser für die Kinder, aber wenn die Gästescharen aus Paris sich im Haus niederließen, kam es vor, dass eine Katzenwäsche genügen musste.
«Nein, Miss.» Beinahe verstohlen hielt das Mädchen Rachel ein knittriges Stück Papier hin. «Ein Telegramm, Miss. Aus Paris.»
«Heute Abend?» Automatisch griff Rachel nach dem Papier. Kein Wunder, dass Manon die Verantwortung weitergeben wollte, wenn es etwas Wichtiges war. Die Gräfin reagierte bei Festlichkeiten auf Störungen höchst ungnädig. «Hoffentlich sind es keine schlechten Nachrichten. Ich bringe es gleich –»
Rachel brach ab, als sie auf das Telegramm hinunterblickte. Es kam nicht aus Paris, es war nach Paris geschickt worden. Und nicht an die Gräfin gerichtet, sondern an sie.
R. Woodley, Hôtel de Brillac, Paris.
Der Text darunter war englisch, nicht französisch.
Mrs. Woodley erkrankt. Influenza. Empfehle sofortige Heimkehr. J. S.
Influenza! Rachel starrte wie gebannt auf das gefürchtete Wort. Die Influenza hatte Netherwell schon früher heimgesucht, gleich nach dem Krieg. Rachel konnte jetzt noch das endlose dumpfe Läuten der Kirchenglocke hören, Tag für Tag, bis schließlich der Glöckner selbst erkrankt war, und da war die plötzliche Stille beinahe noch schlimmer gewesen als das unablässige Gebimmel.
Doch das lag acht Jahre zurück. Inzwischen hatte man doch sicher … Und Jim Seddon war ein guter Arzt, ein moderner Arzt, ein weit besserer als der alte Dr. Potter, der immer den Eindruck erweckt hatte, was für Hippokrates gut genug gewesen war, sei auch für ihn gut genug.
Rachel, die unwillkürlich die Luft angehalten hatte, atmete tief durch. Jim Seddon war nicht nur ein guter Arzt, er war auch mit Rachels bester Freundin verheiratet. Und ihre Mutter – ihre Mutter erfreute sich einer robusten Gesundheit, so zart sie in ihren Kattunkleidern und Spitzenkrägelchen wirkte. Die Influenza mochte zahllose andere getötet haben, Katherine Woodley würde sie nicht umwerfen.
Aber Jim würde sie nicht zur Heimkehr drängen, wenn es keinen triftigen Grund gab.
Sie musste sofort nach Calais. Wenn sie einen Wagen bekommen konnte, der sie zum Bahnhof brachte, konnte sie den nächsten Zug nach Paris nehmen und von dort aus nach Calais weiterreisen; von Calais aus mit der Fähre nach Dover, dann weiter nach London und King’s Lynn und schließlich mit dem Bummelzug nach Netherwell.
Es war Montagabend. Mit etwas Glück, und wenn es den Bahnarbeitern zwischen hier und Calais nicht gerade einfiel, in Streik zu treten, könnte sie morgen um diese Zeit zu Hause sein.
Das hieß … Rachel suchte das Datum auf dem Telegramm und wollte ihren Augen nicht trauen. Es war bereits am vergangenen Mittwoch in Paris eingetroffen, also vor fünf Tagen.
Rachel sah das Mädchen ungläubig an. «Aber das Telegramm ist fünf Tage alt!»
Manon senkte den Blick. «Ich weiß auch nicht. Hector hat’s erst heute mitgebracht, als er mit dem Herrn Grafen raufgekommen ist.»
Hector, der Kammerdiener des Grafen, war ein eingebildeter Schwätzer, der sich für unwiderstehlich hielt. Rachel, die anderer Meinung war und ihm das auch unmissverständlich klargemacht hatte, konnte sich vorstellen, dass er das Telegramm aus reiner Bosheit liegengelassen hatte, um ihr eins auszuwischen.
«Natürlich, natürlich, dafür kannst du nichts, Manon», sagte Rachel hastig. «Danke dir, dass du es mir gebracht hast.» Sie war wütend und empört über diese Nachlässigkeit ihr gegenüber, doch es wäre ungerecht gewesen, Manon Vorwürfe zu machen. Wichtig war im Moment nur, möglichst schnell zum Bahnhof zu kommen. «Würdest du bitte die Mädchen nach oben bringen», sagte sie deshalb nur sehr beherrscht. «Ich muss mit der Gräfin sprechen.»
Sie wandte sich den drei Mädchen zu. «Tut mir leid.» Sie lächelte bedauernd. «Ihr geht jetzt brav mit Manon hinauf, ja? Ich komme gleich nach. Macht euch schon mal fertig und vergesst nicht, euch die Zähne zu putzen.» Sie strich den zwei kleineren über die Köpfe und nickte Albertine zu, als die drei ein wenig widerwillig ihren Beobachtungsposten verließen, um der wartenden Manon zu folgen.
Unten hielt sie einen der Diener auf, der mit einem Tablett voller Champagnergläser aus dem Saal kam. Sie kannte das Personal nicht sehr gut; die meisten der Leute waren im Pariser Haus beschäftigt und nur aus Anlass des Fests aufs Land mitgekommen. Doch jeder wusste, wer sie war: die englische Erzieherin der Mädchen.
Der livrierte Diener begab sich auf die Suche nach der Gräfin, während Rachel im Hintergrund wartete und sich krampfhaft bemühte, ihre Ungeduld zu bezähmen.
Mittwoch. Ihre Mutter war schon seit Mittwoch krank, und das Telegramm hatte einfach irgendwo herumgelegen. Aber warum hatte Jim Seddon nicht noch einmal versucht, sie zu erreichen? Er hätte doch ein zweites Telegramm schicken oder telefonieren können …
Der Diener trat zu ihr. Madame erwarte sie im kleinen Salon.
Der sogenannte kleine Salon war etwa doppelt so groß wie ihr ganzes Cottage daheim in Netherwell, mit einer Pracht aus Gold und Spiegeln ausgestattet, die darauf angelegt war, ehrfürchtiges Staunen hervorzurufen. Genau wie Madame, die am offenen Kamin stand und ungeduldig mit dem juwelenbesetzten Pumps wippte.
«Was gibt es denn so Unaufschiebbares, Mademoiselle?», fragte sie mit einem ostentativen Blick zur vergoldeten Empire-Uhr auf dem Kaminsims. «Wenn eine meiner Töchter krank ist –»
Sie schien diese Möglichkeit eher lästig als besorgniserregend zu finden.
«Den Mädchen fehlt nichts», versicherte Rachel schnell. «Es geht um meine Mutter, Madame. Sie ist – sehr krank.» Es wurde beängstigend real, als sie es laut aussprach. «Ich muss unverzüglich zurück nach England. Ich kann – ich kann in einer Woche wieder hier sein. Solange kann mich vielleicht Manon vertreten.»
Der Blick der Gräfin war kalt. «Nein», sagte sie und wandte sich zum Gehen.
«Nein?», wiederholte Rachel, als hätte sie nicht verstanden.
Die Gräfin blieb stehen. «Nein», sagte sie noch einmal und fügte kurz hinzu: «Das passt im Moment nicht.»
Und das war alles.
Rachel konnte es nicht glauben. Sie lief ihr nach. «Meine Mutter braucht mich, Madame.» Ihre Mutter hätte sie schon vor Tagen gebraucht. «Sie hat nur mich. Mein Vater –»
Die Gräfin interessierte Rachels Vater nicht. «Gute Nacht, Miss Woodley.»
Gute Nacht? Rachel war wütend. So würde sie nicht mit sich umspringen lassen. «Es tut mir leid, Madame», sagte sie in perfektem Französisch und so kalt wie die Gräfin. Sie hatte hier unterrichtet, aber sie hatte auch gelernt. «Aber so geht das nicht. Wenn Sie mir keinen Urlaub geben können, muss ich kündigen. Fristlos.»
Die Gräfin, die schon die Tür erreicht hatte, blieb stehen und drehte sich um. Ihre Brillanten funkelten eisig im Licht des großen Kronleuchters. «Sie können sich Ihren Lohn bei Gaston abholen. Ach, und geben Sie ihm Ihre Schlüssel, bevor Sie abreisen.»
«Aber –» Rachel starrte sie sprachlos an.
«Leben Sie wohl, Mademoiselle Woodley», sagte die Gräfin mit einem kurzen herablassenden Nicken. Noch einmal richtete sie ihren kalten grauen Blick auf Rachel. «Ich nehme doch an, Sie erwarten kein Zeugnis von mir.»
Ein Zeugnis? Was bedeutete hier ein Zeugnis? Es ging um die Kinder – wie sollte sie es ihnen sagen?
Sie konnte der Gräfin nachlaufen, sie bitten, es sich noch einmal zu überlegen. Und dann? Bleiben? Ihre Mutter im Stich lassen?
Die Vorstellung war unerträglich. Im Cottage gab es kein Telefon; es gab nicht einmal elektrischen Strom. Das Haus stand am äußersten Rand des Dorfs, isoliert und abgeschieden. Es konnte Tage gedauert haben, bis überhaupt jemand gemerkt hatte, dass ihre Mutter krank war. Und nun sollte sie sie, schwach und von Fieber geschüttelt, wie sie vielleicht war, dort liegenlassen?
Die Luft im Saal war geschwängert vom schwülen Duft von Treibhausblumen und schwerer Parfums. Rachel fühlte sich benebelt von der aufdringlichen Süße. Keine Zeit, jetzt über Wenn und Aber nachzudenken, der Zug würde nicht auf sie warten.
Viel zu packen gab es nicht in ihrem kleinen Zimmer, ein paar Röcke und Blusen, ein kleiner Stapel Bücher, ein Hut, der in Paris gekauft war, aber keinen Anspruch auf ‹Pariser Chic› erheben konnte. Es passte alles in die eine Reisetasche, mit der sie gekommen war.
Und dann der Abschied.
Anne-Marie, die zu weinen begann. «Aber warum gehen Sie fort?»
«Weil sie dich nicht mag», versuchte Albertine zu spotten, doch Rachel hörte das Zittern in der kindlichen Stimme und wünschte, sie hätte sich mehr um Albertine bemüht. Es war schließlich nicht ihre Schuld, dass sie ihrer Mutter so ähnlich war.
Sie sagte es in einfachen Worten. «Meine Mutter ist sehr krank. Sie braucht mich jetzt.»
«Aber wir brauchen dich auch», entgegnete Amelie. Sie überlegte einen Moment. «Sophie wird dich vermissen.»
Oh, Sophie. Sophie und ihre Botschaften. Sie würde Sophie auch vermissen. Sie würde sie alle vermissen.
Wenn ihre Mutter auf dem Weg der Besserung war, konnte sie vielleicht –
Rachel dachte den Gedanken gar nicht zu Ende. Die Gräfin würde sie nicht wieder einstellen. Und selbst wenn sie es täte, Rachel hatte gelernt, dass es besser war, sich nicht zu tief einzulassen. Amelie mochte jetzt noch an ihr hängen, doch in ein paar Jahren würde sie ihre Haare hochstecken und die Kinderkittel ablegen, und Rachel würde weiterziehen zur nächsten Familie.
Auch wenn sie eine Zeitlang mit ihnen lebte, sie unterrichtete und sogar lieb gewann, sie waren nicht ihre Familie.
Die einzige Familie, die sie hatte, war ihre Mutter.
Indem sie den Chauffeur unverfroren belog und behauptete, die Gräfin habe ihr die Benutzung des Wagens gestattet, gelang es ihr, den Bahnhof rechtzeitig zu erreichen, um den Zug zu nehmen, der um 23 Uhr 15 nach Paris abfuhr. Im Wagen war es eiskalt und dunkel, die Fenster beschlugen im Nu mit ihrer Atemluft; wenn sie hinauszuschauen versuchte, sah sie nur ihr eigenes Gesicht unter dem unmodischen Hut, den sie gegen die Kälte über die Ohren heruntergezogen hatte: hohe Wangenknochen, ein zu großer Mund, dunkles Haar, das blasse Haut umrahmte.
Nichts an diesem Gesicht war bemerkenswert, außer für ihre Mutter, die sie liebte.
Früher einmal, vor langer Zeit, waren sie zu dritt gewesen. Rachel konnte sich dieser glücklichen Tage noch erinnern. Es konnten nicht nur Sommertage gewesen sein, aber so hatte sie sie im Gedächtnis. Sie hatten in einem kleinen Haus mit Garten gewohnt, und auch wenn ihr Vater häufig abwesend war, so kam er doch jedes Mal zurück, und dann nahm er sie in die Arme und wirbelte sie herum, bis sie vor Freude jauchzte.
Bis er eines Tages nicht zurückgekommen war.
Er war gestorben, irgendwo in einem fernen Land, das auf der Landkarte nur ein kleiner Punkt war. Ihre Mutter hatte ihr erzählt, dass er Botaniker gewesen war und auf einer seiner Reisen zur Erforschung seltener Pflanzen an Tropenfieber erkrankt und gestorben.
Als sie noch klein gewesen war, hatte Rachel oft den Globus gedreht und auf der riesigen blauen Fläche des Ozeans diese kleinen Fleckchen Erde gesucht, die Namen trugen wie Martinique und St. Lucia, und sich gefragt, auf welchem von ihnen ihr Vater begraben lag. Sie hatte sich, wie Kinder das gern taten, ihre eigenen Geschichten zurechtgelegt. Ihr Vater war gar nicht tot, er war nur verschollen. Er war kein Botaniker gewesen, sondern ein Spion auf tödlicher Mission. Oder der Erbe eines verloren Königreichs, der untertauchen musste, um den Heeren der Aufständischen zu entkommen, die sein Land besetzt hielten.
Ihr Vater war eine Phantasiegestalt, doch ihre Mutter gab es wirklich, und sie war immer da, wenn Rachel sie brauchte. Sie war die kühle Hand auf Rachels Stirn, wenn sie krank war; sie war die Stimme, die ihr Märchen vorlas; sie war die feste Hand, die morgens ihren Mantel zuknöpfte, bevor sie sich auf den Schulweg machte. In den letzten Jahren war sie oft ein Brief mit einer englischen Marke; ein Päckchen mit einem Paar warmer Handschuhe, einem Stück Plumpudding zu Weihnachten. Mit liebevollen Kleinigkeiten, die Rachel ein Stück Zuhause in die Ferne brachten.
Ihre Mutter verstand sich auf liebevolle Kleinigkeiten.
In dem kalten Abteil kroch Rachel tiefer in ihren Mantel und wünschte, der Zug würde schneller fahren. Lieber Gott, das Ding zuckelte ja vor sich hin wie ein Pferdegespann.
Es war nach zwei Uhr morgens, als sie an der Gare du Nord ausstieg. Die Schalter und der Wartesaal waren geschlossen. Die wenigen gestrandeten Reisenden, die hier und dort, auf ihren Koffern hockend, auf ihren Anschluss warteten, wirkten verloren in der hohen, zugigen Halle.
Der Zug nach Calais sollte laut Fahrplan um drei abfahren. Rachel dachte an die endlosen Stunden Fahrt, die vor ihr lagen. Es war verrückt, dass man Nachrichten per Draht innerhalb von Minuten an die entferntesten Orte senden konnte, das Reisen jedoch immer noch fast genauso mühselig war wie im letzten Jahrhundert. Sie wünschte sich, sie hätte eine Zeitmaschine, wie H.G. Wells sie in seinem Roman entwarf, die sie zurückversetzen könnte in die Zeit vor fünf Tagen. Nein, weiter zurück in die Zeit vor dreiundzwanzig Jahren, als sie noch alle drei zusammen gewesen waren. Dann könnte sie verhindern, dass ihr Vater abreiste, dass ihre Mutter krank wurde …
Und was dann? Ihre ganze Geschichte würde sich verändern. Sie wären nie nach Netherwell gezogen; sie wäre ganz anders aufgewachsen. Nichts als sinnlose Spekulation, mit der sie sich die Wartezeit verkürzte.
Der Zug nach Calais war um diese Zeit fast leer, sie fand mühelos einen Platz. Nur noch zwölf Stunden, dann würde sie wieder daheim sein, in Netherwell in dem Cottage, in dem sie groß geworden war.
Und ihre Mutter … ihre Mutter würde vielleicht schon wieder aufrecht in ihrem Bett sitzen und ungeduldig verlangen, endlich aufstehen zu dürfen, um Himmels willen endlich wieder etwas tun zu dürfen. Wie die meisten Menschen, die mit einer robusten Gesundheit gesegnet waren, war ihre Mutter eine schwierige Patientin. Rachel fiel es schwer, sich ihre Mutter untätig vorzustellen; sie war immer auf den Beinen, immer mit irgendetwas beschäftigt.
Nun ja, sie hatte ja auch keine Wahl gehabt, sie hatte arbeiten müssen. Botaniker verdienten offensichtlich nicht gerade üppig. Die Hinterlassenschaft ihres Vaters hatte ausgereicht, um die Kosten für das Cottage und ihr tägliches Leben zu decken; mehr nicht.
Selbst heute noch hatte Rachel die dunklen albtraumhaften Tage unmittelbar nach dem Tod ihres Vaters in bedrückender Erinnerung, den Klang ihrer eigenen kindlichen Stimme, wenn sie immer wieder gefragt hatte: «Wo ist Papa? Wo ist Papa?»; das starre Gesicht ihrer Mutter mit den rot geränderten Augen, den plötzlichen Aufbruch, als sie praktisch von heute auf morgen ihr Haus verlassen und nur die Dinge mitgenommen hatten, die ihrer Mutter am meisten am Herzen lagen: ihr Klavier, das Schachspiel ihres Mannes, den ovalen goldenen Anhänger mit den ineinander verschlungenen Buchstaben E und K, den sie an einer Kette um den Hals trug.
Ihre Mutter erlaubte sich in dieser ganzen Zeit keine Schwäche. Sie trocknete Rachels Tränen, packte ihre wenigen Besitztümer zusammen, richtete ein neues Zuhause ein, suchte nach Möglichkeiten, ihr mageres Einkommen aufzubessern. Sie hatte ihr Leben fest in die Hand genommen.
Morgen. Als der Zug in Calais einfuhr, ging gerade die Sonne auf und färbte das Wasser des Ärmelkanals mit rotgoldenem Glanz. Im ersten Licht des neuen Tages erschienen Rachel, die müde und zerschlagen aus dem Zug stieg, die Ängste der vergangenen Nacht wie Hirngespinste. Wenn der Zustand ihrer Mutter sich verschlechtert hätte, hätte Jim ihr das doch mitgeteilt. Er hätte es gewiss nicht bei dem einen Telegramm belassen.
An Deck der Fähre hob sie das Gesicht in die salzige Luft und genoss den scharfen Zug des Windes auf ihrer Haut. Es war ein guter Wind, der ihr entgegenblies, er roch nach England und Ausflügen ans Meer.
Mit dem Zug nach London, dort umsteigen und dann noch einmal in King’s Lynn. Rachels Ängste ließen nach, je näher sie ihrem Zuhause kam. Die Luft draußen war noch winterlich kühl, doch die Sonne, die hell von einem blauen Himmel herab schien, tauchte das Land in freundliche Verheißung, und Rachel begann allem Bangen zum Trotz, sich auf das Wiedersehen mit ihrer Mutter zu freuen.
Die Lokalbahn zuckelte von Ort zu Ort, Hausfrauen mit vollen Einkaufstaschen und schnatternde Schulmädchen stiegen aus. Rachel hatte einmal zu diesen Mädchen gehört. Als sie in Netherwell zum Bahnsteig hinuntersprang, sah sie sich wieder, wie sie damals gewesen war, mit ihrem Tornister in der Hand und einem Strohhut mit steifer Krempe auf dem Kopf. Der Kies auf der Schotterstraße knirschte unter ihren Stiefeln, es roch nach modrigem Laub und Lehm, ein Hauch Kohlerauch hing in der Luft.
Es gab eine Abkürzung durch ein Wäldchen, die unter einem natürlichen Laubdach hindurch nicht ins Dorf selbst führte, sondern nur wenige Meter vom Cottage entfernt wieder in die Straße einmündete, so nahe, dass Rachel die altvertrauten grauen Mauern erkennen konnte, teilweise von Efeu überwachsen, der ihnen etwas Verwunschenes gab.
Sie atmete auf vor Erleichterung, als sie den Rauch sah, der aus dem Kamin aufstieg, eines der alten Sprossenfenster stand offen. Sie lief schneller, die Reisetasche hing beinahe gewichtslos in ihrer Hand, als sie den Gartenweg hinaufeilte. Sie kannte jede der alten geborstenen Platten, sie wusste, dass sie nicht zu klopfen brauchte, weil die Tür nie abgesperrt war.
«Mutter!» Sie stieß die Tür auf. Einen Flur gab es nicht. Durch die Haustür trat man direkt ins Wohnzimmer mit den burgunderroten Plüschsesseln und dem durchgesessenen Sofa, alles nicht besonders ansehnlich, aber gemütlich, zu Hause eben.
Vor dem offenen Kamin, der leicht einmal qualmte, stand eine Frau und stocherte vorsichtig mit dem Schürhaken im Feuer. Aber es war nicht ihre Mutter. Diese Frau war zu klein und zu schmächtig, ihre Haare waren nicht braun, sondern rotblond.
Rachel ließ die Reisetasche fallen. «Alice?»
Rachels beste Freundin fuhr zusammen. «Rachel!» Sie steckte den Schürhaken zurück in den Ständer. «Gott sei Dank! Ich hatte schon Angst, dir wäre etwas passiert.»
Keine Zeit jetzt für Erklärungen. Rachel wandte sich der Treppe zu. «Mama? Ist sie –?»
Alice lief Rachel entgegen und nahm sie trotz ihrer kohlegeschwärzten Hände in die Arme. «Rachel! Es tut mir so leid.»
Kapitel 2
Das tiefe Bedauern in Alice’ Blick weckte namenlose Ängste.
«Wo ist sie? Oben? Im Bett?»
Krank. Hinfällig. Zu schwach, um aufzustehen. Ganz gleich, jetzt war sie – Rachel – ja da. Sie würde ihre Mutter wieder gesund pflegen. Ihre Mutter hatte Kraft und einen starken Willen. Sie konnte alles besiegen, selbst die Influenza.
Sie schob Alice weg, doch die nahm ihre Hand. «Rachel – deine Mutter ist tot.»
«Tot?» Rachel begriff nicht.
«Es tut mir so leid», sagte Alice leise und hilflos.
Die Stille im Haus war erstickend. Oben rührte sich nichts. Keine Schritte, kein Rascheln von Bettzeug. Und hier unten nur das Knistern des Feuers.
«Tot?», fragte Rachel noch einmal. Sie konnte es nicht fassen, dass ihre Mutter für immer gegangen sein sollte; dass sie nie wieder ihre Schritte auf der Treppe, nie wieder ihre Stimme hören würde. Ihr Duft hing noch in der Luft, Lavendel und schwarzer Tee.
Alice nickte nur.
«Wann?», fragte Rachel und erkannte kaum ihre eigene Stimme.
«Am Freitag.»
Vor vier Tagen. Was hatte sie selbst an diesem Tag getan? War es passiert, während sie auf dem Schloss die Kinder badete? Während sie Albertine die englischen Könige abfragte? Während sie ihre Haare machte, ihre Strümpfe stopfte, mit irgendeiner von hundert belanglosen Kleinigkeiten beschäftigt war?
Ihre Mutter war gestorben, und sie war nicht bei ihr gewesen.
Alice trat voll Unbehagen von einem Fuß auf den anderen. «Wir haben dir ein Telegramm geschickt. Wir konnten uns nicht erklären, warum du nicht –»
«Ich weiß.» Rachel hatte das Gefühl, keine Luft zu bekommen. «Das Telegramm ist liegengeblieben. Ich habe es viel zu spät bekommen.»
Wenn sie Hector gegenüber nicht so schroff gewesen wäre … Wenn sie das Telegramm sofort erhalten hätte … Wenn sie gleich den ersten Zug genommen hätte …
Wenn, wenn, wenn.
Alice missverstand ihr Schweigen. «Jim hat mehrmals versucht, dich in Paris anzurufen, aber er hat nie eine Verbindung bekommen.»
«Wir waren nicht in Paris, wir waren in der Normandie.»
Sie waren immer in der Normandie. Wenn Alice ihre Briefe richtig gelesen hätte, wüsste sie das. Aber für Alice war Frankreich einfach Frankreich.
Nein, das war hässlich und ungerecht. Alice konnte überhaupt nichts dafür. Jim und Alice hatten ihr Bestes getan, ihnen war weiß Gott kein Vorwurf zu machen.
«Jim hat wirklich alles versucht», sagte Alice wie zur Bestätigung, «aber als endlich jemand merkte, dass sie krank war, war die Krankheit schon zu weit fortgeschritten –»
«Ich weiß.» Rachel rieb sich mit beiden Händen die brennenden Augen. Ruß und Qualm nach der endlosen Bahnfahrt. «Er musste sich ja auch noch um andere Patienten kümmern.»
Es kostete sie Mühe, sich das in diesem Moment abgrundtiefer Verzweiflung ins Gedächtnis zu rufen. Warum, warum, hätte sie am liebsten geschrien, habt ihr euch nicht mehr bemüht, warum hat er es nicht so lange versucht, bis er jemanden erreichte, der mich in Brillac hätte anrufen können, dann hätte ich wenigstens die Möglichkeit gehabt –
Selbst jetzt war es ihr unfassbar, dass sie nichts, absolut nichts mehr tun konnte.
«Ach, Rachel, du kannst es dir nicht vorstellen.» Alice’ Stimme war tränenerstickt. «Wir hatten so viele Kranke im Dorf und niemanden, um sie alle zu pflegen. Als mein Vater irgendwann sagte, dass deine Mutter nicht in der Kirche gewesen war –»
«Bitte! Du brauchst mir nichts zu erklären.» Hör auf, bitte, hör auf, hätte Rachel am liebsten gerufen. Sie wollte es nicht hören. «Sie war meine Mutter. Ich hätte bei ihr sein müssen.» Sie kämpfte die aufsteigenden Tränen nieder und straffte die Schultern. «Die Beerdigung – ich muss mich jetzt erst einmal um alles kümmern.»
Alice senkte den Blick. «Die Beerdigung war gestern.»
Es war, als würde ihr der Boden unter den Füßen weggezogen. Das ganze Zimmer schien zu schwanken wie das Deck der Fähre während der stürmischen Überfahrt. Grauer Nebel wogte um sie herum, sie hielt sich hastig am Treppengeländer fest. «Was?»
«Rachel, komm, setz dich erst einmal. Du hast ja noch nicht einmal deinen Mantel abgelegt. Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen?»
Rachel atmete tief ein und aus. «Irgendwo in der Nähe von Calais, keine Ahnung.» Der Schwindel ließ ein wenig nach. Sie musste sich jetzt zusammennehmen. «Die Beerdigung war gestern?»
Alice senkte den Kopf, als fühlte sie sich schuldig. Rachel verstand es nicht. Sie, Rachel, war es doch, die das Begräbnis ihrer Mutter versäumt hatte. «Wie gesagt, wir konnten dich einfach nicht erreichen. Wir haben wirklich alles versucht. Und», fügte sie zögernd hinzu, «wir wollten es nicht zu lange hinausschieben.»
Rachel stieß das Bild weg, das sich ihr aufdrängen wollte.
Nein. Nein.
«Es war alles so, wie deine Mutter es sich gewünscht hätte», setzte Alice hastig hinzu und verhaspelte sich beinahe, so wie früher in der Schule, wenn sie beim Aufsagen der gelernten Gedichte vor lauter Nervosität immer schneller gesprochen hatte. «Dein Onkel – der aus Oxford – ist hergekommen und hat sich um alles gekümmert. Es war eine schöne Feier, wirklich, mit Veilchen auf dem Sarg – dein Onkel sagte, dass deine Mutter Veilchen geliebt hat –, und Mrs. Trotter kriegte mitten im dreiundzwanzigsten Psalm einen ihrer hysterischen Anfälle.»
«Natürlich, das musste sein.» Rachel musste bei allem Kummer beinahe lachen. Mrs. Trotters hysterische Anfälle waren legendär. Rachels Mutter hatte immer gesagt –
Rachel drückte einen Moment beide Hände auf ihre Augen. «Es – danke euch, dass ihr euch um alles gekümmert habt. Danke.»
Ihren Vater hatten sie nie beerdigen können. Er war irgendwo in der Ferne gestorben. Und nun ihre Mutter …
Rachel meinte jetzt den Sinn der Beerdigung zu erkennen. Ohne Aufbahrung, ohne den dumpfen Aufprall der Erde auf dem Sarg blieb alles irreal.
«Aber mit dem Stein haben wir gewartet. Den musst du aussuchen», sagte Alice, als könnte das ein Trost sein.
Rachel begann zu lachen und konnte kaum wieder aufhören. Sie drückte die Hände auf den Mund. «O Gott, entschuldige. Danke, danke für alles, Alice.»
Die Freundin musterte sie ängstlich. «Komm, ich mache dir eine Tasse Tee. Oder irgendetwas anderes. Du siehst todmüde aus.»
«Ich bin seit gestern Abend unterwegs. Ich bin sofort losgefahren, als ich das Telegramm bekam.» Sie war immer noch im Mantel.
In demselben Mantel, den sie vor einer Ewigkeit in ihrem Zimmer auf Schloss Brillac übergeworfen hatte. Es war warm im Zimmer dank dem Feuer, das Alice angezündet hatte, doch Rachel empfand den Mantel wie eine schützende Hülle, die sie am liebsten nie wieder abgelegt hätte.
Ungeduldig mit sich selbst, riss sie die Knöpfe auf und warf das Kleidungsstück über das Treppengeländer. «Ja, eine Tasse Tee wäre wunderbar.»
Alice stieß einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus. «Ich habe das Wasser schon aufgesetzt.» Sie wandte sich zur Küche. «Es ist bloß leider keine Milch da –»
«Das macht nichts.» Rachel folgte ihrer Freundin in die Küche. Sie kam sich vor wie Besuch in ihrem eigenen Zuhause, fremd und befangen. «Ich habe seit Monaten keine anständige Tasse Tee mehr getrunken.»
Der Kessel auf dem Herd begann schon zu zischen. Alice häufte Tee aus der Dose in die Kanne. «Wissen denn die Franzosen nicht, wie man Tee kocht?»
«Ich glaube, sie sind eher Kaffeeliebhaber.» Rachel bemühte sich krampfhaft, eine Atmosphäre von Normalität zu bewahren, obwohl ihr beinahe die Tränen kamen, als das dampfende Wasser aus dem Kessel in die alte braune Kanne mit der angeschlagenen Tülle strömte und der Duft des irischen Tees, den ihre Mutter so gern getrunken hatte, sich ausbreitete. Im Krieg hatten sie die Teeblätter immer wieder aufgegossen, bis schließlich kaum noch mehr als bräunlich gefärbtes Wasser in ihren Tassen war. Sie konnte sich noch genau an die erste richtige Tasse Tee nach dem Krieg erinnern, an die spürbare Befriedigung ihrer Mutter, als sie ihnen das dunkle, duftende Gebräu aus ebendieser Kanne eingeschenkt hatte.
Sie merkte plötzlich, dass Alice sie ansah. Zwischen ihren Brauen stand eine kleine Falte. «Entschuldige, was hast du eben gesagt?»
«Ach, nichts», antwortete Alice abwehrend und stellte die Kanne auf den braunen Holztisch.
Unzählige Male hatten sie zusammen an diesem Küchentisch gesessen und ihre Hausaufgaben gemacht oder geschwatzt, während im Wohnzimmer eine der Schülerinnen ihrer Mutter auf dem Klavier ihre Fingerübungen machte.
Einen Moment lang hatte Rachel den Eindruck, das Klavierklimpern aus dem Nebenzimmer zu hören. Dann brach es ab, und nichts blieb als die dumpfe Stille im Haus. Sie nahm sich einen der Kekse, die Alice hingestellt hatte, und kaute mechanisch, während sie darüber nachdachte, wie es jetzt weitergehen würde. Sie würde den Anwalt ihrer Mutter aufsuchen müssen. Oder hatte er ihr vielleicht schon geschrieben? Alice nach der Post fragen, mit Norris wegen der Miete sprechen …
«Was wirst du jetzt tun?», fragte Alice, die sich zu ihr gesetzt hatte, zaghaft. «Hast du vor, nach Frankreich zurückzukehren?»
Rachel brauchte nur an das Gesicht der Gräfin zu denken, um zu wissen, dass es eine solche Rückkehr nicht gab. Diese Tür hatte sie endgültig zugeschlagen. «Nein, ganz sicher nicht.» Sie umfasste die Teetasse mit beiden Händen. «Weißt du, ich bin nicht im Guten gegangen. Ich vermute, die Gräfin wird mir nicht einmal ein Zeugnis geben. Jedenfalls keines, das vorzeigbar wäre.»
«Was willst du dann tun?»
«Ich weiß es noch nicht.» Sie hatte gar keine Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen. «Wahrscheinlich bleibe ich erst einmal hier. Bis ich eine neue Stellung habe jedenfalls.» Als sie Alice’ Blick bemerkte, fragte sie scharf: «Was denn? Was ist?»
Alice drehte ihre Teetasse auf der Untertasse hin und her. «Mr. Norris war bei der Beerdigung. Er hat gesagt, er – er muss dir fristlos kündigen.»
«Kündigen? Warum denn?»
«Er behauptet, die Miete sei letzte Woche nicht pünktlich bezahlt worden – was ja wohl verständlich ist, oder? Jeder hier weiß, dass das nur ein Vorwand ist. Er bildet sich ein, er kann das Cottage an irgendwelche reichen Londoner als Wochenendhaus vermieten. Ein grässlicher Mensch. Deswegen bin ich auch hergekommen Ich wollte sehen, dass du auch deine Sachen bekommst – das Klavier deiner Mutter –»
Rachel konnte es nicht glauben. «Norris will mich rauswerfen?»
«Er konnte es gar nicht erwarten», sagte Alice aufgebracht. «Nur deswegen ist er überhaupt zur Beerdigung gekommen. Du musst dich wehren.» Alice rückte ihren Stuhl näher an den Tisch. «Dagegen muss man doch etwas tun können. Die Miete ist gerade mal eine Woche überfällig. Wenn ich auch nur die geringste Ahnung gehabt hätte, hätte ich sie sofort bezahlt, das weißt du hoffentlich.»
«Ja, natürlich, das weiß ich», bestätigte Rachel immer noch wie benommen. Sie sah Alice an. «Wie sagt Mrs. Spicer immer? Ein Unglück kommt selten allein. Recht hat sie.»
Alice legte Rachel die Hand auf den Arm. «Du weißt, dass du jederzeit bei uns wohnen kannst, solange du willst.»
«Braucht ihr eine Erzieherin?» Rachel rieb sich die Schläfen. «Ich muss arbeiten, Alice. Und das kann ich auch. Ich möchte nicht eure Freundschaft ausnutzen.»
«Was heißt ausnutzen? Wir sind praktisch Schwestern, weißt du nicht mehr?»
Sie musste lächeln bei der Erinnerung. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatten sie und Alice die wildesten Pläne geschmiedet, um Alice’ Vater, dessen Frau kurz nach Alice’ Geburt gestorben war, und Rachels Mutter miteinander zu verheiraten. Sie hatten sich vorgestellt, wie großartig das wäre. Sie wären dann richtige Schwestern und hätten ein gemeinsames Zimmer und könnten nachts immer bis in alle Ewigkeit aufbleiben und reden. Und später, wenn sie einmal aus dem Haus gingen, wären Alice’ Vater und Rachels Mutter nicht einsam. Alice’ großes Ziel war es gewesen, den Prinzen von Wales zu heiraten, während Rachels Ehrgeiz darauf gerichtet war, Polarforscherin zu werden und eine Expedition mit Hundeschlitten und allem Drum und Dran in die Arktis anzuführen.
Es war ein famoser Plan gewesen – mit dem einzigen Haken, dass die beiden fraglichen Erwachsenen nicht im Geringsten an einer Heirat interessiert waren.
Alice’ Vater, der Pastor von Netherwell, war mit seiner Arbeit an einer theologischen Abhandlung verheiratet, der er sich seit zwanzig Jahren mehr oder weniger erfolgreich widmete.
Und Rachels Mutter hatte sich ihre Tochter vorgeknöpft und ihr freundlich, aber bestimmt erklärt, dass es nicht ihre Aufgabe sei, sich in das Leben anderer einzumischen.
«Ich kann Mr. Treadwell nicht heiraten», hatte sie nur gesagt.
«Aber warum nicht?», fragte Rachel enttäuscht.
«Du vergisst, dass ich verheiratet bin. Und ich werde es sein bis zu meinem Tod.»
Ihre Worte beschämten Rachel, die Erinnerung an ihren Vater stand plötzlich greifbar zwischen ihnen. Wie hatte sie ihren Vater einfach vergessen, wie hatte sie annehmen können, die Liebe ihrer Mutter wäre geringer geworden, nur weil Zeit vergangen war?
Dann also keine richtigen Schwestern. Sie und Alice hatten sich geschlagen gegeben und damit abgefunden, dass sie immer nur Seelenschwestern bleiben würden.
Aber selbst Seelenschwestern lebten sich auseinander. Rachel liebte Alice und würde sie immer lieben. Die innere Verbindung zwischen ihnen würde bestehen bleiben. Doch der tägliche lebendige Austausch, von dem ihre Freundschaft gelebt hatte, gehörte der Vergangenheit an. Sie kommunizierten jetzt mittels Briefen, die oft Monate und in vieler Hinsicht Welten auseinanderlagen.
Alice würde immer zu ihrer Vergangenheit gehören, das wusste Rachel, doch die Vorstellung, sich jetzt in ihr Leben zu drängen oder sich gar von ihr abhängig zu machen, war abschreckend. So etwas konnte einer Freundschaft nur schaden.
«Ich weiß nicht, womit ich eine Freundin wie dich verdient habe, ehrlich.» Rachel drückte kurz Alice’ Hand. «Aber kannst du dir mich als nörgelnde alte Jungfer in eurem Gästezimmer vorstellen?»
«Du brauchst doch nicht zu nörgeln», entgegnete Alice. «Und wer sagt, dass du nicht heiraten wirst?»
Rachel warf ihr einen leicht ironischen Blick zu. «Der einzig erstrebenswerte Mann weit und breit war Jim, und der ist seit geraumer Zeit in festen Händen, soviel ich weiß. Oder meinst du, ich sollte Mr. Norris anpeilen? Er ist ja Witwer.»
«Igitt», sagte Alice voll Abscheu. Sie sah Rachel fragend an. «Ist denn etwas –»
«– Geld da, meinst du? Nein.» Rachel schüttelte den Kopf.
Es konnte natürlich sein, dass eine Überraschung auf sie wartete, doch sie bezweifelte es. Da müsste ihre Mutter schon einen geheimen Schatz unter ihrem Bett versteckt haben. Auf ihrem Konto hatten nie mehr als fünfzig Pfund gelegen.
Fünfzig Pfund, ein altes Klavier und ihre goldene Uhr. Damit konnte man keine großen Sprünge machen. Nein, sie musste sich einfach schnellstens eine neue Anstellung suchen. Sie schob ihre Teetasse weg. «Hast du eine Ahnung, wie schnell ich hier rausmuss?»
«Wenn ich diesen fürchterlichen Norris richtig verstanden habe, so schnell wie möglich», antwortete Alice bedrückt. «Als ich nachfragte, sagte er, er könne dir vierzehn Tage Zeit geben – zu einem angemessenen Preis.»
«Natürlich. Wie großzügig von ihm.»
Sie schwiegen beide voll Unbehagen. Dann stand Alice auf. «Ich muss los, Annabelle das Abendessen machen. Bitte, komm doch jetzt erst mal mit zu uns.» In heiterem Ton, der ziemlich künstlich klang, fügte sie hinzu: «Annabelle fragt schon dauernd nach ihrer Tante Rachel.»
Rachel stand ebenfalls auf. Sie fühlte sich zerschlagen und merkwürdig benommen. «Du meinst, sie hofft, dass ich ihr etwas mitgebracht habe.»
«Das sicher auch.» Alice nahm ihren Hut. «Komm, du fällst ja gleich um vor Müdigkeit. Bleib wenigstens heute Nacht bei uns. Das Bett im Gästezimmer ist gemacht. Schlaf dich erst mal richtig aus.»
Rachel zwang sich zu einem Lächeln. «Während Jim schreiende Babys holt?»
«Er holt sie selten im Gästezimmer.» Alice drückte ihren Hut auf den Kopf. «Ich will dich heute Nacht nicht hier allein lassen.»
«Hast du Angst, Mr. Norris könnte versuchen, mich zusammen mit dem Haus zu vermieten?»
«Das ist nicht lustig.» Trotzdem konnte Alice ein Lächeln nicht unterdrücken. Sosehr Rachels manchmal recht lockere Bemerkungen sie schockierten, so sehr amüsierten sie sie auch. Diese unverblümte Direktheit war eine der Eigenschaften, die sie an Rachel liebte. «Dann komm wenigstens zum Abendessen mit.»
Doch Rachel konnte sich jetzt ein gemütliches Abendessen unter Freunden nicht vorstellen. Sie brauchte erst einmal Zeit für sich, sie konnte sich nicht mit einem künstlichen Lächeln an einen Tisch sitzen und Konversation machen und so tun, als wäre nichts geschehen.
«Sei mir nicht böse, Alice, aber ich glaube, ich gehe jetzt einfach schlafen.» Eine der letzten Nächte in ihrem eigenen Bett. Unvorstellbar, dass das Zimmer, das sie so lange bewohnt hatte, bald leer stehen und auf einen neuen Bewohner warten würde. Sie schüttelte den Kopf. Nicht melodramatisch werden. Was war schon ein Haus? Ein Kasten voller Schubladen.
«Morgen sehen wir weiter», sagte sie. «Ich werde wohl zuerst mal nach Oxford fahren, um Onkel David zu danken, dass er sich um alles gekümmert hat.»
Und um ihn zu fragen, was sie ihm schuldete. Nichts, würde er natürlich sagen, doch sie wollte ihn die Kosten für die Beerdigung auf keinen Fall allein tragen lassen. Irgendwie würde sie das schon bezahlen können, und wenn sie dafür ihre Uhr verkaufen musste.
«Kann ich wirklich nichts für dich tun?» Alice stand mit ihrem Mantel über dem Arm unschlüssig an der Tür.
«Du hast schon genug getan. Und du hast mich daran erinnert, dass ich nicht ganz verwaist bin», sagte sie dankbar und nahm Alice kurz in den Arm, bevor sie sie sachte zur Tür hinausschob. «Geh schon, deine Kinder warten auf dich.»
Als Alice gegangen war, deckte sie den Küchentisch ab und spülte das Geschirr, das ebenso Mr. Norris gehörte wie das Küchenbuffet, in dem sie es verstaute. Müde trocknete sie sich die Hände. Morgen würde sie das Haus durchsehen und eine Bestandsaufnahme der Dinge machen müssen, die ihr gehörten, um sie eventuell zu verkaufen. Viel war es ohnehin nicht, ihre Mutter hatte das Cottage damals möbliert gemietet. Im Grund nannte sie nicht viel mehr ihr Eigen als ihre Kleider, ein paar Bilder, das Schachspiel ihres Vaters und das Klavier ihrer Mutter.
Der Gedanke, sich von dem Klavier zu trennen, tat ihr weh. Aber was sollte sie mit dem Instrument anfangen? Sie hatte nie die Geduld aufgebracht, darauf spielen zu lernen, und sie würde es ganz sicher nicht mitnehmen können wie eine Schnecke ihr Haus.
Aus dem Erlös für das Klavier ließe sich vielleicht ein Schreibmaschinenkurs bezahlen.
Rachel packte energisch ihre Reisetasche, die immer noch am Fuß der Treppe lag, und ging Stufe um Stufe nach oben, setzte den Fuß auf der vierten, die immer knarrte, mit Vorsicht und spürte mit der Hand bewusst die Glätte des vielbenutzten Handlaufs des Treppengeländers. Mit jedem Ding in diesem Haus verband sie eine Beziehung, und das Gefühl bevorstehender Trennung drohte sie zu überwältigen. Sie merkte, dass sie angespannt lauschte, als müsste sie jeden Moment die Schritte ihrer Mutter hören, die Klänge des Klaviers unter ihren Fingern, die geliebte Stimme, die nach ihr rief.
Die Tür zum Zimmer ihrer Mutter war geschlossen, dahinter regte sich nichts. Rachel trat in ihr eigenes Zimmer und ließ die Reisetasche neben der Tür fallen. Der Spiegel hing zu tief; sie musste in die Knie gehen, um sich sehen zu können, als sie die Nadeln aus ihren Haaren nahm. Sie zog ihre Schuhe aus und ließ sie vor dem Bett liegen. Vielleicht tat Mr. Norris in seiner Profitgier ihr einen Gefallen. Sie konnte entweder hier verharren, in ihrem Mädchenzimmer, und auf einen Ruf warten, der niemals kommen würde, oder sie konnte sich auf den Weg machen in ein eigenes Leben.
Wie ihre Mutter es getan hatte. Rachel hatte den Aufbruch aus ihrem alten Zuhause nur noch verschwommen im Gedächtnis. Es war alles so schnell gegangen. Eines Tages war ein Brief gekommen, und eine Woche später hatten sie mit vollgepackten Taschen und Koffern in einem Zug gesessen, der sie unwiderruflich aus ihrem alten Leben forttrug.
Sie hatte diesen überstürzten Aufbruch damals mit ihren vier Jahren nicht verstanden. Jetzt meinte sie nachfühlen zu können, was ihre Mutter getrieben hatte. Der Geist ihres Vaters wäre überall im Haus gewesen. Es war leichter gewesen, einen Neuanfang zu versuchen, anstatt inmitten von Erinnerungen zu verweilen.
Rachel hatte instinktiv gewusst, dass sie nicht nach ihrem Vater fragen durfte, dass jede Frage nur diese Starre im Gesicht ihrer Mutter hervorrufen würde. Es musste, sagte sie sich jetzt, ungeheuer schwer gewesen sein für ihre Mutter. Sie konnte heute noch die Liebe zwischen ihren Eltern spüren, erinnerte sich der zärtlichen Berührungen, die sie im Vorübergehen tauschten, der Blicke, die mehr sagten als Worte, der Wärme und der Fürsorge, die sie ihr im Übermaß gegeben hatten. Alles weggefegt, über Nacht. Und ihre Mutter hatte sie an der Hand genommen und hatte den nächsten Schritt getan. So wie sie jetzt den nächsten Schritt tun musste.
Beklommen ging Rachel hinüber zur Zimmertür ihrer Mutter und öffnete sie zaghaft. Das Bett war notdürftig gemacht, die Tagesdecke lose über Laken und Kopfkissen geworfen. Jemand hatte gelüftet, aber es roch immer noch wie in einem Krankenzimmer nach Kampfer und Schweiß.
Ach, Mama.
Sie lief zum Bett ihrer Mutter, wie sie es damals, nach dem Tod ihres Vaters, beinahe jede Nacht getan hatte. Tagsüber war sie mit ihrem neuen Leben ganz gut zurechtgekommen, doch nachts, wenn die Dunkelheit des ihr noch fremden Hauses in ihr Zimmer kroch, brauchte sie die Nähe ihrer Mutter, die Schutz und Geborgenheit bedeutete.
Weinend legte sie sich auf das Bett, das der kleinen Rachel so hoch erschienen war, und umschlang mit beiden Armen das Kopfkissen.
Unter ihren Fingern knisterte etwas. Erstaunt setzte sie sich auf und schob das Kissen auf die Seite. Ein Blatt Papier flatterte zu Boden. Es war kein Brief. Das Papier war dünn und glänzend wie aus einem exklusiven Journal und doppelt gefaltet. Rachel konnte eine Reklame für türkische Zigaretten erkennen.
Ihre Mutter hatte nicht geraucht. Was also – vielleicht war Jim das Faltblatt versehentlich aus der Tasche gefallen. Ja, natürlich, so etwas trugen Ärzte ja ständig mit sich herum. Rachel beugte sich aus dem Bett, hob das Blatt auf und entfaltete es.
In körnigem Schwarzweiß blickte ihr das Bild ihres Vaters entgegen.
Sie kniff ungläubig die Augen zusammen, das Bild blieb. Mit zitternden Händen strich sie es auf dem Bett glatt. Wie lange hatte sie nicht geschlafen? Vielleicht schlief sie jetzt gerade, vielleicht träumte sie das alles. Es war auf jeden Fall so unwirklich wie ein Traum: das Bild; das von einem Blitzlicht festgehaltene Gesicht; der in diskreten schwarzen Lettern gedruckte Name der Zeitschrift in der oberen rechten Ecke des Blatts – Tatler. Das allein war seltsam genug. Ihre Mutter hatte immer nur die Morning Post gelesen. Der Tatler war ein Magazin für Leute, die sich für Gesellschaftsnachrichten, Kunst und Mode interessierten, lauter Dinge, für die ihre Mutter gar keine Zeit gehabt hatte.
Und das Bild selbst … Der Mann darauf war ihr Vater und nicht ihr Vater. Hochgewachsen wie ihr Vater, ja, mit den hellen Haaren, die Rachel nicht geerbt hatte, und den tiefliegenden grauen Augen, die er ihr mitgegeben hatte. Die Brille mit dem Goldrand war so vertraut wie die leicht gebeugte Haltung.
Sie konnte sogar den Schatten einer Narbe an seinem Kinn erkennen, an die sie sich aus ihrer Kindheit erinnerte.
Doch dieser Mann war älter, viel älter als ihr Vater überhaupt geworden war. So alt, wie er jetzt wäre, würde er noch leben. Und so gekleidet wie auf diesem Bild hatte Rachel ihn nie gesehen – im Abendanzug, mit Zylinder und lose geschlungenem, weißem Schal und einem Ordensband an der Brust. Neben ihm, ihren Arm in seinen geschoben, stand eine blonde junge Frau.
Der Titel unter dem Bild lautete: Lady Olivia Standish in Begleitung ihres Vaters, des Grafen von Ardmore.
In Klammern stand das Datum: Dezember 1926. Fünf Monate war das her.
Kapitel 3
Ihr Vater … und doch nicht ihr Vater.
Was für ein Unsinn! Rachel erwachte mit einem Ruck aus dem tranceartigen Zustand, in den sie verfallen war, und schob das Papier energisch weg. Ihr Vater war vor dreiundzwanzig Jahren gestorben. Und es war anzunehmen, dass sie davon gewusst hätte, wenn er von Adel gewesen wäre.