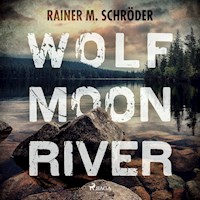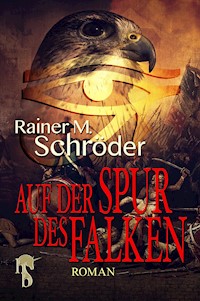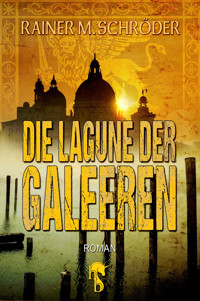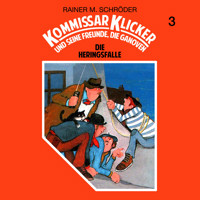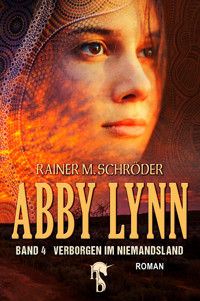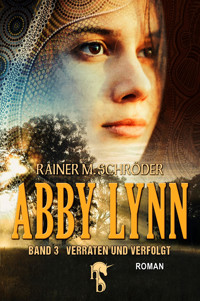4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Eltern des 15-jährigen David Cooper sind in der englischen Stadt Plymouth der Pest zum Oper gefallen. Deshalb soll der Junge von einem entfernen Verwandten in Barbados aufgenommen werden. David hat sich nur widerwillig auf die Reise gemacht, denn ihm ist der Plantagenbesitzer James Inglethorpe als rechthaberischer Mann in Erinnerung geblieben. Als das Handelsschiff »Rose«, das David nach Barbados bringen soll, kentert, wird er von Freibeutern aus dem Karibischen Meer gefischt. Schnell freundet sich der Junge mit Captain Ben Melvin und der Crew der »Golden Sea« an. Doch was für David als großes Abenteuer beginnt, wird schnell bitterer Ernst: Als sie auf einer einsamen Insel stranden, beginnt für die gesamte Mannschaft der Kampf ums Überleben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Die Galgeninsel
Roman
1
Das Freibeuterschiff Golden Sea wurde von einem Orkan mit beispielloser Wut nach Nordosten auf die gefürchteten Riffe der Caicos-Inseln zugetrieben. Der Gaffelschoner erzitterte unter den Sturzbrechern, die auf das Vorschiff niedergingen und über das Deck fegten. Zersplitterte Spieren, tote Fische und wirre Knäuel gebrochener Strecktaue wurden über Bord gespült.
Seit mehr als acht Stunden tobte der Orkan und wühlte das Karibische Meer zu einem Hexenkessel auf, in dem das Freibeuterschiff hilflos wie ein Laubblatt im Herbstwind umhertaumelte. Der Orkan, der den Schoner schon schwer gezeichnet hatte, hatte noch nichts von seiner wilden, zerstörerischen Kraft verloren.
Die Nacht war hereingebrochen. Die Sturmböen jagten dunkle Wolkenfelder über den Himmel. Kein noch so schwacher Mondschein drang durch die dichte Wolkendecke, und kein Stern war zu sehen.
Das Ende der Welt schien gekommen.
Die Kreuzseen hämmerten gegen die Bordwände und schienen das Schiff zermalmen zu wollen. Ein Ächzen ging durch den Rumpf des Gaffelschoners. Immer wieder wurde das Vorschiff von gischtenden Wassermassen unter ohrenbetäubendem Tosen begraben. In solchen Momenten hatte es den Anschein, als wollte sich die Golden Sea geradewegs in den Meeresgrund bohren. Doch nach einem quälend langen Augenblick bäumte sich das Schiff wieder auf, und der Bugspriet stieg aus den sturmgepeitschten Fluten. Gurgelnd lief das Wasser durch die Speigatten ab.
Benjamin Melvin hielt das Ruder verzweifelt umklammert. Die Knöchel seiner Hände traten vor Anstrengung weiß hervor. Die Orkanböen fegten über das Schiff hinweg und peitschten ihm Gischtwolken ins Gesicht.
»Der Teufel soll dich holen!«, fluchte Benjamin Melvin. Er war bis auf die Haut durchnässt. Das Salz brannte ihm in den Augen, die er zu engen Schlitzen zusammengekniffen hatte. Seine aufgesprungenen Lippen bildeten einen schmalen Strich und drückten seine Entschlossenheit aus, bis zum bitteren Ende gegen die Naturgewalten anzukämpfen. Wirr und in nassen, salzverkrusteten Strähnen hing ihm das pechschwarze Haar in die Stirn. Und die fingerlange Narbe, die quer über seine linke Wange lief und von einem Säbelhieb herrührte, hob sich fahlgrau von der sonnengebräunten Haut seines Gesichtes ab.
Benjamin Melvin, ein sehniger Mann Mitte dreißig und Captain der Golden Sea, schrie dem Orkan schreckliche Verwünschungen zu, als wären Wind und Wogen seine persönlichen Todfeinde, vor denen er sich niemals freiwillig ergeben würde.
Er ignorierte die Schmerzen in seinen verkrampften Händen und Beinen. Mit grimmiger Entschlossenheit stand er am Ruder und konzentrierte sich auf die heranrollenden Brecher, die sich zu beängstigenden Wellenbergen auftürmten und immer wieder versuchten, den Schoner in tausend Stücke zu schlagen.
Benjamin Melvin war auf See groß geworden und kannte ihre Tücken. Er vertraute deshalb auf sein Geschick und seine Erfahrungen und bemühte sich, dem Orkan so gut es ging zu trotzen und das Schiff aus der Gefahrenzone herauszubringen. Er machte sich jedoch keine Illusionen. Der Kampf gegen die aufgewühlte See dauerte schon zu lange, und ein Ende war nicht abzusehen.
Die Männer an Bord waren ausgelaugt und fast am Ende ihrer Widerstandskraft, genauso wie der Gaffelschoner. Wenn der Orkan nicht bald abflaute, war das Schicksal des Freibeuterschiffs und seiner Besatzung besiegelt. Die erfolgreichen Kaperfahrten gegen Spanier und Franzosen hatten dann ein jähes Ende. Ihm, Benjamin Melvin, und seinen Kameraden stand ein nasses Seemannsgrab bevor. Und all die Reichtümer, die in den Laderäumen verstaut waren, würden mit ihnen in die Tiefe des Karibischen Meers versinken.
Der Wind heulte in den Wanten und Pardunen. Die Takelage wurde bis an die Grenze des Erträglichen belastet. Viele Taue waren schon gerissen. Vom Bugsprietsegel existierten nur noch einige Tuchstreifen, die gefährlich im Sturmwind knallten.
Mit angespannter Miene beobachtete Benjamin Melvin die vier Männer, die mittschiffs ihr Leben riskierten. Eine der Kanonen hatte sich an Backbord losgerissen. Die schweren Brooktaue, mit denen der Zwölfpfünder gesichert war, hatten der Belastung nicht länger standgehalten. Jetzt donnerte das schwere Geschütz, das auf einer Lafette ruhte, von Backbord nach Steuerbord, krachte gegen das Schanzkleid und drohte auch noch weitere Geschütze aus ihrer Verankerung zu reißen.
Was sich die Männer mittschiffs zuschrien, bekam Benjamin Melvin nur zum Teil mit. Das Tosen des Orkans übertönte zumeist die Rufe der Freibeuter.
»… Schanzkleid durchschlagen …«
»Beim nächsten Überholen … Taue … packen …«
Der Zwölfpfünder schlidderte über das Deck und rammte den Großmast. Deutlich konnte man hören, wie Holz splitterte, und Benjamin Melvin zog sich der Magen zusammen. Einen Augenblick verharrte die Kanone in dieser Stellung.
»Jetzt!«, schrie Long Tom Cody, der zu den vier beherzten Männern gehörte, die mittschiffs versuchten, die Kanone zu sichern.
Long Tom Cody war groß und hager wie eine Handspake. Seine spindeldünne Gestalt ließ die Vermutung zu, dass man ihn auf halbe Ration gesetzt hatte. Und er machte eher den Eindruck eines frommen Asketen als den eines tollkühnen Freibeuters, aber das täuschte.
Long Tom Cody bestand nur aus Sehnen und Muskeln, und beim Entern eines feindlichen Schiffes fand man ihn stets unter den ersten. Er war zäh, schnell und verstand es, die Klinge zu führen. Außerdem besaß er die Augen eines Seeadlers; deshalb fungierte er an Bord des Freibeuterschiffs auch als Geschützmeister. Auf seinen Befehl hin wurden die Kanonen abgefeuert.
Auch jetzt kämpfte er mit ganzem Einsatz, um den wild gewordenen Zwölfpfünder zu sichern, der eine große Gefahr darstellte. Gleichzeitig mussten Long Tom Cody und seine Kameraden die Brecher im Auge behalten, die das Deck überspülten und sie von den Beinen zu reißen drohten.
Auf Long Toms Ruf hin stürzten die vier Männer auf das Geschütz zu. Einer von ihnen packte das abgerissene Brooktau, während die anderen Leinen vorn um die Mündung und hinten an der Traube der Kanone anbrachten.
Plötzlich krängte der Gaffelschoner nach Steuerbord. Die vier Freibeuter brauchten sich nicht erst abzusprechen, um zu wissen, was nun zu tun war. Sie gaben das Geschütz etwas frei und ließen es an Steuerbord gegen das Schanzkleid krachen. Bevor der Zwölfpfünder jedoch wieder nach Backbord rutschen konnte, hatten die Männer die Leinen mit Kreuzschlägen belegt und das schwere Geschütz festgezurrt.
Erleichtert atmete Benjamin Melvin auf. Zumindest diese Gefahr war gebannt. Aber er wusste auch, dass nur sehr selten eine siegreiche Schlacht den Ausgang eines ganzen Krieges bestimmt.
Die Golden Sea tauchte gerade aus einem Wellental empor, um wie ein schwer angeschlagener Boxer die nächste Runde mit dem Mut des Verzweifelten anzutreten, als sich der stämmige, rothaarige Oddie Peeler mühsam den Niedergang hochkämpfte.
»Oddie! … Vorsicht!«, brüllte Benjamin Melvin gegen das Heulen des Sturms an. Mit Entsetzen hatte er die schwarze, gischtgekrönte Wand bemerkt, die auf den Schoner zuraste und dabei immer noch höher in den Nachthimmel wuchs.
Der Brecher traf die Golden Sea mit unbeschreiblicher Wucht. Der Bugspriet knickte weg wie ein dünner Holzspan. Taue rissen mit hellem Sirren. Donnernd schlug die Gaffel vom Fockmast mittschiffs auf das Deck und hätte beinahe einen der Freibeuter erschlagen.
Long Tom Cody drückte sich an Steuerbord gegen das Schanzkleid, suchte dort Schutz und klammerte sich an den Leinen fest, mit denen sie gerade den Zwölfpfünder gesichert hatten. Auch Oddie Peeler verschwand für einige Augenblicke in den kochenden Wassermassen, die sich über das Deck wälzten. Glücklicherweise hatte er sich noch nicht zu weit herausgewagt, sonst hätte die Woge ihn mitgerissen und über Bord gespült.
Als das Vorschiff sich wieder hob, rappelte sich Oddie Peeler auf. Er schüttelte sich wie ein nasser Hund und rieb sich seine eindrucksvolle Habichtsnase.
»In den achterlichen Laderaum dringt jetzt auch Wasser ein!«, schrie er dem Captain zu, aber der Orkan riss ihm die Worte von den Lippen.
Benjamin Melvin ahnte mehr, als dass er hörte, was ihm Oddie Peeler, der ehemalige Schmied aus Devon in England, zurief. Nur Wortfetzen drangen an sein Ohr. Aber er fuhr nun schon lange genug zur See, um sich ein Bild von den Zuständen unter Deck machen zu können.
»Sag mir lieber, wo noch kein Wasser steht, Oddie!«, schrie Benjamin Melvin zurück. Er kannte jeden Zoll der Golden Sea und wusste nur zu gut, was sie verkraften konnte und was nicht. Dieser Orkan überforderte sie zweifellos. Und eigentlich grenzte es fast an ein Wunder, dass die schweren Brecher und Kreuzseen den Gaffelschoner nicht schon längst leck geschlagen hatten. Aber lange würde es bestimmt nicht mehr dauern …
Oddie Peeler arbeitete sich näher zu Captain Melvin heran, der sich achtern am Ruder hatte festbinden lassen, um nicht über Bord gespült zu werden.
»Der Kahn zieht Wasser wie ein mit Schrot durchlöcherter Eimer!«, brüllte der ehemalige Schmied mit dem aufbrausenden Temperament und fuhr sich mit der Hand über das kantige Gesicht.
»Was ist mit den Pumpen?«
»Arbeiten einwandfrei!«, lautete Oddies Antwort, und er lachte rau. »Aber was hilft das, wenn wir mit dem Lenzen einfach nicht mehr nachkommen. Das Wasser steigt und steigt. Unaufhörlich. Außerdem können die Männer bald nicht mehr. Sie sind restlos erledigt, Ben!«
Melvin verzog das Gesicht. »Und was schlägst du vor? Sollen wir umkehren oder Anker werfen? Was ist dir lieber?«
Anstelle einer Antwort spuckte Oddie Peeler einen Strahl Kautabaksaft aus und bedachte Benjamin Melvin mit einem verdrießlichen Seitenblick.
»Wir bleiben also auf Kurs«, stellte Benjamin Melvin mit spöttischem Lächeln fest. Er wusste, wie schlecht es um sie stand. Einen Kurs zu wählen, lag gar nicht mehr im Bereich ihrer Möglichkeiten. Der Orkan diktierte ihnen den Kurs. Sie waren machtlos. Der Sturm hatte sie in der tödlichen Umklammerung. Aber das war für Benjamin Melvin noch lange kein Grund, seinen Galgenhumor zu verlieren. Solange er noch eine Planke unter den Füßen spürte, war noch nicht alles verloren.
»Hölle und Verdammnis!«, fluchte Oddie Peeler und reckte sein scharfkantiges Kinn wie einen Rammsporn trotzig in den Wind. »Solch einen Teufelsorkan habe ich noch nicht erlebt. Und dabei habe ich geglaubt, die karibischen Wirbelstürme so gut wie den Inhalt meines Tabaksbeutels zu kennen. Ich will verdammt sein, wenn ich solch einen Sturm schon einmal erlebt habe.«
»Der Ballast muss über Bord, Oddie!«, rief Benjamin Melvin ihm zu und versuchte, einen heranrollenden Wellenberg in einem günstigen Winkel anzugehen. Er legte das Ruder hart nach Steuerbord, merkte jedoch deutlich, dass die Golden Sea nur noch äußerst schwerfällig auf Ruderbewegungen ansprach. Das eindringende Wasser machte den Gaffelschoner von Stunde zu Stunde schwerer und damit manövrierunfähiger.
»Ballast?«, wiederholte Oddie Peeler verständnislos und zog den Kopf zwischen die Schultern, als der Sturm ihnen die Gischt ins Gesicht schleuderte. »Wir haben nicht einen einzigen Sack Sand mehr an Bord! Es gibt keinen Ballast mehr, den wir über Bord werfen könnten.«
»Du irrst!«
Verwirrt blickte Oddie Peeler Captain Melvin an. Und dann trat ein ungläubiger, fast entsetzter Ausdruck auf sein kantiges Gesicht, das von hell funkelnden Augen unter roten, buschigen Brauen beherrscht wurde.
»Hölle und Verdammnis!«, stieß er schließlich hervor. Dies war sein bevorzugter Fluch, den er bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten von sich gab. »Ich hoffe, ich habe dich falsch verstanden.«
»Das hast du nicht.«
»Du meinst mit Ballast doch nicht etwa die Kisten mit den Goldmünzen und die Silberschätze, die wir den verdammten Spaniern unter Einsatz unseres Lebens abgenommen haben?«, fragte Oddie entsetzt.
»Genau die meine ich.«
»Der Teufel soll mich auf der Stelle holen, wenn ich auch nur eine Golddublone über Bord werfe!«, rief Oddie Peeler und funkelte Melvin an.
»Der Teufel ist drauf und dran, uns alle zu holen!«, erwiderte Benjamin Melvin mit schneidender Stimme. »Weder das Gold noch die Statuen werden uns heil durch diesen Orkan bringen.«
»Ja, aber …«
»Lieber schmeiße ich die gesamte Beute über Bord, als dass ich tatenlos zusehe, wie die Golden Sea voll Wasser läuft und wie ein Stück Blei in die Tiefe sinkt!«, fuhr Melvin ihm in die Rede.
Oddie Peeler kaute heftig auf dem Stück Kautabak in seinem Mund und fuhr sich mit der gespreizten Hand durch das nasse rote Haar. »Hölle und Verdammnis, das wird aber keinem der Männer schmecken!«
»Noch weniger wird es ihnen schmecken, wenn wir alle absaufen. Auf dem Meeresgrund können wir uns für die Truhen voller Gold und Silber nichts kaufen!« Melvin redete beschwörend auf Oddie Peeler ein. »Ein Grabstein aus Gold bedeutet mir weniger als ein Leben mit leeren Taschen.«
»Da ist schon was dran«, gab Oddie widerstrebend zu.
»Gut, dann sorg dafür, dass die Beute bis auf die letzte Münze über Bord geworfen wird. Du bist auf diesem Schiff der Quartermeister, Oddie«, wies ihn Melvin auf seine Vertrauensstellung hin. »Wir müssen unverzüglich handeln. Vielleicht hält das Schiff dann etwas länger durch.«
»Hölle und Verdammnis, du hast mich überredet. Ich werd's den Kameraden schon verspiekern«, knurrte Oddie Peeler.
»Vergiss aber nicht, dass die Pumpen ständig in Betrieb bleiben müssen. Treib die Männer an, Oddie. Hol das Letzte aus ihnen heraus, auch wenn sie dich verfluchen. Es geht um unser aller Leben!«, beschwor ihn Melvin.
Wie zur Bestätigung seiner Worte ging das Sturmsegel mit einem explosionsartigen Knall in Fetzen. Ein neues Segel zu setzen, war unter diesen Umständen ein Ding der Unmöglichkeit. Die Golden Sea war nun endgültig zu einem Spielball von Wind und Wellen geworden. Der Treibanker am Heck, der das Schiff einigermaßen auf Kurs halten sollte, damit es nicht querschlug, vermochte bei diesem Orkan nicht viel auszurichten.
»Wozu diese verfluchte Plackerei!«, stieß Oddie Peeler erbost hervor. Fasziniert starrte er nach vorn zum Bug, der gerade in einem Wasserberg verschwand. »Die Brecher schlagen das Schiff ja sowieso kurz und klein. Und was die Wellen nicht erledigen, das übernehmen bestimmt die Riffe. Ich will mich freiwillig kielholenlassen, wenn wir nicht geradewegs auf die Korallenriffe der Caicos-Inseln zutreiben!«
Benjamin Melvin verzog das nassglänzende Gesicht zu einem gequälten Lächeln. »Zum Teufel, wir befinden uns schon mitten im Korallengarten, Oddie. Das Kielholen bleibt dir also erspart. Aber noch bin ich Captain auf diesem Freibeuterschiff. Und solange euch das Wasser im Laderaum nicht bis zu den Augenbrauen steht, wird weiter gelenzt, und wenn den Männern die Arme abfallen. Haben wir uns verstanden?«
Der stämmige rothaarige Schmied, dem es ein leichtes gewesen wäre, Benjamin Melvin mit nur einem Fausthieb niederzustrecken, konnte sich ein breites Grinsen nun nicht verkneifen.
»Aye, aye, Sir!«, rief er spöttisch und spuckte wieder Tabaksaft aus. »Segeln wir meinetwegen eben geradewegs in die Hölle!«
»Und über Bord mit dem Gold!«, schärfte Melvin ihm noch einmal ein. Er wusste, dass er sich auf Oddie Peeler verlassen konnte. Der temperamentvolle Rotschopf hatte schon so manche heiße Schlacht an seiner Seite durchgestanden. Ähnlich wie Long Tom fürchtete der Schmied weder Tod noch Teufel. Und für die Spanier und Portugiesen in ihren schwimmenden Eimern, die sie Galeonen nannten, hatte er bloß Verachtung übrig. Oddie Peeler würde niemals freiwillig die Waffen strecken, weder im Kampf gegen die Spanier noch im Kampf gegen den Orkan.
»Wird erledigt!«,versicherte er.
»Vergiss nicht, dass noch so manche spanische Galeone und so manches Kauffahrteischiff darauf wartet, von uns gekapert zu werden!«, schrie Benjamin Melvin ihm zu, als das Heulen und Brausen des Sturmes wieder anschwoll. »Wir werden uns alles doppelt und dreifach zurückholen!«
2
Der Schoner rollte und schlingerte so schrecklich, dass David Cooper sich kaum auf den Beinen halten konnte. Mit schmerzenden Armen torkelte er zum Niedergang. Der fünfzehnjährige Junge hielt es unter Deck einfach nicht länger aus. Das Ächzen und Knarren der Spanten jagte nicht nur ihm Angst und Schrecken ein. Auch die sonst so furchtlosen Freibeuter fühlten sich unter Deck wie in einer Falle, die jeden Moment zuschnappen konnte, wenn das Schiff auf ein Riff lief oder von einem Brecher unter Wasser gedrückt wurde.
David Cooper gierte nach frischer Luft. Die Gefahren, die an Deck auf ihn lauerten, schreckten ihn nicht. Wenn er schon sterben sollte, wollte er dem Tod auch ins Auge sehen können. Zumindest machte er sich damit selbst ein wenig Mut.
Als er den Niedergang erreichte, schlug ihm von oben ein Schwall Wasser entgegen. Und im gleichen Moment stürzte Oddie Peeler die Treppe herunter und stieß mit David Cooper zusammen.
»Hölle und Verdammnis, musst du Landratte mir gerade jetzt in den Weg laufen!«, explodierte der Schmied.
»Ich bin an der Pumpe abgelöst worden«, entschuldigte sich David Cooper, erschrocken über den aufgebrachten Tonfall des Quartermeisters. Doch sofort regte sich sein Widerspruchsgeist. »Und eine Landratte bin ich schon längst nicht mehr. Ich entere genauso schnell die Wanten auf, wie jeder andere auf diesem Schiff!«
Oddie Peeler kniff die Augen zusammen, so dass sich eine steile Falte auf seiner Stirn bildete. »Ich weiß, du bist der Seeteufel persönlich, der David unter den Teerjacken«, knurrte er schon eine Spur freundlicher, denn er wusste, dass David Cooper nicht nur flink und gelehrig war, sondern auch Courage besaß. Und das war etwas, das zählte. »Wenn wir nicht gewesen wären, hätte der Teufel schon vor einer Woche eine Seele mehr in der Hölle zählen können. Also nimm den Mund nicht zu voll, Moses!«
In Davids Augen blitzte es triumphierend auf. Moses hatte der Quartermeister ihn genannt und damit die Landratte zurückgenommen. Das war so gut wie ein Sieg.
»Wo willst du hin?«, fragte Oddie knapp.
»An Deck!«
»Ausgeschlossen!«, erwiderte der Quartermeister. »Du hast da oben nichts zu suchen. Außerdem brauche ich jetzt jeden Mann. Wir müssen das Schiff noch weiter erleichtern. Hölle und Verdammnis, wir schmeißen die Beute über Bord!«
David Cooper unterdrückte einen Aufschrei, als der Quartermeister ihn mit schmerzhaftem Griff an der Schulter packte und ihm einen Stoß in Richtung Laderaum gab. Er wusste, dass jetzt Widerspruch zwecklos war und ihm höchstens noch ein paar blaue Flecke mehr einbringen würde.
Während er sich mit Oddie Peeler nach achtern in den Laderaum begab, dachte er kurz daran, dass er sich vor einer Woche in einer genauso lebensbedrohenden Situation befunden hatte. Vor einer Woche war die Rose, ein Handelsfahrer aus Plymouth, in einem nicht annähernd so wilden Sturm gesunken wie ein Stein. Die Ladung, die offensichtlich nicht sachgerecht verladen und festgezurrt worden war, hatte sich losgerissen und das Schiff im Handumdrehen zum Kentern gebracht.
David Cooper war als Passagier an Bord der Rose gewesen. Das Handelsschiff hatte ihn zu einem entfernten Verwandten nach Barbados bringen sollen. Vor mehr als einem Jahr waren nämlich Davids Eltern in der englischen Hafenstadt Plymouth Opfer der Pest geworden, und es hatte sich nun die Frage gestellt, wer die Erziehung des Jungen übernehmen sollte. James Inglethorpe, der Verwandte in Barbados, der dort eine Pflanzung mit schwarzen Sklaven betrieb, hatte sich schließlich bereit erklärt, David bei sich aufzunehmen und für ihn zu sorgen. David war gar nicht erfreut gewesen, als er das gehört hatte. Ihm war James In-glethorpe als feister, rechthaberischer Mann in Erinnerung geblieben, der schnell mit Peitsche und Stock bei der Hand war. Deshalb hatte er sich nur widerwillig auf die Reise nach Barbados begeben.
Es war Zufall gewesen, dass sich David an Deck befunden hatte, als die Rose gekentert war. Er hatte sich in ein leeres Beiboot retten können und war am nächsten Tag als einziger Überlebender von den Freibeutern aufgefischt worden.
David erinnerte sich noch genau an die ersten Worte der Freibeuter, als er erschöpft auf die Ladeluke der Golden Sea gesunken war.
»Was sollen wir bloß mit diesem Bürschchen anfangen?«, hatte Oddie Peeler gefragt.
»Im nächsten Hafen setzen wir ihn an Land«, hatte Benjamin Melvin ohne langes Zögern geantwortet. »Aber solange er an Bord des Schiffes ist, kann er sich auch nützlich machen.«
David Cooper war selbst am meisten überrascht gewesen, wie viel Spaß ihm die Arbeit eines Seemannes machte und dass er völlig schwindelfrei war. Er brauchte sich nicht zu überwinden, um bis zur Mastspitze aufzuentern. Das hatte sogar den rausten Burschen unter den Freibeutern Respekt abgerungen.
Selbstverständlich war David zuerst schockiert gewesen, als er erfahren hatte, dass er sich an Bord eines jener berüchtigten Freibeuterschiffe befand, die das Karibische Meer unsicher machten. Aber dieser Schreck war schnell dem Wunsch, dazugehören zu wollen, gewichen.
Und mittlerweile hegte er die Zuversicht, dass Benjamin Melvin Einsehen mit ihm haben und ihn nicht im nächsten Hafen an Land setzen würde. Der Gedanke an James Inglethorpe schreckte ihn mehr denn je …
Oddie Peelers Stimme brachte David Cooper in die Wirklichkeit zurück. Wer nicht gerade an den Lenzpumpen gebraucht wurde, musste mit anpacken, die Kisten und Truhen aus dem Laderaum nach oben zu schaffen.
Widerwillig gehorchten die Männer seinem Befehl.
»Steh nicht rum!«, brüllte der Quartermeister David an, der einen Augenblick zögerte, welche Truhe er sich zumuten konnte. »Oder soll ich dir erst Beine machen?«
David sprang außer Reichweite und wuchtete sich eine eisenbeschlagene Truhe auf die Schulter. Beinahe wäre er in den Knien eingeknickt, doch er riss sich zusammen und schleppte die Kiste keuchend nach oben. Das Schiff warf sich wie ein bockender Esel hin und her. Mehr als einmal drohte David mit seiner Last zu Boden zu gehen.
Endlich hatte er den Niedergang erreicht und stieg die Treppe hoch. Der Wind blies ihm schneidend ins Gesicht. Das Deck war glitschig. Seetang und andere Wasserpflanzen bedeckten hier und da die Planken. Das war ein schlechtes Zeichen und bedeutete, dass die Inseln nicht mehr weit waren …
Bevor David Cooper die Steuerbordreling in Lee erreichte, verlor er das Gleichgewicht. Die schwere Kiste entglitt seinen Händen und krachte auf das Deck. Der Deckel sprang auf, und ein Strom gleißender Goldmünzen ergoss sich über die Planken.
Einen Augenblick vergaß David, in welcher Gefahr er schwebte und dass der nächste Brecher schon heranraste. Er starrte mit offenem Mund auf die Münzen. Ein Vermögen lag dort vor seinen Füßen, und es erschien ihm verrückt, diesen Schatz über Bord zu werfen. Hastig bückte er sich, um einige Dublonen aufzuheben.
In dem Moment wurde das Deck wieder überspült. Während sich seine Hand um drei Goldmünzen schloss, ergriff ihn die Woge und schleuderte ihn gegen die Treppe, die zum Achterdeck hochführte. Mit der anderen Hand hielt er sich an der untersten Stufe fest. Glücklicherweise war der Brecher vergleichsweise kraftlos gewesen.
Als David sich klitschnass wieder aufrichtete, war von den Goldmünzen und der Truhe nichts mehr zu sehen. Doch in seiner rechten Hand spürte er das Gewicht der drei schweren Dublonen. Um sich in Sicherheit zu bringen, begab sich David auf das Achterdeck und suchte Schutz bei Benjamin Melvin am Ruderhaus.
Der Captain warf ihm nur einen kurzen Blick zu. »Sieh zu, dass du nicht über Bord gespült wirst!« Das war alles, was er ihm zurief. Er hatte jetzt keine Zeit, sich um den Jungen zu kümmern.
Während der eine Teil der Mannschaft weiterhin die Pumpen bediente und so den ungleichen Kampf gegen das einströmende Wasser weiterführte, schleppten die anderen die Ausbeute einer erfolgreichen, monatelangen Kaperfahrt durch die Karibik aus dem Laderaum. Nur mit großer Überwindung trennten sie sich von Gold, Silber, Schmuck und Perlen. Aber sie hatten keine andere Wahl. Die Golden Sea zog so viel Wasser, dass jede Rolle Tauwerk, die im Augenblick nicht gebraucht wurde, über Bord musste.
»Hölle und Verdammnis!«, fluchte Oddie Peeler, als er eine herrliche goldene Statue, die mit Juwelen besetzt war, in die sturmgepeitschten Wogen schleuderte.
3
Benjamin Melvin versuchte die Finsternis mit den Augen zu durchdringen. Der Sturm trieb den Gaffelschoner immer tiefer in das Labyrinth der Caicos-Inseln, die nordöstlich von Haiti liegen. Schon bei gutem Segelwetter war es nicht ungefährlich, sich in diese Gegend mit den zahllosen tückischen Korallenriffen zu wagen. Während eines Sturms jedoch wurde es zu einem Unternehmen, das man getrost als selbstmörderisch bezeichnen konnte.
Der Captain spürte die Nähe der gefährlichen Riffe, die oftmals nur von einem Fuß Wasser bedeckt wurden. Jeden Augenblick konnte der Schoner auflaufen und von dem harten, messerscharfen Korallgestein aufgerissen werden, als wäre er aus Papier.
Die Golden Sea tanzte wie ein Korken auf und ab. Sie schoss in abgrundtiefe Wellentäler hinab und arbeitete sich dann mühsam aus dem Malstrom wieder empor. Und immer mehr Wasser sickerte durch die Planken, die der ungeheuren Belastungsprobe kaum noch gewachsen waren.
Die schweren Kisten und Truhen, die die Männer in Lee über Bord warfen, machten das Schiff auch tatsächlich ein gutes Stück leichter. Aber niemand machte sich deshalb große Hoffnungen. Sie hatten nur einen geringen zeitlichen Aufschub mit dieser Aktion erreicht und die unabwendbare Katastrophe damit nur ein wenig hinausgezögert.
Oddie Peeler tauchte wieder auf dem Achterdeck auf, um Benjamin Melvin am Ruder abzulösen. Er war erstaunt, als er David Cooper erblickte, sagte jedoch nichts.
»Jetzt ist alles über Bord«, meldete er dem Captain. »Mehr können wir nicht tun. Vielleicht sollten wir unsere Piratenflagge hissen und uns dem Teufel als treue Verbündete zu erkennen geben.«
Benjamin Melvin hatte eine nicht weniger sarkastische Erwiderung auf der Zunge, er kam jedoch nicht mehr dazu, dem Quartermeister eine Antwort zu geben.
Eine heftige Böe packte die Golden Sea und drückte sie nach Steuerbord, dass das Schanzkleid unter die Wasseroberfläche geriet. Oddie Peeler ruderte mit den Armen nach Halt suchend durch die Luft und stürzte schwer gegen Benjamin Melvin, und beinahe hätte auch David Cooper seinen Halt verloren. Als das Schiff sich wieder aufrichtete, übertönte ein hässliches Bersten und Splittern von Holz das Heulen des Orkans.
»Hölle und Verdammnis!«, brüllte der Quartermeister entsetzt. »Der Großmast!«
Im selben Augenblick stürzte der Großmast nach Steuerbord und verhinderte damit, dass sich der Schoner wieder ganz aufrichten konnte. Die Bruchstelle befand sich etwas mehr als einen Fuß oberhalb der Stelle, wo der Zwölfpfünder den Mast mit voller Wucht gerammt hatte. Die Gaffel stürzte an Deck. Takelage und Wanten rissen an Backbord. Der Mastbruch verwandelte das Deck mittschiffs in ein Chaos.
Schreie mischten sich in das Tosen des Sturms. Long Tom Cody hatte es erwischt. Eingekeilt lag er zwischen Bordwand und Mast. Er bemühte sich verzweifelt, sich von der Last zu befreien, doch es gelang ihm nicht. Der tonnenschwere Mast lag quer über seiner Hüfte, und das Geschütz hinter ihm verhinderte jeglichen Befreiungsversuch. Ob er sich etwas gebrochen oder nur geprellt hatte, konnte er in dieser Lage nicht feststellen.
Die Golden Sea stand kurz vor dem Kentern. Leider war der Großmast nicht ganz über Bord gegangen, sondern wurde noch von einem Teil der Steuerbordwanten und Pardunen gehalten. Das Gewicht des überhängenden Mastes ließ den Gaffelschoner nun stark nach Steuerbord krängen. Die Brecher drohten es jeden Augenblick zum Kentern zu bringen.
»Die Wanten müssen gekappt werden!«, rief Oddie Peeler.
Einer der Freibeuter, die sich an Deck befanden, zog sein Entermesser und arbeitete sich zum Großmast vor. Es gelang ihm, mehrere Taue zu durchtrennen. Doch dann wurde er unvorsichtig. Ein Brecher packte ihn und spülte ihn über Bord.
Mit Entsetzen beobachtete David Cooper, wie die Arme des Unglücklichen verzweifelt durch das Wasser peitschten und nach Halt suchten. Sekunden später hatte ihn das Meer verschluckt.
»Eine Schiffsaxt! … Besorg mir eine Schiffsaxt!«, schrie Benjamin Melvin dem Decksjungen zu. »Keine lange Rederei! … Beeil dich, Long Tom liegt unter dem Mast!«
David Cooper vergaß seine Angst, hetzte über das stark geneigte Deck und stürzte den Niedergang hinunter. Und obwohl sie alle gleich in die Tiefe gerissen werden konnten, spürte David so etwas wie Freude in sich. Der Captain persönlich hatte ihn mit einer wichtigen Mission beauftragt!
Benjamin Melvin hatte sich schon von den Sicherheitsleinen befreit, als David mit der Axt an Deck zurückkehrte. Er riss sie David aus der Hand.
»Übernimm das Steuer!«, brüllte er dem Quartermeister zu und kümmerte sich nicht darum, was Oddie Peeler ihm warnend nachrief. Jede Sekunde war kostbar und konnte die Entscheidung über Leben und Tod bringen.
Die Taue mussten unverzüglich gekappt werden, wenn die Golden Sea noch eine Chance haben sollte. Und vor allem musste er Long Tom Cody retten. Die Steuerbordseite stand zeitweilig völlig unter Wasser, so dass Long Tom zu ertrinken drohte.
Mit wilder Entschlossenheit bahnte sich Benjamin Melvin einen Weg durch das Gewirr aus Segeln, laufendem Gut und Wanten. Die Axt schnitt durch die Luft und durchtrennte Tau um Tau. Als eine See das gesamte Deck überspülte, verlor er den Halt und schlidderte über die rutschigen Planken. Schließlich bekam er das Schanzkleid an Steuerbord zu packen und hielt sich daran fest. Er rang einen Augenblick nach Atem.
Nur noch wenige Yards trennten ihn von Long Tom Cody.
»He, Long Tom, halt aus!«, schrie Melvin ihm zu und schlug auf die Takelage ein, die den Großmast an Steuerbord daran hinderte, über Bord zu gehen.
»Bis zum jüngsten Tag!«, grölte Long Tom zurück und war im nächsten Moment verschwunden, als eine Welle über ihn hinwegschwappte.
Benjamin Melvin arbeitete wie ein Berserker. Auf einmal hörte er hinter sich eine dunkle, grollende Stimme. Er brauchte sich nicht erst umzudrehen, um zu wissen, dass Diego ihm zu Hilfe geeilt war.
»Long Tom mehr essen … dann mehr Fleisch auf Knochen und auch mit großes Mast fertigwerden«, radebrechte der bärenstarke Neger, während er sich wie selbstverständlich an Benjamin Melvin vorbeischob und die Stränge der Takelage mit seiner breiten Machete in Stücke hieb, als wären sie nicht stärker als Zwirnsfäden.
Diego stammte von der Elfenbeinküste Westafrikas. Vor gut zwei Jahren hatten Sklavenjäger das Dorf seines Stammes nachts überfallen und mit Fackeln die Hütten in Brand gesetzt. Nach einem blutigen Massaker hatten die Sklavenhändler die überlebenden Neger gefesselt und unter Peitschenhieben zur Küste getrieben.
Die Menschenhändler versorgten die Siedler im karibischen Raum und im Süden Amerikas mit billigen Arbeitskräften, die als Sklaven so gut wie keine Rechte hatten. Die meisten Europäer betrachteten sie nur als Ware und sprachen ihnen alle Menschenrechte ab. Die Tatsache, dass ihre Haut schwarz war und sie eine andere Religion besaßen, genügte ihnen, um sie als minderwertig einzuordnen.
Ein spanischer Captain hatte Diego gekauft und ihn zu seinem Diener gemacht. Bei ihm hatte Diego viel erdulden müssen und war oft ausgepeitscht worden. Als sich dann die Golden Sea mit dem Schiff dieses spanischen Captains ein erbittertes Gefecht auf hoher See lieferte, hatte Diego ohne lange zu zögern gegen die Spanier gekämpft. Benjamin Melvin war von der Unerschrockenheit und Tapferkeit des Negers derart beeindruckt gewesen, dass er ihn in seine Crew aufgenommen hatte.
Trotz der Gefahr, in der sie alle schwebten, konnte Benjamin Melvin sich eines leichten Lächelns nicht erwehren. Es war ein Vergnügen, Diego zuzusehen. Mit nacktem, muskulösem Oberkörper und bis zu den Hüften von den Wellen umspült, stand er an der Bordwand und schwang die Machete, als gälte es, Rache für den Tod seiner Stammesangehörigen zu nehmen.
Zusammen schafften sie es.
»Pass auf!«, schrie Benjamin Melvin, als sie das letzte Tau kappten und die Wogen den Großmast packten und über Bord rissen. Long Tom Cody schrie auf und zog hastig seinen Kopf ein, als der gesplitterte Stamm über ihn hinwegschoss.
Die Golden Sea richtete sich zunächst zögernd auf, nahm dann jedoch wieder eine stabilere Lage ein. Es war aber unverkennbar, dass der Schoner schon bedenklich tief im Wasser lag und immer schwerfälliger reagierte.
Long Tom Cody hielt sich an den Brooktauen des Geschützes fest und bewegte vorsichtig die Beine. Erleichtert atmete er auf, als er feststellte, dass er sich nichts gebrochen hatte; er hatte sich nur einige recht schmerzhafte Prellungen und Quetschungen zugezogen.
Diego half ihm auf die Beine. Der Neger stand auf dem ständig überspülten Deck so sicher wie der Fels von Gibraltar. Er überragte Long Tom Cody um Haupteslänge, denn er war über sechs Fuß groß.
»Dünner Pirat sein Schande«, grollte Diego. »Machen Feind keine Angst.«
»Fahr zur Hölle, Diego!«, schimpfte Long Tom Cody, um seine Verlegenheit zu verbergen.
Diego lachte. »Wir alle segeln in die Höhle, langes Tom!«
»Hölle, nicht Höhle, du schwarze Seele!«, korrigierte ihn der hagerere Freibeuter und wischte sich ein paar Strähnen aus der Stirn.
»Spart euch die Diskussion für später auf!«, rief Benjamin Melvin ihnen zu. »Wer nicht an Deck gebraucht wird, geht an die Pumpen. Der Teufel wird sich noch etwas gedulden müssen.«
»Bei meiner geteerten Jacke«, knurrte Long Tom Cody, »warum hab ich nicht gleich auf einer dieser wanzenverseuchten Sklavengaleeren angeheuert?«
Die drei Männer hatten gerade den hüfthohen Aufbau des Niederganges erreicht, als ein merkwürdiger Ruck durch das Schiff ging. Und für einen kurzen Moment war ein knirschendes, schabendes Geräusch zu hören.
Benjamin Melvin zuckte zusammen. Dieses Geräusch ließ keine Zweifel aufkommen: Der Schoner hatte ein Riff gestreift. Eines von vielen …
Alle Blicke richteten sich nach vorn zum Bug. Und dann sahen sie den gezackten Schatten, der von weißer Gischt umtobt wurde.
»Riffe und Klippen!«, gellte eine Stimme vom Vorschiff über das Deck. »Klippen voraus! Ruder hart Steuerbord!«
Benjamin Melvin wusste, dass die Golden Sea nicht mehr zu retten war. Der Orkan trieb den Schoner direkt auf die Klippen zu, die sich unter Wasser vermutlich in Form von Riffen fortsetzten. Sie waren schon zu nah, um die verheerende Kollision abwenden zu können.
Dennoch musste man es versuchen. Und mit drei schnellen Sprüngen war er bei Oddie Peeler am Ruder. Doch es gab nichts mehr zu tun. Der Quartermeister hatte auf den Warnruf des Mannes vom Vorschiff sofort reagiert und das Ruder hart nach Steuerbord gelegt.
»Wir schaffen es nicht!«, brüllte Oddie Peeler. »Der Kahn reagiert nicht mehr, Ben! … Das war die letzte Fahrt der Golden Sea, Captain!«
»Ich weiß«, erwiderte Benjamin Melvin. »Vergiss das Ruder, Oddie.« Und so laut er konnte, brüllte er: »Alle Mann an Deck! Wir sind erledigt! … Riff und Klippen reißen uns in Stücke.«
»Ich sag den Kameraden unter Deck Bescheid!«, rief Od-die Peeler und gab das Ruder frei.
Der Quartermeister schoss den Niedergang hinunter und trieb die Männer aus den Laderäumen. In wenigen Augenblicken würde das scharfe Korallgestein die Bordwände des Schoners auffetzen und das Wasser mit ungeheurem Druck einströmen. Wer sich dann noch hier unten aufhielt, war rettungslos verloren.
Die Freibeuter stürzten an Deck.
»Macht das Beiboot klar!«, befahl Benjamin Melvin.
Wenige Sekunden darauf schleuderte die aufgewühlte See die Golden Sea auf das den Klippen vorgelagerte Riff. Es war, als würde eine unsichtbare Faust den Gaffelschoner packen und ihn quer über das Riff zerren. Die spitzen, scharfen Korallen rissen den Schiffsrumpf auf und drückten an Backbord die Bordwand ein. Planken und Spanten splitterten. Durch die Lecks schoss das Wasser in den Schoner.
Ein Teil der Besatzung wurde über Bord geschleudert, als der Orkan die Golden Sea auf das Riff warf. Eine Woge drückte von achtern gegen das Schiff und schob es unbarmherzig zwischen das Unterwassergestein.
Das Vorschiff bäumte sich auf, hob sich aus den Wellen und zerbarst. Und es war nur noch eine Frage von wenigen Augenblicken, bis auch die Heckpartie des Schoners unter dem wütenden Anprall der Brecher auseinanderbrach.
David Cooper klammerte sich in höchster Verzweiflung an die Speichen des Ruders. Er war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Er war vor Entsetzen wie gelähmt.
Oddie Peeler machte die sensationelle Entdeckung: »Querab an Steuerbord! … Eine Insel!« Er stand direkt neben David am Ruder. Auf seiner Stirn klaffte eine Platzwunde.
»Rette sich wer kann!«, schrie jemand.
»Los, Junge!«, rief der Quartermeister David zu. »Hier auf dem Schiff sind wir verloren! … Versuch die Insel zu erreichen. Das ist unsere einzige Chance!«
David Cooper starrte mit weit aufgerissenen Augen zur Insel hinüber, die sich als schwarze Silhouette abzeichnete, doch er wagte nicht, seine Hände von den Speichen des Ruderrads zu lösen. Er hatte Angst, entsetzliche Angst.
»Hölle und Verdammnis!«, fluchte der Quartermeister und zerrte David vom Ruder. »Schwimm oder stirb! Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist!«
David Cooper schrie auf, hörte das Bersten der Schiffsplanken und erhielt einen gewaltigen Stoß. Er flog über Bord und schlug hart auf dem Wasser auf.
Er schluckte Wasser, würgte und schlug verzweifelt um sich. Die Wellenberge schienen ihn unter sich begraben zu wollen. Doch er tauchte immer wieder auf, und plötzlich siegte der Selbsterhaltungstrieb über seine Angst.
Bis zur Insel waren es vielleicht zweihundert Yards, aber bei dem Sturm konnte er sich auch täuschen. Er hatte nicht genug Zeit gehabt, die Entfernung zu schätzen.
Manchmal war von der Insel überhaupt nichts mehr zu sehen, und wieder drohte das lähmende Entsetzen in ihm übermächtig zu werden. Doch dann sah er plötzlich hinter sich die scharfen Zacken der Klippen und wusste, dass er in die richtige Richtung schwamm. Das gab ihm neuen Mut.
»Schwimm oder stirb!« Die Stimme des Quartermeisters dröhnte in seinen Ohren.
Zweihundert Yards sind eine lächerlich kurze Distanz; sie können aber auch so lang wie eine Reise um die Erde werden, wenn man sie schwimmend in einer sturmgepeitschten See zurücklegen muss. David Cooper hatte das schreckliche Gefühl, trotz aller Anstrengungen kaum ein Yard vorwärtszukommen. Seine Arme erlahmten allmählich, und die nasse Kleidung wog schwer an seinem erschöpften Körper. Und noch immer lag das rettende Ufer scheinbar in unerreichbarer Ferne. Der Strand schien einfach nicht näherkommen zu wollen. Die Konturen der Insel blieben nichts weiter als tiefschwarze Schatten.
»Weiter! … Schwimm oder stirb! … Weiter!«
Nur dieser eine Gedanke erfüllte David. Es war, als hätte sein Gehirn alle anderen Gedanken abgeschaltet, um die gesamten Kräfte auf die Bewegung der Arme und Beine zu konzentrieren.
In jedem Menschen schlummern stille Energiereserven, die in außergewöhnlichen Gefahrensituationen freiwerden und einem ungeahnte Kräfte und Ausdauer verleihen können. Und so verhielt es sich auch bei David Cooper. Obwohl er eigentlich schon längst am Ende seiner Kräfte war, schwamm er weiter und kämpfte sich Yard um Yard näher an das rettende Ufer heran.
Wie durch einen Schleier vor seinen Augen sah David die Palmen, die sich plötzlich aus der Schattenwand lösten. Und dann fühlte er festen Grund unter seinen Füßen. »Sand!«, keuchte er.
Eine kräftige Woge traf ihn im Rücken und drückte ihn wieder unter Wasser. Er kämpfte mit aufkommender Bewusstlosigkeit, die seinen Tod bedeutet hätte. Doch irgendetwas in ihm zwang ihn dazu, sich wieder aufzurichten.
Wie in Trance taumelte David Cooper durch das seichte Wasser und stürzte schließlich völlig erschöpft zu Boden. Mit dem Gesicht im nassen Sand blieb er besinnungslos liegen. Er spürte schon gar nicht mehr, dass ihn zwei kräftige Hände packten und den Strand weiter hochzogen.
4
Der Junge fror erbärmlich. Sand knirschte zwischen den Zähnen, der Gaumen fühlte sich ekelhaft pelzig an, und ein bitterer, salziger Geschmack lag auf seiner Zunge, zudem rumorte es in seinem Magen. Aber am schlimmsten war diese Kälte.