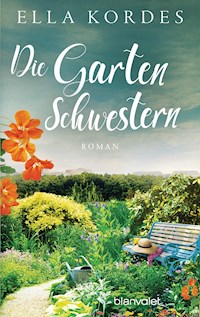
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das Leben ist wie ein wilder, wunderschöner Garten!
Die begeisterten Gärtnerinnen Gitta, Marit und Constanze sind erschüttert: Gittas Mann lässt sich scheiden – und damit verlieren sie den wunderschönen Garten, der zur Villa des Expaares gehört! Wo sollen sie nun graben, pflanzen, wässern und gemeinsam Zeit verbringen? Die Lösung: ein kleiner Schrebergarten in einer Kolonie mitten in Berlin. Auf die vier warten große Herausforderungen, die sie nur mit der Kraft ihrer Freundschaft meistern können. Und auch die kleine Laube, die im Garten steht, birgt ein altes Geheimnis, das es zu lüften gilt.
Februar, 1945. Die junge Lissa flieht vor der Roten Armee von Oderberg nach Berlin, wo sie bei dem Gärtner Albert landet. Der hat eines Tages eine Idee: Könnte man nicht aus den Trümmern der zerstörten Stadt für Lissa ein kleines Häuschen bauen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Die begeisterten Gärtnerinnen Gitta, Marit und Constanze sind erschüttert: Gittas Mann lässt sich scheiden – und damit verlieren sie den wunderschönen Garten, der zur Villa des Expaares gehört! Wo sollen sie nun graben, pflanzen, wässern und gemeinsam Zeit verbringen? Die Lösung: ein kleiner Schrebergarten in einer Kolonie mitten in Berlin. Auf die vier warten große Herausforderungen, die sie nur mit der Kraft ihrer Freundschaft meistern können. Und auch die kleine Laube, die im Garten steht, birgt ein altes Geheimnis, das es zu lüften gilt.
Februar 1945. Die junge Lissa flieht vor der Roten Armee von Oderberg nach Berlin, wo sie bei dem Gärtner Albert landet. Der hat, kaum dass der Krieg zu Ende ist, eines Tages eine Idee: Könnte man nicht aus den Trümmern der zerstörten Stadt für Lissa ein kleines Häuschen bauen?
Autorin
Ella Kordes ist Berlinerin der zweiten Generation. Nach mehreren Auslandsaufenthalten hat sie ihren Lebensmittelpunkt wieder in der Hauptstadt. Solange sie denken kann, macht sie etwas mit Büchern: schreiben, betexten, aus dem Englischen übersetzen und rezensieren. In ihrer Freizeit ist sie entweder in ihrem Garten oder im Boot auf der Havel anzutreffen, vorzugsweise mit Lebenspartner, Freundinnen und Familie.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ELLA KORDES
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung © www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Juliette Wade/Photolibrary/Getty Images;
www.buerosued.de
LH · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23352-5V001www.blanvalet.de
1. Kapitel
Berlin im Februar, Gegenwart
Insgeheim verbarg sich hinter der Begeisterung für durchgestylte Gärten bei Constanze, Gitta und Marit die stille und ein bisschen arrogante Überzeugung, dass sie die Natur zähmen könnten. Oder dass sie sogar die Gärtnerinnen ihres eigenen Lebens waren.
Bis das Schicksal eines Tages in lautes Gelächter ausbrach und fröhlich eine Handvoll Unkrautsamen auf die Beete ihrer Pläne und Erwartungen warf. Denn natürlich war der Glaube, dass man tatsächlich die Herrscherin über das eigene Leben sein konnte, nichts als eine Illusion. Ungefähr so unrealistisch wie eine Mohnstaude, die im tiefsten Winter erblüht und deren seidige Blütenblätter sich blutrot vom Weiß des Schnees abheben. Bezaubernd schön, ja atemberaubend, aber eben komplett unrealistisch.
Die Parallele zur Zähmung der Natur kam Constanze nicht in den Sinn, als sie an einem eisigen Sonntagvormittag in der Königlichen Gartenakademie in Berlin Dahlem das langstielige Glas hob. So kalt war die Flüssigkeit, dass sich an der beschlagenen Außenseite kleine Tropfen bildeten, die wie Tau von einem Blütenblatt an einem frühen Sommermorgen abperlten.
»Danke für die Einladung, Gitta, Chefgärtnerin unseres Vertrauens. Und noch mal alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag«, sagte sie. »Möge dein Garten ewig blühen, möge dein weißer Lerchensporn niemals Staunässe bekommen und dein weißer Rittersporn niemals die Köpfe hängen lassen!«
Marit, die Zweite im Freundinnenbund, folgte Constanzes Beispiel und erhob ebenfalls ihr Glas. »Ja, Gitta, das wünsche ich dir auch. Von ganzem Herzen!« Sie nippte genießerisch an ihrem Crémant. »Mmh! Ich will nicht behaupten, dass Suff immer und gegen alles hilft. Das würde ja klingen, als ob ich an der Flasche hinge. Tu ich nicht. Wirklich nicht! Aber ein Schlückchen hiervon hilft immerhin gegen viel. Nicht nur gegen niedrigen Blutdruck.«
Ihr braunes Haar, in dem sich zunehmend mehr Grau zeigte, seit sie vor zwei Jahren die fünfzig überschritten hatte, schien sich besonders stark zu kräuseln, als sie einen kleinen Schluck trank. Die ungebärdigen Locken erinnerten an die Zweige einer Korkenzieherweide, die sich munter kringelten und ringelten. Marit weigerte sich zu färben. Sie fand, dass das nicht im Einklang mit der Natur stand. Und obwohl sie klein und kompakt war, passten weder Schuhe mit hohen Absätzen noch strikte Diäten in ihr Lebenskonzept. Dafür lachte sie gern und viel.
Constanze dagegen färbte ihr langes Haar seit Jahren, und das einzig Natürliche daran war, dass sie es mit Henna tat. An ihren Färbetagen sah sie aus, als ob sie einen großen Kuhfladen auf dem Kopf hätte, mit Frischhaltefolie eingewickelt. Sie musste das nicht rechtfertigen, weder vor sich selbst noch vor einem Mann, weil sie nämlich keinen hatte. Aber wenn sie es hätte rechtfertigen müssen, hätte sie sicher gesagt, dass sie schließlich eine Schauspielerin war. Sie trat jeden Tag vor Grundschülern auf, da gehörte eine Maske ebenso dazu wie die genaue Kenntnis eines Drehbuchs, bei dem Wissensvermittlung und die Lacher an der richtigen Stelle sitzen mussten.
Die Haarfarbe war nicht der einzige Unterschied zwischen den beiden. Constanze war sehr groß, ernster und irgendwie schwingend. Sie und Marit waren sich so ähnlich wie ein graugrüner niedrig gewachsener Bergsalbei und eine ranke, schlanke Taglilie, deren dunkelrote Blüten an langen Stängeln wippten. Was ihrer Freundschaft keinen Abbruch tat. Im Gegenteil.
Sie mussten laut gegen die Geräuschkulisse anreden. Eines der Gewächshäuser in der Königlichen Gartenakademie war zum Restaurant umgebaut, und die Glasscheiben reflektierten die vielen Gespräche. Das Wasser, das an den Innenseiten hinunterlief, hätte aus kondensierten Wörtern bestehen können. Wie immer war das Lokal zum Sonntagsbrunch bis auf den letzten Platz ausgebucht. Dabei war es ein teurer Spaß, hier zu essen. Die geschmackvolle Erfüllung der Gartensehnsucht konnte eben niemals billig sein.
Und Erfüllung war es: Hyazinthen verströmten ihren Duft, weiße Tulpengestecke schmückten den verglasten Gang, der die fünf Gewächshäuser miteinander verband, gelbe Winterlinge in Tonschalen wirkten wie eingefangene Sonnenstrahlen. Frisches Birkengrün und das gelegentliche Niesen resignierter Allergiker erinnerten daran, dass der Frühling nicht mehr allzu fern war.
Am vergangenen Mittwoch war Gitta einundfünfzig Jahre alt geworden. Marit und Constanze hatten ihr am Telefon gratuliert, und Gitta hatte ihnen fröhlich erzählt, dass sie mit Ralf ins Machiavelli in der Nähe vom Roseneck gehen würde – ein edles italienisches Restaurant bei ihnen um die Ecke.
Ach, der liebe Ralf, hatten die Freundinnen ein klitzekleines bisschen neidisch gedacht. Gitta hatte es wirklich gut mit ihm getroffen! Seit dreiundzwanzig Jahren legte er ihr die Welt zu Füßen, war nicht gerade arm, großzügig und gut aussehend – eine wunderbare Mischung. Neuerdings ging er sogar regelmäßig joggen und hatte seinen Wohlstandsbauch verloren. Gemeinerweise hatte er das Fett direkt an Gittas Hüften weitergegeben. Dass Gitta stundenweise in einem Einrichtungshaus am Kurfürstendamm arbeitete, war für sie eher ein Hobby als eine Notwendigkeit.
Aber an diesem Sonntag waren die Freundinnen dran.
»Gegen was hilft Crémant denn bei dir so, Marit?«, fragte Constanze.
Sie stützte ihre Ellenbogen auf und betrachtete angelegentlich das Treiben. Die Leute strömten zum Büfett, das Klappern von Besteck und Geschirr, Lachen und angeregte Gespräche waren zu hören.
Geburtstagskind Gitta griff nach der Sektflasche im Kühler und füllte ihr leeres Glas schweigend nach.
Marit nahm einen kleinen Schluck. »Na ja, das Weihnachtsgeschäft lief nicht so gut wie in den letzten Jahren. Das macht mir schon Sorgen. Früher hat der Gewinn wenigstens fürs erste Vierteljahr gereicht. Aber in diesem Jahr sieht es jetzt schon mau aus, dabei haben wir erst Februar. Es ist das Internet. Das mag ja für viele ein großer Segen sein, für uns Buchhändlerinnen ist es ein Fluch.«
Marit hatte eine kleine Buchhandlung im Berliner Stadtteil Westend. NATÜRLICHLESEN hieß sie, und der Name war Programm. Sie und ihr Mann Stefan hatten sich auf Natur- und Gartenbücher aller Art spezialisiert. Von Apfelromanen bis hin zu opulenten Wildkräuter-Kochbüchern, von Anleitungen für pflegeleichte Gärten bis hin zu Wildtieren in der Großstadt, von Bestimmungsbüchern für alte Gemüsesorten über Sternenkarten in der Nacht und Urban Gardening in Berlins Hinterhöfen: Wenn irgendwo etwas lebte, leuchtete, atmete oder wuchs, war ein Buch darüber bei Marit zu finden.
»Du weißt doch, dass sie dir wieder die Bude einrennen, sowie die Temperaturen klettern«, versuchte Constanze sie zu trösten. »Jetzt ist nicht die richtige Zeit für Naturbücher. Die Leute sind noch von Weihnachten eingedeckt. Außerdem sind alle im Winterschlaf. Die Tiere, die Pflanzen, vielleicht sogar die Leser.«
»Ja, ja. Ich weiß. Das sagen meine Jungs auch immer«, meinte Marit. Sie hatte vier Söhne, die ihr die Welt bedeuteten. Inzwischen war sie zweifache Großmutter – und Witwe. Vor fünf Jahren war Stefan gestorben. Das Vierteljahr, das zwischen der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs und seinem Tod gelegen hatte, hatte gerade so gereicht, alles Wichtige zu regeln. Nur Marits Herz und die Herzen ihrer Jungs waren noch nicht ganz geregelt. Sie seufzte leise, dann sagte sie resolut: »Aber jetzt will ich mir um den Laden echt keine Sorgen machen. Heute wird gefeiert! Kommt ihr mit zum Büfett?«
Ohne die Antwort der Freundinnen abzuwarten, stand sie auf und strich sich den dunkelgrünen Kordrock glatt, zu dem sie ein lindgrünes Twinset und eine jadegrüne Kette trug. Wenn man sich hier zum Brunch traf, machte man sich hübsch. Das gehörte einfach dazu.
Dann allerdings blieb sie stehen und schaute auf ihre Gastgeberin hinunter.
Gitta schwieg. Regungslos saß sie da und schaute nach draußen. Die Sträucher in den Beeten waren heruntergeschnitten, alles, was noch vor wenigen Monaten grün und bunt gewesen war, war tot, die Zweige der Bäume waren kahl und hoben sich dunkel gegen den grauen Himmel ab. Nichts lebte. Alles war vergangen, weg, vorbei, zu Ende …
»Let’s go«, sagte nun auch Constanze vergnügt und erhob sich ebenfalls. »Komm, Gitta, du edle Spenderin. Der Wildlachs wird warm.« Sie griff nach der Hand der Freundin, um sie hochzuziehen, aber Gitta blieb, wo sie war, stumm und reglos.
Alarmiert schauten die beiden Freundinnen auf ihren aschblonden Haarschopf. Plötzlich fiel ihnen auf, dass Gitta seit der Begrüßung noch kein Wort gesagt hatte. Und das, obwohl sie sonst alles so gern munter kommentierte.
Wie merkwürdig.
Langsam setzten sie sich wieder und musterten sie.
Gitta blickte weiter schweigend hinaus in die gefrorene Winterlandschaft, als hätte sie nichts von dem verstanden, was die anderen gesagt hatten.
Marit registrierte, dass der rote Lack ihres Daumennagels abgeplatzt war. Was äußerst ungewöhnlich war. Gitta hatte genug Geld und Zeit für Schönheitspflege, kaufte stets die besten Produkte in der Kosmetikabteilung im KaDeWe, für das sie die goldene Kundenkarte besaß, ging regelmäßig zur Maniküre, Pediküre, zum Friseur, zur Lymphdrainage und zur Fußreflexmassage. Sie war ihre Mrs. Perfect.
Marit berührte vorsichtig Gittas Hand, und sie zuckte zusammen. »Gitta, was ist denn los?«, fragte sie behutsam.
Gitta schaute sie an, als erwachte sie aus einem tiefen Traum. Sie trug nicht mal Mascara, fiel nun auch Constanze auf, keine Spur von dem rosafarbenen Lipgloss, das ihr Markenzeichen war. Sie war ungeschminkt, hatte das halblange Haar nicht wie sonst gefällig in Form geföhnt. Und der Fleck auf ihrem schwarzen Kaschmirpulli, direkt unter der Perlenkette – war das etwa die Spur von hastig weggewischter Zahnpasta?
Constanze warf Marit einen besorgten Blick zu. »Gitta! Gitta, was hast du denn? Rede mit uns!«, sagte sie.
»Geht es dir nicht gut?« Marit beugte sich vor und sah Gitta an. »Sag uns doch, was los ist.«
Plötzlich glitzerten Tränen in Gittas Augen. Eine rollte die blasse Wange hinunter. Besorgt hielt Constanze der Freundin eine Serviette hin, aber Gitta ignorierte sie. Dann sprang sie unvermittelt auf, so heftig, dass ihr Stuhl nach hinten kippte und scheppernd umfiel, einer Kellnerin mit einem voll beladenen Tablett mit Getränken vor die Füße. Hastig sprang diese zurück.
»Dieser Mistkerl!«, rief Gitta und riss die Arme hoch, als wollte sie die Glasdecke des Gewächshauses von unten her in tausend Scherben zerschmettern. Augenblicklich verstummten die Gespräche. Alle Gäste wandten sich ihrem Tisch zu, es herrschte Totenstille. Die Kellnerinnen blieben wie eingefroren stehen. »Dieser verdammte Mistkerl! Ich könnte ihn umbringen!«
»Wen denn?«, fragte Constanze erschrocken, und auch die Leute an den Nachbartischen sahen so aus, als ob sie das unbedingt wissen wollten.
»Ralf natürlich!«, rief sie. »Dieser miese Verräter!«
Mit irrem Blick schaute sie um sich, bereit, nach dem nächstbesten Hyazinthentopf zu greifen und ihn dem unsichtbaren Ralf an den Kopf zu schleudern.
Constanze und Marit drückten die Aufgebrachte hastig zurück auf ihren Stuhl.
»Psst, Gitta. Beruhige dich«, sagte Marit leise. Sie füllte Gittas Glas und stellte es vor sie hin. »Hier, trink noch einen Schluck. Und dann erzähl erst mal, was passiert ist. Wir helfen dir, bestimmt!«
Denn irgendetwas war da ganz und gar nicht in Ordnung.
Bis jetzt hatte Gittas Ehe auf Constanze und Marit geradezu überharmonisch gewirkt. Es war ihnen manchmal direkt unheimlich. Man war ja nicht mal immer mit sich selbst glücklich – wie sollte das denn zu zweit gelingen? Marit hatte mit ihrem verstorbenen Mann gern und oft gestritten (und sich anschließend leidenschaftlich versöhnt). Und Constanze hielt sich sowieso für einen überzeugten Single.
Für Gittas glückliche Ehe hatten sie nur eine Erklärung gehabt: Aus beruflichen Gründen reiste Ralf viel. Wenn er und Gitta sich nur zwei, drei Tage in der Woche sahen, dann blieb einfach zu wenig Zeit, sich zu streiten.
Ralf arbeitete für eine Abrissfirma, die auch Neubauten erstellte. Er war Manager der Schnittstelle, gewissermaßen eine unternehmerische Personalunion. Abriss des Altbaus – mit Ralf Velten besprechen. Planung des Neubaus – mit Ralf Velten besprechen. Ehrgeizig war er und sehr erfolgreich, Gitta kümmerte sich um alle sozialen Belange in ihrem gemeinsamen, wohlsituierten Leben. Keine Frage, Gitta und Ralf gehörten zusammen wie Gießkanne und Wasser, Rasenmäher und Stromkabel, Kompost und Kartoffelschalen.
Gitta tupfte sich die Tränen ab, die nun reichlich flossen. »Er hat mir am Mittwochabend erklärt, dass er mich verlässt. Nach meinem Geburtstagsessen. Mir ist sofort schlecht geworden! Er will raus, will sich scheiden lassen, möglichst bald. Dieses Miststück.«
Constanze und Marit sahen sich betroffen an. »Warum will er dich denn verlassen?«, fragte Marit leise. »Und so plötzlich …«
»Er hat eine andere!«
»Nein, das kann nicht sein«, sagte Constanze entschieden. »Niemand ist so perfekt wie du. Er kann keine andere haben. Dazu seid ihr doch viel zu glücklich zusammen.«
»Natürlich kann das sein. Es ist so.« Gitta schluchzte auf. »Er hat es mir gesagt. Das läuft schon eine ganze Weile. Offenbar will er keine perfekte Frau. Vielleicht will er lieber eine Schlampe. Mit ganz vielen Fehlern. Eine junge Schlampe, eine mit glatter Haut, mit definierten Oberarmen! Und wahrscheinlich mit Oberschenkeln, an denen sich nichts dellt wie an meinen«, sagte sie resigniert. »Apfelsinenhaut … Apfelsine klingt ja noch appetitlich, aber Cellulitis …«
»Wir Gärtnerinnen bekommen keine Cellulitis«, sagte Marit entschlossen. »Höchstens Zellulose.«
Gitta winkte ab und schnäuzte sich. »Auf jeden Fall ist er ein guter Schauspieler. Auch wenn ich mich über die vielen Geschäftsreisen in letzter Zeit gewundert habe. Und ein bisschen verändert war er schon. Er hat so untypische Dinge getan wie ein neues Rasierwasser kaufen und so. Und dieses blöde Joggen um den Grunewaldsee. Ach, ich hab’s einfach verdrängt. Ich wollte es nicht sehen. Ich bin so blöd …«
»Ich dachte, ihr liebt euch«, sagte Constanze.
Gitta sah sie ungehalten an. »Nun sei doch bitte nicht naiv, Constanze. Was heißt denn schon Liebe! Mal kommt man miteinander gut aus, mal könnte man sich gegenseitig an die Wand klatschen. Eine so lange Ehe hat doch nichts mehr mit Liebe zu tun. Es ist eher ein Abkommen. Ich hab mich um alles gekümmert. Er hat alles bezahlt. Ihr wisst genau, wie das ist! Was nicht heißt, dass es nicht höllisch wehtut. Er entsorgt mich einfach und tauscht mich gegen ein neueres Modell aus.« Die Tränen versiegten. Jetzt war Gitta wütend.
Constanze schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Ahnung, wie das war. Und sie wollte auch wirklich nicht an die Wand geklatscht werden. Wenn diese Ehe ein Abkommen war, klang es so, als ob eine Seite gerade einen ungeregelten Ehe-Exit vornahm.
»Wer ist es denn?«, fragte Marit und streichelte Gittas zitternde Hand.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Gitta. Sie klang plötzlich unendlich müde. »Er hat durchblicken lassen, dass es niemand aus unserem Bekanntenkreis ist.«
»Ein schwacher Trost«, murmelte Marit. »Und wie geht es nun weiter?«
»Wenn ich das wüsste.« Gitta kippte den Crémant in einem Zug hinunter. »Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein Horror. Wir haben so gestritten. Am Donnerstagmorgen ist er dann nach Hamburg gefahren, zu seiner Baustelle. Die Firma baut dort ein Verlagshaus. Er war schon weg, als ich aufgewacht bin. Natürlich hat er im Gästezimmer geschlafen. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört.«
»Nicht nur ein Mistkerl, sondern auch ein herzloser Mistkerl«, zischte Marit.
Gitta lächelte schwach. »Wahrscheinlich hofft er, dass ich mich im Grunewaldsee ertränke. Dann wäre er das Problem los. Also mich.«
»Ach komm, das ist zynisch. Damit verletzt du dich selbst«, sagte Constanze und stand auf. »Ich hol uns mal was vom Büfett. Gitta, du musst was essen, sonst kippst du vom Stuhl. Zu viel Sekt auf leeren Magen ist nicht gut. Und wenn die Kellnerin kommt – ich nehme einen Ingwertee mit frischer Minze.«
Marit nickte und legte den Arm um Gitta, während sich Constanze zwischen den Stühlen hindurch zum Büfett schlängelte.
Von geräuchertem Wildlachs über Ziegenrohmilchkäse mit kandierten Veilchenblättern, von knusprigen Brötchen aus Bioschrot bis hin zu Knäckebrot mit Rosmarin, von hauchdünn geschnittenem italienischem Aufschnitt bis hin zu Zanderfilet auf Winterwurzelgemüse und zarten Scheiben vom Iberoschwein in silbernen Warmhalteschalen – sich hier durchzufuttern war einfach ein appetitlicher Superlativ.
Constanze nahm von allem etwas und wollte schon zurückgehen, da fiel ihr Blick auf Honiggläser. Sie beugte sich vor und las, was auf den Etiketten stand: Berliner Sommerblüte, Teschendorfer Tannenhonig und Lindower Lindenblüte. Den Adressen nach kamen alle Imker aus Berlin und der Mark Brandenburg.
Plötzlich hatte sie eine Idee. Wie wäre es, wenn sie für den Schulgarten einen Bienenstock anschaffen würde? Sie hatte keine Ahnung, was man dabei beachten musste. Aber das wäre doch ein fantastisches Projekt für ihre Umwelt-AG.
Sie richtete sich wieder auf und bekam prompt ein schlechtes Gewissen. Wie konnte sie sich nur über so etwas Gedanken machen, wo es Gitta doch so schlecht ging!
Eilig ging sie zurück zu ihrem Tisch, wo der Ingwertee bereits auf sie wartete. Gitta saß mit gesenktem Kopf da, aber Marit sah sie mit ihren blauen Augen groß an.
»Wusstest du, dass die Villa am Messelpark schon Ralfs Eltern gehört hat? Dass er sie von ihnen übernommen hat, als die beiden nach Teneriffa gezogen sind?«
Constanze schüttelte den Kopf. Sie hatten nie darüber gesprochen, sie selbst hatte immer angenommen, dass Gitta und Ralf die Villa zusammen gekauft hatten, zu einer Zeit, als die Immobilienpreise in Berlin noch nicht durch die Decke gegangen waren. Das Haus gehörte nicht ihnen beiden?
»Wie geht es denn jetzt weiter?«, fragte Marit leise.
Gitta schluchzte laut auf. »Er hat gesagt, dass er mich verlässt. Und nicht, dass ich ausziehen soll. Denn das kommt ü-ber-haupt nicht infrage! Ich bleibe. Was soll denn sonst aus den Pflanzen werden? Es sind meine Babys. Er hat sich nie für den Garten interessiert, der kann ein Schneeglöckchen nicht von einem Gänseblümchen unterscheiden. Für Ralf sind meine Funkien Unkraut!«
»Da hast du recht. Er war immer ignorant«, meinte Marit. »Dabei war dein Garten schon in der Home & Eden !«
Was stimmte. Das edle Gartenmagazin hatte vor einiger Zeit Gittas Garten und besonders ihre beeindruckende Funkiensammlung porträtiert. Mit ihrem prächtigen Blattwerk schmückten die Funkien den schattigen, etwas abgelegenen Teil der Anlage in allen Grüntönen. Sie hatten nur sich gegenseitig, um sich geschmackvoll zu ergänzen. Wie in einer glücklichen Ehe, in der die verführerischen grellen Farben der Welt draußen um der inneren Harmonie willen besser ignoriert wurden.
Ein klarer Fall von Fehlfarben, wie sich gerade herausstellte.
Gitta winkte matt ab. »Ihm ist nur der Rasen wichtig. Mit dem hat er eine richtige Macke. Grün und kurz geschoren soll er sein wie auf dem Golfplatz. Ihr wisst ja, wie Ralf sich da anstellt.«
Marit nickte und tätschelte ihr beruhigend den Arm, Constanze strich ihr behutsam über den Rücken. Aber sie warfen sich einen höchst beunruhigten Blick zu.
Denn plötzlich wurde ihnen das ganze Ausmaß der Katastrophe klar. Es ging um die Existenz ihrer Freundin, um einen gemeinsamen Bekanntenkreis, der sich teilen würde, um Werte, die für Gitta in Stein gehauen waren. In einen Stein, den Ralf nun wie mit einer Abrissbirne in Staub und Asche verwandelt hatte.
Und außerdem ging es um den Erhalt eines Ortes, den sie alle liebten.
Die Liebe zu Gärten hatte Constanze, Marit und Gitta vor vier Jahren zusammengebracht. Während einer Gartenreise nach Südengland hatten sie sich kennengelernt und sich über zweifarbige Iris, pinkfarbene Pfingstrosen und gewaltige Horste von lila blühendem Storchschnabel hinweg als Gartenschwestern erkannt. Sie liebten alles, was grünte und blühte.
In dem großen Villengarten am Messelpark setzten die drei Freundinnen ihre Leidenschaft praktisch um. Nach Gittas Anleitung formten sie Büsche, schnitten Äste ab, die der gewünschten Form entgegenwuchsen, rissen alles heraus, das ungefragt zwischen ausgewählten Stauden zu wuchern versuchte, pflanzten energisch um, damit stets etwas in den von Gittas gewünschten Farben blühte – Weiß und Grün. Dabei setzten sie scharfe Waffen aus Edelstahl ein, aber es flossen weder Blut noch Tränen. Auch beschnitten und gezähmt machten die Pflanzen geduldig das, was sie sollten: Sie wuchsen und gediehen.
Ein bisschen gehörte Gittas Garten ihnen allen. Marit und Constanze kannten die meisten Stauden persönlich, inzwischen mit deutschem und lateinischem Namen. Alle zwei Wochen zwischen April und Oktober trafen sie sich dort. Im Frühling wanderten sie die Beete entlang und kommentierten, was sich aus dem Boden schob, teilten Stauden, brachten Kompost aus. Im Herbst steckten sie Zwiebeln für weiße Tulpen, weiße Narzissen, weiße Märzenbecher und verpackten die weißen Rosen winterfest. Und im Sommer, der allerschönsten Zeit, machten sie tausend Sachen, die in einem großen Garten eben gemacht werden mussten.
Zum Abschluss eines gemeinsamen Nachmittags saßen sie dann gemütlich im lauschigen Schatten eines Baumes, lobten sich gegenseitig für ihren Einsatz, tranken kalten Rosé und blickten zufrieden auf ihre schwarzen Fingernägel.
Und was ihnen körperlich zu schwer war – hey, sie waren auch nicht mehr die Jüngsten, und ständig Ralfs Rasen zu mähen war langweilig –, übernahm ein junger, kräftiger Gärtner.
Constanze und Marit, die bereits vor der Gartenreise befreundet gewesen waren, hatten schon immer für raffinierte Staudenbeete, großzügige Parkanlagen, hübsche Baumgruppen und Linné’sche Sichtachsen geschwärmt. In Marits Buchhandlung hatten sie opulente Gartenbücher wie illustrierte Märchenbücher bewundert, auch oder gerade weil sie wussten, dass sie niemals Teil dieser Welt sein würden. Constanzes Altbauwohnung hatte keinen Balkon, sie konnte höchstens drei Töpfe auf das äußere Fensterbrett stellen, und auf Marits Balkon passte ein bisschen, aber nicht sehr viel mehr.
Wie Dorothy mit den roten Schuhen waren Constanze und Marit ins Zauberland Oz gesprungen – und mitten in Gittas weiß-grünem Traumgarten gelandet.
Das konnte unmöglich vorbei sein! Gitta hatte recht: Wenn Ralf die Trennung wollte, musste er ausziehen.
Ein Leben ohne Mann war möglich, ein Leben ohne Garten dagegen sinnlos.
Dass Gitta im Haus wohnen blieb, damit sie alle drei weiter ihren Traum vom Garten leben konnten, musste der betrügerische Ralf einfach einsehen. Dieser Ignorant sollte sich gefälligst trollen und woanders hinziehen, am besten gleich auf den Mond oder zumindest in eine andere Stadt in einen Nobelbau aus Stahl, Marmor und Beton, möglichst weit weg von ihrem Garten in Dahlem.
Bloß dass das überhaupt nicht glaubhaft klang.
2. Kapitel
Oderberg im Februar 1945
»Elisabeth, die Russen sind nicht mehr weit entfernt. Die Frontlinie ist jetzt schon fast an der Neuen Oder«, flüsterte Frau Schmölln hinter mir angstvoll. »Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie hier sind. Dann gnade uns Gott.«
Ich hatte sie nicht hereinkommen hören, weil ich eingedöst war. Die ganze Nacht hatte ich an Muttis Bett gesessen und ihre Hand gehalten. Gegen die Kälte hatte ich mich in eine Decke gehüllt, aber das half nicht viel. Ich war bis auf die Knochen durchgefroren. Frau Schmöllns Worte machten das dumpfe Grollen in der Ferne noch entsetzlicher. Sie kämpften, und sie kamen immer näher.
Zuerst wusste ich nicht, ob Mutti Frau Schmölln gehört hatte. In den letzten Tagen hatte ich schon mehrmals gedacht, ich hätte sie verloren. Es hatte mit einer Erkältung angefangen, der Winter war so schrecklich kalt. Die Kohlen, die die Schiffe auf der Oder brachten, gingen schon lange nicht mehr an uns, die Bewohner der Stadt. Und auch nicht das Holz vom Sägewerk. Nein, es wurde in der Fabrik im Wald gebraucht, wo Sprengstoff hergestellt wurde. Munition für den Krieg, für die Fronten im Osten und im Westen, war wichtiger, als die Menschen es waren. Alles war wichtiger. Von überallher hatte man Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene für die Produktion herangekarrt, selbst Frauen aus dem fernen Rheinland, die in Lagern im Wald wohnten. Tag und Nacht wurde gearbeitet, aber es war nie genug.
Die Oderberger mussten auch ran. Ich arbeitete in der Fabrik wie viele andere aus dem BDM, obwohl ich eigentlich nach der Schule eine Ausbildung zur Kindergärtnerin gemacht hatte, weil ich Kinder so mochte. Auch Mutti hatte in der Fabrik gearbeitet, bis sie zu krank geworden war.
Unser kleines Haus hinten auf dem Grundstück der alten Schmölln hatte drei Räume. Hier war ich aufgewachsen. Es stand am Ufer der Alten Oder. Der Flussnebel kroch durch alle Ritzen, die Fenster schlossen nicht mehr richtig, weil sie verzogen waren. Wenn man so wie wir nicht ausreichend heizte, war es kalt und feucht. Tischler und Zimmerleute, die die Fenster hätten reparieren können, waren schon lange eingezogen. Es gab nur noch wenige Männer in Oderberg. Vati, der immer geschickt gewesen war und mit einem gutmütigen Lachen alles repariert hatte, war drei Jahre zuvor gefallen.
In der letzten Zeit hatte Mutti immer häufiger rasselnd gehustet und sich die Hand gegen die Brust gepresst, weil es sie so schmerzte. Wenn sie Atem holte, klang es mühsam. Unser selbst gemachter Hustensaft aus Spitzwegerich und auch der Kandissaft aus schwarzem Rettich hatten nichts genutzt. Wir wussten es wohl beide, aber wir sprachen es nicht aus: Mutti hatte eine schwere Lungenentzündung.
Dr. Wernecke, den ich angefleht hatte, sie zu untersuchen, obwohl er mit den vielen Verwundeten in Oderberg schon überfordert war, hatte nur traurig den Kopf geschüttelt. Es gab keine Medikamente und erst recht nicht das Wundermittel Penicillin. Jedenfalls nicht für eine Frau. Da habe ich gewusst, dass es nicht mehr lange dauern würde.
Jetzt schlug Mutti allerdings die Augen auf. »Du musst weg, Lissa«, sagte sie leise. »Hörst du? Du musst vor den Russen fliehen, Kind. Hier bist du nicht mehr sicher. Geh! Geh so schnell du kannst. Versprich es mir.«
Frau Schmölln musterte kritisch meinen langen blonden Zopf und meine zierliche Figur und nickte. Aber wenn es stimmte, was man erzählte, war das Aussehen sowieso nicht wichtig. Eine Frau, die aus Schlesien geflüchtet und beim alten Voss untergeschlüpft war, hatte von Gräueltaten der Russentruppen erzählt. Wenn sie deutsche Frauen fanden, die noch nicht vor ihnen geflohen waren, oder wenn sie auf einen Treck stießen – egal ob die Frauen jung oder alt waren, sie vergingen sich an ihnen. So schrecklich verletzbar waren die vielen Flüchtlinge auf den gefrorenen Straßen.
»Aber Mutti, wohin soll ich denn?«, fragte ich.
Der Gedanke, unsere kleine Stadt zu verlassen, kam mir beängstigend vor. Mein ganzes Leben war ich nicht weiter als bis Bad Freienwalde gekommen.
Oderberg war voller Flüchtlinge, die zu Fuß, mit Leiterwagen oder auf Pferdewagen aus dem Osten kamen, bepackt mit ihrem wenigen Hab und Gut. Oft hatten sie obenauf die Federbetten, wo doch gerade die sich bei Regen und Schnee sofort vollsogen. Sie zogen und schoben ihre Wagen mit der aufgetürmten Last, wie eine menschliche Welle trieb die Rote Armee sie vor sich her. Wir hatten wenigstens unser Häuschen und einen kleinen Garten.
Früher hatten wir uns in Oderberg umeinander gekümmert. Inzwischen war die Lage so verzweifelt, dass jede Frau allein zusah, wo sie mit ihrer Familie blieb. Niemand hatte mehr viel Essbares, auch unsere Vorräte waren fast aufgebraucht.
An der Alten Oder hatte es im Spätsommer zudem Hochwasser gegeben. Es war in unseren Keller gelaufen und hatte die meisten Vorräte zerstört. Unsere magere Kartoffelernte war verfault, die Äpfel, die sich sonst bis ins Frühjahr hielten, waren auf dem schmutzigen Kellerwasser geschwommen, die Einmachgläser waren vom Regal gefallen und aufgeplatzt, auch das Eingekochte verdorben.
»Geh zu Tante Martha. Sie wird dir helfen. Versuch, in Eberswalde einen Zug nach Berlin zu bekommen«, flüsterte sie. Dann hustete sie so schrecklich, dass sie regungslos liegen bleiben musste.
Frau Schmölln sog erschrocken die Luft ein. »Aber Anna, Frauen und Kinder fliehen aus Berlin, warum sollte Lissa dorthin?«
»Weil dort … die einzige Schwester ist, die ich habe. Sie wird auf mein Kind aufpassen«, antwortete meine Mutter kaum hörbar. Nach Berlin? Ich wollte laut protestieren, angesichts der Blässe meiner Mutter und ihrer zuckenden, schweißnassen Händen schwieg ich jedoch. »Versprich es mir«, wisperte sie, und ich tat es.
Meine Eltern hatten keine Geschwister. Tante Martha war meine Nenntante. Sie stammte auch aus Oderberg, aber hatte in den Zwanzigerjahren einen Berliner geheiratet. Onkel Kurt arbeitete in einer Bank, Kinder hatten sie nicht, mich dagegen behandelten sie immer wie eine Tochter, wenn wir uns sahen. In den ersten Kriegsjahren waren sie noch jeden Sommer nach Oderberg gekommen. Wir waren mit Vatis altem Angelkahn auf den Oderberger See hinausgerudert und dort schwimmen gegangen, hatten am Ufer der Alten Oder im Schatten eines Walnussbaumes gesessen, erzählt und gelacht, als würde uns der Krieg an den fernen Fronten nichts angehen. Warum sollte er auch? Wir hatten ja gehört, dass wir kurz vor dem Sieg standen, bald würde er vorbei sein, und wir wären die Sieger.
Dann war die Front näher gerückt, und Tante Martha und Onkel Kurt hatten die Besuche eingestellt, doch wenn ein Brief von Tante Martha aus Berlin gekommen war, war das immer ein kleines Fest gewesen. Was sie berichtet hatte, war sehr aufregend gewesen. Offenbar gab es in Berlin auch während des Krieges noch viele Vergnügungsmöglichkeiten. Sie und Onkel Kurt hatten sogar Konzerte besucht. Im Austausch hatte Tante Martha von Mutti immer wissen wollen, was zu Hause in Oderberg los war.
Aber dann hatte sie in ihren Briefen immer häufiger von feindlichen Fliegern berichtet, die nachts gekommen waren, von Bomben, die Häuser und ganze Straßenzüge zerstört hatten. In Berlin wünschte man sich jetzt abends nicht »Gute Nacht«, sondern »BoLoNa« – bombenlose Nacht.
Das Heulen der Alarmsirenen, Christbäume am Himmel, die zur Erde sanken, um die Ziele zu beleuchten, Nächte in Kellern und Schutzbunkern konnten wir uns einfach nicht vorstellen. Wir schauten stets unruhig in den Himmel in Richtung Chorin und in Richtung Hohenwutzen. Manchmal sahen wir hoch oben Flugzeuge, aber sie warfen zum Glück keine Bomben auf Oderberg.
Im vergangenen November hatte Onkel Kurt, obwohl er schon über fünfundfünfzig Jahre alt war, zum Volkssturm gemusst. In einem sehr traurigen Brief hatte Tante Martha vor Weihnachten geschrieben, dass er erschossen worden war.
Wir sind immer noch Seelenschwestern, Anna, hatte sie geschrieben, und an dieser Stelle war die Schrift von ihren Tränen ganz verwischt gewesen. Selbst im Tod unserer Männer ähneln wir uns. Sie wurden uns vom Krieg genommen.
In dieser Nacht starb meine liebe Mutti. Jetzt war ich wirklich mutterseelenallein auf der Welt. Ich hatte solche Angst und überlegte, ob ich nicht einfach ins Wasser gehen sollte. Die Oder war zugefroren, aber Schiffe hatten das Eis durchbrochen. Es konnte der Welt so egal sein, ob es eine Elisabeth Benthin gab, und mir war die Welt egal.
Mir fehlte dann doch der Mut, also beschloss ich, mich auf den Weg zu Tante Martha zu machen, kaum dass man Muttis Leichnam abgeholt hatte. Die Erde war so hart gefroren, ich wusste nicht, wie lange es dauern würde, ein Grab zu schaufeln. Ein Tag, eine Woche, einen Monat – dann könnte es für mich zu spät sein, nach Berlin zu gehen. Und ich hatte es versprochen. Der leblose Körper, der aus unserem Haus herausgetragen wurde, war nicht mehr Mutti, versuchte ich mich zu trösten. Aber meine Tränen wollten nicht aufhören zu fließen.
In jedem Brief hatte Tante Martha uns eingeladen, wir waren jedoch nie zu ihr nach Berlin gefahren. Jetzt nahm ich einen der Briefe, die Mutti mit einem grünen Band umwickelt in dem Schrank mit den Wintersachen aufgehoben hatte. Ich drehte ihn um. Martha Ebeling, Berlin West-1000, Kaiserdamm 53 stand da als Absender, und ich steckte ihn in Muttis alte Reisetasche. Dazu packte ich so viel Kleidung, wie hineinpasste, unsere letzten zweihundert Reichsmark, die uns nach dem »Volksopfer« im Januar, als wir für den Volkssturm sammeln mussten, geblieben waren, Vatis goldene Uhr, meinen Ausweis, den Ariernachweis und das Dokument, dass ich Kindergärtnerin war. Ein altes Foto von Mutti, die mit mir auf dem Schoß unter unserem Apfelbaum im Garten sitzt, und ein Foto von Vati in Uniform legte ich ganz obendrauf.
Ich fand auch Vatis alten Wehrmachtsrucksack. Mit ihm hatte man uns alles zugestellt, was er besessen hatte. Viel war es nicht gewesen. Ich stopfte eine warme Decke und ein Kissen hinein, ein halbes Brot und zwei Gläser Brombeermarmelade. Mehr hatten wir nicht im Haus. Es wurde rationiert, die Zivilisten bekamen immer weniger, damit es für die Soldaten reichte. Wir hatten die Marmelade aufgespart, hatten uns vorgestellt, damit irgendwas zu feiern, das nun nicht mehr kommen würde.
Mein langes hellblondes Haar verbarg ich unter einer dicken Mütze. Dann wand ich mir einen dunklen Schal um den Hals, der mir fast bis zu den Augen reichte. Schließlich schlüpfte ich in meinen dicken Wintermantel, in Wollstrümpfe und in meine alten Stiefel. Ganz abgelaufen waren die Absätze schon, der Schuster von Oderberg war eingezogen worden, aber sie würden meine Füße warm halten.
Ich schnallte mir Vatis Rucksack auf den Rücken, griff nach der Tasche und verließ den Garten, in dem wir früher Hühner und Kaninchen gehalten und Gemüse geerntet hatten und Pflaumen, Kirschen und Himbeeren und wenn ein Frühling mild gewesen war, sogar Pfirsiche. Das Haus, in dem ich dreiundzwanzig Jahre gewohnt hatte. Mein Zuhause.
Mit gesenktem Kopf ging ich den schmalen Weg von der Oder zur Straße vor. Verabschieden wollte ich mich von niemandem, weil ich nicht wusste, ob ich dann noch weggehen konnte. Ich erwartete sowieso nicht, dass mich jemand in diesem Chaos bemerkte. Aber Frau Schmölln stand in der offenen Tür, obwohl es ein sehr kalter Tag war. Ich blieb stehen, und sie kam und steckte mir ein kleines Paket zu.
»Es ist gut, dass du gehst, Lissa. Hier, nimm, und pass auf dich auf.«
»Und Sie, Frau Schmölln? Bleiben Sie hier?«, fragte ich.
Meine Worte malten neblige Kringel in die kalte Winterluft.
»Ich bin vierundsiebzig. Ich habe immer hier gelebt, und hier werde ich sterben. Für mich ist das Ende sowieso nah. Du dagegen bist jung, du musst leben, hörst du?«
Ich wischte mir die Tränen mit den dicken Wollhandschuhen aus dem Gesicht, dann verstaute ich ihr Paket in Vatis Rucksack. Wir umarmten uns nicht, das war nicht üblich bei uns. Aber als ich mich noch ein letztes Mal umdrehte, stand sie am Fenster ihres Fachwerkhauses und schaute mir hinterher.
Ich war nicht allein auf der Straße. Wieder war ein Treck Frauen und Kinder in Richtung Westen unterwegs, so schnell wie möglich weg von der östlichen Truppenlinie, die immer näher rückte. Ich schloss mich einer großen Gruppe an, die zu Fuß in Richtung Eberswalde unterwegs war. Wir gingen langsam am Pimpinellenberg vorbei, und ich fragte mich, ob ich dort jemals wieder wilden Bärlauch pflücken würde.
Kurz vor Liepe hatte ich Glück und fand Platz auf einem Wagen, der gerade auf den Weg einbog und von zwei schweren Pferden gezogen wurde. Ich kannte den Kutscher, es war ein junger Kerl aus Liepe, aber er erkannte mich nicht. Vielleicht tat er auch nur so, als ob er mich nicht kennen würde, weil es ihm nicht passte, dass ich meine Heimat verließ.
Wir zuckelten durch den grauen Tag. Zur Linken erhob sich das Schiffshebewerk Niederfinow wie ein stählernes Skelett in den trüben Winterhimmel. Diejenigen, die keinen Platz auf dem Wagen hatten, mussten laufen. Ich sprach mit niemandem, niemand sprach mit mir. Mein Herz war schwer, und ich hatte Angst, allein nach Berlin zu fahren, in eine Stadt, in der ich noch nie gewesen war.
Als wir Eberswalde erreichten, war es schon dunkel. Ich hatte Hunger und Durst. Mir war kalt. Ich fühlte mich zerschlagen und hoffnungslos. Ich trauerte um Mutti, die zwar alles überstanden, doch mich allein gelassen hatte. Die Dunkelheit war unser Feind. Man wusste nicht, was sie verbarg. Aber sie bot uns auch Schutz, denn sie verbarg uns.
Der Kutscher forderte uns auf abzusteigen und fuhr dann ohne uns weiter. Wir gingen mit unseren Habseligkeiten langsam zum Bahnhof – eine schweigende Menschenmenge. Viele trugen zerlumpte Kleidung in Schichten übereinander, Mützen und darüber noch Kopftücher, und sie zogen Handwagen hinter sich her. Kinder weinten. Ich weiß nicht, ob diese Menschen überhaupt wussten, wo sie hinwollten. Sie schienen schon lange unterwegs zu sein.
Wir erfuhren, dass an diesem Abend kein Zug mehr fahren würde. In der Ferne grollte es lauter, die Nachtkämpfe hatten begonnen. Ich kauerte mich in eine Ecke des Bahnhofs und versuchte, nicht daran zu denken, wie es am kommenden Morgen weitergehen würde. Aus meinem Rucksack nahm ich das Paket von Frau Schmölln und öffnete es – zwei Gläser mit Wurst, Blutwurst und Jagdwurst, hatte sie mir geschenkt. Sorgfältig verstaute ich sie wieder, wenn ich auch hoffte, dass ich bei Tante Martha eine Lebensmittelkarte bekam.
Ich brach ein Stück Brot ab, tunkte es in die Brombeermarmelade und aß gierig. Jeder Biss war wie eine Erinnerung an mein Zuhause, meine Vergangenheit, meine Eltern. Ich aß, um sie nicht zu vergessen. Das Essen schenkte mir innere Wärme, dass die Brombeermarmelade auf meinen Wintermantel tropfte, störte mich nicht. Achtlos verwischte ich die klebrigen Stellen, leckte sogar meine Finger ab und tat so, als ob ich die hungrigen Blicke der Frauen und Kinder um mich herum nicht bemerkte.
In der Nacht stahl irgendwer das Glas mit der restlichen Brombeermarmelade aus meinem Rucksack. Als ich es am nächsten Tag bemerkte, weinte ich.
Der erste Zug aus Stettin nach Berlin war bereits hoffnungslos überfüllt, als er in den Bahnhof einfuhr. Es herrschte Enge und Gedränge, ich war in dichten Trauben von schubsenden Menschen gefangen, die mitsamt ihren schweren Taschen und Koffern vergeblich versuchten, die Waggons zu stürmen.
Auch in den zweiten Zug kam ich nicht, ich musste mit vielen anderen weiter in der Kälte warten. Einmal beobachtete ich, wie eine Frau zwei weinende kleine Mädchen durch ein offenes Fenster vom Bahnsteig aus in den Waggon hob. Ich hoffte, dass sie selbst noch einsteigen konnte, bevor er abfuhr und ihr die Kinder entriss.
Als ich es endlich in den dritten Zug am Tag schaffte, waren die Abteile voller Schwerverletzter, die von der Front zurück nach Berlin geschickt wurden. Blutige Bandagen, entstellte Gesichter, fehlende Gliedmaßen … Erschrocken schaute ich weg.
Nur ein Abteil war fast leer. Darin saßen vier unverletzte Männer in blitzsauberen SS-Uniformen, rauchend und mit ernstem Gesicht. Ich spürte ihre Blicke, als ich mir die Mütze abnahm und mein blonder Zopf herausfiel. Sie machten ein Zeichen, ich solle in ihr Abteil kommen, wirkten interessiert. Aber ich blieb lieber im überfüllten Gang stehen, selbst wenn es so unerträglich eng war, dass ich fast nicht atmen konnte.
Ich hatte beschlossen, bis zur Endstation zu fahren, zum Stettiner Bahnhof. Tante Martha wohnte im westlichen Teil der Stadt, irgendwer würde mir schon sagen, wo der Kaiserdamm war.
Immer wieder hielt der Zug auf offener Strecke, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Allmählich änderte sich die Umgebung, man sah kaum noch Felder, Häuser tauchten entlang der Bahnstrecke auf. Erst niedrigere, dann höhere, schließlich Gebäude, die viel höher als die in Oderberg waren. Etliche hatten keine Dächer und in den schwarzen Fensterrahmen kein Glas. Zwischen ihnen türmten sich Geröll, Schutt und Steine.
Das waren keine Häuser mehr. Es waren Ruinen. Tot, als ob ein Riese sie einfach zerdrückt hätte. Ein Kriegsriese, der mit Flammen und Gewalt das Land überzog. Wir waren in Berlin angekommen.
Mir wurde kalt, denn plötzlich verstand ich, was Tante Martha über Bomben und Luftschutzkeller geschrieben hatte. Lieber hätte ich es nicht verstanden.
Es war bereits dunkel, als wir in einen mächtigen Rangierbahnhof einfuhren und hielten. Ich hatte noch nie so viele Gleise gesehen. BERLIN-PANKOW stand auf einem Schild am Bahnsteig. Ich fragte mich gerade, wo ich in dieser Nacht schlafen würde, denn zu Tante Martha würde ich es wohl nicht schaffen, als plötzlich Sirenen aufheulten. Der ungewohnte Ton und die Lautstärke jagten mir einen Schauer über den Rücken. Um mich herum schrien Menschen angstvoll auf.
Auch von einem Zug auf dem Parallelgleis schallten Schreie zu uns herüber. Nur Frauen und Kinder sah ich hinter den Zugfenstern. Ich konnte sie hören, weil wir wegen der schlechten Luft und der Überfüllung des Waggons die Fenster etwas geöffnet hatten.
Wir waren in dem Zug gefangen. Luftschutzkeller und Bunker, wie Tante Martha sie beschrieben hatte, waren unerreichbar. Niemand konnte hinaus, niemand herein, und alle wussten es. Wir sanken auf den Boden des Ganges und hielten die Arme schützend über den Kopf. Dann hörten wir Flugzeuge über uns, hörten peitschende Schüsse und schließlich, ganz nah, eine Detonation, so gewaltig, dass unser Zug schwankte. Die Außenwand in meinem Rücken wurde warm, was unter normalen Umständen angenehm gewesen wäre. Aber ich wusste nicht, woher diese Wärme stammte, und das war unheimlich.
Schließlich wurde das Flugzeuggeräusch leiser, und die heulenden Sirenen verstummten. Wir rührten uns nicht, schwiegen, was mir wie eine lange Zeit vorkam. Dann ruckte es, und wir fuhren weiter.
Ich rappelte mich auf und sah aus dem Fenster zurück zum Bahnhof. Der Zug mit den Frauen und Kindern, den ich bei unserer Einfahrt auf dem Nachbargleis gesehen hatte, stand noch da. Aber er hatte keine Fenster mehr. Und er brannte lichterloh. Da wusste ich, woher die Wärme gekommen war.
Ich empfand es als Glück, dass es sie und nicht uns getroffen hatte, und schämte mich zugleich für diesen Gedanken.
Der Stettiner Bahnhof, den wir eine halbe Stunde später erreichten, war das größte Gebäude, das ich jemals gesehen hatte. Es herrschte ein Gewimmel von Ankommenden, Soldaten, Verletzten, die bandagiert auf Tragen lagen, und Abfahrenden mit viel Gepäck, meist Frauen und Kinder. Anders als in Eberswalde schienen alle zu wissen, wo sie hinwollten. Nur ich nicht. Ich war nun seit fast zwei Tagen unterwegs und fühlte mich unendlich erschöpft.
Auf einem Bahnsteig fragte ich eine Frau in Uniform, wo es einen Anschluss in westlicher Richtung gab. Sie schickte mich zu einem anderen Bahnsteig und ermahnte mich streng, mir ein Billett zu kaufen. Doch kaum hatte ich ihn erreicht, heulten schon wieder die Sirenen los.
Ich folgte den Menschen, die sich in den Tunneln in Sicherheit brachten, während die Züge im Bahnhof stehen blieben. Erst eine Stunde war ich in Berlin und hatte schon zweimal einen Bombenalarm erlebt. Ich wollte nur eins: zurück nach Oderberg. Aber das ging nicht.
Dicht zusammengedrängt mit Wildfremden saß ich in der Dunkelheit, in Todesangst nach oben lauschend, ob eine Bombe über uns einschlug. Wie alle anderen presste ich meine Habseligkeiten an mich. Manchmal döste ich ein, der Kopf fiel mir auf den Rucksack, der auf meinen Knien lag.
Irgendwann wurde es über uns stiller, und draußen graute wohl schon der Morgen. Ich verließ den unterirdischen Gang und suchte nach meinem Bahnsteig.
Ein weites Stück fuhr ich mit der S-Bahn, vom Straßenbahnhof Charlottenburg schleppte ich mich zu Fuß weiter. Wie war die Stadt zerstört! Manche Häuser waren ausgebrannt, ganze Straßenzüge lagen in Schutt, der das Laufen erschwerte. Ich sah Ruinen, steinerne Höhlen, tiefe Krater. Einmal fragte ich mich, warum so viele schwarz verbrannte Baumstämme zwischen dem Geröll lagen. Bis ich zu Tode erschrocken Beine und Arme an den vermeintlichen Baumstämmen erkannte: Es waren verbrannte Menschen.
Ich versuchte nicht daran zu denken, dass auch Tante Marthas Haus zerbombt sein könnte.
Gegen Mittag erreichte ich den Kaiserdamm, eine breite Straße mit mehreren Spuren und einer Straßenbahn, die nicht fuhr. In Richtung Osten meinte ich eine große Säule zu sehen. Ich hatte gelernt, dass jeden Moment wieder die Sirenen losgehen konnten, und ich hatte keine Ahnung, wo ich den nächsten Bunker finden würde. Meine Arme schmerzten, die Beine brannten, Tasche und Rucksack wurde immer schwerer, aber die Angst beflügelte mich. Und dann endlich, endlich hatte ich mein Ziel erreicht.
Das Nummernschild an dem hohen Altbau war gut zu sehen, denn, o Wunder, hier standen die Häuser noch. Weinend vor Erleichterung stieg ich die Treppen hoch, unter meinen Füßen staubiger roter Sisal, und klingelte bei Ebeling. Ich hörte innen Schritte, die Tür wurde nur so weit geöffnet, wie eine Kette es erlaubte. Dann wurde sie mit einem Schrei aufgerissen.
»Anna!«
»Nein, Tante Martha. Ich bin’s, Lissa.«
Ungläubigkeit, Sorge, Erschrecken, Freude spiegelten sich auf Tante Marthas Gesicht wider, als sie mich endlich erkannte. Sie sah anders aus, als ich sie in Erinnerung hatte, viel dünner und herber. Das Haar war streng zurückgebunden, sie trug eine weite Strickjacke über einem schlichten Kleid und dicke Strümpfe, die Falten an ihren Beinen schlugen.
Es war kalt in der Wohnung. Das fröhliche Lachen meiner Nenntante war verschwunden. Aber als sie mich umarmte, war es fast wie früher. Zum ersten Mal seit fünfzig Stunden atmete ich tief durch. Ich fühlte mich entsetzlich erschöpft.
Wir saßen in der Küche, die Fenster waren wegen der Verdunkelungsvorschriften mit dunklem Papier beklebt. Als Tante Martha ein Fenster öffnete, sah ich in einen hohen, engen Innenhof. Alles hier war fremd für mich, selbst in den härtesten, kältesten Zeiten in Oderberg hatte ich einfach in den Garten gehen können. Überhaupt war ich noch nie in einem so hohen Gebäude gewesen, im vierten Stock!
Aber ich war dankbar, in Berlin sein zu können. Wir weinten beide, als ich von Muttis Tod erzählte und von Muttis Wunsch, dass ich zu ihrer Freundin fahren sollte. Tante Martha dagegen fand es wegen der Luftangriffe viel zu gefährlich, in Berlin zu sein, sagte, ich wäre besser auf dem Lande aufgehoben und in Oderberg geblieben und ob ich nicht woanders Verwandte hätte. Die hätte ich nicht, versicherte ich ihr, worauf sie seufzte und meinte, natürlich könne ich bei ihr bleiben. Weil ich ohne amtliche Erlaubnis in die Stadt gekommen sei, würde ich allerdings keine Lebensmittelkarte bekommen. Wenn alle Stricke reißen würden, müssten wir zu Albert gehen.
Darauf konnte ich mir keinen Reim machen.
Mir fiel Frau Schmöllns Abschiedsgeschenk ein, und ich gab Tante Martha die beiden Gläser. Wir aßen Brot mit Wurst, aßen, bis wir richtig satt waren, dann gähnte ich, zum Umfallen müde.
Tante Martha machte mir ein Lager auf dem Sofa, direkt dahinter stand Onkel Kurts Klavier. Wasser und Strom gebe es nur stundenweise, erklärte sie, was ich schon von Oderberg her kannte. Aber sie hatte einige Eimer mit Wasser in die Badewanne gestellt. Ich wusch mich, zog mein Nachthemd an und legte mich aufs Sofa, war schon fast eingeschlafen, als Tante Martha noch mal hereinkam.
»Zieh dir die Straßenkleidung übers Nachthemd«, sagte sie. »Es ist wärmer, außerdem hast du dafür nachher keine Zeit.« Wozu?, wollte ich schon fragen, während ich mir den Pullover und die Hose übers Nachthemd zog, die sie mir reichte. Da heulten wieder die Sirenen auf, und ich hatte meine Antwort. »Mach schnell, Lissa«, wies Tante Martha mich an. »Los, los!«
Ich beeilte mich, schlüpfte in die Stiefel, nahm meinen Rucksack und lief ihr hinterher. Wir rannten die Treppen hinunter in den Keller. Eine Frau warf, kaum dass wir drin waren, hinter uns eine Eisentür ins Schloss und verriegelte sie.
»Das hat heute aber gedauert, Frau Ebeling«, sagte sie ungehalten. Ihr fettiges graues Haar war streng gescheitelt, sie hatte dicke graue Augenbrauen und war dafür, dass es Essen auf Lebensmittelkarten gab, erstaunlich beleibt. »Sie wissen doch, dass wir alle erst sicher sind, wenn die Tür schließt. Und wen haben wir hier?« Sie musterte mich.
»Meine Nichte. Ihre Mutter ist vor einigen Tagen gestorben. Sie bleibt bei mir«, antwortete Tante Martha kurz.
Ihr Gesicht konnte ich nicht gut erkennen, sie stand neben mir, nur zwei Kerzen brannten. Aber das Gesicht der Frau gegenüber sah ich. Tiefes Misstrauen las ich darin, während draußen die Sirenen heulten.
Und dann fielen die ersten Bomben. Auch in unserem Keller war ihr durchdringendes Pfeifen zu hören, die Detonationen, als sie ihr Ziel fanden. Eine Bombe schien ganz nah eingeschlagen zu haben, die Erschütterung war bis in den Keller zu spüren. Wir schrien auf.





























