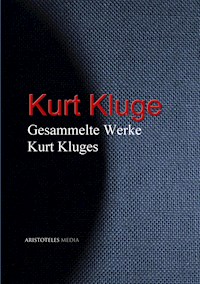Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Loreart
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Naß wie ein Meerschwamm betritt der Gelehrte Stellach Xenodochion, seit Schliemanns Tagen von den Deutschen "das Gasthaus zur schönen Helena" genannt, hört von einer Ausgrabung, die nach Athen geschafft werden soll. Stellach will die Statue um jeden Preis für sein Museum. So beginnt ein Verwirrspiel um Original und Fälschung, die archäologische Jagd nach einer antiken Göttin, einem Erzweib im sonnigen Griechenland. Die gefälschte Göttin ist eine melancholisch-heitere Erzählung, perfekt und pointiert gemeißelt von Kurt Kluge, der auch Bildhauer und Erzgießer war und seine Schriftstellerkarriere erst als fast Fünfzigjähriger begann. Sein erfolgreichster Roman Der Herr Kortüm (1938) gilt als literarische Besonderheit im 20. Jahrhundert, zeichnet er doch eine "lebendige, abseitige Sonderlingsgestalt" (Fricke/Klotz), wie sie sonst nur von Autoren früherer Epochen, z.B. Jean Paul, Charles Dickens oder Wilhelm Raabe, bekannt sind. Noch mehr als seine Romane stehen die heiter-besinnlichen Erzählungen und Novellen Kurt Kluges stofflich im Zusammenhang mit seinem Künstlerberuf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Die gefälschte Göttin
Über den Autor
Impressum
Hinweise und Rechtliches
Kurt Kluge
Die gefälschte Göttin
Erzählung
Edition Loreart
Die gefälschte Göttin
Im strömenden Regen eines späten Septemberabends mußte der Doktor Stellach, Beauftragter eines großen ausländischen Antikenmuseums, sein trockenes Abteil der eben fertig gebauten argolischen Eisenbahn verlassen und mißmutig in einem zähen Schlammbett entlangwaten, das ihm der Stationsbeamte als die richtige Straße nach Charwati bezeichnet hatte. Der Gedanke an Regenwetter war Stellach bei den Reisevorbereitungen in Athen nicht gekommen: Wochen, Monate hindurch hatte er, im gnadenlos weißen Sonnenlicht wandelnd, den unendlich feinen Staub Griechenlands geschluckt und nach Wasser gestöhnt, nach feuchten Wolken wenigstens - jetzt hatte er Wasser!
Es plätscherte auf der zerweichten Straße, trieb Blasen auf den Pfützen, quietschte in seinen Stiefeln und trommelte auf seinen Hut, dessen Krempe trübselig herabhing. Der durchnäßte Gelehrte schob die Brille auf die Stirn - er war kurzsichtig, aber bei solchem Unwetter vermochte er ohne Gläser immer noch ein wenig mehr zu sehen: rechts vom Wege schien sich ein Maisfeld auszubreiten, links ein Ölbaumgarten. Unruhig spähte Stellach in das zerfließende eintönige Grau: war der dunkle Schatten dort drüben ein Regenschwaden oder vielleicht doch schon der Eliasberg?
„Zeit wäre es“, seufzte Stellach und stopfte sein Taschentuch zwischen Hals und Kragen, damit das Wasser nicht zu ungehemmt aus der Huttraufe den Rücken hinabrieseln konnte. „Wenn der verdammte Dunststreif der Hagios Elias ist, muß der ermordete Agamemnon gleich halblinks davor liegen. Ein gemütliches Gelände. Dieses Sauwetter paßt dazu. Jawohl, Orest und die Blutflecken in der Badstube“ - Stellach schauerte zusammen - „es regt sich, kommt heran - nein, was sich da bewegt, sind verkrüppelte Ölbäume im Winde.“
Er blieb stehen und sah lange in den Nebel: Hinter den Ölbäumen andre Baumschatten ... aber das Breite, Langgestreckte, das - ja, das mußten Dächer sein! Wo Dächer sind, wohnen auch Menschen, und Mensch, gut oder böse, ist besser als Gespenst - wenigstens in diesem heillosen Erdenwinkel.
Stellach hatte sich nicht getäuscht. Er stand am Dorfeingang. Der Wind blies noch einmal Regenschwaden gegen den fremden Mann, der sich hereinwagte in diesen von Göttern und Menschen verfluchten Bezirk, um seine weißen Schreiberhändchen auf die Zyklopenblöcke mit den undeutlichen dunklen Flecken zu legen. Aber Stellach scheute nicht wieder zurück: das größere unter den Dorfhäusern mußte nach der Beschreibung jenes Xenodochion sein, das die Deutschen seit Schliemanns Tagen das Gasthaus zur schönen Helena nennen.
„Was hilft mir das Gasthaus zur schönen Helena, dreimal verflucht - was hülfe mir Helena selber? Ich bin naß wie ein Meerschwamm, und meine Handtasche steht beim Stationsvorsteher!“ rief Stellach verzweifelt.
Um nicht das Zerweichen auch seines wenigen Gepäckes erleben zu müssen, hatte Stellach die Reisetasche in der Stube des Bahnhöfchens zu treuen Händen des Beamten zurückgelassen und klinkte nun, ohne irgendein trockenes Kleidungsstück bei der Hand zu haben, die Haustür des Xenodochions auf. Mit einem Blick ließ sich das ganze Erdgeschoß des langgestreckten Gebäudes erfassen: wie in den antiken Wohnstätten ging dieser Raum durchs ganze Haus. Am einen Ende flackerte das Herdfeuer und beleuchtete - die einzige Lichtquelle im Gemach - ein Wandbrett mit Weinflaschen und Gläsern: es war richtig. Stellach befand sich im Gasthaus von Charwati. Zwei Wegebiegungen weiter, und er hätte in den Trümmern der Burg von Mykenä gestanden.
Mehr verzweifelt als erschöpft bemerkte Stellach die beiden Mädchen kaum, die am Herde geschafft hatten und nun erstaunt innehielten, um den triefenden Fremdling anzustarren, der wie eine Wassergottheit plötzlich aus der rauschenden Regennacht aufgetaucht war. Der gelehrte Mann aber sank auf die Bank an der Tür nieder und gab langsam, fast mit Genuß, eine sehr unwissenschaftliche Vorrede von sich: „Himmelkreuzbombenschockdonnerwetter.“
„Sei bedankt für den Gruß, willkommen, Herr“, beantwortete das eine der Mädchen in klangvollem Neugriechisch die ihr unverständliche Anrede aus dem dunklen Norden der Welt.
Stellach beschränkte seinen Dank auf einen grunzenden Urlaut und sah stumpfsinnig zu, wie im ungewissen Herdlicht das Wasser des Himmels schimmernd von ihm ablief, auf die Bank tropfte, von der Bank auf den Estrich rieselte und auf diesem Estrich in unheimlich kurzer Zeit einen ansehnlichen Teich um seine Stiefel herum erzeugte.
„Was nun?“ - Stellach spiegelte sich in diesem Teich.
Aber sein eigener Anblick schien ihn gar nicht zu befriedigen: „O Helena, wie komme ich zu einem trocknen Hemde!“
Diese Anrufung Helenas half ganz unerwartet: „Ja, Herr?“ fragte das Mädchen, hing den Wasserkessel in den Kettenhaken und kam näher: „Woher kennst du mich?“
Leider fühlte der nasse Gelehrte jetzt eben bei einer unvorsichtigen Bewegung der Überraschung, wie eiskalt sein nasses Hemd an ihm klebte. Steif und starr hielt er die Arme vom Leib und murmelte: „Verdammt.“
„Er versteht unsere Sprache nicht“, sagte Helena zu dem anderen Mädchen, das am Herd stehengeblieben war. „Der arme Mann. Er ist ganz naß. Komm, Herr“ - Helena zog ihn an seiner Rockklappe vom Sitz hoch.
Stellach verstand und sprach zwar ausgezeichnet Neugriechisch, aber in seinem derzeitigen Stumpfsinn fühlte er beim Aufstehen nichts als das niederträchtig naßkalte Anklatschen seiner Kleidung - er dachte gar nicht daran, in diesem eines Gelehrten unwürdigen Zustande zu denken, sondern beschränkte sich auf möglichste Vermeidung einer Verschiebung des nassen Hemdes auf seiner armen Haut und stelzte steifbeinig hinter Helena her.
Die Treppe zu den oberen Räumen führte außen am Haus hoch. Es regnete immer noch. Der Hof stand voll Wasserlachen. Vorsichtig tastete Stellach die ungefüge Treppenleiter hinauf und tappte in eine stockdunkle Kammer, deren Türe ihm Helena öffnete. Sie zündete eine Kerze an, schlug die bunte Ziegenhaardecke des Bettes auf und lief geschäftig hinaus. Stellach sah sich um. Die Fensterläden waren fest geschlossen. Nur eines der Fenster besaß noch Glasscheiben. Seufzend klopfte Stellach an den nackten Holzladen, knurrend zog er eine Schachtel mit zerweichten Zigaretten aus der Rocktasche und richtete vorwurfsvoll und ernstlich die Frage an Gott, was denn jetzt eigentlich werden solle. Helena schien es zu wissen - eben kam sie lachend mit einem schneeweißen weichen Wollmantel herein, legte ihn über den Strohstuhl, stellte ein paar rotlederne, mit dicken Quasten verzierte Griechenschuhe auf den Boden, machte dem fremden Mann, den sie ihrer Sprache nicht mächtig glaubte, mit Hand- und Armbewegungen vor, daß er rasch die griechischen Kleider anziehen solle, und verschwand.
Stellach strich mit der Hand über die weiße Wolle: „Trocken“, murmelte er, „trocken und warm.“ In ihm dämmerte eine Möglichkeit auf, vielleicht doch nicht hungrig und nackt unter die kratzige Ziegenhaardecke kriechen zu müssen, bis seine Kleider getrocknet wären. Vorsichtig schälte er sich den Rock ab, dann die Weste, den Kragen - ein Stück Europa nach dem anderen legte er ab und stand schließlich so antik im Kerzenlichte der Kammer, daß er plötzlich mit Schrecken die halb offen gebliebene Kammertür wahrnahm. Eilends faßte der nackte Gelehrte die Klinke, zog, zog abermals - die Tür wollte nicht. Sie klemmte, wie auch Stellach zerrte. Nun, er war lange genug im Südosten und im Orient gereist, um zu wissen, daß der Mensch zu solchen Türen geduldig „Inschallah“ sagt und ihnen den Willen läßt. Stellach legte den weiten Mantel um, zog die schönen roten Schnabelschuhe an, warf sein nasses Kleiderzeug über den Arm und stieg die Treppe am Haus hinunter, um das wärmende und nährende Herdfeuer aufzusuchen. Das Hochgefühl, dem Lurchdasein entronnen und ins Menschliche zurückgekehrt zu sein, gab ihm ein gut Teil seiner Geisteskräfte zurück. Griechisch von der Sohle, nicht bis zum Scheitel, aber doch bis zur Halsfalte seines Mantels, betrat der Vertreter der Altertumswissenschaft die Halle.
Helena stand über die Herdflamme gebeugt, drehte ein Huhn am Bratspieß und bestrich es mit Öl. „Nimm ihm die Kleider ab, Maritsa“, sagte sie und tauchte die Feder in den Ölkrug. „Häng sie über die Leine.“
Aber Maritsa war übermütig: „Nein, Helena! Nein! Er muß doch frieren ohne Kleider!“
„Die nassen Kleider mein ich“, lachte Helena.
Sieh da, sagte sich Stellach, die Mädchen denken, ich verstehe ihre Sprache nicht. Er beschloß, die ihm zugewiesene Rolle des Taubstummen bis auf weiteres beizubehalten, zog schweigend, ohne eine Miene zu verziehen, den Schemel zum Herd, raffte kunstvoll seinen Hirtenmantel und setzte sich. Der Duft des Brathuhns stieg ihm lieblich in die Nase. Er zeigte stumm auf den Braten, dann auf sich und blickte Helena fragend an. Sie nickte ihm lachend zu. Dabei fielen ihr ein paar lose Haarsträhnen ins Gesicht. Der Schein des Herdfeuers flackerte in ihren Augen. Stellach sah Helena an. Die Schönheit hatte er eigentlich nur in Stein und Erz entdecken gelernt, und wenn ihn einmal lebendige Schönheit anstrahlte, so war sie dem Gelehrten bis zu dieser Stunde doch nie mehr gewesen als die erfreuliche Bestätigung der alten Bildwerke durch vergängliches Fleisch und Bein. Ob nun das jähe Glücksgefühl des Geborgenseins bei solchem Unwetter und in diesem grausigen Winkel von Argos sein Herz auflockerte, ob ihm die flackernde Beleuchtung in der abenteuerlichen Umgebung die Augen öffnete - Helena schien ihm schöner zu sein als irgendeiner seiner alten Steine. Unverwandt starrte er das Mädchen mit dem gefährlichen Namen an: Stirn, Nase, der Schnitt ihrer Augen - herrlich! Nur an der rechten Seite des Kinns störte eine kleine Narbe die vollkommene Klarheit dieser lebenden Antike. Unbewußt bog er seinen Kopf etwas seitwärts, bis er die Narbe mit seinen verwöhnten Archäologenaugen nicht mehr sah. Er hielt auch die Hand fachmännisch probend ins Blickfeld, damit sich ihr Kopf rein von der Umgebung abhöbe - Stellach benahm sich in dieser Halle am Herd, als ob er in seinem Museum wäre. Was er vermißte, war nur ein Sockel unter diesem Bildwerk, ein Sockel mit Inschrift aus der besten Zeit. Was ihn störte, war das unnütz viele Gewand.
Maritsa hing eben die nasse Weste des Gelehrten auf die Leine und beobachtete ihn, wie er mit dem Kopf vogelartig hin und her ruckte und Helenas Gesicht studierte. „Warum lachst du denn, Maritsa?“ fragte Helena. „Merkst du nicht, wie er dich ansieht?“
Helena streifte den Fremden mit einem Blick.
„Du“, fing Maritsa wieder an und breitete sorgfältig Stellachs Hemd auf der Leine aus, „du - der liebt dich.“ „Schaf“, antwortete Helena, tauchte die Gänsefeder ein und bestrich das Huhn mit Öl.
Unerhört, dachte Stellach gekränkt, aber schwieg erwartungsvoll weiter.
„Möchtest du ihn heiraten?“
„Gott ist mit mir.“
Nein, sagte jetzt Stellach zu sich, ihre Schönheit kommt nur vom Licht: das Herdfeuer macht sie schön.
„Schade“, seufzte Maritsa.
„Was ist schade?“
„Daß er mich nicht ansieht. Ich würde ihn heiraten von der Stelle weg.“
Eine recht angenehme Erscheinung, dachte Stellach und lugte verstohlen zu Maritsa hin - wie’s scheint, etwas albanesischer Einschlag ... freilich - sein Blick hing wieder an Helena, die eben jetzt mit einem Palmblatt das Feuer anfachte, im aufglühenden Licht strahlte und lachte: „Schäme dich, Maritsa. Das werd’ ich dem Spiros sagen!“
„Läßt mich dein Bruder nicht auch sitzen?!“
Helena hörte auf zu fächeln und wandte sich um: „Aber Maritsa.“
„Hat er sich etwa nicht in eine andere verliebt?!“
Jetzt ließ Helena das Huhn braten, wie es wollte: „Was fällt dir ein! In eine andre?“
„In das grüne Weib! Oder ist er nicht bei der seit drei Tagen und Nächten!“
Unwillig drehte Helena den Bratspieß um: „Rede kein dummes Zeug!“ Sie warf ein paar Hände voll Holzkohlen in das Herdloch; der Schein verglomm, und halb für sich sagte sie: „Für Liebe ist die da drüben zu kalt.“ Stellach besah sich gedankenvoll das Huhn, welches, taubstumm wie er, eben auf dem Höhepunkt des Gebratenseins anlangte: Was schwatzen die Mädchen? Ein grünes Weib? Zu kalt für Liebe? Er nickte ... ich bin in der Argolis ... auf Gespenstererde ...