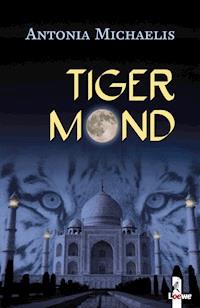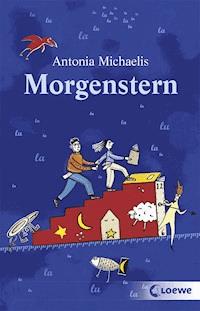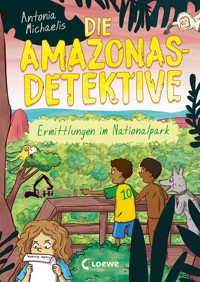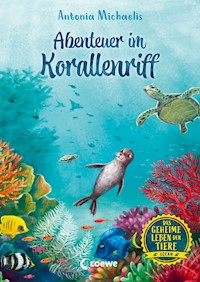9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Alles drin! Der Schmökertipp Schätze, Geheimnisse und große Dramatik Fast schon ist es zu spät, als José Jonathan aus den Wellen des Pazifiks rettet und auf sein Schiff, die "Mariposa", bringt. Obwohl Jonathans Vergangenheit im Dunkel liegt, freunden die beiden sich an und Jonathan begleitet José auf seiner Reise zur düsteren Isla Maldita. Dort hoffen sie herauszufinden, wohin die rätselhafte Karte weist, die José bei sich trägt. Doch auch die Männer, die die beiden erbarmungslos über das Meer verfolgen, haben es auf die Karte abgesehen. Welcher Schatz ist auf der Insel verborgen? Und welches Geheimnis verbirgt Jonathan? Ein pralles Abenteuer - spannend und voller Action, inmitten von Stürmen, Wellen, Vulkanen und der faszinierenden Tierwelt Südamerikas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Liebe Tanja,
die Leute in diesem Buch fallen des Öfteren ins Wasser.
Ungefähr so falle ich jede Woche aus irgendeiner Geschichte in die Montessori-Dramagruppe. Immer zu spät und immer ohne Textheft. Du hast noch nie geschimpft, und deshalb ist dieses Buch Dir gewidmet: etwas Pazifiksonne zum Entspannen nach dem Probenstress. Keine Angst. Wir machen kein Stück daraus.
Vorweg
Dieses Buch spielt im Zweiten Weltkrieg, aber es ist kein Buch über den Zweiten Weltkrieg. Bücher über den Zweiten Weltkrieg gibt es viele.
Weil dies kein Buch über den Zweiten Weltkrieg ist, enthält es keine Erklärungen, warum es einen solchen Krieg gab und warum es ihn nie wieder geben darf. Solche Erklärungen gibt es viele.
Wenn Ihr etwas darüber wissen wollt, lest in den anderen Büchern nach. Im Internet. Fragt Eure Eltern. Oder Eure Lehrer. Lehrer gibt es viele …
Dieses Buch spielt im Zweiten Weltkrieg, aber es ist kein Buch über den Zweiten Weltkrieg.
Es ist ein Buch über zwei Menschen, die einen Weg finden, den sie nicht gesucht haben.
Ein Buch über den Tod und das Leben. Über Lüge und Wahrheit. Über Träume und Wirklichkeit. Über Verzweiflung und Hoffnung.
Über Feuernächte und blaue Schmetterlinge.
Und über den Flug des Albatros.
Primavera 1945
Frühjahr 1945
Er wusste genau, wie er das Schiff um die unsichtbaren Klippen herumsteuern musste, die vor der Insel lagen. Er wusste es besser, als die Piraten es gewusst hatten, Jahrhunderte zuvor. Er würde es nie vergessen.
Er wusste, wo er den Anker auswerfen musste und wo der Weg begann, der den Berg hinaufführte. Sein Vater sah zu, wie er die Spannung der Ankertrosse prüfte. In seinem Blick lag Stolz. »Dieses Schiff«, sagte er. »Es gehorcht dir wie ein Hund.«
»Nicht wie ein Hund«, sagte José. »Es hat seinen eigenen Willen. Wir verstehen uns.«
Sie wateten schweigend zum Ufer. Eine Gruppe von Seelöwen lag im warmen Sand und beobachtete die Neuankömmlinge aus trägen Sonnenaugen. Dann, ganz plötzlich, rollte eines der Tiere herum und robbte auf José zu.
»Chispa?«, fragte er verwundert. »Bist du das?«
Die Seelöwin rieb ihren Kopf an seinem Knie. Natürlich bin ich es, antwortete sie stumm.
José schloss für einen Moment die Augen und tausend Bilder schossen durch seinen Kopf. Bilder aus einer Geschichte, die drei Jahre zurücklag.
Er sah spritzende weiße Gischt und stiebende rote Funken. Die Muster der grünen Wasserschildkröten. Den Tanz der Delfine. Eine Tür, die unter der gleißenden Sonne auf dem Pazifik schwamm, mit zwei leblosen Gestalten darauf. Er spürte scharfe dünne Schnur, die seine Handgelenke fesselte. Er hörte das Heulen des Sturms in der Takelage, das Bersten von Holz. Er hörte Schüsse. Er hörte Worte. Wir trennen uns nicht für ewig. Und er hörte, wie jemand seinen Namen sagte. Er öffnete die Augen.
»José? Träumst du?«, fragte sein Vater.
José schüttelte den Kopf. »Nein. Ich erinnere mich.«
Er fuhr der Seelöwin noch einmal übers Fell, stand auf und hob die linke Hand vor die Augen, um den Weg hinaufzusehen, an dem die verblichenen Panzer der toten Schildkröten lagen. Er war Rechtshänder, aber er konnte den rechten Arm seit damals nicht so benutzen wie den linken. Die Schulter würde für immer steif bleiben. Es machte nichts. Er lebte.
»Geh langsam«, bat er seinen Vater. »Ich möchte vor dir da sein. Ein wenig nur.«
Señor Fernandez nickte. »Ich werde langsam gehen. Erzählst du es ihnen?«
»Ja. Es wird nicht einfach. Aber ich erzähle es ihnen.«
»Gut«, sagte Señor Fernandez. »Viel Glück.«
Lied der Fregattvögel
Seht nur! Seht nur! Wie schön wir sind!
Schön wie der Morgen, der bald beginnt,
stolzgeschwellt unsre roten Kehlen,
rot wie die Sonne, rot wie Juwelen.
Seht nur! Seht nur! Wie frei wir sind!
Frei wie die Luft, frei wie der Wind.
Wir steigen so hoch wie der Regenbogen
und stürzen pfeilgerade hinab in die Wogen.
Seht nur! Seht nur! Wie schnell wir sind!
Schneller, als ein Gedanke zerrinnt.
Rot-schwarze Blitze über dem Meer.
Seht nur! Seht nur! Seht her!
Ihr Menschen, die ihr so träge und schwer,
ihr sucht nach der Freiheit, ihr sucht nach dem Licht,
ihr denkt, eure Schiffe beherrschen das Meer.
Ihr glaubt euch so mächtig und seid es doch nicht.
Una noche en el mare pacifico
Eine Nacht auf dem Pazifik
Der Pazifik lag schwer und schwarz in der Nacht wie ein Stein. Ein dunkler Stein aus erkalteter Lava.
Es war kaum auszumachen, wo das Wasser endete und wo der Himmel begann. Alles, was es gab, war Schwärze. Sternenlose Schwärze. Und irgendwo in dieser Schwärze war ein Schiff unterwegs: die Isabelita. Sie hieß nach der Insel, von der sie jetzt kam, Isabela, der größten der Galapagosinseln.
Die Positionslichter des Schiffs waren das Einzige, was man in der Dunkelheit sah: ein schwaches grünes Leuchten rechts, an Steuerbord, ein rotes Glühen an Backbord, eine weiße Lampe am Bug. So glitt die Isabelita durch die Nacht, lautlos, unter Segel, denn Treibstoff gehörte zu den Dingen, die in der letzten Zeit gespart werden mussten. Die Nacht um das Schiff herum war eine Mainacht im Jahr 1942. Für die Galapagosinseln bedeutete dies das Ende der Regenzeit. Für die Weltgeschichte bedeutete es etwas anderes: Weit, weit fort, in Europa, tobte ein Krieg. Aber er dehnte und reckte sich schon, wuchs und gedieh und streckte seine Krallen bis in die pazifische Nacht.
Wäre jemand an Deck gewesen und hätte dieser Jemand eine Lampe gehabt, so hätte er gesehen, wie eine kleine Gestalt den Steuerbordaufgang hinaufkletterte. Im Licht der Lampe wäre ein Kopf mit struppigem, kurzem blondem Haar in der Luke aufgetaucht … zwei magere Hände, die sich am Geländer festklammerten … eine abgetragene Jacke und eine graue Hose … bloße Füße. Schließlich wäre das Licht an der Gestalt hinaufgewandert und hätte in ein blasses Gesicht geschienen: ein Gesicht mit einer Narbe an der Stirn. Ein Gesicht, das auf den ersten Blick wirkte, als besäße es weder Augenlider noch Brauen, so hellblond waren sie. Ein Gesicht mit fest geschlossenen Augen.
Die Gestalt, der das Gesicht gehörte, schlief. Sie war im Schlaf die steile Treppe hinaufgeklettert und nun ging sie im Schlaf über das taufeuchte Deck.
Oh, wäre jemand an Deck gewesen und hätte dieser Jemand eine Lampe gehabt, so hätte er sich sicherlich gewundert. Doch es war niemand da, und so sah niemand, wie die Gestalt das Vorderdeck überquerte – oder sollten wir sagen: der Junge? Nennen wir den Jungen Jonathan, denn Jonathan war der Name auf dem Pass in seiner Tasche. Jonathan Christopher Smith, geboren am 12.2.1929 in London.
Natürlich stimmte das nicht unbedingt.
Jetzt begann er zu rennen, panisch, im Zickzack, hierhin und dorthin – wie ein Kaninchen auf der Flucht. Seine Angst füllte die Nacht auf dem Vorderdeck der Isabelita ganz aus und machte sie noch schwärzer, als sie ohnehin schon war.
Aber Jonathan befand sich nicht auf dem Vorderdeck der Isabelita. Er träumte. Und im Traum glitt er zurück, Tage, Wochen, Monate – im Traum befand er sich wieder in Deutschland.
Er stand auf einer Treppe, den Griff eines Koffers in der Hand. Draußen jaulten Sirenen, ihr Ton schwoll an und wieder ab, an und wieder ab, wie das Schmerzgeheul eines riesigen verletzten Tieres.
Das riesige Tier war die Stadt Hamburg und das Heulen der Sirenen bedeutete Fliegeralarm. Irgendwo dort draußen glitten die Flugzeuge durch die Nacht. Sie sahen die Lichter der Stadt nicht. Die Stadt lag im Dunkeln. Aber die Flieger wussten, wo sie zu suchen hatten …
Unten auf der Treppe drängten sich Schemen von Menschen aneinander vorbei. Er konnte ihre Angst riechen. Hektische Stimmen füllten den Hausflur. Er umklammerte den Koffer fester. Er wollte nicht mit ihnen rennen, wollte nicht Teil ihrer Hektik werden.
Mama wartete unten. »Wo bleibst du?«, rief sie. »Komm! Beeil dich!«
Und dann rannte er doch. Er hetzte die dunklen Stufen hinunter, stolperte und fing sich wieder und schließlich stand er draußen auf der Straße. Hinter ihm lag der Eingang zum Haus Nummer 19. Die Straße war nicht so dunkel, wie er gedacht hatte. Der Mond schien. Der Mond wusste nichts von Verdunkelungen. Dummer, einfältiger Mond.
Er beschien den alten Herrn Meier aus dem zweiten Stock mit seiner zu schweren Stofftasche. Er beschien die junge Frau Edler aus dem Erdgeschoss, die zwei kleine Kinder mit sich zog. Er beschien Frau Adam, die eine Stehlampe trug. Wozu eine Stehlampe?
Der Mond wusste es nicht. Er beschien auch Jonathans Schwester Julia, die ihren Teddybären an sich drückte, den mit der roten Schleife am Hals. Und er beschien Mamas Gesicht. Im Mondschein sah Jonathan sie lächeln. Sie war stehen geblieben, als wäre plötzlich nichts mehr eilig. Er würde nie vergessen, wie sie da im Mondschein auf der Straße stand, lächelnd. Sie trug die alte karierte Schiebermütze seines Vaters auf ihrem hellen Haar, eines der wenigen Dinge, die er hinterlassen hatte. Die Mütze ließ sie wie ein Straßenjunge wirken, unpassend frech und fröhlich für die Nacht.
Sie streckte eine Hand aus und zerzauste Jonathans Haar. Irgendwo hinter ihr in der Nacht blühte das Geißblatt am Haus, schwer und süß.
»Komm!«, sagte Mama noch einmal. »Es wird Zeit.« Dann nahm sie die kleine Julia an der Hand. »Halt deinen Bären gut fest«, sagte sie, »denn jetzt laufen wir.«
In diesem Moment hörte Jonathan die Flugzeuge. Er hob den Kopf. Sie waren ganz nah, so nah, wie er sie noch nie gesehen hatte – und die Nacht zerbarst mit einem lauten Krachen. Er sah ihre Scherben nach allen Seiten davonspritzen, tödlich rot. Sie hatten ein Haus in der Nähe getroffen. Er rannte jetzt wieder. Rannte vorwärts, den anderen nach. Das Haus Nummer 19 besaß keinen eigenen Luftschutzkeller, sie waren dem Keller von Nummer 21 zugeteilt worden. Nur ein paar Schritte, – das Heulen der Sirenen vermischte sich mit einem weiteren Krachen, irgendwo prasselten Flammen, mehr und mehr Flammen. Es – es war, als bewegten sich seine Beine in Zeitlupe. Er stolperte Stufen hinunter … und hämmerte gegen eine Tür. Jemand öffnete sie, zerrte ihn in den Keller und warf die Tür wieder zu. Das Heulen der Sirenen blieb hinter ihm zurück. Das schwache Licht einer Kerze machte die kauernden Menschen zu unwirklichen, klobigen Schatten, sie verschmolzen mit ihren Klappstühlen und ihren Koffern zu großen, hässlichen Klumpen aus Angst. Jonathan merkte, dass jemand ihn am Kragen gepackt hielt: Richard. Richard hatte ihn auch eingelassen. Er war schon siebzehn, fünf Jahre älter als Jonathan. Irgendwie hatte er es trotz der Eile geschafft, seine Uniform anzuziehen. Seit Richard Blockwart von Nummer 21 war und eine Uniform besaß, war er zehn Zentimeter größer. Vielleicht schlief er auch in der Uniform. Jetzt holte Richard mit der freien Hand aus und schlug Jonathan ins Gesicht.
»Was hast du dir gedacht, so lange da draußen herumzutrödeln?«, keuchte er. »Ich habe die Verantwortung für den Keller. Eigentlich hätte ich dich gar nicht mehr hereinlassen dürfen.«
Er legte den Riegel vor die Tür und stellte sich davor, breitbeinig, uniformiert.
Jonathan sah sich um. Er spürte den Schmerz in seinem Gesicht nicht. Er hatte keine Zeit für den Schmerz. Er hatte keine Zeit für Richards Uniform.
Wo waren Mama und Julia?
Richards Worte klangen in Jonathans Ohren nach: »… dich nicht mehr hereinlassen dürfen.« Dich, nicht euch. Sie waren noch draußen, da draußen im Chaos. Sie und Julia und der Teddybär mit der roten Halsschleife.
Jonathan machte einen Satz nach vorn, um Richard beiseitezuschieben und die Tür noch einmal zu entriegeln. Da lief ein Zittern durch den Betonboden. Irgendwo war ein weiteres Haus getroffen worden, ganz nah. Feiner Staub rieselte von der Decke wie Schnee. Einen Moment später bebte der Boden so stark, dass Jonathan das Gleichgewicht verlor. Als er aufstehen wollte, spürte er eine Hand im Nacken, die ihn zu Boden drückte.
»Bleib, wo du bist!«, befahl Richard. Seine Stimme war scharf und schneidend wie zerbrochenes Glas. Wie eine zerbrochene Nacht. »Lass die Finger von der Tür! Hörst du denn nicht, was da draußen los ist? Willst du uns alle umbringen?«
»Aber … meine Mutter!«, keuchte Jonathan. »Und … Julia ist …«
»Wenn sie jetzt noch da draußen sind, kann man ihnen nicht mehr helfen«, sagte Richard kalt.
Jonathan versuchte sich loszureißen, doch Richard war stärker als er. Sie rangen eine Weile auf dem Boden miteinander, stumm, schwer atmend, und endlich schaffte Jonathan es, aus Richards Griff zu schlüpfen. Er rappelte sich auf und streckte den Arm nach dem Türgriff – da sah er aus dem Augenwinkel, dass Frau Adam aufgestanden war. Sie hatte sich oft im Treppenhaus mit Mama unterhalten. Sie würde ihm helfen. Sie hielt etwas in den Händen … und dann traf ihn der Fuß einer Stehlampe hart am Kopf.
Nein, es war nicht der Fuß einer Stehlampe. Es war Wasser. Kaltes, salziges Wasser, das in seinen Mund drang. Er erwachte mit einem Ruck aus seinem Traum, kämpfte sich an die Oberfläche und schnappte nach Luft. Um ihn lag die schwarze Nacht des Pazifiks. Dann rollte die Wolkendecke am Himmel zurück und entblößte eine Kuppel, voll von Millionen glitzernder Juwelen: Sternbilder auf ihrem Weg über den Himmel. Und Jonathan begriff: Er war im Traum über die Reling geklettert, ohne es zu merken.
Die Reling der Isabelita.
Der dunkle Umriss des Schiffs begann bereits, sich zu entfernen.
»Schwimmen. Du musst schwimmen.«
Wer hatte da geflüstert? Das Flüstern war ganz nah gewesen. Es flüsterte jetzt einen Namen. Einen falschen Namen. Einen Namen, den er in Deutschland zurückgelassen hatte. Und plötzlich wusste er, wem die Stimme gehörte. Es war seine eigene. Er gehorchte. Er schwamm.
Er schwamm der Isabelita nach, hinein in die pazifische Nacht, über sich nur die funkelnden Sternbilder, unerreichbar weit weg. So unerreichbar wie Deutschland.
»Deutschland«, sagte er, nur um noch einmal seine eigene Stimme zu hören. Sie war ihm fremd geworden. Er hatte sie lange nicht gebraucht. Seit jener Nacht, in der ihn Frau Adam mit einer Stehlampe bewusstlos geschlagen hatte, um ihn zu retten.
Damals war etwas geschehen, etwas Seltsames: Er war verschwunden. Nur eine leere, tote Hülle war zurückgeblieben, eine Hülle, die sich gehorsam bewegt hatte wie eine Puppe. Und jetzt, hier, im kalten Wasser, war diese Hülle zerbrochen.
Die Zeit war an ihm vorbeigeglitten. Welcher Monat war dies? Welche Jahreszeit? Sie waren eine Ewigkeit unterwegs gewesen, er und Thomas Waterweg. Er erinnerte sich fast nicht an die Reise. Nur daran, dass er Spanisch gelernt hatte auf dem Schiff. Allein durch das Zuhören. Das war nicht auf der Isabelita gewesen, sondern auf dem größeren Schiff, vorher – dem, das sie in einer wochenlangen Reise über den Atlantik gebracht hatte.
Er begann zu frieren. Irgendwo, viele Meilen unter ihm, lag der Meeresgrund. Er hatte keine Chance. Plötzlich musste er lachen. »Wie sehr sich Waterweg wundern wird!«, flüsterte er.
Er weigerte sich, Waterwegs Vornamen auszusprechen. Ein Vorname setzt ein gewisses Maß an Intimität voraus, ein gewisses Maß an Sympathie. Er hegte keine Sympathie für Waterweg, Verwandtschaft hin oder her.
»Ja, wie er sich wundern wird!«, fuhr Jonathan fort. »Der ganze Aufwand umsonst! Die Reise, die Pässe, die Namen – alles umsonst! Er hat nur einen Teddybären mit einer roten Schleife aus Hamburg gerettet. Die andere Person, die er retten wollte, ist ihm auf dem letzten Stück des Weges verloren gegangen. Sie wird irgendwo zwischen Isabela und Baltra ertrinken, egal unter welchem Namen.«
Er schloss die Augen. Eigentlich war alles gut, wie es war. Mit eisigen Fingern griff er in seine Hosentasche und zog die Mütze hervor, die alte Schiebermütze seines Vaters. Er hielt sie ganz fest.
»Ich komme«, flüsterte er. »Wartet nur noch ein Weilchen, dann bin ich da.«
Er hatte nie an viel geglaubt. Seine Eltern waren keine Kirchgänger gewesen. Doch jetzt strengte er sich an zu glauben, er glaubte so fest, dass es wehtat: Er würde sie wiedersehen. Sie alle. Sie waren irgendwo, nur noch getrennt von ihm durch eine papierdünne Wand aus wenigen Minuten, wenigen Grad Celsius. »Ich bringe die Mütze mit«, flüsterte er. »Papa, deine alte! Und das Geißblatt wird blühen, wie damals in Hamburg. Nur schade, Mama, dass du jetzt die Inseln nie zu sehen bekommst, von denen du immer geträumt hast. Ich weiß noch, wie du uns von ihnen vorgelesen hast, von den Seelöwen und den Leguanen, die so zahm sind, dass man sie streicheln kann … Ich weiß noch … jedes Wort …«
Dann zog das Meer ihn hinab.
Ein Kind? Er war kein Kind.
Wie konnten sie so etwas sagen? Er war dreizehn. Fast vierzehn. Und er konnte mit seinem Mausergewehr umgehen, seit er zehn war. Wenn seine Brüder alt genug waren, Sandro und Felipe, dann war er es auch. »In Europa ist Krieg«, sagte José ernst. »Im Krieg kann man es sich nicht leisten, in meinem Alter ein Kind zu sein.«
Sein Vater lachte und Sandro und Felipe stimmten mit ein. Es war ein gemütliches, dröhnendes Lachen, das sie lachten, aber in diesem Moment hasste José sie dafür.
»Seht ihn euch an, meinen erwachsenen Sohn!«, rief Josés Vater. »Seht ihn euch nur gut an! Läuft von der Farm zu Hause weg und lässt sich vom alten Silvio auf seiner Jacht mitnehmen, um ein Held zu werden!«
»Und in Europa ist Krieg, sagt er«, meinte Sandro. »Unser weiser kleiner José.«
Ehe José sich wehren konnte, hatte Felipe ihn hochgehoben. Felipe war stark wie zwei Pferde. Er schob ein paar Bierdosen beiseite, grinste den beiden Amerikanern am Tisch zu und stellte José mitten auf den Tisch.
»Schau dich nur gut um, tapferer kleiner Bruder«, sagte er mit einem breiten Lächeln. »Schau ihn dir an, den Krieg!«
Die Welt, in die José von dem Tisch aus hineinsah, war blau. Blau lag der Pazifik da, blau wölbte sich der Himmel darüber, und in weiter Ferne lagen als blaue Umrisse andere Inseln – die größte davon Isabela. Irgendwo dort stand seine Mutter, vermutlich an einem blau gestrichenen Zaun, und machte sich Sorgen um ihren jüngsten Sohn. Nur der Hafen von Baltra, keinen Gewehrschuss weit von dem Tisch entfernt, war nicht blau. Im Hafen legte eben ein graues Schiff der amerikanischen Marine ab, um eine Spur ins Meeresblau zu malen. José drehte sich um. Hinter ihm begann der neue Flugplatz der Amerikaner zu wachsen. Daneben lagen die Baracken der Arbeiter. Auch sie waren grau.
Ein Schwarm schwarzer, rotbrüstiger Fregattvögel schoss durch den Himmel, schlug ins Meer ein wie Granaten und tauchte sofort wieder auf, synchron, in einem perfekten Luft-und-Wasser-Ballett. Einige von ihnen trugen jetzt silbrige Fische im Schnabel. Von irgendwoher drang Musik aus einem amerikanischen Transistorradio durch den warmen Nachmittag.
»Ich sehe den Krieg«, sagte José. »Baltra wäre leer ohne den Krieg. Nichts und niemand wäre hier außer den Leguanen und den Fregattvögeln und ein paar einsamen Büschen. Seid ihr so blind?«
Er kletterte vom Tisch, setzte sich auf einen freien Klappstuhl und verschränkte die Arme.
»Nein, das hier nicht der Krieg«, sagte einer der Amerikaner. Sein Spanisch war holprig, aber er gab sich Mühe. »Wir bauen Flugplatz to control Panamakanal, du weißt. Nicht, weil hier ist Krieg. Hier ihr habt noch peace und paradise.«
»Du weißt«, sagte der andere. »Wir sind hier for control, dass keine deutschen U-Boote kommen durch den Kanal, zu angreifen Amerika von diese Seite. Und auch Japaner, die mit den Deutschen Freunde sind. Ohne Kanal the way is zu weit, der Weg, außen herum um Kontinent, you see, Kanal ist wichtig for Abkürzung, schnell hier die U-Boote, schnell angreifen, schnell Katastrophe.«
»Aber hier«, sagte der Erste wieder, hier is nicht Krieg. Das Meer so blue, Himmel ganz hoch, und die Vögel, tausend bunte Vögel, alle frei, schau, dort!«
Einer der Fregattvögel war in der Nähe gelandet und füllte seinen signalroten Kehlsack mit Luft, bis er einer roten Boje glich, einem Ballon aus lauter Stolz. Dann warf er den Kopf zurück, um ein lautes Klappern aus seiner Kehle zu holen. Er versuchte einem Weibchen zu imponieren. Aber es war kein Weibchen in der Nähe. José sah zu, wie der Vogel seinen Kehlsack wieder schrumpfen ließ und in die Luft hinaufschoss, davon, davon.
»Ja«, sagte er, »die Vögel sind frei.« Er sprach jetzt englisch. Sie sollten nicht denken, er könnte ihre Sprache nicht. »Aber wir, wir sind gefesselt an unsere Inseln. Nehmen Sie mich mit! Wenigstens ein einziges Mal. Auf einen einzigen Flug!«
»No«, sagte der andere Amerikaner. »Wir fliegen nicht for fun, nicht für Spaß. Wir fliegen für control, zu sehen, ob U-Boote in der Nähe von Kanal.«
Josés Vater legte seine große, grobe Hand auf Josés schmale, schlanke Hand. »Mein jüngster Sohn bleibt schön auf der Erde«, sagte er. »Morgen früh fährst du mit Silvio zurück nach Isabela. Er hat mir versprochen, dich mit zurückzunehmen, nach Hause. Ich bin mir sicher, Mama Carmelita ist krank vor Sorge.«
»Sie braucht Hilfe auf den Feldern, unsere Mutter«, sagte Sandro. »Sie braucht einen Mann auf der Farm.«
»Ach was«, sagte José. »Und warum geht ihr nicht zurück?«
»Wir verdienen eine Menge Geld hier, Kleiner«, meinte Felipe. »Am Ende wird es genug sein für ein Fischerboot.«
José hob eine Bierdose hoch und schüttelte sie. Sie war leer. »So«, sagte er. »So, so. Auf diese Weise verdient ihr das Geld für ein Fischerboot. Vergesst es. Ich geh nicht zurück.«
»Oh, hört auf zu streiten«, sagte ihr Vater. »Wenn ich dir sage, du gehst zurück, José, dann gehst du zurück, so einfach ist das.«
Aber so einfach war es nicht. José stand auf.
Irgendwo da draußen kämpften Männer für die Freiheit, Seite an Seite. Irgendwo da draußen gab es Helden. Helden, die ihre Maschinen hoch in den Himmel lenkten, die mit den Fregattvögeln um die Wette flogen, höher und höher hinauf ins trügerisch friedliche Blau … nicht nur solche, die eine Schiffspassage kontrollierten. Solche, die weiter flogen. Die Leben retteten, die für Gerechtigkeit starben. Die gegen die Deutschen kämpften, die den Krieg angefangen hatten und ein Weltreich errichten wollten, die wahnsinnigen Deutschen.
»Wartet nur«, sagte er leise. »Irgendwie komme ich in die Luft. Irgendwann werde ich selbst fliegen. Vielleicht bis nach Europa. Ich kann schießen. Ich habe keine Angst. Ich knalle sie alle ab, die deutschen Mörder. Und wenn ich zurückkomme, sprechen wir uns wieder.«
Dann ließ er sie sitzen, an ihrem Tisch, mit ihrem Bier, und lief davon.
Der Hafen kam ihm still vor und beinahe verlassen, verglichen mit der Barackensiedlung der Amerikaner. Im niedrigen Gestrüpp hinter dem neuen Kai summte nur die Hitze. José sah sich um. Es war nicht nur still hier. Es war zu still. Keine Leguane lagen in der Sonne, keine Schildkröten waren zwischen den Sträuchern unterwegs. Nur die Fregattvögel hoch in der Luft hielten die Stellung. Früher, dachte José, musste es hier Tiere gegeben haben, so wie auf den anderen Inseln. Früher, als noch niemand einen Flugplatz baute. Vor dem Krieg.
Auch die Albatros, Silvios Jacht, die José hierher mitgenommen hatte, lag stumm am Kai. Der alte Silvio war irgendwo in der Barackensiedlung der Arbeiter, auf Besuch bei Bekannten. Einer wie er konnte es sich leisten, nach Baltra zu segeln, um jemanden zu besuchen. Er hatte zu viel Land und zu viel Geld, der alte Silvio, aber er war in Ordnung. Er hatte José verstanden.
Die warme Luft der Inseln war voll von Nervosität. Manche von den deutschen Siedlern auf den Inseln waren bereits ausgewiesen worden: plötzlich zu Feinden geworden, als die Amerikaner in den Krieg eingetreten waren. Denn Ecuador und die Inseln standen aufseiten der Amerikaner, natürlich. Manche andere, Engländer, Franzosen, Amerikaner, hatten von zu Hause den Befehl erhalten, zurückzukehren und Teil des Krieges zu werden. Der Rest wartete: auf die Nacht, auf den nächsten, den übernächsten Tag – im Herzen keine Ruhe, auf den Lippen schon Abschiedsworte.
Und José wartete mit ihnen. Darauf, dass etwas geschah. In den Nächten träumte er, und im Traum segelte er ganz allein nach Europa, um zu kämpfen wie ein Mann. Gegen die Deutschen und für die Freiheit. Ein Schiff, dachte er, müsste man besitzen – eines wie diese kleine honiggelbe Jacht, die am Anleger lag. Ihr lackiertes Holz glänzte in der Sonne wie der dunkle, flüssige Honig aus frischen Bienenwaben.
»José?«
Er fuhr herum. Hinter ihm stand sein Vater. »Mein Junge«, sagte er. »Ich habe dich gesucht. Sage mir, siehst du den blauen Schatten dort hinten, fast hinter dem Horizont? Ein Stück rechts von Santiago?«
Natürlich sah José den blauen Schatten. Die Isla Maldita. Die verfluchte Insel. Ein Ort der Vergangenheit, der nichts mit dem Krieg zu tun hatte, der José rief.
»Vielleicht ist diese Insel schuld daran, dass ich keine Helden in meiner Familie haben will«, sagte Josés Vater. »Dein Urgroßvater, weißt du, mein Großvater – er wollte ein Held sein wie du. Es gab keinen Krieg, in dem er kämpfen konnte. Keinen Feind. Da hat er gegen den größten Feind gekämpft, den der Mensch besitzt: das Meer. Er … ist zur Isla Maldita gesegelt. Ganz allein, in seinem winzigen Boot. Es gab schon immer eine Menge Geschichten über die Insel. Jeder, der daran vorübersegelte, brachte neue Geschichten mit. Manche wollten die Schreie von Menschen gehört haben, andere berichteten von Feuerschein. Früher haben Piraten dort gehaust, so viel ist sicher.«
»Früher haben überall Piraten gehaust«, sagte José. »Auf allen Inseln. Und?«
»Mein Großvater erklärte mir, er käme bald zurück und er würde Schätze mitbringen, gleißende, glitzernde Diamanten, groß wie Melonen. Irgendwie war er an eine alte Karte der Insel gekommen, und er war überzeugt, sie stammte aus der Zeit der Piraten und darauf wäre ein Schatz eingezeichnet. Ein altes Versteck, das niemand je gefunden hatte, weil niemand je gewagt hatte zu suchen. Ich lauschte ihm mit großen Augen. Ich war gerade sieben Jahre alt. Ich liebte meinen Großvater sehr. Doch die Augen meiner Mutter und meiner Großmutter waren rot geweint, als er ging. Er ist trotzdem gegangen.«
José versuchte sich seine Urgroßmutter als junge Frau mit rot geweinten Augen vorzustellen, aber das war schwierig. Für ihn war sie immer die Abuelita gewesen, das Großmütterchen, immer alt: voller Falten, voller Geschichten. Nur von der Reise ihres Mannes, des Abuelitos, hatte sie nie erzählt.
»Er ist … nicht zurückgekommen«, sagte José.
Sein Vater schüttelte den Kopf. »Nein. Er ist nicht zurückgekommen. Alles, was ich von meinem Großvater habe, ist eine Kopie der Karte. Ich habe sie als kleiner Junge abgezeichnet, ehe er fortging. Ich trage sie bei mir wie einen Talisman. Ein dummes Stück Papier. Verstehst du jetzt? Verstehst du, dass ich nicht will, dass du ein Held wirst? Helden sterben alle jung.«
Er griff in die Tasche seiner Arbeitsjacke und zog ein zusammengefaltetes Stück Papier heraus, das er José hinhielt. »Die Karte«, sagte er. »Mein Talisman. Nimm sie mit, wenn du morgen mit Silvio nach Isabela zurückfährst.«
José nahm das Stück Papier. Es fühlte sich alt und brüchig an in seinen Händen. »Warum?«
»Damit du daran denkst, dass manche Helden nicht zurückkommen. Warte noch ein Weilchen damit, ein Held zu werden. Versprich es mir.«
»Ich verspreche es«, sagte José und steckte das Stück Papier ein, ohne es anzusehen. Ohne seinen Vater anzusehen. Er wusste, dass er seinen Vater belog.
»Wem gehört die gelbe Jacht dort am Kai?«, fragte er, um das Thema zu wechseln.
Sein Vater seufzte. »Die Mariposa«, sagte er, und jetzt sah José den dunklen Schriftzug am Heck. »Einem Toten.«
José schüttelte unwillig den Kopf. »Einem Toten?«
»Ja. Doktor Juan Casaflora. Einer von den Weltenbummlern hier. Vor ein paar Tagen ist er losgesegelt nach Isabela, aber er ist wohl nicht weit gekommen. Das Fieber hatte seinen Geist schon verwirrt, als er losfuhr. Eine holländische Jacht hat die Mariposa auf ihrem Weg hierher aufgesammelt und ins Schlepptau genommen. Sie trieb ziellos auf dem Wasser. Der alte Juan war wohl schon tot, als sie ihn fanden. Die Holländer haben erzählt, sie hätten ihn auf See bestattet.« Er seufzte. »Du wirst hier wenige finden, die um Juan Casaflora trauern. Er war … eigen. Angeblich war er Forscher. Man hört, er wollte herausfinden, was für einen Einfluss der Flugplatz und die Menschen auf die Gewohnheiten der Tiere haben, die Leguane, die Vögel, die Schildkröten …«
»Sie verlassen die Insel«, sagte José. »Um das herauszufinden, braucht man kein Forscher zu sein.«
Sein Vater nickte. »Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Ich nehme an, jemand wird das Schiff nach Isabela zurücksegeln. Dort gibt es mehr Leute, die eine Jacht gebrauchen können. Allerdings weiß ich nicht, wer ein Schiff kaufen will, auf dem jemand gestorben ist.« Er sah sich um. »Komm, es wird dämmrig. Gehen wir zurück.«
José schüttelte den Kopf. »Lass mich noch ein Weilchen hierbleiben und nachdenken«, bat er. »Ich finde schon zurück.«
»Ja«, sagte sein Vater ernst, »du findest schon zurück.«
Später, viel später, würde José oft an diese Worte denken.
Es war fast dunkel, als der Amerikaner zum Hafen hinunterkam, einer von denen, die heute mit Josés Vater und seinen Brüdern am Tisch gesessen hatten. José erkannte ihn an seinem Gang, er war jung, groß und schlaksig, beinahe selbst noch ein Junge. Aber er war alt genug, um zu fliegen.
»Hey«, sagte der Amerikaner.
»Hey«, sagte José.
»Ben«, sagte der Amerikaner. »Ben Miller.«
»José«, sagte José. Es war gut, sich vorzustellen. Es machte ihr Gespräch zu einem Gespräch unter Männern. Vielleicht konnte er mit Ben reden. Vielleicht würde Ben ihn verstehen. »Übrigens bin ich siebzehn«, sagte er aus dem Blauen heraus. »Nur, falls mein Vater herumerzählt hat, ich wäre jünger. Er lügt gewöhnlich, weil er Angst um mich hat.«
»Siebzehn?« Ben lachte. »Und ich bin die Königin von England.«
»Im Ernst«, beteuerte José. »Ich werde achtzehn.«
»Alle Menschen werden einmal achtzehn«, sagte Ben und steckte sich eine Zigarette an. »Fragt sich nur, wie viele Jahre bis dahin vergehen. Zigarette?«
José nahm die Zigarette, ohne zu zögern. Falls das ein Test war, dachte er, war er leicht. Er hatte oft mit seinen älteren Brüdern hinter dem Stall geraucht, heimlich, zu Hause. Eine Weile blinkte nur die Glut der Zigaretten ab und zu in der Dämmerung auf wie winzige Signalfeuer.
»Haben Sie von der Isla Maldita gehört?«, fragte José schließlich. »Der verfluchten Insel?«
Ben nickte. »Die verfluchte Insel«, wiederholte er. »Wie ihr eure Flüche und eure Gerüchte liebt, hier auf Galapagos, in eurem Paradies!«
»Wir brauchen sie«, antwortete José ernst. »Wir sind gefangen in unserem Paradies. Das Meer ist eine blaue Mauer, die uns einschließt. Und dieses Paradies ist eine grüne Hölle. Eine Hölle, die alles verschlingt und überwuchert, was einen Moment unbewacht bleibt. Jede verdammte Maispflanze. Wir arbeiten hart in unserem Paradies.«
»Weise Worte«, sagte Ben.
José erwähnte nicht, dass es die Worte seines Vaters waren.
»Interessant, dass du von der Isla Maldita sprichst«, fuhr Ben fort. »Gerade heute haben wir über sie gesprochen. Sie ist nicht bewohnt, nicht wahr? Die Männer von einem der Patrouillenboote schwören, sie hätten Rauch von der Insel aufsteigen sehen.«
»Jaja«, sagte José und verbiss sich ein Grinsen. »Dort gehen irgendwelche alten Piratengeister um.«
»Vielleicht gehen auch ein paar Leute um, die sich zu sehr für unsere Pläne auf den Inseln interessieren.«
José trat seine Zigarette ebenfalls aus. »Deutsche«, sagte er.
Eine Weile schwiegen sie. Irgendwo zirpten Zikaden. Der Wind spielte in der Takelage der Schiffe im Hafen. Jetzt wird er gehen, dachte José, und ich habe nichts über das Fliegen gesagt und die Gelegenheit ist beinahe vorüber. Aber was konnte er sagen? Wie konnte er Ben erklären, dass er fliegen musste? Dass es das Wichtigste auf der Welt war? Dass der Himmel dort oben ihn rief, selbst dieser nächtliche Himmel? Er holte tief Luft.
»Geben Sie mir eine Chance«, sagte er. »Was muss ich tun, damit Sie mich mit in die Luft nehmen?«
Ben lachte leise. Er nahm ihn also doch nicht ernst. »Wie wäre es, wenn du zur Isla Maldita schwimmst und herausfindest, was dort wirklich geschieht?«
José ließ eine ganze Weile verstreichen, ehe er antwortete. Eine Idee hatte begonnen, sich in seinem Kopf zu formen, und er wartete, bis sie greifbar war. »Schwimmen«, sagte er schließlich, »werde ich nicht.«
Am nächsten Morgen war Juan Casafloras Boot verschwunden. Und eine Menge Leute hatten eine Menge Theorien. Über Juan Casaflora hatten immer eine Menge Leute eine Menge Theorien gehabt. Es dauerte zwei Tage, bis Ben Miller eine eigene Theorie entwickelte. Und da war es vielleicht zu spät. Da war schon jemand dem Boot gefolgt, der eine ganz andere Theorie hatte als Ben.
Lied der Pinguine
Wenn wir gehen, siehst du uns schwanken,
als wären wir tief in Gedanken.
So watscheln wir über die Hügel,
unsre kurzen Stummelflügel
sind nicht zum Fliegen gemacht.
Ihr lacht!
Nein, wir sind noch nie geflogen,
doch dafür stets gut angezogen.
Wir legen in Nester aus Stein
ein einziges Ei hinein.
Ein Ei voller Träume, ein Hirngespinst.
Ihr grinst!
Man fängt uns leicht, hier auf dem Land.
Wir sind nicht schnell. Nicht elegant.
Und doch tut mancher, als wäre er wer,
und wedelt die Flügel hin und her
wie ein feiner Herr, der sich Luft zufächelt.
Ihr lächelt!
Aber begegnet ihr uns im Meer,
da sieht die Sache ganz anders aus!
Im Meer sind wir nicht mehr träge und schwer,
wir schwimmen mühelos weit, weit hinaus,
wir tauchen so tief, wie kein Mensch es vermag,
wir flitzen wie Pfeile die Küste entlang,
hell wie die Strahlen der Sonne am Tag,
schnell wie ihr Untergang.
Wir lassen all unser Gewicht am Strand
und unsre Melancholie an Land.
Eben noch hier, sind wir schon dort,
eben noch nah, sind wir schon fort.
Ihr bleibt mit offenem Mund zurück.
Ein Glück.
La grandeza del muerte
Die Großartigkeit des Todes
Es war, als hätte die Mariposa auf José gewartet. Er betrat sie leise, ungehört von den Besitzern der anderen Boote im Hafen. Niemand sah ihn.
Unter Deck fand er mehrere große Kanister mit Trinkwasser und mit Benzin, einen Gaskocher und Dosen mit eingemachten Nahrungsmitteln. Juan Casaflora hatte sich auf eine lange Reise eingerichtet. Und er hatte, dachte José, eine noch längere angetreten: eine Reise zu einem Ort, den niemand kannte. Ins Jenseits. Er, José, hatte ein anderes Ziel: die Isla Maldita.
Der Amerikaner, Ben, er hatte seine Worte nicht ernst gemeint, natürlich nicht. Er hatte sich über ihn lustig gemacht, genau wie sie alle. Bald würde sich niemand mehr über ihn lustig machen. Er würde es schaffen. Er würde zur Isla Maldita segeln, ganz allein, und für sie herausfinden, was dort vor sich ging. Und dann würde Ben sein Versprechen halten müssen. José würde fliegen.
Er ging noch einmal zurück zu den Baracken, um seinen Rucksack und etwas Brot zu holen, rasch, rasch, leise, leise – alles war still dort. Er bemühte sich, das Gesicht seines schlafenden Vaters nicht zu lange anzusehen. Als er zum zweiten Mal in dieser Nacht auf das Deck der Mariposa sprang, schaukelte sie sacht, als wollte sie ihn begrüßen.
»Gutes altes Mädchen«, flüsterte José, während er sich an der Reling entlangtastete. »Ich brauche dich, und du brauchst mich, denn ein Boot ohne Skipper ist ein totes Boot, tot wie dein Juan Casaflora.«
José brauchte das Vorsegel der Mariposa nur auszurollen, ein Zug an der richtigen Leine und es entfaltete sich hell in der dunklen Nacht. Im Licht einer Streichholzflamme machte er die Leinen los und weckte das Schiff aus seinem Schlaf. Er kümmerte sich nicht ums Großsegel, das Vorsegel musste reichen, bis er genug Ruhe und Licht hatte, um sich mit den Tauen und Segeln, den Klemmen und Klampen und Rollen und Segeln der Mariposa vertraut zu machen. Soweit er es beurteilen konnte, war die Mariposa mit allem ausgestattet, was ein Schiff brauchte – allem außer einem Funkgerät. Aber er würde kein Funkgerät brauchen. Seine Reise war eine geheime, niemand brauchte davon zu wissen. Er steuerte die Mariposa mit einem Gefühl der Glückseligkeit durch die Nacht; geräuschlos glitt der schlanke Holzkörper an den anderen Schiffen vorbei, hinaus aus der schützenden Bucht, und dann brach der Himmel auf, und der Mond goss sein Licht ins Meer gleich Milch in Kaffee. Der Milchpazifik verfärbte sich unwirklich weiß wie im Traum. Erst ein gutes Stück vor der Küste von Baltra entzündete José die Bordlaternen, Grün und Rot für Steuerbord und Backbord, Weiß am Bug und Weiß am Heck. Er hatte ungesehen losfahren wollen, aber er hatte keine Lust, draußen in der Nacht mit irgendeinem anderen Schiff zusammenzustoßen.
Er war kein Dummkopf. Er war José Julio Fernandez. Ein Mann. Kein Kind.
Er sah zu den Sternbildern empor, die über ihm glitzerten wie merkwürdig geformte Perlenketten, und prägte sich den Kurs ein, den er fahren musste. Es war nicht schwer. Er war oft nachts mit den Fischern von Isabela hinausgefahren, und er war schon als Kind immer wieder von der Farm entwischt, um den weiten Weg zur Küste zu laufen, wo die Segler anlegten. Silvio hatte ihn am häufigsten mitgenommen. José und der Pazifik waren alte Bekannte.
Eine Weile stand er ganz still am Heck der Mariposa und versuchte die Nacht in sich aufzunehmen: die erste Nacht auf dem Meer, die ihm allein gehörte.
In der Ferne tauchten die Lichter eines anderen Schiffs auf, eines großen Schiffs, und im Mondlicht erkannte er es: Es war die Isabelita, deren Heimatinsel auch Josés Insel war. Isabela. Er hob die Hand zu einem stummen Gruß. Er war froh, dass er die Positionslichter gesetzt hatte. Sie würden sich natürlich fragen, was für ein Schiff das war, das ihnen um diese Zeit entgegenkam.
»Das Schiff eines Toten«, flüsterte José. Die Worte zitterten in der Nacht.
Es waren die verkehrten Worte, sie riefen die Angst aus den dunklen Tiefen der See herauf, wo sie lauerte – zusammen mit den unbekannten Geschöpfen, deren Namen unaussprechlich und undenkbar waren. Die Abuelita hatte nur wispernd von ihnen erzählt, riesig sollten sie sein und schrecklich, voller Tentakel, voll spitzzähniger Mäuler und tödlicher Stachel …
»Nein. Es ist nicht das Schiff eines Toten«, sagte José laut. »Es ist jetzt mein Schiff.«
Das waren bessere Worte. Die Angst tauchte zurück ins Wasser und nahm die undenkbaren Geschöpfe mit. Aber eines der Meeresungeheuer schien seinem Willen entkommen zu sein. Etwas regte sich vor ihm im Wasser, zur Linken, backbord voraus. José hörte ein Plätschern, und dann sah er im Mondlicht etwas um sich schlagen.
Die Abuelita kicherte zufrieden in seinen Gedanken. Siehst du, mein Junge, sagte ihre alte Stimme, brüchig von unzählbaren Jahren Arbeit auf der Farm, es gibt sie doch, die Unaussprechlichen. Ich habe es euch immer gesagt: Lasst eure Finger von den Tauen und Steuerrädern der Schiffe! Ihr wolltet ja nicht hören. Aber du, José, du treibst es toller als alle anderen. Allein hinauszufahren, in der Nacht, auf einem Totenschiff … Du hast sie gerufen, die Unaussprechlichen, und einer von ihnen ist heraufgekommen.
»Sei still, Abuelita«, flüsterte José. »Du hast keine Ahnung, und du bist alt und außerdem gar nicht da! Es ist nur ein Seelöwe.«
Ah ja?, höhnte die Abuelita. Ein Seelöwe mit langen Armen und Beinen, die durch die Nacht schnellen wie die Wedel einer Palme?
Sie hatte recht. Es war kein Seelöwe. José hörte das Keuchen des Unaussprechlichen in der Nacht. Er wollte das Steuerruder herumreißen und fliehen, doch seine Hände waren starr vor Angst und gehorchten ihm nicht. Der Wind drehte kaum merklich, die Mariposa gierte nach Lee und drehte ihren Bug ohne sein Zutun ein wenig nach backbord, und jetzt hielt sie genau auf das zu, was kein Seelöwe war. Er sah es untergehen, wieder auftauchen … – und plötzlich erkannte er, was es war.
Es war keiner der Unaussprechlichen aus der Tiefe, der versuchte, heraufzukommen. Es war ein Mensch, der versuchte, nicht unterzugehen. Ein Mensch, der mitten in der Nacht, mitten auf dem Pazifik, mit dem Tod kämpfte.