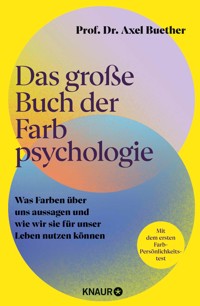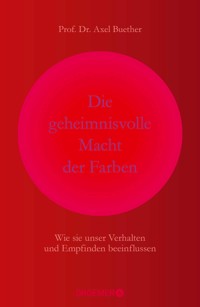
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Deutschlands führender Farb-Experte, Dr. Axel Buether, geht in diesem populären Sachbuch dem Geheimnis der Farben auf den Grund. Sie sind nicht nur schön, sondern erfüllen als Produkt der Evolution lebenswichtige Funktionen für Natur und Mensch. Unablässig kommunizieren wir mit unserer Umwelt durch die Sprache der Farben, die insgeheim großen Einfluss auf unser Gefühlsleben, unser soziales Verhalten und unsere Gesundheit hat. Farben wirken stark auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit - Ein unterhaltsames Wissensbuch mit hohem Nutzwert Öffnen wir die Augen, sehen wir – Farben! Die Welt ist bunt, Farben verleihen ihr Kontur und Form, aber nur zu einem Prozent verarbeiten wir sie bewusst. Dr. Axel Buether entlarvt sie als das größte Kommunikationssystem der Erde und erklärt, wie wir Menschen Farben wahrnehmen. Er beschreibt, wie sie unser Verhalten steuern, ohne dass wir es merken, und welche Rolle sie für unser Wohlbefinden, ja unsere Gesundheit spielen. Vor allem verrät er, wie Farben auf unsere Psyche wirken. Dazu nimmt sich Buether die 13 Grundfarben vor, spürt ihrer Symbolik in der Kulturgeschichte nach und schlüsselt ihre Effekte auf unsere Psyche auf. Ein informatives und spannendes Farb-Panorama, das uns Einblick in die neuesten Erkenntnisse der Farb-Forschung gewährt und zeigt, wie wir dieses Wissen auch für unseren Alltag nutzen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Prof. Dr. Axel Buether
Die geheimnisvolle Macht der Farben
Wie sie unser Verhalten und Empfinden beeinflussen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Deutschlands führender Farbexperte, Dr. Axel Buether, geht in diesem populären Sachbuch dem Geheimnis der Farben auf den Grund. Sie sind nicht nur schön, sondern erfüllen als Produkt der Evolution lebenswichtige Funktionen für Natur und Mensch. Unablässig kommunizieren wir mit unserer Umwelt durch die Sprache der Farben, die insgeheim großen Einfluss auf unser Gefühlsleben, unser soziales Verhalten und unsere Gesundheit hat.
Öffnen wir die Augen, sehen wir – Farben! Die Welt ist bunt, Farben verleihen ihr Kontur und Form, aber nur zu einem Prozent verarbeiten wir sie bewusst. Dr. Axel Buether entlarvt sie als das größte Kommunikationssystem der Erde und erklärt, wie wir Menschen Farben wahrnehmen. Er beschreibt, wie sie unser Verhalten steuern, ohne dass wir es merken, und welche Rolle sie für unser Wohlbefinden, ja unsere Gesundheit spielen. Vor allem verrät er, wie Farben auf unsere Psyche wirken. Dazu nimmt sich Buether die 13 Grundfarben vor, spürt ihrer Symbolik in der Kulturgeschichte nach und schlüsselt ihre Effekte auf unsere Psyche auf.
Ein informatives und spannendes Farbpanorama, das uns Einblick in die neuesten Erkenntnisse der Farbforschung gewährt und zeigt, wie wir dieses Wissen auch für unseren Alltag nutzen können.
Inhaltsübersicht
Einleitung Wie Farben unser Leben beeinflussen
I DIE NATUR DER FARBEN
Die sieben biologischen Funktionen der Farben. Warum wir Farben sehen
Orientierung. Farbleitsysteme der Natur
Gesundheit. Wohltuende Farben
Warnfarben. Zwischen Angst und Provokation
Tarnfarben. Die Kunst des Verschwindens
Werbung. Die Schönheit der Farben
Status. Die soziale Hierarchie der Farben
Verständigung. Die Sprache der Farben
Das größte Kommunikationssystem der Erde. Die Evolution des Farbensehens
Das Wunder des Farbensehens
Farbstoffe als Grundbausteine des Lebens
Sehen und gesehen werden
Die Reise des Lichts von den Augen zum Gehirn. Wie wir Farben sehen
Das Geheimnis des Regenbogens
Farbe im Auge des Betrachters
Die physiologische Rangfolge der Farben
Das Geheimnis unserer Sehfarbstoffe
Wechselwirkungen von Farben und Licht
Interaktion der Farben
Warum es unmöglich ist, Farben frei von Emotionen zu sehen
Die Gedächtnislandkarte der Farben
Wie viele Farben nehmen wir wahr?
Sinnlichkeit der Farben. Warum wir Farben stets mit allen Sinnen wahrnehmen
Die ersten Farben nach der Geburt
Synästhesie. Im Rausch der Sinne
Farben sind Geschmackssache. Tipps zur Farbgestaltung
Vom Duft der Farben
Farben mit dem Blick berühren
Das Gewicht der Farben
Farbtöne, Farbklänge und Farbharmonien
Wohltuende Farben. Wie uns Farben helfen, gesund zu leben
Gesunde Ernährung – nach den Farben des Regenbogens
Vorsicht, Lebensmittelfarbstoffe!
Die gefährliche Macht der Verpackungsfarben
Die Wirkungen von Lichttherapien bei Antriebslosigkeit und Winterdepression
Wohlfühloase oder Arbeitsatmosphäre? Für jede Situation das richtige Licht
Mehr als Feng-Shui. Der Einfluss von Raumfarben auf Wohlbefinden und Gesundheit
II DIE KULTUR DER FARBEN
Die Symbolkraft der Farben
Weiß
Lichtweiß
Milchweiß
Wolkenweiß
Schneeweiß
Schwarz
Nachtschwarz
Samtschwarz
Phantomschwarz
Maskeradenschwarz
Grau
Neutralgrau
Schattengrau
Nebelgrau
Aschgrau
Rot
Lippenrot
Schamrot
Kardinalsrot
Blutrot
Grün
Blattgrün
Biogrün
Paradiesgrün
Giftgrün
Blau
Azurblau
Himmelblau
Ultramarinblau
Meerblau
Gelb
Sonnengelb
Emoji-Gelb
Zitrusgelb
Gallengelb
Braun
Melaninbraun
Erdbraun
Naturbraun
Sackbraun
Rosa
Kirschblütenrosa
Nude
Pink
Nymphenrosa
Orange
Apfelsinenorange
Safranorange
Hippie-Orange
Feuerorange
Violett
Mauve
Purpur
Ultraviolett
Lavendel
Silber
Perlmutt
Spiegelsilber
Hightech-Silber
Mondsilber
Gold
Ikonengold
Dukatengold
Glamourgold
Katzengold
Farbpsychologie und Farbgestaltung. Wie Sie die richtigen Farben finden
Dank
Einleitung Wie Farben unser Leben beeinflussen
»Die Erfahrung lehrt uns, daß die einzelnen Farben besondre Gemütsstimmungen geben.«
Johann Wolfgang von Goethe
Die ganze Welt ist voller Farben. Bunte, grelle, sanfte; reine, laute, kühle; dumpfe, satte, leuchtende Farben. Es gibt Farbexplosionen und »Fifty shades of grey«. Wir sind umgeben von Farben, und ihre Wirkung auf uns ist unmittelbar. Farben teilen uns etwas mit, sie ziehen uns an oder stoßen uns ab, sie beruhigen oder warnen uns. Sie sind Botschafter der Natur, ebenso wie auch wir uns über Farben mitteilen. Als Kommunikationsinstrument haben Farben nicht nur eine große Bedeutung, sie sind sogar überlebenswichtig. Hätten sie diese eingeschriebene biologische Funktion und Bedeutung nicht, würden wir sie erst gar nicht sehen. Farben sind kein hübsches Beiwerk, wir brauchen sie tatsächlich zum Überleben.
Farben prägen unsere Selbst- und Umweltwahrnehmung und steuern unser Verhalten. Dabei ist es keineswegs selbstverständlich, dass Lebewesen Farben wahrnehmen, denn der biologische Aufwand fürs Farbensehen ist extrem hoch. Unser Gehirn verbraucht etwa 60 Prozent seiner neuronalen Ressourcen für die Verarbeitung der Informationen, die es über das Licht erhält und aussendet.1 In Bruchteilen einer Sekunde werden gewaltige Datenmengen von bis zu 240 Megabit zwischen Augen und Gehirn ausgetauscht – solche Datenmengen würden einen modernen Breitbandanschluss komplett auslasten.
Farbe ist unser schnellstes, leistungsfähigstes und einflussreichstes Sinnesmedium. Farben offenbaren uns nicht nur die faszinierenden Geheimnisse der Natur, sondern auch die Schöpfungen unserer eigenen Farbkultur. Dabei können wir die verschiedenen Farben niemals von ihren Bedeutungen und Wirkungen trennen, denn sobald wir sie bewusst wahrnehmen, hat unser Gehirn sie bereits interpretiert. Demzufolge nimmt jeder Mensch Farben auf seine ganz persönliche Weise wahr, sodass Farben nur in unserem Kopf existieren. Die Umwelt bleibt so lange unsichtbar, bis das Licht zur Wahrnehmung wird.
Unsere Farbwahrnehmung wird von biologischen und kulturellen Faktoren geprägt, weshalb sie dort objektiv und mitteilbar ist, wo sie der Verständigung mit der Natur und den Menschen dient. Farben sind unser Fenster zur Welt – im Einklang mit allen Sinnen legt dieses Fenster fest, was wir von der Welt wahrnehmen, worauf wir reagieren und wie wir uns dabei fühlen. Doch die Macht der Farben reicht weit über unsere Spezies hinaus. Farben bilden das größte Kommunikationssystem der Erde. Jede Farbe der Natur hat genau bestimmbare biologische Funktionen, die ich Ihnen an anschaulichen Beispielen aus dem Tier- und Pflanzenreich zeigen und in ihrer Bedeutung für unsere Farbkultur und unseren Alltag vorstellen werde. Die tiefen Beziehungen zwischen der Natur und Kultur der Farben werden Ihnen nach dem Lesen so selbstverständlich erscheinen, dass Sie Ihre Umwelt fortan mit anderen Augen sehen werden.
Farbe ist ein atmosphärischer Umweltfaktor, der uns müde, lustlos und krank machen oder auch wach, aktiv und gesund erhalten kann. In der weltweit größten Studie zu den Wirkungen von Farben auf das Wohlbefinden und die Gesundheit von Patienten und Personal in der Intensivmedizin habe ich mit meinem Forschungsteam dazu erschreckende wie ermutigende Tatsachen herausgefunden. Atmosphären wirken nicht nur auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen, sondern sie beeinflussen auch den Medikamentenverbrauch und den Krankheitsstand des Pflegepersonals.
Doch Farben erfüllen noch viele andere wichtige Funktionen. Wir orientieren uns an Farben, identifizieren uns mit Farben, ernähren uns nach Farben, werben durch Farben oder verstecken uns hinter Farben. Wir nehmen Farben zwar erst einmal nur mit unseren Augen, danach jedoch stets mit allen Sinnen wahr. Verantwortlich dafür sind wirkmächtige Assoziationen, die uns beständig mitteilen, wie etwas riecht und schmeckt oder sich anfühlt und verhält. Um es mit den leicht abgeänderten Worten des Philosophen Paul Watzlawick zu sagen: Wir können nicht nicht über Farben kommunizieren.2
Wir bilden unsere Farbexpertise in der frühen Kindheit und vervollkommnen sie ein Leben lang. Farben geben Auskunft über unsere Person, unser gesellschaftliches Milieu und unsere Identität – und jeder Mensch ist ein Farbexperte! Wir wissen meist nur sehr wenig davon, denn unser Gehirn verarbeitet etwa 99 Prozent aller Farbinformationen unbewusst. Farbe ist ein Medium wie die Sprache, das die innere psychische Welt unserer Erinnerungen, Gedanken und Emotionen mit der äußeren physischen Welt verknüpft. Jeder Mensch entwickelt daher seine eigenen Farbpräferenzen und reagiert individuell auf die Farbigkeit seiner Lebenswelt. Was uns dennoch verbindet, ist die Natur bzw. die natürliche Umgebung, in der wir leben, und die Teilhabe an der uns umgebenden Farbkultur.
Wer den Einfluss der Farben auf sein Leben verstehen und gestalten möchte, muss sich mit ihren Bedeutungen auseinandersetzen und ihre Wirkungen in unterschiedlichen Situationen verstehen. Wer die für sich richtigen Farben für den jeweiligen Gebrauchszweck findet, fühlt sich wohler und lebt gesünder, ist wacher, aufmerksamer und leistungsfähiger, denkt und lernt konzentrierter oder kommt schneller zur Ruhe und schläft besser ein, um nur einige Wirkungen zu nennen.
Mit diesem Buch möchte ich Sie ermuntern, mehr Farbe in Ihr Leben zu lassen, denn Farb-Wissen ist Macht und ein Schlüssel zu einem bewussteren und selbstbestimmten Leben.
I DIE NATUR DER FARBEN
Die sieben biologischen Funktionen der Farben. Warum wir Farben sehen
Was verstehen Sie unter dem Begriff der Farbe?« Diese Frage stellte ich zum Auftakt einer internationalen Fachkonferenz etwa einem Dutzend Expertinnen und Experten aus Wissenschaften, Kultur und Industrie, als ich vor gut zehn Jahren zum Vorsitzenden des Deutschen Farbenzentrums gewählt wurde. Das Ergebnis erstaunte alle Beteiligten, denn jede der befragten Disziplinen definiert Farbe anders. Ob Naturphänomen, Sinnesempfindung, Wellenlänge, Farbladung, Farbvalenz, Farbwiedergabe, Pigment, Farbstoff, Atmosphäre, Ausdrucksmittel oder Kulturprodukt, wir brauchen viele Blickwinkel, um das Wesen der Farbe zu begreifen.
Um herauszufinden, warum es Farben überhaupt gibt, oder anders gesagt, warum das Farbensehen für unsere Spezies so bedeutend ist, dass es den größten Teil der Gehirnkapazität beansprucht, ist eine nähere Betrachtung ihrer biologischen Funktionen nötig. Ich habe mir dafür unterschiedliche Forschungsfelder der Biologie angeschaut und zum ersten Mal alle überlebenswichtigen Funktionen der Farbe nach signifikanten Merkmalen geordnet. Die sieben Kategorien, auf die ich so gekommen bin, ergeben die sieben biologischen Grundfunktionen der Farben. Diese sind: Orientierung, Gesundheit, Warnung, Tarnung, Werbung, Status und Verständigung. Im ersten Teil dieses Buches werde ich die Wirkung dieser Grundfunktionen an Beispielen aus der Tier- und Pflanzenwelt exemplarisch aufzeigen. Bevor es im zweiten Teil des Buches um die von uns Menschen produzierte Farbkultur geht, ist es wichtig, die Natur der Farben zu verstehen. Denn nur so lässt sich erkennen, warum, wie und in welchem Umfang Farben unser Leben steuern. Innerhalb der sieben biologischen Grundfunktionen, auf denen die Wirkmacht der Farben gründet, lässt sich keine Rangfolge festmachen, da die Funktionen oft gemeinsam auftreten und allesamt von großer Bedeutung für die Entfaltung und den Erhalt des Lebens sind.
Orientierung. Farbleitsysteme der Natur
Farbe ist das größte und vor allem leistungsfähigste Orientierungssystem der Natur. An der Buntheit der Natur zeigt sich das Maß an Biodiversität, von der Buntheit lässt sich auf die Vielfalt der Flora und Fauna schließen. Die Lebensräume mit dem größten Artenreichtum und der größten Farbenvielfalt der Erde sind die tropischen Regenwaldgebiete und die Korallenriffe.
Die größten Bauwerke der Welt werden von lebenden Korallenpolypen geschaffen, die Fotosynthese betreiben und dafür von vielfarbigen Mikroorganismen mit Glukose und anderen Nährstoffen versorgt werden. Wo Hunderttausende Arten auf engstem Raum in Freundschaft und Feindschaft zusammenleben, sind eindeutige und leistungsfähige Orientierungs- und Leitsysteme wichtig.3 Nahsinne wie Tasten, Riechen und Schmecken reichen hier nicht aus, denn sie vermitteln Lebewesen in komplexen Umgebungen keine Übersicht. Auch das Hören verliert an Wert, wo wichtige Ereignisse wie Bedrohungen, Nahrung, Partner oder soziale Kontakte entweder keine identifizierbaren Geräuschmuster entwickeln oder von anderen Schallquellen überlagert werden. Stellen Sie sich einfach eine große Bahnhofshalle vor, in der Sie jemanden oder etwas suchen. Obwohl es dort meist sehr bunt zugeht, sorgen prägnante Farben wie ein roter Mantel, ein gelbes Taxischild oder eine blaue Anzeigentafel einfach, schnell und effizient für Orientierung.
Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, was die schöpferische Kraft der Evolution mit den expressiven Farbmustern bezweckt, etwa bei vielen Bewohnern der Korallenriffe. Wer würde sich Lebewesen ausdenken, deren goldenes Schuppenkleid mit cyanblauen Pünktchen übersät ist? Warum gibt es einen geleeartigen zitronengelben Fisch, dessen Augenränder und Schwanzflossen neongrün leuchten? Oder weshalb befindet sich auf einem ganz gewöhnlichen silbrig geschuppten Fisch ein großer neonoranger Fleck, der wie aufgesprüht wirkt?
In tropisch warmen Gewässern leben mehr als 1700 Buntbarscharten.4 Die großen schwarzen Augen hat der Buntbarsch mit vielen Meeresbewohnern gemein. Die weit geöffneten Pupillen sorgen dafür, dass unter Wasser genügend Licht auf die Netzhaut fällt. Doch die hierdurch entstehende große Brennweite der Linse würde die Lichtstrahlen bei Tag auf verschiedenen Bereichen der Netzhaut fokussieren. Dieses Problem löst die Natur durch eine optische Meisterleistung. Die Linse des Buntbarschs weist gleich mehrere konzentrische Zonen auf, die durch Anpassung der Brennweiten das einfallende Licht verschiedener Wellenlängen optimal auf der Netzhaut bündeln. Buntbarsche haben noch einen weiteren Farbrezeptortyp für ultraviolettes Licht. Mit einer UV-Kamera erhalten wir eine Ahnung von den geheimnisvollen Mustern, die für seine Artgenossen auf dem Schuppenkleid zu sehen sind. Das kurzwellige Farbspektrum erleichtert Buntbarschen die Nahrungssuche, da sich kleinste Meeresbewohner wie Wasserflöhe viel deutlicher vor der hellen Wasseroberfläche abzeichnen. Das exklusive Farbspektrum hilft den Buntbarschen bei der Orientierung in sozialen Systemen, da sie ihre Artgenossen hierdurch schneller und sicherer identifizieren können.
Woran sich Buntbarschweibchen bei der Partnersuche orientieren, wurde kürzlich bei Forschungsexperimenten im Victoriasee entdeckt.5 Reagieren die Augen der Weibchen sensibler auf kurzwelliges Licht, bevorzugen sie Männchen im blauen Schuppenkleid. Sind ihre Augen hingegen sensibler für das langwellige Spektrum, geben sie Männchen mit orangeroten Zeichnungen den Vorzug. Die Auswahl des »Richtigen«, der nicht unbedingt der Schönste sein muss, liegt hier im wahrsten Sinne des Wortes im Auge der Betrachterin. Selbstverstärkungsprozesse, bei denen die Präferenzen des Weibchens die entscheidende Rolle spielen, bezeichnet man in der Biologie als »Fisher’s Runaway Selection«.6 Die Farbpräferenz der Weibchen sorgt für die Selektion der männlichen Gene, die darüber hinaus keine weiteren Vorteile bieten müssen. Dass Männchen nicht nur auf Basis eines allgemeinen Schönheitsideals, sondern auch aufgrund ihrer persönlichen Eigenarten geliebt werden können, ist nicht nur eine wunderbare Vorstellung, sondern ein Selektionsprinzip der Evolution. Buntbarschweibchen sorgen mit ihrer Farbpräferenz für die Selektion höchst individueller Farbkombinationen. Die exzentrischen Farbpräferenzen der Weibchen wie auch die fantasievollen Muster der Männchen werden gleichermaßen an die Nachkommen vererbt.
In komplexen Lebensumwelten sorgt der Ausdruck individueller Farbpräferenzen sehr effizient für Orientierung. Daran ändert sich auch nichts, wenn Korallenriffe für Außenstehende wie uns lediglich bunt und verwirrend wirken. Für den Arterhalt reicht es völlig aus, wenn sich die richtigen Adressaten von den Farbcodes angesprochen fühlen und hierüber die für sie wichtigen Informationen erhalten.
Gesundheit. Wohltuende Farben
Unsere nächsten biologischen Verwandten, die Schimpansen, bauen zwar keine Häuser, doch sie errichten sich Schlafnester aus Zweigen und Blättern in Baumkronen, die sowohl ausreichend Licht als auch genügend Schatten und Schutz bieten. Der Lebensraum der Schimpansen ist auch unsere angestammte Farbheimat. Wir brauchen Licht, Luft und Farben für unser Wohlbefinden. Am gesündesten lebt es sich im Grünen, was aktuelle Studien eindrucksvoll belegt haben.7 Mit dem Grünraum steigt die Lebensqualität. Am wohlsten fühlen wir uns, wenn wir uns in der freien Natur bewegen, doch selbst der Sichtkontakt zu einem Garten wirkt sich positiv auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit aus.8 Denn Grün ist nicht nur irgendeine Farbe für uns – der grüne Anteil des Lichtspektrums umfasst mehr als die Hälfte aller wahrnehmbaren Farbtöne. Das schauen wir uns später noch genauer an.
Tiere nutzen Farbmerkmale nicht nur für die Suche nach einem lebenswerten Habitat, sondern auch für die Auswahl gesunder Nahrungsmittel. In der Regel müssen sie viel Zeit und Energie für die Nahrungssuche aufwenden, weshalb es ihnen einen erheblichen Vorteil bietet, wenn sie einem Naturprodukt aus der Ferne ansehen können, ob sich der Aufwand seiner Beschaffung lohnt. Die gesparte Zeit kann das Tier sehr viel besser verwenden, um Naturprodukte wie reife Früchte, Pilze und Beeren oder frische Triebe zu suchen, deren Nährwert unverkennbar ist. Wer schon einmal in freier Natur nach Walderdbeeren oder Pilzen gesucht hat, kann das sicher gut nachvollziehen. Selbst die Ernte auf dem Erdbeerfeld wird deutlich erschwert, wenn man die Farben der reifen Früchte nicht erkennt.
Der Vorteil der Farbwahrnehmung zeigt sich nicht nur bei pflanzlicher Nahrung. Eine frische rötliche Farbe ist ein untrüglicher Indikator für die Beurteilung des Nährwerts und der Bekömmlichkeit von fleischlicher Nahrung. Bakterien und Pilze setzen Enzyme frei, die organische Verbindungen nach dem Tod schnell zersetzen. So wie viele andere Fleischfresser auch können wir den Fortschritt dieser Oxidationsprozesse anhand der Farbveränderungen diagnostizieren. Unwillkürlichen Körperreaktionen, die von Appetit und Heißhunger bis hin zu Ekel und Übelkeit reichen, können wir uns deshalb kaum entziehen. Der Stoffwechsel von Fleischfressern reagiert direkt auf die zartrosa Färbung von Geflügelfleisch, die tiefrote von Rindfleisch und die dunkelrote von Wildfleisch. Färbt sich das Fleisch grau, sinkt der Appetit. Industriell produziertes Fleisch wird daher fast immer rot gefärbt, bevor es in den Handel kommt.9 Auf gräulich-grüne und -gelbliche Farbspuren von Verwesungs- und Fäulnisprozessen reagiert unser Körper unwillkürlich mit Ekelgefühlen. Das ist ein natürlicher Schutzreflex, der uns ebenso wie viele Tiere vor Vergiftungen, bakteriellen Krankheitserregern und Parasitenbefall bewahrt.
Farben sind der natürliche Ratgeber für eine gesunde Ernährung, weil genau das zu ihren biologischen Grundfunktionen gehört. Wir nutzen unsere Sinne, um den Nährwert, Reifegrad und die Bekömmlichkeit potenzieller Nahrungsmittel zu beurteilen – und viele Tierarten tun das auch. Wenn wir der Farbe nicht vertrauen, sind wir an weiteren Merkmalen wie dem Geruch und der Konsistenz schon gar nicht mehr interessiert.
Doch Farben tun noch viel mehr für uns. Sie wirken ebenso wie der Geruch, die Konsistenz und der Geschmack auf unser vegetatives Nervensystem, um uns bei der Auswahl der Nahrung zu unterstützen und unseren Körper auf den bevorstehenden Verdauungsprozess vorzubereiten.10 Beim Anblick von Farben, die wir mit nährstoffreichen Nahrungsmitteln assoziieren, reagiert unser Stoffwechsel mit Unterzuckerung. Die Produktion von Magensäften und der Speichelfluss werden angeregt, wir spüren Appetit. Dieses Gefühl macht sich auch dann bemerkbar, wenn wir auf farbige Abbildungen von Speisekarten oder Produktwerbungen schauen.
Warnfarben. Zwischen Angst und Provokation
Menschen und Tiere reagieren reflexhaft auf Warnfarben, ihre Reaktionen sind blitzschnell, intuitiv und hochemotional, denn genau das ist ihre biologische Funktion. Vom Zeitpunkt eines Ereignisses bis zu dem Augenblick, in dem wir es bildhaft vor uns sehen, vergeht etwa eine Sekunde. Um einer akuten Gefahr zu entkommen, kann diese Zeitspanne dennoch zu lang sein, zumal wir auch noch unsere Reaktionszeit dazuaddieren müssen. Darauf müssen wir uns zum Glück nicht immer verlassen, denn unser Nervensystem verfügt über einen reflexartigen Schutzmechanismus, der uns häufig vor Schlimmerem bewahrt. Achten Sie beispielsweise im Alltag auf Ihre Reaktionen, wenn sich eine Wespe nähert. Die Farbkombination Gelb-Schwarz sorgt dafür, dass wir intuitiv zurückweichen, was uns manch schmerzhafte Begegnung erspart. Wir agieren weit defensiver als bei anderen Insekten, deren harmlose Farbtracht keinen Alarm verursacht. Abschreckende Farben oder Farbkombinationen sorgen nicht nur für maximale Aufmerksamkeit und Emotionen, sondern lösen in Bruchteilen einer Sekunde unwillkürliche Abwehr-, Flucht- oder Vermeidungsreaktionen aus.11
Warnfarben warnen selbst unaufmerksame Beobachter schnell und effizient vor lebensbedrohlichen Gefahren wie Krankheiten, Verletzungen und Tod. Einige Tierarten haben hieraus wirksame Waffen zur Abschreckung ihrer Feinde entwickelt. Dieser evolutionäre Erfindungsgeist, der uns schon einmal in Schockstarre versetzen kann, zeigt sich besonders anschaulich an den Baumsteigerfröschen, von denen uns etwa 170 Arten bekannt sind. Obwohl sie sehr klein sind, flößen sie Menschen wie Tieren großen Respekt ein. Dabei produziert nur etwa ein Drittel der Arten die tödlichen Hautgifte, die ihnen auch den Titel Pfeilgiftfrösche eingetragen haben. Einige Arten der Lurche sowie Giftfrösche bilden geradezu chemische Kampfstoffe. Nicht um zu töten, sondern um potenzielle Feinde vor einem Angriff zu warnen. Leuchtend rote, gelbe, orange, grüne und blaue Signalfarben sorgen vor schwarzem Hintergrund für ein Repertoire des Schreckens. Damit die Gefahr selbst unter komplexen Umweltbedingungen und bei wenig Licht nicht zu übersehen ist, werden sogar fluoreszierende Pigmente eingesetzt.
Das Prinzip der Abschreckung funktioniert jedoch nur dann erfolgreich, wenn Angreifer mit dem Leben davonkommen und anderen über die qualvollen Erfahrungen berichten. Was nutzt einem Giftfrosch wie dem brasilianischen Aparasphenodon brunoi sein starkes Gift, von dem ein Gramm 80 Menschen oder 300000 Mäuse töten kann, wenn niemand davon weiß! Der A. brunoi nutzt daher seinen Stachel, um Angreifer durch die Verabreichung einer winzigen Giftdosis so leiden zu lassen, dass sie dieses fürchterliche Erlebnis und seine Warntracht nie wieder vergessen.12 Nach dieser Erfahrung wird der Angreifer einen großen Bogen um alle Tiere mit glänzend schwarzer Haut und neonorange schimmernden Flecken machen. Es ist zudem wahrscheinlich, dass andere Warntrachten gleichermaßen erkannt und respektiert werden.
Wespen setzen ihr Gift ebenfalls dosiert ein, um vom Angreifer Respekt einzufordern. Wenn wir panische Angstreaktionen vor Wespen zeigen, legen wir anderen Menschen unsere Warnung sehr viel eindringlicher ans Herz, als wir es mit Worten jemals könnten. Dass wir beobachtete Angstreaktionen emotional und physisch am eigenen Leibe spüren, haben wir den Spiegelneuronen unseres Gehirns zu verdanken. Die Wirkungen von Warnfarben graben sich hierdurch besonders tief in unser emotionales Gedächtnis.13
Warnfarben wirken daher auch bei völlig harmlosen Tieren wie Schmetterlingen. Die großen Punkte auf ihren Flügeln sollen weit aufgerissene Augen imitieren – und ihre Fressfeinde fallen tatsächlich darauf herein. Die Imitation von Warntrachten wird in der Biologie als Mimikry bezeichnet. Schlangenarten wie die Dreiecksnatter und die Lystrophis nutzen den schwarz-weiß-roten Farbcode hochgiftiger Korallenottern, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Die schwarz-gelbe Warntracht von Wespen ist bei Hochstaplern aus dem Reich der Insekten sehr gefragt. Schwebfliegen, Bockkäfer, Hornissenschwärmer und die Schmetterlingsraupen der Gattung Jakobskrautbär nutzen den Bekanntheitsgrad dieser Warntracht, um ihre Feinde von einem schmackhaften Imbiss abzuhalten. Das Pokerspiel geht jedoch nur dann gut, wenn nicht zu viele Nachahmer in einem Habitat vorhanden sind. Sobald die Räuber den Bluff entdecken, wird es lebensgefährlich für die Betrüger.
Von jeder Gefahr geht auch eine Faszination aus, wenn wir sie aus sicherer Entfernung oder in anderem Kontext betrachten. Die Farbkombination von Schwarz und Neonrot wirkt extrem abschreckend, wenn wir sie bei einer Giftspinne wie der Schwarzen Witwe wahrnehmen. Kaum jemand würde sich so anziehen oder seine Umgebung mit Warnfarben gestalten. Doch bei Produkten für junge Zielgruppen, wie Sportschuhe und T-Shirts, können diese aufreizenden Farbkombinationen sehr erfolgreich sein. Bei der Beurteilung der Farbwirkung kommt es immer auf den Kontext an.
Tarnfarben. Die Kunst des Verschwindens
Die Kunst der Tarnung, in der Biologie auch Mimese genannt, wird im gesamten Naturraum praktiziert. Wer zu schwach, zu langsam oder zu unbeweglich ist, um sich durch Angriff oder Abschreckung vor gefährlichen Räubern in Sicherheit zu bringen, muss sich gut verstecken. Am effektivsten funktioniert das Versteckspiel im gesamten Tagesablauf, wenn Tiere für die Augen ihrer Feinde unsichtbar werden. Die meisten Tiere sind in ihrem angestammten Lebensraum sehr schwer zu finden, da ihre Tarntracht perfekt mit den Farben des Hintergrunds verschmilzt. Selbst nachtaktive Tiere legen Wert auf Tarnfarben, damit sie bei Tageslicht ungestört ruhen können und auch bei Mondlicht nicht zu erkennen sind. Die hohe Kunst des Farbwechsels, die wir tagtäglich mit unserer Kleidung praktizieren, bleibt hingegen nur wenigen Tieren wie Tintenfischen, Kraken und Chamäleons vorbehalten. Mithilfe von Chromatophoren passen sie ihre Körperfarbe jeder Umgebung an. Wenn das nicht reicht, verschwinden Tintenfische in einer Farbwolke aus Melanin, ein Farbstoff, den sie für den Fall ihrer Entdeckung aufbewahren.
Quallen verzichten hingegen lieber ganz auf Farbstoffe, damit ihre transparenten Körper im Meer nicht so einfach zu entdecken sind. Doch wie uns das glänzend weiße Fell von Eisbären zeigt, kann sich der Verzicht auf Farbstoffe auch ganz anders auf das Erscheinungsbild auswirken. Der schillernd weiße Glanzeffekt des Eisbärfells entsteht an den hohlförmigen transparenten Haaren, an denen sich das Licht wie in Schneekristallen spiegelt und bricht. In seiner eisigen weißen Lebenswelt ist das Raubtier damit ebenso perfekt getarnt wie die dort lebenden Schneeleoparden und Schnee-Eulen. Andere Tiere wie Schneehasen, Hermeline und Polarfüchse wechseln ihre Farbtracht mit den Jahreszeiten, im Winter ist ihr Fell weiß, im Sommer braun.
Die meisten Tiere nutzen jedoch die sandigen und erdigen Tönungen des Farbstoffs Melanin für ihre Tarnung, der auch dem menschlichen Körper seine Farbe gibt. Wo der Farbstoff nicht gleichmäßig über Haut, Fell, Federn und Schuppen verteilt ist, kommt es zur Musterbildung. Die Evolution lebt zwar vom kreativen Zufall, doch auf lange Sicht sorgt allein das Leben dafür, dass die effizientesten Muster genetisch bewahrt werden.
Die Tarnkunst wird nicht nur von den Gejagten, sondern auch von den Jägern beherrscht. Raubtiere brauchen eine wirksame Tarnung, um sich dicht an ihre Opfer heranzuschleichen, denen sie in Sachen Geschwindigkeit und Ausdauer meist deutlich unterlegen sind. Großkatzen sind für ihre Opfer besonders schwer erkennbar. Wenn sich ein Raubtier seinem Opfer gegen die Windrichtung annähert und dabei Gräser, Buschwerk oder Unterholz zur Tarnung nutzt, bewirken unregelmäßige Streifen, Flecken und Rosetten, dass die Gestalt des Jägers in unidentifizierbare Einzelteile zerfällt. Bei Raubtieren funktioniert dieses Verwirrspiel weit weniger effizient, da ihre Farbwahrnehmung meist sehr viel besser funktioniert. Für sie bleibt die Gestalt der gemusterten Opfer meist konstant. Daher ist man auch lange Zeit nicht darauf gekommen, warum Zebras so auffällige Streifenmuster tragen. Die Facettenaugen von Insekten wie Mücken und Tsetse-Fliegen, die gefährliche Krankheitsüberträger sind, können diese Streifenmuster nicht ausreichend auflösen, was ihnen die Landung nachweisbar erschwert.14 Was Tarnfarben sind, liegt im Auge des Betrachters.
Schauen wir zuletzt noch auf die Meister der Tarnung, die so detailgenau an ihre Umgebung angepasst sind, dass sie sich nicht vor den wachsamen Blicken ihrer Feinde verstecken müssen. Die Sandflöhe der Tropeninsel Ascension passen sich den Korngrößen und Farben der hellgelben, bräunlichen und rötlichen Sandstrände so perfekt an, dass sie für die scharfen Augen hungriger Krabben und Raubvögel nicht zu sehen sind. Furchtlose Vögel wie die Regenpfeifer legen ihre gefleckten Eier ganz offen in das Kiesbett von Flüssen und Seen, die den Steinen selbst in der Nähe noch zum Verwechseln ähnlich sehen. Wie Ausgeburten einer überschäumenden Fantasie wirken hingegen Stabheuschrecken und tropische Gespenstschrecken, die ihre Namen völlig zu Recht tragen. Einige Exemplare imitieren das Erscheinungsbild brauner Äste oder grüner Blätter mit so hoher Perfektion, dass sie selbst in der Fortbewegung noch wie wandelnde Pflanzen wirken.
Werbung. Die Schönheit der Farben
Sie haben sicher schon einmal die Schleppe eines Pfaues bewundert, auf der uns eine Vielzahl schillernder bunter Augen anblickt, wenn das Tier seine Schwanzfedern zu einem kreisrunden Rad aufspannt. Doch hätten Sie gewusst, dass die Anzahl und Fläche dieser Augen auf der Farbtracht des Männchens verlässliche Prognosen zur Überlebenswahrscheinlichkeit seines Nachwuchses erlaubt?15 Pfauenweibchen reagieren intuitiv auf das Geheimnis dieser Farbenpracht und räumen den Bewerbern höhere Chancen ein. In der Evolutionsbiologie gibt es dafür eine Erklärung, die als »Gute-Gene-Hypothese« bekannt wurde. Farben gelten hiernach als Visitenkarte des genetischen Codes, da sie den Angehörigen der betreffenden Art die Vorhersage gesunder und starker Nachkommen erlauben.16 »Schöne Farben« sind für den jeweiligen Betrachter oder die Betrachterin ein genetisches Kennzeichen von Vitalität.
Die biologische Funktion der Schönheit zeigt sich auf ganz andere Weise an den Kunstwerken der Laubenvögel, die einzigartige Bauwerke errichten und sie mit farbigen Blättern, Blüten und Früchten dekorieren. Je unscheinbarer ein Männchen gefärbt ist, desto mehr Mühe und Sorgfalt verwendet es auf die Farbgestaltung seines Baus. Die Schönheit des fertigen Werks bringt ihm die Bewunderung der Weibchen ein und ermöglicht ihm die Weitergabe seiner Gene.17 Die Bauten der Laubenvögel befinden sich oft in Sichtweite, was die Weibchen zu Vergleichen ermuntert und den Konkurrenzdruck bei den Männchen erhöht. Wer nicht genug Farben findet, bedient sich auch mal bei den Nachbarn.18 Der Ideenklau ist keine menschliche Erfindung. Die erfolgreichsten Künstler können sich auf diese Weise mit Dutzenden von Weibchen verpaaren. Wer nicht kreativ genug ist, stirbt aus. Schönheit ist der Preis für die Unsterblichkeit.
Biologen gehen sogar so weit, die Baukünste des Laubenvogels als sekundäres Geschlechtsmerkmal zu bezeichnen. Die Gestaltung der eigenen Lebenswelt lässt ihre Bewohner attraktiv, begehrenswert und vital erscheinen. Kreise aus leuchtenden Blütentönen wie Blau, Orange oder Gelb bilden einen spannenden Kontrast zu den gräulichen Brauntönen der Gräser und Zweige, die sie für das Flechtwerk ihrer Nestbauten verwenden.19 Tragwerk und Dekor bilden hierdurch eine gestalterische Einheit, die jedem Element seine Wirkung lässt. Wo keine Farbe, kein Kontrast und kein Farbklang unbedacht bleibt, kann auch nicht weggenommen oder ergänzt werden, ohne die gesamte Komposition zu schwächen. Doch woher wissen Laubenvögel eigentlich, was schöne Farben sind und wie sie damit schöne Lebensumwelten gestalten können?
Ganz einfach, sie richten die Farbauswahl und Komposition an den Verhaltensänderungen aus, die sie bei ihrer Zielgruppe bewirken wollen. Präferiert das Weibchen Blau, dann basiert die Gestaltung ganz auf dieser Farbe. Der männliche Seidenlaubenvogel sammelt zum Beispiel bevorzugt blaue Blüten, Früchte und Schwanzfedern, die er zu kunstvollen Ornamenten anordnet. Manche Vögel betätigen sich auch als Maler, indem sie Früchte zerkauen und die gewonnenen Farbstoffe mithilfe ihrer Federn am Bau verstreichen. Damit das Blau besser zur Geltung kommt, werden Farbkontraste geschaffen, was der Laubenvogel durch die Komposition von Blau mit rosa Blütenblättern oder purpurfarbenen Federn erreicht. Mit großer Selbstverständlichkeit machen Laubenvögel auch von Resten der Zivilisation Gebrauch. Wenn Laubenvögel farbige Objekte wie Verschlüsse von Trinkflaschen, Becher und Löffel in den Schnabel bekommen, dann bauen sie aus Plastikmüll kunstvolle Installationen mit Hunderten von Einzelteilen, die in der Tierwelt einzigartig sind.
Status. Die soziale Hierarchie der Farben
Auffällige Farben sind ein biologisches Merkmal von Dominanz. Nach der »Handicap-Hypothese« haben die Männchen mit den auffälligsten Farbtrachten schon deshalb gute Chancen bei den Weibchen, weil sie noch am Leben sind.20 In den Augen der Weibchen haben sie besonderen Mut bewiesen, denn die Zurschaustellung auffälliger Farbmerkmale provoziert nicht nur die Konkurrenz, was zu dauerhaften Machtkämpfen führen kann, sondern weckt auch den Appetit potenzieller Feinde. Wer seine Farbpracht offensiv zur Schau stellt, muss sich das Statussymbol leisten können.
Schauen wir uns dazu die Hackordnung der Hühnervögel an, die das Sozialverhalten aller Gruppenmitglieder steuert. Der evolutionäre Nutzen von Farbhierarchien zeigt sich immer dort, wo die einzelnen Mitglieder sozialer Gemeinschaften von klar erkennbaren Rangordnungen profitieren. Bei den etwa 250 bekannten Arten der Hühnervögel ist der Sexualdimorphismus meist sehr stark ausgeprägt. Die geschlechtsspezifischen Statusgruppen der Hähne und Hühner sind sofort und eindeutig an ihrer Farbigkeit erkennbar. Die Farbtracht der Junghühner ähnelt den graubraunen Tarnfarben der Hennen, wobei je nach Art noch einige spezifische Farbmerkmale hinzukommen. Die Farben der alten und kranken Tiere wirken verblasst. Die dominanten Männchen sind nicht nur bunter, sondern auch größer, schwerer und kräftiger. Sie sorgen für die innere Ordnung, den sozialen Zusammenhalt und die äußere Sicherheit der Gruppe. Dafür stehen sie ganz oben in der sozialen Hierarchie.
Die prägnantesten Bunttöne zeigen sich an den langen prachtvollen Schwanzfedern wie den meist nackten Kamm-, Kehl- und Ohrlappen, die stark durchblutet sind und bei emotionaler Erregung deutlich anschwellen. Die Kämme vieler Arten wie die unserer Haushühner sind immer signalrot gefärbt. Bei den Hennen erreicht die Schwellung und Rötung der Kämme ein Maximum während der Legeperiode. Die trächtigen Hühner bilden daher eine eigene Statusgruppe, die von den anderen klar unterscheidbar ist.
Am Erscheinungsbild der Männchen tritt die soziale Funktion der Farben noch deutlicher zum Vorschein. Die Köpfe und Hälse dominanter Männchen sind auffällig gefärbt, während die Rangniederen deutlich blasser daherkommen, was ihre Chancen bei den Weibchen zunichtemacht. Sie fügen sich in ihr Schicksal und unterstützen den farbenprächtigsten Hahn bei der Eroberung der Hennen, was sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaft und langfristig auch ihren Fortbestand fördert. Am spannendsten jedoch sind die Farbveränderungen, die bei Schwäche, Krankheit oder Tod des Anführers zu beobachten sind. Beim Sieger der Hahnenkämpfe um die Macht sorgen genetische Veränderungen in verhältnismäßig kurzer Zeit für ein farbenprächtigeres Aussehen. Aus dem subdominanten wird ein dominanter Phänotyp.21 Farbe ist das Statussymbol, mit dem der neue Herrscher seinen Rang in der Gruppe manifestiert. Ein Blick auf den Symbolgebrauch des Purpurs, auf den ich im zweiten Teil des Buches zu sprechen komme, weist erstaunliche Parallelen zur Farbhierarchie der Hühnervölker auf.
Verständigung. Die Sprache der Farben
Da Farben das Verhalten so stark steuern, stellt sich die Frage, ob der Austausch von Farbcodes in der Tier- und Pflanzenwelt bereits eine Sprache ist. Die Klärung der kommunikativen Funktion des Sinnesmediums bildet einen Schwerpunkt meiner eigenen Farbforschung, die von den biologischen Ursprüngen bis zum Symbolgebrauch führt.
Alles Leben steht untereinander und mit der Umwelt in einem ständigen Austausch. Mit jeder neuen Erkenntnis über die Zeichensysteme in Flora und Fauna wächst unsere Einsicht, dass die Sprache keine Erfindung des Menschen ist, sondern eine Grundbedingung der Evolution. Die moderne Bio- und Zoosemiotik führt uns vor Augen, dass jedes Lebewesen mit seiner Umwelt kommuniziert und dafür alle Mittel nutzt, die ihm zur Verfügung stehen.22
Farbe ist das leistungsfähigste Kommunikationsmittel der Natur, was allein schon der Aufwand belegt, den ein Organismus in die Produktion und Verteilung von körpereigenen Farbstoffen und die neuronalen Kapazitäten für das Farbensehen investieren muss. Der größte Aufwand steckt in der Produktion des Seheindrucks, der uns natürlich viel mehr zu erzählen hat als die Farben, aus denen er besteht.
Farben sind das Sinnesmaterial und der Programmcode unserer Bilder, die wir heute mit einem Klick auf das Display unserer Smartphone-Kameras erstellen und in Echtzeit mit Adressaten auf der ganzen Welt austauschen können. Pflanzen und Tiere verfügen über viel einfachere Kommunikationsmittel, die dennoch ihren Zweck erfüllen. Die Farbensprache der Tiere führt uns vor Augen, wie gut diese nonverbale Verständigungsform in komplexen sozialen Gemeinschaften funktioniert. Jedes Individuum kann seine Gefühle, Gedanken und Handlungsabsichten durch Farben zur Sprache bringen und hierdurch gezielt Wirkung erzielen.
Chamäleons sind bekannt als Magier des Tierreichs, da sie ihre Körperfarben nach Belieben wechseln können. Doch die Frage, warum sie das tun und wie sie es anstellen, blieb lange Zeit ein Mysterium. Doch mit dem steigenden Interesse an den Geheimnissen der Natur wird immer deutlicher, dass diese Zeichensysteme auch unserer Sprachkultur zugrunde liegen.
Die Farbensprache der Chamäleons weist nicht nur ein Repertoire an bedeutsamen Zeichen auf, sondern besitzt auch eine semantische und syntaktische Struktur. Die Reptilien nutzen ihre Farbwechsel, um anderen Mitgliedern ihrer Sprachgemeinschaft konkrete Bedeutungen zu signalisieren, um sie zu Handlungen wie Verhaltensänderungen aufzufordern. Die Adressaten zeigen wiederum durch Farbsignale, ob und wie sie die Botschaft verstanden haben. Sie signalisieren ihre Antworten in differenzierter Form, was zur Weiterführung oder auch zum Abbruch der Konversation führen kann. Alle Mitglieder dieser Sprachgemeinschaft kennen diese Farbcodes und gebrauchen sie, um sich untereinander zu verständigen.
In ihrer angestammten Umgebung sind Chamäleons nicht einfach zu entdecken, da die Köperfarbe der Reptilien perfekt an ihre Umgebung angepasst ist. Doch anders als die meisten Tiere sind sie in der Lage, die Farbe ihrer Körperhülle zu verändern, um ihrer Umgebung etwas mitzuteilen und sich mit ihren Artgenossen zu verständigen. (Das tun wir übrigens auch, wenn wir durch Farben kommunizieren, doch mit ganz anderen Mitteln.) Seine wundersame Fähigkeit zum Farbwechsel verdankt das Chamäleon »intelligenten« Materialien, die in zwei Hautschichten seiner Körperhülle eingebettet sind. In der tiefer liegenden Hautschicht befinden sich Iridophoren, die ein Gitternetz aus Nanokristallen bilden und durch Interferenzeffekte für schillernde Buntfarben sorgen. Die typischen Farbwechsel entstehen durch Veränderungen des Gitterabstandes, die über physische Faktoren wie den Blutdruck und die Muskelanspannung gesteuert werden. Dem Chamäleon stehen damit aktive wie passive Kommunikationsmittel zur Verfügung.23
Wenn ein Chamäleon keinen Kontakt will und seine Ruhe braucht, dann passt es sich der Farbigkeit seiner Umgebung an. Auch wir nutzen unauffällige Kleidungsfarben, wo wir nicht auffallen oder ungestört bleiben möchten. Die Farbigkeit eines Chamäleons nimmt hingegen sichtbar zu, wenn es emotional erregt ist, was den aufmerksamen Artgenossen nicht entgeht, die solche Botschaften intuitiv verstehen. Hinter dem faszinierenden Farbenspiel können sich Gefühle wie Wut und Aggression oder Zuneigung und Liebe verbergen. Für Machtkämpfe steht den Reptilien ein ganzes Repertoire an Farbcodes zur Verfügung, mit dem sie ihren Konkurrenten Verhaltenszustände anzeigen, die zwischen Dominanz und Unterwerfung liegen. Signalfarben wie leuchtende Rot-, Gelb- und Orangetöne, die oft in grellen Kombinationen auftauchen, signalisieren dem Kontrahenten höchste Kampfbereitschaft und geben ihm eine unmissverständliche Warnung. Wer hingegen seinen Rückzug ankündigen will, um einen Kampf zu vermeiden oder zu beenden, vermittelt seine Absicht durch matte Farben, die zugleich auch an Kontrast verlieren.
Weibchen sind bei den Chamäleons an ihrer dezenten Farbtracht erkennbar, bei der pastellige Töne dominieren. Wenn sie paarungswillig sind, kommen weibliche Farben verstärkt zur Geltung. Wer jetzt sofort an Rosa denkt, hat eine weitere Gemeinsamkeit zu unserer Farbensprache entdeckt. Männchen werden von den Farbsymbolen der Weiblichkeit erregt und zur Kontaktaufnahme ermuntert. Befruchtete Weibchen legen sich hingegen dunkle Muster auf ihren zarten Farben zu, um aufdringlichen Bewerbern ihr Desinteresse zu demonstrieren und weitere Flirtversuche zu unterbinden. Männchen nutzen Signalfarben wie Blutrot, Neonorange und Neongrün sowie spektakuläre Farbkontraste, um dem anderen Geschlecht durch ihre Schönheit aufzufallen und Begehren zu erregen. Sie tun dies, da vitale Farben, wie bereits ausgeführt, die effektivste Strategie der Werbung sind. Männchen fragen attraktive Weibchen zudem mit speziellen Farbsignalen höflich an, ob sie an einer Paarung interessiert sind. Diese geben wiederum durch Farbsignale kund, was sie von dem Annäherungsversuch halten. Das Männchen merkt daran, ob sich weitere Versuche lohnen oder ob bei diesem Weibchen einfach nichts zu erreichen ist.
Wenig attraktiv wirken blasse Farben, die Alter und Krankheiten kennzeichnen. Jungtiere können im Wettstreit noch nicht mithalten, da sie ihre unauffällige Farbtracht, die zwischen Beige, Ocker und Schwarz liegt, noch nicht ablegen können. Sie müssen warten, bis sie »sprachfähig« geworden sind, was erst dann eintritt, wenn sich die Iridophoren in den Hautschichten gebildet haben.
Die Farbensprache ist ein Instrument der Mündigkeit, denn durch die selbst gewählten Farbsignale vermitteln Chamäleons der Gemeinschaft ihr Einverständnis oder auch ihre Ablehnung der vorgefundenen sozialen Hierarchie. Wie die meisten Tiere bekommen auch wir kaum etwas von den oftmals sehr angeregten Unterhaltungen der Chamäleons mit, da das Frage-und-Antwort-Spiel meist in so kurzen Intervallen erfolgt, dass es von trägeren und farbschwächeren Augen wie den unseren nicht zu sehen ist. Chamäleons sind Meister der geschützten Farbkommunikation. Sie sehen viermal schneller als wir und können Ziele in Entfernungen von einem Kilometer noch scharf und kontrastreich auflösen. Durch ihre herausstehenden drehbaren Augen erhalten sie einen panoramaartigen Rundumblick von 342 Grad, mit dem sie zugleich ihre Vergangenheit wie ihre Zukunft sehen.
Sieben biologische Funktionen der Farbe
Grafik nicht lesbar? Sie finden die Abbildungen auch unter diesem Link: https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/hb-drupal-droemer.active-value.com/s3fs-public/2020-03/Buether_Macht-der-Farben_Biologische-Funktionen.pdf
Das größte Kommunikationssystem der Erde. Die Evolution des Farbensehens
Das Wunder des Farbensehens
Die Farben der Erde verdanken wir so unglaublichen Zufällen, dass man dabei fast an Wunder oder Vorsehung glauben könnte. Das erste Wunder offenbart sich, wenn wir den Abstand zwischen Augen und Sonne in den Blick nehmen. Das Sonnenlicht reist über eine Entfernung von rund 150 Millionen Kilometern durch die endlose Weite des Universums, bevor es nach etwa acht Minuten auf die Erde trifft, wo es augenblicklich reflektiert wird und ein Strahlungsbild der Oberfläche erzeugt. Durch die Kernfusion der Sonne gelangt die unfassbare Energieleistung von 3,8 × 1026 Watt pro Sekunde ins All. Bis zum Kontakt mit der hochempfindlichen Netzhaut unserer Augen reduziert sich die mittlere Leistung auf ein perfektes Maß von 1367 Watt. Diese sogenannte Solarkonstante schuf die Voraussetzung für die Entwicklung des Farbensehens.
Durch die Umlaufbahn der Erde um die Sonne schwankt die Wegstrecke des Lichts um etwa drei Prozent. Am Unterschied zwischen Sommer und Winter erleben wir ganz direkt, was die damit verbundene Energieschwankung für unser Farbensehen bedeutet. Der sichtbare Farbraum reduziert sich während der lichtarmen Jahreszeit so dramatisch, dass uns der blaue Himmel und die brillanten Farben sonniger Urlaubsorte wie ein Schlag treffen, wenn wir aus dem Flugzeug steigen. Setzen wir die Energieleistung in Bezug zur erleuchteten Fläche, erreicht die Beleuchtungsstärke des Sonnenlichts etwa 100000 Lux. Mit Kunstlicht erreichen wir im Mittel etwa 500 Lux, also weniger als ein Prozent. Das erklärt, warum Farben bei Tageslicht völlig anders aussehen als bei Kunstlicht. Wenn Sie Kleidung kaufen, dann verlassen Sie sich nicht auf den Blick in den Spiegel, sondern gehen damit nach draußen ins Sonnenlicht. Das gilt natürlich auch für den umgekehrten Fall. Wenn Sie Fliesen für innen liegende Räume wie Bäder im schönsten Sonnenlicht aussuchen, dann sind Sie vermutlich entsetzt über das Resultat. Das Licht ändert nicht nur die Helligkeit, sondern auch alle anderen Farbeigenschaften wie den Buntton und Glanz oder die Transparenz und Farbsättigung. Betrachten Sie Dinge immer im richtigen Licht, denn nur so erhalten Sie Kontrolle über die Farbwirkungen.
Doch wie sieht es mit der Beleuchtungsstärke auf unseren Nachbarplaneten aus? Auf dem Mars, der in einer 1,5-fachen Entfernung um die Sonne kreist, ist es nicht nur leblos und kalt, sondern es gibt dort für uns auch kaum Farben zu sehen. Das liegt nicht allein an der Beleuchtungsstärke, die dort nur etwa 60 Prozent geringer ist als auf der Erde. Wo es kein Leben gibt, kann sich auch keine Farbvielfalt entwickeln. Noch dramatischer für das Farbensehen wäre ein geringer Abstand zur Sonne. Auf der Venus ist die Solarkonstante fast doppelt so hoch wie bei uns, was eine mittlere Temperatur von 464 Grad Celsius auf der Oberfläche erzeugt. Die lebensfeindliche Umwelt würde irreparable Schäden auf unserer Netzhaut verursachen, ähnlich wie ein Laserpointer, der länger als 0,25 Sekunden auf eine Stelle gerichtet bleibt. Bei modernen Lasern verstärken wir die Lichtemission heute so weit, dass wir damit bis zu 40 Millimeter dicken Stahl durchtrennen können. Wie durch ein Wunder ist das Verhältnis zwischen der Energieleistung der Sonne und ihrem Abstand zur Erde absolut perfekt für unser Farbensehen.
Die Frage, was das Phänomen der Farben hervorgebracht hat, hat viele der bedeutendsten Physiker bis in unsere Tage hinein beschäftigt. Isaac Newton hielt seine Antrittsvorlesung an der Royal Society über seine Theorie der Farben, die er auf unveränderliche Lichtteilchen oder Korpuskel zurückführte.24 Die Korpuskeltheorie veröffentlichte er 1704 in seinem Hauptwerk Opticks.25
Etwa hundert Jahre später kamen Thomas Young und Augustin Fresnel mit ihrer Wellentheorie zu einer ganz anderen Erklärung. Sie betrachteten Farben als energetische Schwingungen, die gleich den Wellen der Meeresoberfläche Interferenzmuster erzeugen. Wie dieses Prinzip der Lichtbeugung funktioniert, können Sie an den schillernden Spektralfarben jeder Ölpfütze beobachten. Das Strahlungsspektrum der Sonne durchdringt den Ölfilm, wird dort gebrochen und von der darunterliegenden Wasserschicht gespiegelt. Es durchdringt den Ölfilm erneut, wird von der Luftschicht reflektiert und zurück durch die Ölschicht geschickt. Durch den ständigen Richtungswechsel bilden sich Schwingungen, die sich wie Wasserwellen immer wieder treffen und überlagern. Trifft ein Wellenberg auf ein Wellental, löscht sich die Energie aus. An diesen Stellen bleibt der Ölfilm transparent. Wo sich die Wellen gegenseitig verstärken, nehmen wir Farben wahr. Die Wellenlänge bestimmt den Farbton. Die Wellenhöhe, auch Amplitude genannt, wirkt sich auf die Eigenschaften des Farbtons wie seine Helligkeit und Sättigung aus.
Das Verhältnis von Licht und Farbe war hiermit für die Physik geklärt. Doch dann kam plötzlich noch einmal alles ganz anders. Kein Geringerer als Albert Einstein erbrachte den Nachweis, dass Lichtwellen auch ein Teilchenverhalten zeigen, was ihm 1921 den Nobelpreis und uns die Erkenntnis des Welle-Teilchen-Dualismus gebracht hat. Der von Einstein entdeckte »Fotoelektrische Effekt« zeigt, dass die Energie der Elektronen nicht von der Intensität des Lichts abhängt, sondern von der Wellenlänge, die wir als Farbe wahrnehmen. Aus den bereits zur Seite gelegten Korpuskeln von Newton wurden plötzlich Photonen, die als Lichtquanten oder Lichtteilchen elektromagnetische Wechselwirkungen erklären. Obwohl Farben heute in der Physik auf das elektromagnetische Wellenspektrum des Lichts zurückgeführt werden, bleibt ihre Natur immer noch ein rätselhaftes Phänomen. Farben besitzen sowohl eine Wellen- als auch eine Teilchennatur. Als Wellenphänomen kann sich die Strahlungsenergie der Sonne völlig unsichtbar im luftleeren Raum des Weltalls ausbreiten, das uns hierdurch lichtlos und schwarz erscheint. Die Strahlungsenergie nehmen wir erst dann als Licht und Farbe wahr, wenn sie mit den Materieteilchen interstellarer Staubwolken, von Himmelskörpern oder der Erdoberfläche in Wechselwirkung tritt.
Wunder oder Glück, wenn wir den Einfluss des Lichts auf das Farbensehen betrachten, muss noch ein zweiter erstaunlicher Zufall zur Sprache kommen. Für das Sehen nutzen wir nicht das gesamte energetische Spektrum des Sonnenlichts, das sich von der Gammastrahlung im Bereich von 0,005 Nanometer bis zur Niederfrequenzstrahlung ausdehnt und Wellenlängen von 100000 Kilometer erreicht. Farben nehmen wir nur in dem verhältnismäßig winzigen Bereich zwischen 380 und 780 Nanometern wahr. Doch exakt in diesem Nanobereich des Spektrums erreicht unser Sonnenlicht seine größte Intensität. Den besten und gleichmäßigsten Empfang von Umweltinformationen haben wir daher genau auf den Frequenzen, die wir über die Sensorik unserer Augen als Farben wahrnehmen! Wären die nur geringfügig kürzeren Wellenlängen des Lichts intensiver, also das UV-Licht im Bereich von 100 bis 380 Nanometer, würde die Strahlung unsere Netzhaut zerstören. Wären die längeren Wellenlängen intensiver, hätten wir zwar besseren Empfang mit unseren Smartphones, doch für das Farbensehen sind diese Frequenzen unbrauchbar.
Kommen wir zuletzt noch auf den dritten wunderbaren Zufall zu sprechen, durch den sich die Farben im Verlauf der Evolution zum größten Kommunikationssystem der Erde entwickeln konnten. Die Fasern pflanzlicher Zellwände und tierischer Bindegewebe, auch Fibrillen genannt, haben einen Durchmesser von 300 bis 500 Nanometer, was genau dem Bereich entspricht, in dem wir die meisten Farben sehen.26 Die Wellenlängen des sichtbaren Lichts, die wir als Farben wahrnehmen, korrespondieren erstaunlich genau mit den Molekülgrößen organischer Substanzen wie den Zellmembranen von Pflanzen oder den Hautzellen von Menschen und Tieren. Wir können daher nicht nur Farben, sondern auch die hiervon codierten Inhalte in hoher räumlicher Auflösung und optimaler Detailgenauigkeit sehen. Die Chlorophyllmoleküle der belebten Natur sind nicht nur die Grundbausteine des Lebens, sondern sie sind auch biochemisch wie genetisch eng verwandt mit den Sehfarbstoffen unserer Augen.
Wenn wir das Energiefeld der Sonne als Sender von Umweltinformationen betrachten, dann sind die Farbsehzellen in der Netzhaut unserer Augen der perfekte Empfänger. Das Sonnenlicht ist daher nicht nur unsere Hauptenergiequelle, sondern zugleich auch die wichtigste Datenressource der Erde. Erst die Entwicklung des Farbensehens hat es uns ermöglicht, das Informationspotenzial dieser Quelle für unsere anschauliche Erkenntnistätigkeit zu nutzen.