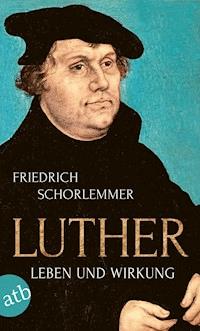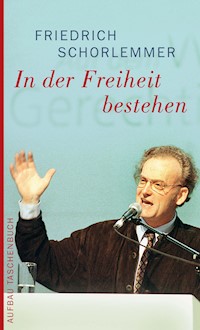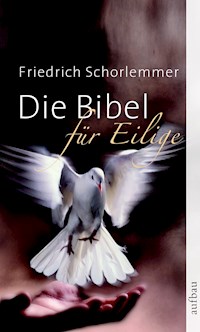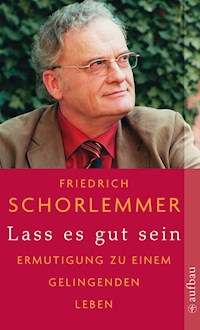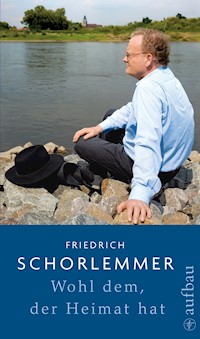Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Buch über das Leben - wie es ist. Und wie es sein könnte. Eine Gesellschaft von Egoisten, getrieben von der Sucht nach Mehr, kann nicht überleben, sagt Friedrich Schorlemmer. Wenn wir unseren Blick nicht weiten, auch auf andere hin, sind wir verloren. Gier lauert hinter jeder Tür. Sie will das schnelle Glück und sieht den anderen nur als Konkurrenten. Durch Konsum, durch Haben und Besitzen, freilich in einer ewigen Spirale, die keine Zufriedenheit, kein Maß kennt. Glück: das ist Freude, Vitalität, innere Freiheit und Weite. Gier macht unfähig zum Genießen, sie verengt den Blick und verhärtet das Herz. Gier will haben. Glück will sein. Leben braucht Sinn. Wo wir der Gier verfallen verhindern wir den Sinn. Schorlemmer zeigt Konsequenzen für den Einzelnen und für unsere Gesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedrich Schorlemmer
Die Gier unddas Glück
Wir zerstören,wonach wir uns sehnen
Impressum
Titel der Originalausgabe: Die Gier und das Glück
Wir zerstören, wonach wir uns sehnen
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80457-1
ISBN (Buch): 978-3-451-33515-0
Inhalt
1. Glück haben, das wollen alle
2. Und wer ohne Gier ist, trete vor!
3. Unseren Lebenshunger kultivieren
4. Den Reichtum der Empfindungen auskosten
5. Die kleinen Wohltaten und das große Glück
6. Zwischen Genuss und Weggeben:Hans im Glück
7. Neugier – offen sein mit allen Sinnen
8. Wie wir zerstören, wonach wir uns sehnen
9. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat
10. Das Doppelgesicht der Gier
11. Die Macht des Geldes
12. Vom Marxismus zum Marktismus
13. Das Giersystem – Reichtum als Diebstahl
14. »Öffnet eure Gesichter«
15. Das Geldsystem in der Krise
16. Wie die Macht schmeckt
17. »Narren soll man nicht über Eier setzen«
18. Leben hat einen Wert, nicht einen Preis
19. Auf der Suche nach dem menschlichen Maß
20. »Aus so krummem Holze gemacht«
21. Das Un-Glück und die Melancholie
22. Unsere Welt ist zu retten
23. Im Einklang leben lernen
24. Liebe den Baum wie dich selbst
Dank
1.Glück haben, das wollen alle
Glück. Glück! Glück? Größer geht’s wohl nicht?! Wie oft führen wir das so verheißungsvolle Wort im Munde. Die Philosophien über das Glück stehen in heftigem Widerstreit. Und füllen Bibliotheken. Vielleicht genügte schon dies: mit sich selber auszukommen, aber ganz ohne Schrecken vor sich selber und ohne Erwartung an sich selber. Oder wenigstens: der Schrecken nicht zu groß, die Erwartung auch nicht zu groß. Das Glück ist jener Moment, da man vergisst, an welche Bedingung es geknüpft sein könnte. Ein flüchtiges Durchgangsstadium, das flüchtigste überhaupt. Es ist, als müsse man sich hüten, es zu bemerken. Wer nachdenkt, ist ja mitunter ohnehin schon verloren. Wer aber ausgerechnet übers Glück nachdenkt, der hat plötzlich einen besonders unsicheren Weg unter den Füßen. Glücksgier und Verlustangst kommen aus elementarer Verunsicherung.
Glück ist zum Jagdobjekt geworden. Als lieferte diese Jagd Fetteinreibungen gegen den Weltfrost, der uns dauernd damit angreift, dass deutlicher als das Glück das Unglück zu fassen sei: indem wir von erstickten Kindheiten verbraucht werden, von unauflösbaren Ängsten, von massiver Verdrängung, vom Glauben an überlebte Ideen. Kurz: von Schwächen – statt von Möglichkeiten, von Fremdem – statt von uns selber. Was immer dem Menschen geschieht, er ist an das Grundgesetz gebunden, das nicht selten Tragödien zur Folge hat: Er ist für sich selber verantwortlich! Zum Grund der Tragödie wird oft genug die Tatsache, dass man sich dieses Gesetzes sehr spät, zu spät bewusst wird. Aber letztlich rettet da nichts, keine Religion, keine Zwangslage, kein Befehlsnotstand, kein geleisteter Eid – Treue (zur Idee, zur Macht), eben noch Tugend, kann plötzlich zum Versagen werden; Untreue, eben noch als Feigheit bezeichnet, ist plötzlich Charakter. Wie viele eingebildete Berge besteigen wir, und wachen erst auf, wenn wir beim Absturz wirklich bluten.
Das Glück bildet kein Volk, und es ist nicht Aufgabe einer Gesellschaft, Glück zu produzieren. Dafür sind Glücks- und Sinnvorstellungen zu ausgefächert. Ein System, das meint, ein Maß für Glück vorgeben zu können, sieht sich irgendwann genötigt, den undankbaren Bürger anzuklagen, der sich dem vermeintlichen Füllhorn verweigert. Was ein Staat kann und soll: dem Einzelnen die Möglichkeit der Teilhabe schaffen, sich als Mitglied einer Gemeinschaft, als Bürger einer Gesellschaft zu fühlen.
Unser Leben verläuft gleichzeitig entlang zweier Linien. Die eine führt hinab. Schwinden, Erschöpfung, häufig Verhärtung; sinkende Ansprüche, Sich-Abfinden mit allen Unzulänglichkeiten, irgendwann, womöglich, ein Tod im Leben. Der hässliche Zynismus der Enttäuschungen. Die zweite Linie: Bemühen, Drang nach oben, Selbstüberwindung, immer mehr guter Wille, Seele, Weisheit, irgendwann, womöglich, ein anderer Tod im Leben: ein Sich-Verflüchtigen durchs Abwerfen von Belastungen. Beide Linien gleichen zwei Blutkreisläufen, sind ein Gegenströmen, in das das Glücksempfinden partikelgleich aufgenommen ist, strudelnd, nicht zu bannen im Fluss der Dinge. In einem Gedicht übers Glück schrieb Karl Krolow: »Das reicht für Augenblicke: / denn vorüber ist es schon. / Und der Teufel sitzt im Genicke / zu rasch – als des Glückes Lohn.« Wie viele Plätze der Einzelne im System der verworrenen Realität einnehmen kann! Einübung in eine Selbstvergewisserung: Ich komme vor. Zum Begreifen gehört freilich die Einsicht, dass es nicht darauf ankommt, sich in diesem System der Wirklichkeit die Hauptrolle nehmen zu wollen.
Was nun ist Lebenskunst angesichts dessen? Es geht wohl um die Kunst, in einer verteufelt freizügig ausschlagenden Gesellschaft auf lebenswerte Weise Ich zu sagen. Der heutige Mensch ist kein »ungeteiltes« Wesen mehr; er kann sich nur behaupten, wenn er gewissermaßen eine extrem geforderte Vielheit lebt; jeder Einzelne ist eingebunden in ein nicht wegzuschiebendes System von Fragmentierungen, Arbeitsteilungen, Aufspaltungen, von Gleichzeitigem; jeder ist einer Unmenge von Vernetzungen und Befehlsketten ausgesetzt – man fühlt sich eingespannt in einen fortwährenden Wechsel von undurchschaubaren Prozessen. Unser Ich ist demnach innerlich, seelisch ein vielgestaltiges Wir, das in einer rasenden Globalisierung ständig von Selbstverlust bedroht ist. Und in gleichem Maße gefährdet, zum falschen Rettungsring zu greifen: der Selbstgier.
Lebenskunst heißt demnach: Bevor ein fremdes, äußeres Wir als Schutz, als Auffangmasse angerufen wird, damit man der Einsamkeit und den Verwirrungen der eigenen Freiheit entgehen kann, empfiehlt es sich, das andere Wir, diese vielfarbige Welt in uns selbst, dieses Wogen von Stärken und Schwächen, optimal zu organisieren. So, dass der Selbstverlust in gleicher Weise gering gehalten wird wie die Neigung zur Selbstsucht.
Es kann nicht gelingen, Fremdbestimmtheit und Bedingtheit des Daseins völlig aufzuheben, aber man kann mit einer Haltung durchs Leben gehen, die es beiden quälenden Faktoren schwer macht. Das System ist schuld! Der Satz stimmt immer – aber es bleibt die nüchtern zu betrachtende Tatsache, dass man sein Leben trotzdem weiterleben muss. Wer das will, hat zu sortieren: Was kann ich ändern, was nicht? Was tue ich und was lasse ich mit mir geschehen? Wo bewahre ich etwas, und wo erkenne ich, dass mir Berufung auf Vergangenes nur als »Tablette« dient, um schmerz- und anstrengungsfrei durch die neue Gegenwart zu kommen? Freiheit der Wahl.
Es geht um ein Leben, das sich zur Schwäche bekennt. Das sich Versagen leistet. Das noch im tiefen Ernst den Spielcharakter aller Handlungen entdeckt. Das gewissermaßen selbst das noch erlebt, was es vermisst. Das sich wohlfühlen will. Das dennoch nicht im Schmerz verzagt. Ja, das noch die Resignation zur Kultur erhebt. Die Skala der Stichwörter umfasst alles, was sich mit unserem Körper und unserer Seele verbindet: Pflege, Berührung, Schönheit, Atmen, Ernährung, Rausch, Klugheit, Müdigkeit, Tod. Vorm Tod die Kunst des Älterwerdens: jene Einübung in eine natürliche Passivität, welche einem heiteren Loslassen von Wichtigkeit, Bedeutsamkeit, Einflusskraft die körperliche Grundstimmung beigibt. Loslassen, so der Philosoph Wilhelm Schmid, das von einer Erfahrung spezieller Schönheit begleitet werden möge. Zunächst hat jeder Mensch nichts Wertvolleres auf der Welt als sich selbst. Das macht misstrauisch gegenüber allen, die vor Selbstlosigkeit gar nicht mehr als Ich existent sind. Die euphorisch, bis zur Unkenntlichkeit eintauchen in eine »Sache«. Lebenskunst ist lustvoller Aufenthalt in der Mitte, zwischen der Größe, die es nicht gibt, und dem Glück, das eine Furie des Verschwindens bleibt. Jeder, der es wirklich schafft, mit sich selbst befreundet zu sein (im Leben, wie es ist, nicht im Leben, wie es sein sollte!) – vielleicht ist der ein wahrer Partisan einer Zukunft, in der sich die Menschheit wieder anschickt, in großen guten Zusammenhängen zur Einheit zu finden.
Das Einverständnis mit der Welt ist nicht a priori Resignation. Es kann Widerstand sein, wenn man ausgerechnet in Umständen, die uns als gehörige Kraft bedrängen, einen Freiheitsraum gründen kann. Einen Freiheitsraum, darin man die eigenen Zweifel, Ohnmachten, Unsicherheiten überdauert – indem man ihnen etwas abgewinnt.
Der Trost des Daseins liegt so nicht im Vertrösten, sondern im Be-Greifen alles Gegenwärtigen. Den strömenden Regen nicht mit Sonnenhoffnung verfluchen, sondern Schönheit in ihm entdecken. Im Grimm über das Menschheitsprodukt Welt die Menschenliebe preisen. Im Herbst-Sturm etwas sehen wollen, das unter aufhellendem Himmel verschwände. Eine Meinung haben und sofort an deren Gegenteil basteln – und nicht erschrecken, wenn es funktioniert; unser Innenleben ist nämlich reicher, als wir oft zugeben wollen (oder dürfen). Die Luft sagt uns etwas, der Glanz spricht, die Trübnis auch. Und: Alle Luft ist wie geschaffen, den Zufall zu genießen. Zufall und Zufall summieren sich zu einer Fügung, die am Leben halten kann.
Schade vielleicht, dass wir auf dem Weg von der Haustür zu unseren täglichen Zielen so vielen Verkehrszeichen folgen müssen und dadurch nicht mehr ganz so wach sind für den Andrang ganz anderer, älterer Zeichen. Aber es gibt sie, wenn wir nur richtig schauen. So Weniges kann uns wirklich belehren, aber so Vieles kann uns Winke geben. Wilhelm Schmid hat einmal von der »Weltinnenpolitik« des Ich gesprochen: zuallererst mit sich selber ausmachen und in sich selber austragen, was man der Welt gern als Richtung empfehlen würde. Sich selbst als den Zusammenschluss all jener Unverträglichkeiten begreifen, die das Leben kräftig aufbietet, um nur ja schön kompliziert zu sein. Mit diesen Unverträglichkeiten dann nicht arbeiten, sondern spielen. Oder zu spielen versuchen. So einfach ist das ja nicht, wenn man gleichzeitig das Alltägliche mit jenem Ernst betrachten muss, den es uns andauernd abpresst.
Offen zu sein für die Welt, seine Sinne auszubilden für sehnsüchtige Wahrnehmung, Charakter zu entwickeln für Güte und freundliche Ausstrahlung – das kann keine Partei lehren. Weltveränderung beginnt mit dem Bild, das ich meinen Mitmenschen jeden Tag von mir selber anbiete. Auch das Unfrohe im Tonfall, das Unglück in den Blicken, das Maskierte in den Zuwendungen, das Mürrische in den Urteilen verändert die Welt – und genau da beginnt auch Glück. Die Passformen der Welt wollen uns immer anders, als wir sind und sein möchten. Gegenwelt aber ist möglicher, als wir uns oft zutrauen.
Nachdenken über Leben, das sich zur Schwäche bekennt und das annimmt, was ist, in aller Widersprüchlichkeit, in allen Spannungen, das heißt auch: unseren Lebenshunger, unsere Gier und unser Glück zusammensehen, innere Nähe und fließende Übergänge, aber auch den Gegensatz zu erkennen, die Bruchstellen zu verorten, zu sehen, wo ein vitaler Impuls zur tödlich zerstörerischen Kraft wird. Und dabei immer auch auf sich selber zu achten, nicht nur auf die anderen oder die Umwelt. Gierigsein ist eine Gefahr und kann zur tödlichen Sünde werden. Aber Gier als elementare, äußerst expressive Lebensäußerung, in der auch viel von unserem Glücksverlangen als Verlangen nach der prallen Fülle des Lebens steckt, kann auch eine unverzichtbare Lebens-Kraft sein. Glück ist ja nichts Vergeistigtes, es vereint Sinnenerleben und Sinnerfüllung. Damit verbindet sich der Entschluss, einfach zu leben, mit dem Wunsch, einfach zu leben, also danach, dem Dionysischen, dem Überschwang und Überschuss Raum zu geben und zu lassen.
Wer also meint, Gier sei nichts, was glücklich machen könnte, hat nicht gelebt. Und er übersieht: Ohne die Kraft des Begehrens, ohne die Gierkraft gäbe es einfach viel zu wenig Leistungsanreiz mit Gewinnerwartung, Selbstanstrengung mit Selbstentfaltung. Freilich: Glückserleben bleibt aus, sobald alles Leben sich mit Gier verschwistert, sobald Gier nach immer mehr die alles beherrschende und alles verschlingende Kraft wird, die nichts anderes und keinen anderen mehr im Blick hat. Die Glücksillusion des »Immer-Mehr« neigt zur Kälte gegenüber denen, die im Zuwenig dahinvegetieren müssen. Die Frage bleibt, für uns als Einzelne, aber auch für die Gesellschaft: Wie können wir – ohne unter das verlockende Joch einer Gier zu geraten, die nur unfrei macht – gewinnen, wonach wir hungern und wonach wir uns sehnen: ein intensives, ein glückendes Leben? Denn das wollen alle.
2.Und wer ohne Gier ist, trete vor!
Sie sind noch nie gierig gewesen? Dann haben sie nicht nur etwas verpasst, dann sind Sie unter Ihren Möglichkeiten geblieben. Selbst gierig zu essen, kann glücklich machen, zumal dann, wenn einer lange Zeit gierig sein musste, um etwas (ab)zubekommen.
Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich von Gier rede. Wer bis zum 16. Lebensjahr täglich am großen Mittagstisch mit Eltern, sechs Geschwistern, der Oma und oft noch ein, zwei Gästen miterlebt hat, wie er sich beeilen musste, wenn er beim Nachschlag noch etwas abbekommen wollte, der neigt lebenslang zum hastigen Essen. Es wird zur Gewohnheit. Genießen und gieriges Verschlingen werden eins – im alsbald wohligen Sattsein. Bei mir ist es so und mein Sohn hat diese Unart von mir »geerbt«. Wie gern trinke ich nach anstrengender Arbeit – stets am liebsten auf nüchternen Magen – eine Flasche Bier. Ich setze sie an und trinke sie genussvoll-hastig aus. Das ist für mich ein ganzheitlicher Glücksmoment.
Als Zehnjähriger hab ich mir mit meinem Freund Heinz öfter verbotene kleine Vergünstigungen verschafft – durchs Naschen irgendwo im Erdbeerfeld des Gärtners weiter draußen, in der Kirschplantage auf dem Weg zum Badesee. Mundraub sei kein Diebstahl, hieß die selbstentschuldigende Formel. Hastig die süßen Früchte in den Mund stopfen, dann aber schnell weg. Ja nicht erwischt oder auch nur erkannt werden.
Wie ich es immer drehe und wende – Satz und Gegensatz stimmen. Glück und Gier gehören zusammen. Ebenso stimmt die Alternative Glück oder Gier. Wir erleben Glück ohne jede Gier und Gier ohne jedes Glück. Glück durch Gier und Gier statt Glück. Abgesehen vom stillen Glück der Eremiten, von in sich ruhenden weltfernen Klosterbrüdern und zurückgezogenen bedürfnislosen Buddhisten ist Glück nicht vom Überschwang, von genussvollem Überfluss samt der emotionalen Kraft der Lebens-Gier ablösbar. Wer sich ganz sicher gierfrei wähnt, wer für sich die Hand ins Feuer legen will, der trete vor. Verirrt und verlockt, verwoben und versucht im Bann der Geld-, der Macht-, der Sex-, der Fress-, der Darstellungs- und Geltungsgier mit narzistischen Anteilen – wer sich ganz sicher ist, der trete vor. Dazu treten die Derivate der Gier, die Alkohol- und Anerkennungssucht, der Kauf- und der Schnelligkeitsrausch, der Arbeits- und der Schönheitskult, die Hass- und die Liebesbesessenheit, die Obsessionen im Sport, in der Kunst, in der Wissenschaft, bei genüsslicher oder gemeiner Geheimnisschnüffelei oder einträglicher Geheimnisverräterei. Die Raffgier und Rachgier, die Gewinn- und Ehrbegier, die Profit- und Anerkennungsgier entfachen ungeahnte Kräfte. Dem Giervirus ist Aggressives und schier Unstillbares eigen. Das Sonnensüchtige oder das Redselige gehören zum Menschen. Einige jener dem Menschen eigenen Obsessionen sind glückhaltig, andere zerstörerisch. Die humane, Maße und Maßstäbe setzende Herausforderung liegt für jeden einzelnen darin, mit seinen Obsessionen fertigzuwerden, hinter den eigenen Süchten der tiefer wurzelnden Sehnsucht auf die Spur zu kommen und dieser Spur zu folgen. Und aus innerem Antrieb der Sehnsucht ein Maß zu geben und damit eine Gelassenheit zurückzugewinnen, die nicht in Leblosigkeit, Emotionslosigkeit, Begeisterungslosigkeit mündet.
Das ist keineswegs nur eine individuelle Angelegenheit: Die Gesellschaftsform, die zentral vom menschlichen Gierimpuls angestachelt wird, lässt sich von einem Wachstumsdiktat treiben, das in destruktive Zwänge führt. Die als alternativlos deklarierte Wachstumsideologie mit Wohlstandsversprechen impliziert rücksichts- und voraussichtslose menschliche Herrschaft über die Natur mit einem unstillbaren Energiehunger und einer Verbrauchs- und Wegwerfkultur, die immer schneller immer mehr Ressourcen des Globus irreversibel verbraucht. Als deren Symbole können die atomaren Brennstäbe, die Unmengen von Elektroschrott und die Milliarden Plastiktüten gelten. Die Natur, unsere Mutter Erde, wird erschöpft. Die Erschöpfte bekommt bisher nicht wirksam genug Stimme. Unser menschliches Glücksverlangen wird sich der Ambivalenz der Gier nach der Maxime Albert Schweitzers zu stellen haben: »Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.« Ich will – mit aller Macht glücken in einem glückenden sozialen und kulturellem Umfeld. Und dazu gehört das Feld, der Garten, der Wald, das Meer in einem gedeihlichen Welt-Klima.
Und warum soll nicht der Wein dazugehören? Warum nicht guten Wein trinken und die gesamte Schöpfung im Gemüt schmecken? Das ist nicht zu hoch gegriffen, das ist nicht zu sentimental gedacht. Essen und Trinken sind gleichsam tonangebende Politiker unserer Weltwerdung. Bei Essen und Trinken lernen wir, was uns bekömmlich ist. Und geht es darum nicht immer? So zu leben, dass Leben bekömmlich ist? Uns selber, unseren Nächsten, der Welt. Essen und Trinken als Zentralorgane unserer Sinnlichkeit – für Wein und Brot und für Willensbildung. Die Lippen – wir wollen sie nicht für Bekenntnisse spitzen, mit denen wir uns durchlügen müssten. Der Mund – er soll nicht behandelt werden wie das Maul, das man stopft. Die Zunge – wir wollen nicht auf sie beißen, nur weil etwas nicht an die Öffentlichkeit soll. Die Zähne mögen beißen, aber nicht auf den Granit der Hartherzigen oder auf den Gummi der Bürokraten. Der Hals – er ist dafür da, dass wir schlucken, aber nicht die Wahrheit, nur weil sie unbequem ist.
Essen und Trinken als Einheit von Notwendigkeit und Genuss. So etwas wie der Psalm 104, der die gesamte Schöpfung preist und sie besingt als einen Oikos in dem alles aufeinander abgestimmt ist:
»Du lässest Wasser in den Tälern quellen,
dass sie zwischen den Bergen dahinfließen,
dass alle Tiere des Feldes trinken
und das Wild seinen Durst lösche.
Darüber sitzen die Vögel des Himmels
und singen unter den Zweigen.
Du feuchtest die Berge von oben her,
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
Du lässest Gras wachsen für das Vieh
und Saat zu Nutz den Menschen,
dass du Brot aus der Erde hervorbringst,
dass der Wein erfreue des Menschen Herz
und sein Antlitz schön werde vom Öl
und das Brot des Menschen Herz stärke.«
Das nenne ich Glück: auch einmal weltversunken sein, mit Freunden Weinlese betreiben, dann zur Weinprobe gehen, bleiben, bis Probe in Gelingen übergeht, ins Gelingen, kräftig und bewusst und gern über den Durst zu trinken. Über den Durst, nicht unters Niveau. Den Kopf verlieren bis zur Überraschungsfreude am nächsten Morgen: wie klar er trotzdem ist! Wein trinken, Wasser predigen? Ja, am anderen Morgen ist das so, und noch besser ist: auch das Wasser trinken! In großen Zügen Frische! Was will ich mehr, was willst du mehr?
3.Unseren Lebenshunger kultivieren
Ich erinnere mich, wie begierig wir 1963 als Studentinnen und Studenten nach einem kultivierten Zusammensein waren, wie wir es richtig genossen haben, dichtgedrängt im Wohnzimmer des Pfarrhauses in Wilmersdorf (Uckermark) auf dem Fußboden zu sitzen – nach drei Wochen schlafen in einer Scheune über dem Kuhstall, mit wenigen Schüsseln kaltem Wasser zum Waschen abends und tagsüber Kartoffeln lesen nach Norm. Wie freuten wir uns am geschmackvoll eingerichteten, warmen Wohnzimmer, an der Musik von der Schallplatte und daran, wie die Frau des Pfarrers Mozart auf dem Klavier spielte!
Die Erinnerung an den unbändigen Wunsch auf ein anderes, ein freieres Leben, an unseren Hunger auf Kultur, die Verbindung mit unseren damaligen Gastgebern blieb in uns Studenten wach. Am 30.10.1989 gründeten wir im evangelischen Krankenhaus in Berlin formell den »Demokratischen Aufbruch«. Wieder waren wir zu Gast bei Pfarrer Thomas Passauer, der nun ein evangelisches Krankenhaus leitete. Wir hatten unbändige Lust auf Demokratie. Wir hatten die SED-Herrschaft gründlich satt. Aber wir wollten auch Südfrüchte satt … Wir lebten gewissermaßen eingesperrt im stickigen Warteraum der Geschichte und fanden uns vor 25 Jahren plötzlich wieder im D-Zug der Weltereignisse. Seither scheint alles zu rasen. Dabei blieb Bedenkenswertes bedenklich auf der Strecke, etwa die Zeit für intensive Gespräche, das Näher-Beieinanderliegen von Wohnen, Leben und Arbeiten.
Langsam habe ich es wieder gelernt, das Langsame zu genießen, die Glücksmomente durch Intensität und Behutsamkeit zu verlängern und zu steigern – beim Gespräch, beim Spazierengehen, beim Essen, beim Lieben, beim Singen, beim Radfahren. Unerreichbar sein für viele Stunden und ganz da sein, wo ich gerade bin. Glück genießen, wo sich mir Zeit schenkt, wo ich nichts will, als da zu sein und nur das zu tun, was ich gerade tue, wo ich schweige, schaue, lausche, mich ins Gras lege und die Wolken über mir hinwegziehen lasse. Lange, bis der Himmelsmoment sich mir zur Ewigkeit ausdehnt.
Es wäre übertrieben, wenn ich an meine Kindheitund Jugendjahre zurückdenke und sagen würde, wir hätten damals gehungert, aber es war sehr oft – besonders am Monatsende – knapp. Und wenn dann ein Westpaket kam! Mein Vater inszenierte das Auspacken geradezu. Die Kordel wurde nicht durchgeschnitten. Sorgsam lockerte er alle Knoten, rollte die wertvolle Schnur erst auf, bevor er sich an das Packpapier machte. Er bremste uns Geschwister, steigerte unsere Begier und die Spannung, bis sie fast nicht mehr zu ertragen war – bis zum Genuss der Westschokolade und der saftigen Apfelsine. Später gab es auch »Ernte 23« für mich. Für Vater immer prächtige Zigarren.
Was ich damit noch einmal sagen will: Gier ist auch Glück, Glück gibt es auch in der Gier. Es ist manchmal nicht leicht zu trennen. Aber wahr ist zugleich: Wir verlieren, wonach wir uns sehnen, wir zerstören, worauf wir hoffen, wenn es Gier ist, was uns antreibt und beherrscht. »Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele.« (Mt 16,26) Die Frage des Nazareners – vor 2000 Jahren ausgesprochen – ist aktueller denn je.
In der geistigen Orientierungskrise unserer Zeit spiegelt sich das wider, was Erich Fromm die »Pathologie der Normalität« genannt hat. Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts skizzierte Erich Fromm in »Haben oder Sein« die »seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft«. Er beschrieb den Typus des von sich entfremdeten Menschen, der in verzweifelter Gier materialisierten Besitz anhäuft, seinen vergeblichen Versuch, in den konsumierbaren Dingen zu sich selbst zu finden.