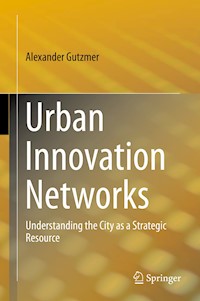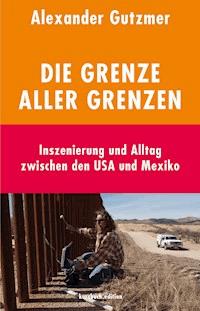
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: kursbuch.edition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie ist insgesamt über 3000 Kilometer lang und soll – geht es nach Donald Trump und seinen Anhängern – endgültig den Zustand einer veritablen Befestigungsanlage erreichen: "La Frontera", wie die Grenze zwischen Mexiko und den USA genannt wird, aufgerüstet zum Bollwerk gegen den armen Süden und die von dort einströmende illegale Migration in den reichen Norden. So weit die Rhetorik, die viel weiter ist als die faktische Realität. Das gigantomanische Projekt ist noch nicht in Angriff genommen – lediglich die Test-Errichtung von prototypischen Mauersegmenten bei San Diego ist mit gebührendem Medienpomp begleitet worden. Für den vielleicht noch lang anhaltenden Moment wichtig aber ist schon einmal das damit gegebene Signal: wir drinnen, ihr draußen. Ganz das Klischee von der Grenze als Schutzwall gegen alles Unerwünschte von draußen. Dieses medial vermittelte schlichte Bild steht in einem grotesken Gegensatz zur vorhandenen Vielschichtigkeit, in der sich diese "Grenze aller Grenzen" präsentiert. Nie ist eine Grenze einfach nur linearer Verlauf. Immer und in jeder Hinsicht ist sie soziales Konstrukt und spiegelt als solches die Gesellschaft und schließlich sich selbst. Sie selbst wird zum Medium, das sich durch gelebten Alltag, Kunst und Kulturprojekte genauso verändert wie durch Ökonomie und Politik und nicht zuletzt durch Drogenkartelle, Gewalt und Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grenze ist nicht nur da, wo sie als Linie verläuft: die weltbekannten Murals im Chicano Park in San Diego – mit vielseitig interpretierbaren Botschaften (siehe Kapitel »Transgressive Architektur«).
Impressionen aus dem Chicano Park.
Der »Kiosko« in architektonischer Anlehnung an einen Maya-Tempel – oder als kulturkritische Simulation.
Alexander Gutzmer
Die Grenze aller Grenzen
Inszenierung und Alltag zwischen den USA und Mexiko
kursbuch.edition
Inhalt
Einleitung Porosität und Vielschichtigkeit: Grenze als Entgrenzungsphänomen
Mediating Borderlines: Die Medialität der FronteraDer Verleger Oscar Cantú
Gemauertes Symbol: Trump und die Illusion des StabilenDie Aktivistin Marisela Ortiz Rivera
Ökonomien der Grenze: Bataille im WüstensandDer Ökonom Tito Alegría
Kulturmechaniken: Die größte Leinwand der WeltDie Künstlerin Ana Teresa Fernández
Screen Wars: Horror und StacheldrahtDer Filmemacher Matthew Heineman
Transgressive Architektur: Bauen, wo nichts sein darfDer Architekt René Peralta
Vom schwierigen Raum: Entgrenzte ÖkologienDer Aktivist Oscar Romo
Schlusswort
LiteraturÜber den AutorImpressum
Einleitung Porosität und Vielschichtigkeit: Grenze als Entgrenzungsphänomen
Alles beginnt mit der Sprache. Kein Ding sei, wo das Wort gebricht, schrieb Stefan George einmal. Kein Ort ist, wo das Wort gebricht, könnte man Georges Gedanken erweitern. Und damit wäre man direkt bei dem »Ort«, um den es in diesem Buch geht – der Grenze zwischen Mexiko und den USA, der »Frontera«. Denn diese hat ihre eigene Sprache. Es gibt sie, die Terminologien, die nur hier verwendet werden oder die hier etwas anderes bedeuten als im Norden der USA, in New York oder in Mexiko-Stadt.
Ein Ort im gängigen Verständnis des Begriffes ist die Frontera natürlich nicht. Sie hat kein Zentrum, sondern ist nur von linearer Ausdehnung – 3144 Kilometer, um genau zu sein. Ihrem Wesen nach ist sie zunächst ein künstlicher Bruch zwischen Orten. Und zugleich ein Systembruch. Eine Demarkationslinie zwischen zwei Ländern respektive Kulturkreisen respektive Weltsystemen. Und eine eigene Sprache? Die hat sie natürlich im offiziellen Sinne auch nicht. Man lehrt an Schulen kein »Grenzisch«. Aber – die Frontera wirkt sprachproduktiv. Sie bringt ihr eigenes Sprachverständnis hervor. Hier wird eine distinkte Sprache gesprochen, werden distinkte Terminologien gepflegt. »A border vocabulary has grown up on both sides«, schreibt der Schriftsteller Paul Theroux in einem Essay über eine Reise entlang der Grenze.1 Und insofern ist die Grenze vielleicht eben doch ein »Ort«, etwas räumlich Reales. Und etwas, das sich lohnt, intensiver betrachtet zu werden.
Wie aber funktioniert diese Sprache der Grenze? Manche Begrifflichkeiten leiten sich schlicht aus dem Clash der beiden Kulturen, die hier aufeinandertreffen, ab. Der populäre Begriff »gabacho«, schreibt Theroux, bedeute hier nicht Frosch und sei auch kein despektierlicher Ausdruck für »Franzose«. Gabacho gelte hier schlicht den Nordamerikanern, eine Abwandlung des »gringo« sozusagen. Und Gringo ist auch schon kein Lobgesang. Der Begriff leitet sich von »griego« für »Grieche« ab und bezeichnete ursprünglich jemanden, der unverständlich Spanisch sprach. »Das klingt alles griechisch für mich« – heißt: Ich verstehe nichts.
Nette Geschichte. Allerdings: Viele Idiome, die Theroux auf seiner Grenzreise entdeckt hat, haben einen weniger harmlosen Ursprung. Sie sind die Begleitmusik der Machtübernahme durch die so omnipräsenten wie unsichtbaren Drogenkartelle. Natürlich kommt das Wort »cartel« selbst häufig vor. Von »mafia« ist ebenso oft die Rede. »Piedra« (Stein) ist ein Insider-Ausdruck für Crack-Kokain, mit »marimba« oder »mota« ist Marihuana gemeint, »agua de chango« (Affenwasser) bezeichnet eine spezielle flüssige Heroin-Mixtur. »Montado«, spanisch für »bestiegen«, bezeichnet hier einen unschuldig (was auch immer man darunter versteht) Gefolterten. »Coyote« gilt nicht dem Tier, sondern einem Drogen- oder Menschenschmuggler. »Hancon«, also Falke, nennt man die Späher.
Wer, wie Theroux, sich die Zeit nimmt, beiderseits der Grenze zu reisen, hört Begriffe wie diese im Slang der Bewohner, speziell der Jugendlichen. Er kann sie aber auch gesungen hören. Sprachbildend wirkt entlang dieser Grenze nämlich nicht zuletzt die Musik.2 Es gibt grenzspezifische Gesänge, sogenannte »corridos«. Manche davon handeln von den Heldentaten der Kartellchefs. Das sind dann die »narcocorridos«. In Balladenform huldigen diese den kriminellen Bossen, in denen die Sänger so etwas sehen wie furchtlose Helden, die der Obrigkeit ein Schnippchen schlagen (was sie ja auch unbestreitbar tun).
Die ursprünglichen Corridos, die Vorform der Narco-Songs, verpackten Liebeskummer, Fernweh oder auch Unterdrückung durch die Obrigkeit (die lokale oder nordamerikanische) in stets etwas rührselige Zeilen. Von »música norteña« ist in diesem Zusammenhang auch die Rede. Norteña bezeichnet dabei den Norden Mexikos. Noch weiter aus dem Norden, also aus Texas oder Kalifornien, klingen wehmütige Songs über Freiheit und grenzenlose Selbstentfaltung hinüber in den Süden (Country-Songs).
Alle drei Musikstile haben gemein, dass sie ein ganz eigenes Vokabular pflegen und damit eigene, gegen offizielle Lesarten oder politische Definitionen arbeitende Perspektiven auf die Grenze werfen. Sie sind ein Vehikel dessen, was die Soziologin Elena Dell’Agnese als spezielle Form der »spatial representation« bezeichnet 3 – eine Form der Repräsentation, die keinem vordefinierten Kanon folgt. Die diversen Corridos unterschiedlicher Herkunft verkomplizieren den Blick – und passen daher gut in eine Grenzregion. Denn sie verstehen das, was Grenzen als soziologisches Untersuchungsobjekt gerade auch in Zeiten der Globalisierung so spannend macht – und was auch dieses Buch treibt und legitimiert.
Im Grunde sind Grenzen tragische Erscheinungen. Sie wollen klären, kontrollieren, Komplexität reduzieren – und scheitern damit dramatisch. Denn heutzutage sind Grenzen porös und vielschichtig, werden aufgeweicht, neu gezogen, interpretiert, unterminiert oder auch einfach ignoriert. Ihrer Funktion als Verhinderer von Komplexität kommen sie nur noch rudimentär nach.
Für kaum eine Grenze gilt dies in stärkerem Maße als für jene zwischen den USA und Mexiko. Sie repräsentiert in gewisser Hinsicht die ultimative Komplexität einer Grenze schlechthin. Sie stellt den Inbegriff vom Prinzip Grenze dar, ist schlicht »La Frontera«, wie sie von Künstlern, Fotografen, Journalisten, Migranten in einer Mischung aus Faszination, Respekt und Angst genannt wird.4 Ihre Vielschichtigkeit bildet einen fundamentalen Gegensatz zu den irritierend einfachen Versprechen von US-Präsident Donald Trump, eben zu jenem, eine gigantische Betonmauer zwischen Mexiko und den USA zu errichten. Doch auch hier ist das Scheitern an der Komplexität vorprogrammiert. Das zeigt schon der Blick auf die verschiedenen parallel existierenden Erscheinungsformen dieser Grenze. Über weite Strecken ist sie von natürlichen Barrieren wie Wüsten, Bergketten oder Canyons geprägt. Ab Ciudad Juárez/El Paso bis in den Golf von Mexiko verläuft sie entlang des Flusslaufs des Rio Grande beziehungsweise Río Bravo, wie ihn die Mexikaner nennen. Durch feste Grenzzäune oder Metallwände ist heute nur etwa ein Drittel des gesamten Grenzverlaufs gesichert.
Viel mehr geht auch nicht, glauben viele. Es sei technisch unmöglich, deutlich mehr Grenzanlagen zu bauen, sagt etwa der in Tijuana lebende Architekt René Peralta (siehe dazu das Kapitel »Vom schwierigen Raum«). Flüsse und tiefe Schluchten würden vielerorts einfach Baumaschinen und Materialtransporte fernhalten. Auch daher hat sich an der Konstruktion des einen, des umfassenden Walls bisher noch kein US-Politiker ernsthaft versucht. Die Folge: Bis heute gibt es zahlreiche Stellen, die einen Grenzübertritt zu Fuß »eröffnen«. Man spricht daher auch von einer »porösen« Grenze. Wobei – diese Porosität ist natürlich trügerisch: Immer wieder kommen bei dieser Art von Grenzübertritt Menschen auf tragische Weise ums Leben – 251 waren es im Jahr 2015. Initiativen wie die NGO »Humane Borders« in South Tucson, Arizona tun alles, um genau das zu verhindern.
Und dennoch oder gerade deswegen ist die Frontera heute von realer Präsenz. Längst ist sie nicht mehr unsichtbar wie zu Zeiten ihrer ursprünglichen Festlegung. Der heutige Verlauf der Grenze ist das Ergebnis des mexikanisch-amerikanischen Krieges von 1846 bis 1848. Texas, weite Teile Kaliforniens und andere Regionen wurden danach den USA zugeschlagen. Doch auch dann rückten nicht sofort die Mauerbauer an. Erst mit dem Jahr 1924 begann die Errichtung der ersten regelrechten Grenzbefestigungen.5 Seitdem aber haben die USA die Grenze, in leichten Wellenbewegungen, sukzessive immer massiver befestigt.
Der Klassiker ist heute eine Art Blechwall aus riesigen Metallplatten. Mit dem Ausbau begann kein Republikaner, sondern in den 1990er-Jahren der damalige US-Präsident Bill Clinton. In Texas gab es 1993 erste Maßnahmen zur stärkeren Grenzsicherung, ab 1997 erfolgte eine systematische Befestigung. Von 1994 bis 2000 wurde die Grenze in Kalifornien ausgebaut, ab 1999 in Arizona.
Mit den dabei zum Einsatz gebrachten Wellblechplatten verbindet sich eine überaus eigentümliche Symbolik. Zum Teil nämlich stammten sie aus Landeflächen, wie sie im Ersten Irakkrieg in der Wüste von Kuwait verwendet worden waren. Die Grenzbefestigung gegen Mexiko als Fortführung von Nahostkriegen – mehr brutale Symbolik geht kaum. Die Frage darf erlaubt sein, wie America-Great-Maker Trump dies mit seinem neuen Patriotenwall überhaupt noch steigern will.
Natürlich war Clintons Recyclingmaßnahme auch eine ökonomisch-baupraktische Entscheidung. Man sparte schlicht Material und damit Geld. Präsident Trump wird sich an derlei Überlegungen künftig vielleicht auch noch orientieren müssen. Experten schätzen, dass seine vorgeschlagene Betonwand gigantische 9,5 Millionen Kubikmeter Baumasse verschlingen würde und damit dreimal so viel wie der legendäre Hoover-Damm, die beeindruckende Staudammkonstruktion zwischen Nevada und Arizona.
Für Trump ist, wie ich im Kapitel »Ökonomie der Grenze« erörtern werde, die Mauer ein Image-Projekt. Doch schon Clinton verfolgte mit »seiner« Art der Grenzbefestigung, wenn man so will, kommunikative Ziele. Die Wiederverwendung der Landeplatten aus dem Golf signalisierte, wie man diese Grenze auch verstehen kann und wohl auch verstehen muss: als hochgradig symbolisches, um nicht zu sagen nachgerade surreales Phänomen. Der Golfkrieg wurde und wird hier quasi weitergekämpft. Und mithilfe der Transformation der Wellblechpaneele in Grenzelemente wird zugleich eine Symbolträchtigkeit, ja eine Medialität geschaffen, die dieser Grenze etwas über ihre physische Ausdehnung weit Hinausgehendes verleiht. Genau an solchen Mechanismen setzt dieses Buch an.
Die Grenze als komplexes kulturelles, ja als mediales Phänomen zu interpretieren bedeutet, den Blick auf das Fluide und Nichtmaterielle zu richten. Was nicht heißt, ihre physische Realität zu ignorieren oder auch nur gering zu schätzen. Denn nur durch ihre massive Konkretheit ist die Grenze überhaupt in der Lage, die hier zur Diskussion stehende Medialität zu produzieren – für die im Übrigen auch ihre Porosität eine Rolle spielt.
Denn alle Befestigungen hin oder her – kaum eine Grenze stellt sich als so porös dar wie die Frontera. Nicht nur sind die Befestigungen unvollständig, sie werden zudem von unzähligen Schmugglertunneln unterquert. Allein in Kalifornien entdeckten Grenzpatrouillen seit dem Jahr 2006 nicht weniger als 13 neue Tunnel.6 Und natürlich dürfte es noch weit mehr geben. In gewisser Hinsicht ist es der Tunnel und nicht die Brücke, das Wachhäuschen oder der Zaun, welcher architektonisch als Symbol für die Sozialstruktur und den Geist dieser Grenze gelten kann.
Experten unterscheiden drei unterschiedliche Tunneltypen. Die einfachsten liegen nur einen halben Meter unter der Erde und beginnen auf beiden Seiten nur wenige Meter jenseits der Grenzzäune. Die etwas anspruchsvolleren machen sich bestehende Wasser- und Abwasserleitungen zunutze. Schmuggler graben solche Stollen von Mexiko aus bis zu einem Parkplatz auf der amerikanischen Seite und kaschieren den Ausgang oft als Kanaldeckel. Schließlich gibt es professionell gegrabene Großtunnel mit Elektrizität, Ventilation und Schienen. Solchen Profikonstruktionen spüren die Grenzer mit seismologischen Geräten nach.
Zuletzt vermeldeten Drogenfahnder im April 2017 den Fund eines solchen Hightech-Tunnels: 800 Meter lang war dieses komplexe Stück Schmuggellogistik – wie gesagt, eines von 13 in jüngerer Zeit entdeckten. Die letzten drei endeten alle auf derselben, parallel zur Grenze verlaufenden Straße in San Diego.
Zur Sicherung der Grenzlinien wenden die USA pro Jahr zweistellige Milliardenbeträge auf. Tausende Beamte patrouillieren zu Fuß oder zu Pferd, per Auto, Flugzeug, Schiff oder Fahrrad. Auch Drohnen sind zunehmend im Einsatz. Hinzu kommen freiwillige Freizeitgrenzer, die ihre Bürgerwehraktivitäten für einen patriotischen Akt halten.
Die Zahl der Menschen, denen die »illegale Immigration« trotzdem gelingt, ist nicht bekannt. Man schätzt jedoch, dass mehr als die Hälfte der elf Millionen ohne Papiere in den USA lebenden Menschen irgendwann über die mexikanische Grenze gekommen sind. Und ohnehin ist die gesellschaftliche Realität von einer hermetischen Abschottung weit entfernt. Denn neben den sogenannten »Illegalen« überqueren 330 Millionen Personen und 140 Millionen Fahrzeuge jährlich die 46 offiziellen Übergänge ganz legal. Viele davon sind schlicht Touristen oder besuchen Verwandte. Andere etablieren das, was zum wirtschaftlichen Wachstum in beiden Ländern beiträgt: den täglichen Fluss von Arbeitern und Gütern über die Grenze hinweg.
Volkswirtschaftlich gesehen sind Grenzen nicht immer kontraproduktiv. Unter bestimmten Bedingungen – die zwischen Mexiko und den USA vorliegen – kann eine Grenze zu einem regelrechten wirtschaftlichen Kraftfeld werden. Das funktioniert, wie ich im Kapitel »Kulturmechaniken« erläutern werde, nicht zuletzt über sogenannte »Sonderwirtschaftszonen«. Nicht umsonst werden diese, gewissermaßen institutionalisierte ökonomische Ausnahmezustände, gerne in Grenzgebieten etabliert. Im Norden Mexikos hat das sogar zu einem eigenen Konzept von Wirtschaftsbetrieb geführt – den sogenannten »maquilas« beziehungsweise »maquiladoras«. Hinter den Begriffen verbergen sich Montagebetriebe, welche importierte Einzelteile oder Halbfertigware zu Endprodukten zusammensetzen.7
Die aus der Luft als flächendeckende Vergrauung sichtbare Teppichstruktur der Maquiladoras ist wirtschaftlich effizient, architektonisch aber Ausdruck einer hochgradig problematischen Kahlschlagphilosophie. Hier wird nicht für die Ewigkeit gebaut, nicht einmal für einen überhaupt definierten Zeitraum oder für ein bestimmtes Produkt. Vielmehr braucht es maximal flexible, billige, jederzeit umdefinierbare Montageräume. Dieser Bedarf führt räumlich zur totalen Neutralität der erzeugten Flächen – die sich nicht nach den Bedürfnissen der Menschen richten, sondern nach rein abstrakt ökonomischen Kriterien gestaltet sind. Wer hier arbeitet, entscheidet sich nicht für angenehme oder zumindest annehmbare Arbeitsbedingungen. Er oder sie handelt aus der Not heraus.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die sozialtopografische Positionierung der Maquiladoras: Man baut mit Vorliebe direkt neben Slums. Nicht eine gute Infrastruktur ist entscheidend, sondern die Nähe zu billigen und willigen Arbeitskräften. Das »Wo« ist strategisch wichtiger als das »Was«. Besonders gut ist dies an der später dargestellten Situation um Tijuana zu sehen. Wir erleben dort Produktion im Schatten des Prekären als ökonomische Maximierungsstrategie.
Auch wenn die Bauaktivitäten an der Grenze nicht als architektonisch wertvoll erscheinen mögen – um leeres, verödetes Grenzgebiet handelt es sich nicht. Zwar befindet sich auf der amerikanischen Seite viel Wüste, umso höher ist dafür die Dichte an Menschen und Gebäuden im südlichen Streifen. Darüber hinaus gibt es mehrere grenzbezogene urbane Agglomerationen, sogenannte Doppelstädte. Diese breiten sich auf beiden Seiten der Grenze aus und präsentieren sich wie ungleiche Stadtgeschwister, die einander vielleicht nicht mögen, aber auch nicht ohne einander können. Laredo – Nuevo Laredo; El Paso – Ciudad Juárez; San Diego – Tijuana.
Gerade in Tijuana und San Diego schlagen die Immobilienentwickler zurzeit massiv zu.8 San Diego boomt. Bereits in den vergangenen 20 Jahren haben sich zahlreiche Einfamilienhaussiedlungen in Richtung Grenze breitgemacht. Und auch die Innenstadt wurde massiv verdichtet. San Diego zieht offenbar ökonomische Aktivität aus dem nördlich gelegenen Großraum Los Angeles ab. Von 2000 bis 2013 verdoppelte sich die Anzahl der Innenstadtbewohner, allein im Jahr 2015 wurden dort 1248 neue Wohnungen fertiggestellt. Jetzt zieht auf der mexikanischen Seite Tijuana nach. Sogar Wohnhochhäuser mit bemerkenswerten 2000 Wohnungen befinden sich dort in der Planung.
Jedoch wäre es zu kurz gedacht, San Diego und Tijuana als grenzbezogenes Pars pro Toto zu nehmen. Mit dem hier zu beobachtenden Boom können die anderen Gegenden nicht aufwarten. Dort haben speziell die Drogenkriege zwischen rivalisierenden Kartellen auf Jahre hinweg ökonomisches Wachstum blockiert. Ein Spaziergang durch Ciudad Juárez etwa fühlt sich, obschon die Hochzeit der dortigen Kartellkriege ein paar Jahre zurückliegt, in Teilen immer noch wie der Gang durch eine Gespensterstadt an.
Ein Spezialfall war und ist die Gegend um Tijuana und San Diego übrigens noch in einem anderen Zusammenhang – Stichwort: »Friendship Park«. Dieses kleine Stück Grenzland direkt am Pazifik – das mit bewusster, einheitlicher landschaftlicher Planung eines Parks wenig zu tun hat – wurde im Jahr 1971 als Ort der Begegnung gestaltet. Nur ein durchsichtiger Drahtzaun separierte die beiden Länder, sodass sich getrennt lebende Familien hier zumindest auch zur minimalen körperlichen Berührung treffen konnten. Im Laufe der Jahre wurde der Zaun dann undurchlässiger und schließlich sogar durch einen zweiten auf US-Seite ergänzt. Inzwischen aber werden die Menschen von Norden aus wieder hindurchgelassen, ein Mindestmaß an Berührungen ist also wieder möglich. Auf US-Seite gleicht dieser Park heute einem Picknickplatz mit Tischen und Bänken. Der Friendship Park stellt letztlich eine Art familienorientierte Verkomplizierung des Systems Grenze dar, weil hier das Regime der Trennung erweitert wird durch die Möglichkeit des (begrenzten, politisch gesteuerten) Austausches.
Ergänzt wird diese Verkomplizierung durch sozialkulturelle Ansätze ganz anderer Art – die zahlreichen Architektur- und Kunstprojekte, die sich mit der Grenze befassen und sie dazu nutzen, um sich an unserer grenzfetischisierenden Gegenwart insgesamt abzuarbeiten. Der amerikanische Architekt Teddy Cruz etwa realisiert im Norden Projekte, die sich demonstrativ an der informellen Bauweise um Tijuana anlehnen. Mit seiner gemeinnützigen Organisation »Casa Familiar« entwickelt er nach dem Vorbild mexikanischer Siedlungen generationsübergreifende, integrative, dicht strukturierte Wohnprojekte in den kalifornischen Grenzvierteln. Dieses »Learning from Tijuana« schafft im Ergebnis kostengünstigen Wohnraum im Norden – und unterläuft so das Bild einer einseitigen Nord-Süd-Hierarchie.
Friendship Park wie die Cruz-Projekte sind prototypische Beispiele der Kernthese dieses Buches – dass die Grenze immer unter dem Blickwinkel der Mediatisierung zu verstehen ist, was entsprechend im Kapitel »Gemauertes Symbol« verhandelt wird. Einerseits werden sie medial verhandelt, nicht zuletzt in digitalen Medien; andererseits machen in beiden Fällen Menschen die Projekte zum Anhaltspunkt eigenen symbolischen Handelns.
Gleiches gilt natürlich auch für das große ideelle Gegenstück, für Donald Trumps Idee einer »Mauer der Abgrenzung«. Auch sie führt ein mediales Eigenleben und erzeugt neue künstlerisch-symbolische Projekte. Von der Vision einer homogenen Betonmauer haben sich nicht zuletzt Architekturbüros »inspirieren lassen« zu Initiativen, die meist weniger auf sofortige Verwirklichung aus sind, sondern von vornherein als kulturelles Unterfangen geplant waren. Im Kapitel »Vom schwierigen Raum« kommen Projektansätze dieser Art zur Sprache. Exemplarisch erwähnt werden soll hier nur kurz eine dystopische Idee der Architekten des Büros »Estudio 3.14«. Ihr vor einigen Monaten für einiges Medieninteresse sorgender Vorschlag lautete: eine pinkfarbene Megastruktur als Grenze. Farbgebung als Symbolpolitik.
Die hier diskutierten konzeptionellen Ansätze zeigen: Das (Alb-)Traumbild einer Mauer lässt immer wieder künstlerische wie architektonische Kreativität entstehen. Und das ist auch ein Nebeneffekt der konsequent vereinfachenden Trump-Ideologie. Die Projekte machen auch deutlich, dass der politinstrumentale Bautyp Grenze als Phänomen unterschiedlichste gestalterische wie akademische Disziplinen in ungekannt hohem Maße beschäftigt. Womit eine gängige These der postmodernen Politiktheorie empirisch ad acta gelegt scheint: nämlich jene, dass in Zeiten der zunehmenden wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtungen der vergangenen Jahrzehnte das Konzept der Grenze eine immer weniger wichtige Rolle spielte. Tatsächlich leben wir nicht in einer »borderless world«, wie sie von so manchem Theoretiker wohl mehr herbeigewünscht als sorgfältig analysiert wurde.9 Und das bedeutet, dass es für die raumorientierten Kulturwissenschaften eine spannende und wichtige Aufgabe sein kann, die permanente Verkomplizierung des Phänomens Grenze nachzuverfolgen. Dabei gilt es, einem analytischen »anything goes« keinen Vorschub zu leisten: Es gibt Grenzen, und es gibt sie auch nach wie vor als potenziell reglementierende Regimes beziehungsweise im Foucault’schen Sinne als Dispositive.10 Aber die Art, wie diese Reglementierungen ablaufen, und auch ihr jeweils konkretes physisches Ausdehnungspotenzial sind je unterschiedlich – auch unterschiedlich permeabel.
In diesem Zusammenhang spielt auch das momentan zu erlebende Fragilwerden der Idee vom Nationalstaat eine Rolle. Wenn der Nationalstaat in der Krise ist, sind es auch die ihn umgebenden Grenzen.11 Das erklärt das Defensive, teils auch Verzweifelte im Diskurs über das Konzept der Nation. Neue Raumkonzepte und damit auch neue Mechanismen der Grenzziehung, Definition und Aufrechterhaltung vor allem durch die Politik entstehen quasi täglich. Doch das, was Stabilität schaffen soll, erzeugt eine zunehmend labile Situation, das Konzept der Grenze wird multipel. Um den Prozess dieser Art von Multiplizierung soll es hier wesentlich gehen.
Die genaue Forschungsperspektive ist dabei durch die empirische Untersuchung der speziellen Situation der Menschen an der Grenze entstanden. Ursprünglich stand im Zentrum die Idee, ein Buch über Schicksale von Grenzgängern und Grenzaktivisten zu verfassen, über all jene Individuen und Entscheidungsträger also, die in ganz unterschiedlicher Weise die Grenze durchdenken und verändern, die an und in ihr aktiv sind und daraus eine eigene politische Praxis ableiten. In ersten Vorrecherchen dieser Prozesse fiel mir dabei auf, wie ungemein medial viele der dabei entstehenden Strategien funktionieren. Ob NGO, Soziologe oder Künstlerin – nahezu alle Grenzaktivisten agieren in ihren konkreten Handlungen zugleich auch medial. Sie kommunizieren ihre Aktivitäten über Medien, sie spannen mediale Mechanismen für ihre Aktionen ein.
Und sie tun das in einer Weise und in einer Intensität, dass man den Eindruck gewinnen muss, die Verwendung klassischer Kommunikationsmedien sei hier letztlich nur ein Schritt hin zu einer umfassenderen medialen Strategie. Es scheint eine Ausweitung des Konzeptes des Mediums beziehungsweise des Medialen selbst stattzufinden. Dies ist die Kernthese dieses Buches: Die Grenze selber scheint zunehmend Elemente medialer Vielfalt zu entwickeln. Die Grenzlinie zwischen den USA und Mexiko scheint selber zum Medium zu werden.
Dies wird die Leitperspektive der Untersuchungen in diesem Buch sein. Der ursprünglich angedachte Untersuchungsschwerpunkt, die Grenze als vielfältiges Produkt aus unterschiedlichen Akteurspositionen und Akteursstrategien zu konstituieren, wird beibehalten. Er wird aber durch den medialen Untersuchungsschwerpunkt ergänzt. Die Frontera ist ein Produkt der Aktivitäten sehr unterschiedlicher Akteure und Aktanten.12 Sie ist aber zugleich ein mediales Erzeugnis und fungiert als Medium. Ja mehr noch: Nur durch das Verständnis der Medialität der Grenze können die einzelnen Akteure überhaupt erst zu einer Wirkmächtigkeit gelangen, die sie im Prozess der sozialen Schaffung und permanenten Transformation des fluiden Dispositivs Grenze relevant werden lässt.
Damit verortet sich meine Untersuchung in konzeptioneller Nähe zum Konzept des »Bordering«, über das sich die Kultur- wie Regionalwissenschaften in den vergangenen Jahren der gesteigerten Komplexität des Phänomens Grenze angenähert haben. Dieses Bordering-Prinzip wird in Richtung einer kulturell-symbolischen Perspektive ausgeweitet, man könnte auch sagen konkretisiert. So betrachtet ist Bordering immer auch ein medialer Prozess oder anders argumentiert: Um teilhaben zu können am Prozess des Bordering, also an der sozialkulturellen Konstituierung und Strukturierung der Realität von Grenze, ist eine mediale Strategieentwicklung unumgänglich. Bordering, so argumentiert dieses Buch, ist immer ein medialer Vorgang. Und damit wird die Grenze selbst wirklich zum Medium.
Die Perspektive der »Borderscape« wird also um das Konzept der »Mediascape« ergänzt. Der Terminus der Borderscape, geprägt von dem Soziologen Prem Kumar Rajaram und dem Geografen Carl Grundy-Warr 13, beschreibt das Prozesshafte von Grenzen, ihre sozialkulturelle Konstituiertheit. Eine besondere Rolle spielt dabei das Thema Konflikt: Borderscapes »should be considered as sites of perpetual struggle, where alternative imaginations and beliefs content a space of visibility and fulfilment«.14
Meine perspektivische Erweiterung dieses Ansatzes um den Aspekt Mediascape stütze ich auf folgende These: Um überhaupt in einen Prozess des »Scapens« einzutreten, müssen alle an der Aushandlung sozialkulturell determinierter Grenzhaftigkeiten (Borderscapes) beteiligten Akteure medial agieren. Im Rückgriff auf mediale Prozesse und Logiken entsteht das, was der wachsenden Zahl an »grenzorientierten« Theoretikern als permanenter Prozess der Auflösung von Eindeutigkeiten erscheint. Nicht nur, dass in diesem Zusammenhang unterschiedlichste Medien zum Tragen kommen. Die Grenze selbst wird dabei insofern zum Medium, als sie als solches genutzt wird und auf kommunikativer Ebene im Sinne einer medialen Eigenproduktivität funktioniert. Zum Medium transformiert sich die Grenze also durch die Aktivitäten ihrer Stakeholder. Und nur im Zuge der Akzeptanz dieser spezifischen Medialität werden deren Handlungsstrategien wirkmächtig.
Mein Verständnis des Konzeptes »Mediascape« stellt eine gedankliche Erweiterung der ursprünglichen Idee einer Mediascape von Arjun Appadurai dar, der den Terminus in den 1990er-Jahren prägte und populär machte. Für Appadurai ging es vor allem um die Rolle des Medialen in der globalen Konstitution einer Welt, die auf kulturellen Flows basiert, nicht mehr auf Strukturen oder rigiden politischen Hierarchien. Medien sind für ihn Imageproduzenten, die eine auf diesen Flows basierende Welt überhaupt erst möglich machen.15
Appadurai interessierten vor allem bestehende Medien – Magazine, Fernsehen, Kino, nicht zuletzt auch Werbung. Zu ergänzen wären aus heutiger Perspektive natürlich digitale und soziale Medien. Alle zusammen haben für den Kulturanthropologen die Kapazität, gesellschaftliche Verständigungsmuster zu definieren und zu unterminieren. Sie sind auf diese Weise unerlässlich für unsere globalisierte Gegenwartskultur.
Doch es können eben auch neue Medien in die globalisierte Mediascape eintreten. Mediascape ist selber fluid. Es können Dinge oder Systeme zu Medien werden, die bisher noch keinen medialen Charakter haben. Die Mediascape ist in diesem Sinne selber einem Prozess der Mediatisierung unterlegen.
Mit dem Prinzip der Grenze als neuem Mitspieler in diesem Konzert ist nun aufgezeigt, dass auch die Verhinderung von gesellschaftlichen Flows medial funktionieren kann (durch nichts anderes wirkt ja eine Grenze). Medien ermöglichen Flows, sie verhindern oder lenken sie aber auch. Und die unterschiedlichen Formen der Flows, ebenso wie ihre Inhalte, sind reversibel und potenziell konfliktgeladen. Die Schaffung neuer Medien, der Eintritt neuer Medialitäten in Appadurais Mediascape ist immer auch eine Transformation des Systems der Flows. An kaum einem anderen Medium wird das so deutlich wie am Eintritt des Konzeptes/Dispositivs Grenze in diesen Kanon.
Mit diesem erweiterten Begriff des Medialen nähern wir uns einer Gesellschaftskonzeption, die ihrem Wesen nach immer mit der politrealen Funktionsweise von Grenzen befasst ist – der globalisierungsorientierten Gegenwartskritik von Peter Sloterdijk nämlich. In dieser spielt der Begriff des Medialen immer eine Rolle. Speziell in seiner Gegenwartsanalyse Schäume, dem letzten Band seiner Opus-Magnum-Trilogie Sphären, präsentierte Sloterdijk einen umfassenden Begriff des Mediums.16 Entscheidend dabei ist, dass Medien für ihn nicht unkritisch produktive Glieder der Verbindung von Menschen sind, auch nicht unbegrenzt effektive Vehikel zur Beförderung von Kommunikation. Medien sind nach seinem Verständnis ebenso Elemente der Trennung wie der Verbindung. Medien trennen Menschen voneinander und ermöglichen es ihnen, durch mediale Kommunikation die Grenzen um das (natürlich konstruierte) Selbst immer wieder und immer wieder neu zu etablieren. Medienkompetenz ist im Sinne Sloterdijks nicht zuletzt auch Abgrenzungskompetenz.
Dass das Trennungselement im Medienmechanismus nicht auf den von Sloterdijk primär avisierten Interaktionsmodus von Individuen oder Kleingruppen beschränkt bleiben muss, zeigt sich in der Erweiterung dieses Mechanismus auf das größere Menschengruppen umfassende Konzept der Grenze. Eine Grenze mag als strikt dichotomisch gedachte Zerlegung von Kulturkreisen in »innen« und »außen« versagen und räumlich wie symbolisch mannigfach unterminiert werden. Aber als medial wirkendes Abgrenzungsvehikel entfaltet sie gerade heute eine beträchtliche gesellschaftliche Wirksamkeit. Grenzen trennen Menschen – real-räumlich, aber auch kulturell-symbolisch.
Auch bei der Analyse künstlerischer Strategien im Borderscaping-Prozess gilt es, der häufig zu hörenden Rhetorik der radikalen Unterminierung aller Art von Abgrenzungen mit Vorsicht zu begegnen. Es stimmt, Künstler haben die Kapazität, mit ihren Werken die eindimensionalen Trennmechaniken offizieller Grenzpolitik herauszufordern. Sie erzeugen neue Komplexitäten, indem sie diese Mechaniken mithilfe ihrer eigenen Symbollogik attackieren. Ein Künstler »inverts the reduction process on which border is based, destabilising and perturbing the certainty and definiteness of its essentialist categories«, schreiben Giudice und Giubilaro.17 Das heißt aber nicht, dass das Endresultat dieser künstlerischen Dekonstruktionen eine Welt friktionsfreier Flows wäre, noch viel weniger eine Gesellschaft unzweideutiger grenzüberschreitender Harmonie.
So wollen die in den Kapiteln »Sreen Wars« und »Transgressive Architektur« diskutierten künstlerischen Ansätze natürlich Perspektiven eröffnen, neuen Akteuren (neuen »Stakeholdern«) Handlungsmacht verleihen, politische Dichotomien aufbrechen. Zugleich aber erzeugen sie eben auch neue Friktionen – und ziehen neue Grenzen. Schon die Definition neuer Stakeholder ist ja letztlich ein Prozess der Grenzschaffung.18 Künstler reißen Grenzen ein, aber sie schaffen auch neue – und genau das ist, wenn man so will, ihre Aufgabe. Denn diese Form der Grenzziehung kreiert zugleich neue Projektionsflächen für andere Künstler, neue Konfliktlinien, die artistisch bearbeitet werden können. Eine friktionslose Welt wäre eine kunstlose, die nicht im Zentrum künstlerischer Schaffensprozesse stehen kann. Der medial erweiterte Blick auf das Phänomen Grenze USA – Mexiko geht nicht vom irreversiblen Einreißen bestehender Linien als Endziel aus, vielmehr werden die bestehenden Linien vielfältig medial gespiegelt. So entsteht eine Drei- oder auch Vieldimensionalität: Borderscape und Mediascape erzeugen neue Perspektiven, aber auch neue Perspektivbrüche.
Mediating Borderlines: Die Medialität der Frontera