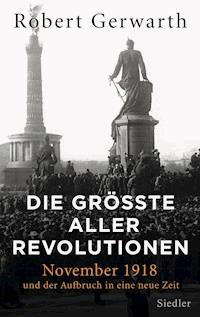
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Blick auf ein epochales Ereignis deutscher Geschichte
Die deutsche Revolution von 1918 – sie gilt noch heute als gescheitert. Eine verpasste Chance, die den Weg zum Aufstieg der Nazis und zur Katastrophe ermöglichte. Ein Fehlurteil, wie der renommierte Zeithistoriker Robert Gerwarth zeigt. Nicht nur zerschlug die Revolution die autoritäre Monarchie der Hohenzollern, sie schuf auf erstaunlich unblutige Weise den ersten deutschen demokratischen Nationalstaat. Gerwarth schildert die dramatischen Ereignisse zwischen den letzten Kriegsmonaten 1918 und dem Hitlerputsch 1923 und beschreibt dabei, wie grundlegend und nachhaltig die Novemberrevolution Deutschland veränderte. Denn wer das Geschehen nur vom Ende her betrachtet, ignoriert, wie sehr die Zukunft damals offen war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Die deutsche Revolution von 1918 – sie gilt noch heute vielen als gescheitert. Eine verpasste Chance, die den Weg zum Aufstieg der Nationalsozialisten und in die Katastrophe ermöglichte. Ein sehr einseitiges Urteil, wie der renommierte Zeithistoriker Robert Gerwarth zeigt. Nicht nur zerschlug die Revolution die autoritäre Monarchie der Hohenzollern, sie schuf auf erstaunlich unblutige Weise den ersten deutschen demokratischen Nationalstaat. Gerwarth erzählt, wie grundlegend die Novemberrevolution Deutschland veränderte. Denn wer das Geschehen nur vom Ende her betrachtet, ignoriert, wie sehr die Zukunft damals offen war.
Zum Autor
Robert Gerwarth, geboren 1976, hat Geschichte in Berlin studiert und in Oxford promoviert. Nach Stationen an den Universitäten Harvard und Princeton lehrt Gerwarth heute als Professor für Moderne Geschichte am University College in Dublin und ist Gründungsdirektor des dortigen Zentrums für Kriegsstudien, das vom European Research Council und der Guggenheim Stiftung gefördert wird. Er ist gewähltes Mitglied der Academia Europaea und der Royal Irish Academy und Autor zahlreicher Publikationen. Sein Buch »Der Bismarck-Mythos. Die Deutschen und der Eiserne Kanzler« (2007) wurde mit dem renommierten Fraenkel Prize ausgezeichnet. Bei Siedler erschienen 2011 seine hochgelobte Biographie Reinhard Heydrichs und zuletzt »Die Besiegten. Das blutige Erbe des Ersten Weltkriegs« (2017).
Robert Gerwarth
DIE GRÖSSTE ALLER REVOLUTIONEN
November 1918
und der Aufbruch in eine neue Zeit
Aus dem Englischen vonAlexander Weber
Siedler
Die englische Originalausgabe erscheint 2019 unter dem Titel »1918 and the Making of Modern Germany« bei Oxford University Press.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Erste Auflage
Copyright © 2018 by Robert Gerwarth
All rights reserved
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018
by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben
Umschlagabbildung: Demonstration am Bismarck-Denkmal vor dem Reichstag in Berlin am Tag nach der Ausrufung der Republik, 10.11.1918 © ullstein bild/Haeckel ArchivLektorat und Satz: Peter Palm, Berlin
Karten: Peter Palm, Berlin
Reproduktionen: Aigner, Berlin
ISBN 978-3-641-15622-0V003
www.siedler-verlag.de
Für Helga und Gundi – Kinder der Weimarer Republik
Inhalt
EINLEITUNG – »Wie ein schöner Traum«
Kapitel I – 1917 und die Revolution der Erwartungen
Kapitel II – Hoffen auf den Sieg
Kapitel III – Endspiel
Kapitel IV – Der Matrosenaufstand
Kapitel V – Der Ölfleck der Revolution
Kapitel VI – Showdown in Berlin
Kapitel VII – Friedensschluss im Westen
Kapitel VIII – Imperiale Nachbeben
Kapitel IX – Herausforderungen für die Demokratie
Kapitel X – Kampf der Radikalisierung
Kapitel XI – Triumph des Liberalismus
Kapitel XII – Druck von innen: die Frühjahrsunruhen von 1919
Kapitel XIII – Torpedierung von außen: Versailles
EPILOG – Die streitbare Demokratie: Deutschland 1919–1923
Anhang
Dank
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Personenregister
Bildnachweis
Ein von den revolutionären Ereignissen in Deutschland sichtlich mitgenommener Wilhelm II. (2.v.l.) wartet mit seinem Gefolge auf einem Bahnhof an der niederländischen Grenze auf den Zug ins Exil. Am Vortag hatte Reichskanzler Max von Baden die Abdankung des Kaisers verkünden lassen, ohne zuvor dessen Zustimmung einzuholen.
EINLEITUNG
»Wie ein schöner Traum«
In den frühen Morgenstunden des 10. November 1918 passierte ein kleiner Autokonvoi nahe der Gemeinde Eijsden die belgisch-niederländische Grenze. In einem der Wagen saß Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser und König von Preußen.
Tags zuvor hatte der deutsche Reichskanzler Max von Baden ohne Einwilligung des Monarchen dessen Abdankung verkündet. Nur wenige Stunden später hatte Philipp Scheidemann, einer der Vorsitzenden der Sozialdemokraten, von einem Balkon des Berliner Reichstagsgebäudes die Republik ausgerufen. Noch am selben Abend, kaum dass die Königin der Niederlande und das niederländische Parlament dem deutschen Kaiser politisches Asyl zugesagt hatten, verließ der königliche Hofzug das Hauptquartier der Obersten Heeresleitung im belgischen Spa. Wilhelm fürchtete, dass er das gleiche Schicksal erleiden könnte wie sein Verwandter, Zar Nikolaus II. von Russland, der kaum vier Monate zuvor mit seiner gesamten Familie von den Bolschewiki brutal ermordet worden war. Dass es zu diesem Verbrechen gekommen war, dürfte die Entscheidung der niederländischen Regierung beeinflusst haben.1
In der Hoffnung, unerkannt zu entkommen, stieg Wilhelm kurz vor der niederländischen Grenze vom grün angestrichenen Hofzug in ein Automobil um, von dem zuvor die königlichen Hoheitszeichen entfernt worden waren. Doch die Bevölkerung erkannte den Kaiser trotz dieser Vorkehrungen und beschimpfte ihn wütend als Kriegsverbrecher. Es gelang ihm dennoch, seine Reise in die Niederlande fortzusetzen. Zwei Wochen später, am 28. November 1918, erklärte er offiziell »für alle Zukunft« seinen Verzicht auf den preußischen Thron und die deutsche Kaiserkrone. Zu diesem Zeitpunkt dürfte das nur noch wenige Deutsche interessiert haben.2
Wie der Kaiser waren auch die meisten seiner Zeitgenossen überrascht, mit welcher Geschwindigkeit sich die radikale politische Wandlung Deutschlands im Herbst des Jahres 1918 vollzog. Bereits an jenem 10. November 1918, als Wilhelm II. ins Exil floh, veröffentlichte Theodor Wolff, der prominente Chefredakteur des liberalen Berliner Tageblatts, eine oft zitierte Lobeshymne auf die revolutionären Ereignisse der Novembertage, denen er noch mehr historische Bedeutung beimaß als der englischen Glorious Revolution von 1688: »Die größte aller Revolutionen hat wie ein plötzlich losbrechender Sturmwind das kaiserliche Regime mit allem, was oben und unten dazu gehörte, gestürzt. Man kann sie die größte aller Revolutionen nennen, weil niemals eine so fest gebaute, mit soliden Mauern umgebene Bastille so in einem Anlauf genommen wurde […]. Gestern früh war, in Berlin wenigstens, das alles noch da. Gestern Nachmittag existierte nichts mehr davon.«3
Besonders bemerkenswert erschien Wolff, dass das kaiserliche Regime nahezu gewaltfrei hinweggefegt worden war: »Jedem Volke, das sich zu wahrer Freiheit erhebt, muss dieses Musterbild vor Augen stehen. Symbole des alten Geistes sind bei uns aneinandergereiht wie die Marmorstatuen in der Siegesallee. Ein reifes, verständiges Volk schafft sie ohne etwas zu zerbrechen fort.«4
Wolffs Lobgesang auf die Novemberereignisse mag zunächst überraschen, gilt die Revolution von 1918 doch heute allgemein als bestenfalls »halbe« Revolution. Ganz gewiss gehört sie nicht zu jenen Ereignissen, derer die deutschen Demokraten heute mit Stolz gedenken. In gängigen Geschichtsbüchern, politischen Reden und Zeitungskolumnen werden die politischen Geschehnisse vom Herbst 1918 gewöhnlich als »halbherzige« Revolution bezeichnet. Dabei waren die Errungenschaften dieser wohl einzigen erfolgreichen Revolution in einem hochindustriellen Staat vor 1989 durchaus beachtlich: Innerhalb kurzer Zeit wurde Deutschland auf ungewöhnlich friedliche Weise von einer konstitutionellen Monarchie mit begrenzter politischer Teilhabe des Parlaments zur wohl fortschrittlichsten Republik der Zeit, eine Demokratie, die trotz massiver innen- und außenpolitischer Herausforderungen – Folgen eines verlorenen Krieges – vierzehn Jahre überdauerte und damit länger währte als die meisten anderen 1918 gegründeten Demokratien Europas.
Die dramatische Verwandlung Deutschlands 1918/19 und die Errungenschaften der deutschen Revolution sind noch bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass »1918« nicht nur ein politischer Umbruch stattfand, sondern zugleich eine kulturelle und soziale Revolution, die Geschlechterbeziehungen wie Bürgerrechte tangierte.5 Die Revolution führte ja nicht nur zum Zusammenbruch des Hohenzollernregimes und anderer deutscher Fürstenhäuser, sondern beförderte auch die politische Mobilisierung und Teilhabe der Frauen, die nach dem massenhaften Sterben an den Fronten des Weltkriegs die Mehrheit der deutschen Bevölkerung stellten.6 Bis heute wird die Politikgeschichte der Weimarer Republik zumeist aus einer dezidiert männlichen Perspektive erzählt, dabei kam Frauen bei den revolutionären Ereignissen, die der Demokratie zum Sieg verhalfen, eine wesentliche Rolle zu. Deutschland gestand 1918 als eine der ersten großen Industrienationen Frauen das allgemeine Wahlrecht zu und damit eines der grundlegenden Bürgerrechte. Schon in den Jahren 1917 und 1918 war bei den Protesten gegen den Krieg der Ruf nach Wahlgerechtigkeit immer lauter geworden, und das hatte nicht mehr nur das preußische Dreiklassenwahlrecht betroffen, sondern zunehmend auch das Frauenwahlrecht.7 Als Deutschlands Frauen bei den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919 erstmals auf nationaler Ebene ihre Stimme abgeben durften, überstieg die Zahl der wahlberechtigten Frauen die der Männer um 2,8 Millionen.8 Die durch den Krieg und dessen Folgen verursachten strukturellen Veränderungen in Staat und Gesellschaft verschoben die Mitbestimmungsrechte so grundlegend, wie es sich vor 1914 kaum jemand hätte vorstellen können.9
Das Jahr 1918 brachte den Deutschen noch weitere Freiheiten, die vor 1914 niemand für möglich gehalten hätte und die weit über die Aufhebung der offiziellen Zensur hinausgingen.10 Neben den politischen waren das vor allem größere sexuelle Freiheiten, und zwar für heterosexuelle Frauen wie für homosexuelle Menschen beiderlei Geschlechts. Zwar war Berlin schon vor 1914 ein attraktives Zentrum gleichgeschlechtlicher Subkulturen gewesen, doch die kleinen Freiheiten vor dem Krieg ließen sich mit den Verhältnissen in der Nachkriegszeit kaum vergleichen.11 Schwulenaktivisten träumten schon von einer Ära sexueller Befreiung und der Gleichberechtigung Homosexueller. »Die große Umwälzung der letzten Wochen können wir von unserem Standpunkt aus nur freudig begrüßen«, schrieb Magnus Hirschfeld, Vorsitzender des in Berlin ansässigen »Wissenschaftlich-humanitären Komitees«, der weltweit ersten Organisation für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender (LGBT), im November 1918. »Denn die neue Zeit bringt uns die Freiheit in Wort und Schrift und mit der Befreiung aller bisher Unterdrückten, wie wir sie mit Sicherheit annehmen dürfen, auch eine gerechte Beurteilung derjenigen, denen unsere langjährige Arbeit gilt.«12
Gewiss teilten nicht alle Zeitgenossen die Begeisterung und die Hoffnungen von Magnus Hirschfeld und Theodor Wolff. Die Reaktionen auf die Novemberereignisse waren, wie kaum anders zu erwarten, zwiegespalten. Während viele ehemalige Frontoffiziere der Revolution feindselig gegenüberstanden, waren die meisten einfachen Soldaten erleichtert, vier Jahre eines historisch beispiellosen Krieges überlebt zu haben, und sahen in den Ereignissen in der Heimat wohl zuallererst eine Revolution zur Beendigung des Krieges. Viele wurden zu Pazifisten und wollten fortan mit aller Kraft verhindern, dass sich das, was sie zwischen 1914 und 1918 durchlitten hatten, wiederholte. Andere wiederum, vor allem die Matrosen auf den Schiffen der kaiserlichen Hochseeflotte, die den Großteil des Krieges untätig in deutschen Nordseehäfen gelegen hatte, und Soldaten, die im Hinterland stationiert gewesen waren, beteiligten sich an dem Umsturz, der die deutsche Monarchie zu Fall brachte.13
An der Heimatfront gingen die Meinungen ebenfalls weit auseinander, wobei die Meinungsunterschiede meist entlang politischer Parteilinien verliefen. So beurteilte der konservative Heidelberger Mediävist Karl Hampe den 9. November aus der Sicht eines bürgerlichen Intellektuellen, der Bismarcks Nationalstaat von 1871 als Höhepunkt der deutschen Geschichte begriff, als den »elendste[n] Tag meines Lebens! Was ist aus Kaiser und Reich geworden! Nach außen steht uns Verstümmelung, Willenlosigkeit, eine Art Schuldknechtschaft bevor; im Innern […] Bürgerkrieg, Hungersnot, Chaos.«14 Sein Berliner Kollege Hans Delbrück, einer der einflussreichsten Historiker im kaiserlichen Deutschland und vehementer Verfechter der Monarchie, teilte diese Ansicht. Als er am 11. November 1918 im Kreise namhafter Intellektueller seinen siebzigsten Geburtstag feierte, war die Stimmung überaus gedrückt, wie sich einer der Anwesenden erinnerte: »Es war eine merkwürdige Feier, ähnlich einer Begräbnisfeier. Man sprach gedämpft.« Delbrück selbst äußerte sich voller Bedauern über das Ende der Monarchie, »mit der all sein politisches Denken und jeder Glaube an Deutschlands Zukunft verwachsen sei«.15
Der erzkonservative Politiker Elard von Oldenburg-Januschau – der seinem alten Freund, dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, im Januar 1933 raten sollte, Hitler zum Kanzler zu ernennen – lehnte die Revolution ebenfalls vehement ab und sprach wohl vielen deutschen Adligen aus der Seele, als er bekannte: »Ich finde keine Worte, um meinen Schmerz über das Geschehen des Novembers 1918 wiederzugeben, um zu schildern, was in mir zerbrach. Ich fühlte eine Welt einstürzen und unter ihren Trümmern alles das begraben, was der Inhalt meines Lebens gewesen war, was meine Eltern mich von Kindesbeinen an zu verehren gelehrt hatten.«16 Andere gingen in ihrer Verzweiflung noch weiter. Bestürzt vom Zusammenbruch des Kaiserreichs und angesichts einer unsicheren finanziellen Zukunft nahm sich Albert Ballin, der jüdische Schiffsmagnat, am 9. November 1918 das Leben. Der Generaldirektor der einst weltgrößten Reederei HAPAG sah sein Lebenswerk in Trümmern. Nun fühlte er sich außerstande, sich der Zukunft zu stellen.17
Es mochte für den einen oder anderen gute Gründe geben, die Zukunft in düsteren Farben zu sehen, doch die überwältigende Mehrheit der Deutschen begrüßte die revolutionäre Umgestaltung Deutschlands von einer konstitutionellen Monarchie mit eingeschränkter parlamentarischer Mitbestimmung zu einer parlamentarischen Demokratie – zumindest im Herbst 1918 und Frühjahr 1919 –, sei es aus innerer Überzeugung oder weil sie sich von der innenpolitischen Demokratisierung des Landes mildere Konditionen für den in Paris zu verhandelnden Frieden versprach.18 Die Unterstützung für die demokratische Erneuerung und die Sehnsucht nach Frieden war zu jener Zeit viel tiefer in der Bevölkerung verankert, als bisher angenommen wurde. Die Frauenrechtsaktivistinnen Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann beispielsweise, die Kurt Eisners sozialistische Revolution in Bayern unterstützten, berichteten voller Enthusiasmus über das »neue Leben« seit dem 9. November 1918: »Zurückdenkend erscheinen die folgenden Monate wie ein schöner Traum, so unwahrscheinlich herrlich waren sie! Das schwer Lastende der Kriegsjahre war gewichen; beschwingt schritt man dahin, zukunftsfroh! Der Tag verlor seine Zeiten, die Stunde der Mahlzeiten wurde vergessen, die Nacht wurde zum Tage, man brauchte keinen Schlaf; nur eine lebendige Flamme brannte: sich helfend am Aufbau einer besseren Gemeinschaft beteiligen. […] Das waren Wintermonate voller Arbeit, Hoffen und Glück.«19 Der Sozialdemokrat Hermann Müller, der später zweimal zum Reichskanzler ernannt werden sollte, erinnerte sich, wie überschwänglich die Nachricht von der Revolution auch in der deutschen Hauptstadt aufgenommen worden war: »Als ich am 9. November 1918 abends gegen 9 Uhr auf dem Lehrter Bahnhof in Berlin ankam, […] wogten in der Dunkelheit die Massen noch durch die Straßen. Von den Gesichtern war die Freude abzulesen, daß endlich der Umschwung vollzogen war, der das schwergeprüfte deutsche Volk dem heißersehnten Frieden näherbringen sollte.«20
Einen Eindruck vom Optimismus jener Tage liefert auch Leonhard Frank in seinem autobiographischem Roman Links, wo das Herz ist (1952). Darin schildert Frank, der den Krieg offen ablehnte und deswegen 1915 ins schweizerische Exil fliehen musste, wie sein literarisches Alter Ego Michael Vierkant und dessen österreichische Frau Lisa beim Essen in einem Berliner Restaurant erstmals von der Novemberrevolution in Bayern erfahren: »Da kam ein Zeitungsverkäufer herein und rief: ›Bayern eine freie sozialistische Republik! Kurt Eisner Ministerpräsident!« – ›Jetzt wird alles anders, jetzt wird alles gut‹, sagte Michael freudig erregt. ›Alles wird gut. Und wir sind dabei.‹ Er presste die Hand Lisas. Sie sagte: ›Warum mussten vorher Millionen sterben?‹ Er versuchte zu trösten. ›Wenigstens sind sie nicht vergebens gestorben. Jetzt wird alles gut.‹21 Und sogar der sonst eher verhalten-skeptische anarchistische Schriftsteller Gustav Landauer schrieb am 28. November 1918 enthusiastisch an seinen Freund Fritz Mauthner, er habe den soeben beendeten »Entsetzenskrieg« nur ertragen »in der Erwartung dessen, was nun gekommen ist […] glühendes und inniges Leben, Erfüllung der Augenblicke wie mit Jahrhunderten, geschichtliches Leben«.22
Oft war es gerade die fehlende Radikalität der Revolution, ihr Pragmatismus, der von den meisten Zeitgenossen immer wieder lobend hervorgehoben wurde. Diese »Elastizität«, so formulierte es der Direktor des Berliner Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik, Albert Einstein, in einer überaus wohlwollenden Einschätzung für einen schwedischen Kollegen am 14. November, sei »das überraschendste Erlebnis von all den Überraschungen« gewesen.23
Ganz gleich, ob sie die Vorgänge vom November 1918 als Bedrohung oder als historisch einzigartige Chance begriffen, in einem waren sich alle Zeitzeugen einig: dass sie eine wahrhaftige Revolution erlebten oder – in den Worten der monarchistischen Kreuzzeitung – eine »Umwälzung, wie sie die Geschichte noch nicht gesehen hat«.24 Von der extremen Rechten bis zur nichtkommunistischen Linken hegte im Herbst 1918 niemand ernsthafte Zweifel daran, dass in Deutschland ein fundamentaler Umsturz der politischen Ordnung stattgefunden hatte. Diese Einschätzung unterscheidet sich erheblich von der Wertung späterer politischer Kommentatoren und Historiker.25 Diese standen den Ereignissen vom November 1918 stets weitaus ablehnender gegenüber als die große Mehrheit der Zeitgenossen, beschrieben sie nicht selten als »gescheiterte«, »unvollständige« oder gar »verratene« Revolution – Wertungen, die vor allem vom retrospektiven Wissen um das Ende der Weimarer Republik im Januar 1933 geprägt waren und sind.26 Weil die neuen politischen Entscheidungsträger im Winter 1918/19 bestehende soziale und wirtschaftliche Strukturen, Staatsverwaltungen und Gerichte relativ unberührt ließen und weil die Weimarer Republik 1933 nur vierzehn Jahre nach ihrer Gründung wieder unterging, gilt die Novemberrevolution häufig als »halbherzige« Revolution zweiten Ranges, der es im Vergleich mit den »großen« europäischen Revolutionen von 1789 und 1917 an Dramatik und klarer ideologischer Zielsetzung fehlte.27 Einige haben sogar bezweifelt, dass die Geschehnisse vom November 1918 die Kriterien einer Revolution erfüllen.28
Wie kam es zu dieser drastischen Neubewertung der Vorgänge vom Jahresende 1918? Der Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung der Revolution zeichnete sich bereits 1919 ab, als der anfangs noch sehr breite Rückhalt für einen demokratischen Umbruch aus vielerlei Gründen erodierte – nicht zuletzt wegen der unrealistischen Erwartungen vieler Deutscher in Bezug auf das, was sich mit einer Revolution erreichen ließ und wie sich der Demokratisierungsprozess auf den Friedensvertrag auswirken würde, den die siegreichen Alliierten von Januar 1919 an in Paris verhandelten. Die radikale Linke hatte eine Revolution zwar herbeigesehnt, allerdings nicht diese Revolution. Wie ihre Führer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg begriffen viele ihrer Anhänger den militärischen Zusammenbruch des deutschen Kaiserreichs im November 1918 als historische Chance zur Verwirklichung eines sozialistischen Staates unter Führung jener Arbeiter- und Soldatenräte, die sich beim Zerfall der alten Ordnung überall im Land spontan gebildet hatten. Ohne Lenins bolschewistische Revolution in Russland zu verklären, verlangten sie einen umfassenderen politischen und gesellschaftlichen Neubeginn, einen weitaus radikaleren Bruch mit den alten Eliten und sozialen Hierarchien des kaiserlichen Deutschlands. Der Entschluss des mehrheitssozialdemokratischen Reichskanzlers Friedrich Ebert, landesweite Wahlen zu einer konstituierenden Nationalversammlung abzuhalten, die über die künftige Regierungsform des neuen Deutschlands entscheiden sollte, wurde von der extremen Linken als fundamentaler »Verrat« gewertet und öffentlich gebrandmarkt, weil dieses Vorgehen der Umsetzung ihrer eigenen Vorstellungen bezüglich einer Neuordnung von Gesellschaft und politischem System zuwiderlief.
Ende 1918 und zu Beginn des Jahres 1919 unterstützte allerdings lediglich eine kleine Minderheit die radikalen linken Positionen. Somit kam es während der revolutionären Ereignisse auch zu einem Höhepunkt in der langen und turbulenten Geschichte von Spaltungsprozessen sowohl innerhalb der deutschen als auch der internationalen Arbeiterbewegung, die vom »Revisionismus-Streit« zwischen orthodoxen Verfechtern eines revolutionären Marxismus und sozialdemokratischen Reformern zu Beginn des Jahrhunderts bis zum Zerwürfnis von 1914 zwischen »Burgfrieden«-Befürwortern und Kriegsgegnern im sozialistischen Lager reichte und 1917 zunächst in der offiziellen Aufspaltung in Mehrheitssozialdemokraten (MSPD) und stärker linksgerichtete Unabhängige Sozialdemokraten (USPD) gipfelte. Der vermeintliche Verrat von 1918/19 hatte eine weitere Eskalation dieses Konflikts zur Folge, da die radikale Linke der MSPD nun vorwarf, eine »echte« Revolution verhindert zu haben, als diese machbar schien. Diese Anschuldigungen wirken bis in unsere Gegenwart nach. Noch im Jahr 2008 erklärte der damalige Vorsitzende der Partei Die Linke Oskar Lafontaine öffentlich, Eberts »Verrat« an der Arbeiterbewegung im Jahr 1918 habe »die Weichen für die unselige Geschichte der Weimarer Republik« gestellt.29
Die MSPD-Führung unter Ebert hegte im Herbst 1918 gleichfalls unrealistische, wenn auch gänzlich anders geartete Erwartungen. Sie glaubte, Deutschland könne Gewalt im Innern vermeiden und mit milden Friedensbedingungen rechnen, wenn die Demobilisierung und Demokratisierung ohne den Widerstand der alten Eliten gelang. Dann würde es möglich sein, aus dem verlorenen Krieg als starke Demokratie und als gleichwertiger Partner einer internationalen Nachkriegsordnung hervorzugehen. Diese Hoffnung teilten viele bürgerliche Intellektuelle, auch wenn sie einen politischen Umsturz nicht guthießen.30 Sie waren aber angenehm überrascht, wie wenig radikal und gewalttätig sich die Geschehnisse im November 1918 entwickelten, und vermerkten erleichtert, dass das Land nach dem Machtwechsel vom 9. November nicht im Bürgerkrieg versunken war. Für den angesehenen Theologen und Philosophen Ernst Troeltsch, dessen Spektator-Briefe zu den bekanntesten Zeitdokumenten dieser Jahre zählen, war die Furcht vor Gewalt und Chaos bereits am 10. November beseitigt: »Am nächsten Sonntagmorgen nach banger Nacht ward das Bild aus den Morgenzeitungen klar: der Kaiser in Holland, die Revolution in den meisten Zentren siegreich. […] Kein Mann tot für Kaiser und Reich! Die Beamtenschaft in den Dienst der neuen Regierung getreten. Die Fortdauer aller Verpflichtungen gesichert und kein Sturm auf die Banken!«31 Der Schriftsteller Thomas Mann hatte einen ähnlichen Eindruck, als er sich am 10. November die Ereignisse des Vortags bei einem Spaziergang durch München ins Gedächtnis rief: »Die deutsche Revolution ist eben die deutsche, wenn auch Revolution. Keine französische Wildheit, keine russisch-kommunistische Trunkenheit«, notierte er erleichtert.32
Diese Wahrnehmung wie auch die rückblickende Wertung der Novemberrevolution durch Zeitzeugen veränderte sich im weiteren Verlauf der Revolution, vor allem durch die Radikalisierung und die gewalttätige Eskalation zu Beginn des Jahres 1919. Der »Spartakusaufstand« der radikalen Linken vom Januar 1919, die Münchner Räterepublik wenig später sowie die brutale Gegenreaktion der rechtsgerichteten Freikorpskämpfer ließen Exzesse wie im russischen Bürgerkrieg befürchten. Viele, die die Demokratisierung Deutschlands zunächst befürwortet hatten, waren enttäuscht, als der krasse Gegensatz zwischen den Erwartungen, die sie an einen Verständigungsfrieden knüpften, und den tatsächlichen Konditionen offenbar wurde, die der jungen Demokratie im Sommer 1919 im Versailler Vertrag von den siegreichen Alliierten auferlegt wurden. Obgleich jeder wusste, dass eine Ablehnung dieser Bedingungen eine Fortsetzung der Kampfhandlungen bedeutete, brandmarkte die nationalistische Rechte diese umgehend als »Beweis« für die Unfähigkeit der neuen Republik, bessere Ergebnisse auszuhandeln. Im kollektiven Gedächtnis verschmolzen Revolution, militärische Niederlage und deren unmittelbare Folge – der Versailler Vertrag – allmählich zu einer einzigen Erzählung, in der die Revolution – als Akt des Verrats an den Frontkämpfern – eine vermeintlich unnötige militärische Niederlage zur Folge hatte, und damit waren die Revolutionäre ganz allein für die harten Bedingungen des Pariser Friedensabkommens verantwortlich. Niemand machte sich dieses rasch weit verbreitete Narrativ von Versagen und Verrat beharrlicher und erfolgreicher zunutze als Adolf Hitler. Auf den Tag genau fünf Jahre nach Ausrufung der Republik, am 9. November 1923, unternahm er mit dem »Marsch auf die Feldherrnhalle« den ersten Anlauf zu einer »nationalen Revolution«, die die »Verbrechen« der Revolution sühnen sollte. Während der anschließenden Haftzeit in der bayerischen Festung Landsberg verfasste er dann seine Programmschrift Mein Kampf, in der die stilisierte Rückschau auf den 9. November 1918 als politischer »Erweckungsmoment« eine zentrale Rolle spielt.
Hitler, in den letzten Kriegswochen verwundet und zeitweise erblindet, kam am 12. November 1918 in einem Militärkrankenhaus im pommerischen Pasewalk wieder zu Bewusstsein und hatte den Eindruck, die Welt um ihn herum habe sich bis zur Unkenntlichkeit verändert. Die einstmals so mächtige deutsche kaiserliche Armee, in der er als Meldegänger gedient hatte, war zerfallen. Der Kaiser hatte inmitten der Revolutionswirren abgedankt. Sein Heimatland Österreich-Ungarn existierte nicht mehr. Als er von der militärischen Niederlage der Mittelmächte erfuhr, erlitt er einen Nervenzusammenbruch: »[Ich] taumelte […] zum Schlafsaal zurück, warf mich auf mein Lager und grub den brennenden Kopf in Decke und Kissen. Seit dem Tage, da ich am Grabe der Mutter gestanden, hatte ich nicht mehr geweint […]. Nun aber konnte ich nicht mehr anders.«33
Für die Nationalsozialisten wurde der 9. November zum Tag der Mobilmachung gegen die Republik, ein Tag, an dem Hitlers Anhänger aufgerufen waren, die »Gefallenen« des gescheiterten Umsturzes zu ehren, indem sie dafür kämpften, das verhasste, 1918 errichtete System durch ein mythisches »Drittes Reich« zu ersetzen.34 Bereits in den 1920er Jahren sprach Hitlers Chefideologe Alfred Rosenberg vom 9. November als »Schicksalstag«, um den »in leidenschaftlicher Weise gerungen« werde und der mit der brennendsten Frage der Zukunft Deutschlands aufs engste verbunden sei. Sollte diese Zukunft von den »Novemberverbrechern« oder den »nationalen Revolutionären« um Hitler bestimmt werden?35
Sowohl vor 1933 als auch nach Hitlers Berufung zum Reichskanzler bezog sich der politische Diskurs der Nationalsozialisten immer wieder auf die Novemberrevolution und die Bestrebungen ihrer Bewegung, deren »Errungenschaften« zu revidieren. In unzähligen Reden erklärte der »Führer«, dass sich ein »November 1918« nie wiederholen dürfe, und diejenigen, die für die »Novemberverbrechen« verantwortlich seien – die politische Linke und natürlich »die Juden« –, dafür bestraft werden müssten. Bis zu seinem Tod blieb Hitler wie besessen von jenem »Verrat«, den er mit dem November 1918 verband. Noch in seinen letzten Befehlen von 1945 beharrte er darauf, dass es um keinen Preis eine Wiederholung der »Verbrechen« vom November 1918 geben werde, keinen Dolchstoß und keine Revolution. Wenn dies die Auslöschung der deutschen Nation und der deutschen Bevölkerung bedeute, dann zog er den »ehrenhaften« Untergang einer schmachvollen Kapitulation vor.36
Mit der totalen Niederlage des »Dritten Reiches« fand die Kontroverse über die Bedeutung des 9. November 1918 für den Verlauf der deutschen Geschichte aber längst kein Ende, wie der Historiker Wolfgang Niess gezeigt hat. Obwohl sich die Stoßrichtung der Debatten im Laufe der Jahre mehrfach änderte, verloren die Auseinandersetzungen kaum etwas von ihrer Schärfe – was mehr über die sich wandelnde politische Kultur in Deutschland als über die Revolution an sich verrät. Im politischen wie im historischen Diskurs der DDR etwa spielte die Novemberrevolution eine wesentliche Rolle, da sie die Existenz einer mächtigen sozialistischen »Einheitspartei« legitimierte – der regierenden SED, die 1946 aus der Zwangsvereinigung von SPD und KPD im sowjetisch besetzen Ostteil Deutschlands hervorgegangen war. Eben weil eine solche geeinte Partei der Arbeiterklasse 1918/19 gefehlt habe, so die offizielle historische Lesart in der DDR, sei eine echte »proletarische Revolution« von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Anstatt sich mit den Vorgängen von 1918 auf ernsthafte und unvoreingenommene Weise auseinanderzusetzen, ließ die marxistisch-leninistische Geschichtsschreibung der DDR – wie kaum anders zu erwarten – ausschließlich diese Deutung zu und sah in der Novemberrevolution einen bürgerlichen Aufstand. Auch diese Erzählung misst den Führern der MSPD die Rolle von Verrätern zu – von Abtrünnigen, die die proletarische Revolution preisgegeben und hintertrieben hatten. Allein der Spartakusbund und die KPD verkörpern hier die zukunftsweisenden Kräfte, die Helden, deren visionäre revolutionäre Pläne von Ebert, Noske und ihren bürgerlich-reaktionären Schergen vereitelt wurden.37
Wenngleich die Forschung in der Bundesrepublik vergleichsweise frei von staatlicher Einflussnahme war, erwiesen sich auch hier die historischen Deutungen der Novemberrevolution als zeitgeistabhängig. Die großen historischen Debatten der Nachkriegszeit wurden dominiert von der Suche nach den Ursachen der »deutschen Katastrophe« des Nationalsozialismus wie auch vom intellektuellen Klima des Kalten Krieges. Der Umstand, dass zwischen der Revolution von 1918 und dem Anbruch des »Dritten Reiches« gerade einmal vierzehn Jahre lagen, führte schließlich zum Aufkommen der irreführenden Meta-Erzählung von der »todgeweihten« Republik – eines übereilt improvisierten Intermezzos zwischen Kaiserreich und Hitler-Diktatur.38 »Weimar« geriet zu einer Warnung der Geschichte, dass Demokratien scheitern können, und gleichwohl zu einer Art Negativmatrize der 1949 geschaffenen Bundesrepublik, vor der diese sich positiv abhob – als die stabilere, westlichere und wirtschaftlich erfolgreichere Demokratie.39
Aber auch innerhalb der Bundesrepublik blieben die Meinungen über »1918« extrem gespalten und waren im Laufe der Jahrzehnte beträchtlichem Wandel unterworfen. In der fachhistorischen wie in der öffentlichen Debatte nach 1945 beschäftigte man sich vor allem mit der Frage, ob den Hauptakteuren vom November 1918 – insbesondere den Führern der MSPD – nicht auch andere Handlungsoptionen offen gestanden hätten.40 Merkwürdigerweise glichen die abweichenden Positionen dieser Diskussion dabei stark den Standpunkten von MSPD und USPD in der Weimarer Republik. Während die einen argumentierten, die einzige Alternative zu Eberts parlamentarischer Demokratie – unter Einbeziehung der alten demokratiefeindlichen Eliten des Kaiserreichs – wäre eine bolschewistische Diktatur nach russischem Vorbild gewesen,41 sahen andere, weiter links stehende Historiker in den Arbeiter- und Soldatenräten ein erhebliches – von Ebert aber nicht genutztes – Demokratisierungspotenzial.42 Ganz ähnlich wie die radikalen Linken der 1920er und frühen 1930er Jahre in den Vorwürfen gegen Ebert und die MSPD bezeichneten manche Historiker die Geschehnisse von 1918 als »verratene Revolution«.43
Die Ansicht, Ebert und seine Mehrheitssozialdemokraten hätten in Deutschland keine stabilen demokratischen Grundlagen geschaffen, war oft gepaart mit der Unterstellung, Hitler hätte Deutschland und der Welt womöglich erspart bleiben können, wenn nur die Revolution von 1918/19 nicht »unvollendet« geblieben wäre.44 Dass die Weimarer Demokratie bis zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise Ende 1929 etlichen Versuchen der radikalen Linken und Rechten, gewaltsam die Macht an sich zu reißen, erfolgreich getrotzt hat, wurde dabei bewusst ignoriert – größtenteils, weil es dem fest verwurzelten Narrativ der labilen Republik und des sozialdemokratischen »Verrats« an der »wahren« Revolution nun einmal im Wege stand.
Die öffentlichen Debatten über den 9. November 1918 und die Bedeutung der Weimarer Republik in der deutschen Geschichte werden in jüngerer Zeit weit weniger hitzig geführt – manche bezeichnen die Novemberereignisse heute gar als »vergessene Revolution«45 –, doch die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Jahren hat nicht nachgelassen und eine ganze Reihe von Paradigmenwechseln durchlaufen, die unseren Blick auf die Ereignisse von 1918 nachhaltig verändert haben. So stimmen die meisten Historiker heute darin überein, dass die Geschichte der ersten deutschen Demokratie nicht allein im Hinblick auf ihr Ende untersucht werden darf, sondern eine unvoreingenommene, ergebnisoffene Betrachtung erfordert.46 Bis heute hat dieser Konsens jedoch keine neue allgemeine Darstellung der Novemberrevolution hervorgebracht, die dieses Versprechen tatsächlich einlöst.47
Der hundertste Jahrestag der Revolution bietet nun die Chance zur nüchternen Auseinandersetzung mit den Vorgängen von 1918 und auf eine neue historische Erzählung, die den Blick mehr darauf richtet, wie die Zeitgenossen die Welt um sich herum erlebten, was sie wahrnahmen und welche Vorstellungen sie sich von der Zukunft machten. Wenn viele das Resultat der militärischen Niederlage Deutschlands mit dem Begriff »Krise« versahen, dann wohl vor allem, weil das der Ungewissheit bezüglich der Zukunft ihres Landes am ehesten Ausdruck verlieh, einer Zukunft, über die sie zwar spekulieren, die sie aber nicht vorhersehen konnten.48
Die zweite historiographische Strömung, die unseren Blick auf die Ereignisse vom November 1918 weitaus stärker bestimmen sollte, als dies bisher der Fall war, ist die transnationale Geschichtsschreibung, die in den letzten Jahren die historische Perspektive auf das deutsche Kaiserreich stark verändert hat. Die Novemberrevolution wird dagegen immer noch vorzugsweise im nationalen Kontext betrachtet mit gelegentlichen Bezügen zu gleichzeitigen Vorgängen in Westeuropa.49 Dabei ist es äußerst fraglich, ob die historischen Vorgänge in Deutschland nach der Niederlage von 1918 im Rahmen der Geschichte »des Westens« überhaupt hinreichend untersucht werden können. Gerade im Kontext der Entwicklungen in Frankreich und Großbritannien scheint das fraglich, schließlich waren dies beim Waffenstillstand 1918 fest etablierte, historisch gewachsene Demokratien, die zudem als Sieger aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen waren – was auf Deutschland eben alles nicht zutraf. Die deutsche Geschichte verlief in den folgenden Jahren vielmehr ähnlich der in den Staaten Ostmitteleuropas: Der militärischen Niederlage und der Implosion der Landimperien folgten Revolutionen und demokratische Staatsgründungen.
Verglichen mit den anderen Nachfolgestaaten ehemaliger Großreiche und den neuen demokratischen Staaten im Europa nach 1918 – etwa Ungarn oder den baltischen Staaten – war die Weimarer Republik allerdings relativ stabil und ungewöhnlich langlebig. Als etwa ein Jahrzehnt nach dem Waffenstillstand immer mehr Europäer die Demokratie als rückständige und überholte Regierungsform betrachteten, außerstande, die sozio-ökonomischen und politischen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise zu meistern, erwies sich unter den nach 1918 in Europa neu geschaffenen parlamentarischen Demokratien – mit den nennenswerten Ausnahmen Tschechoslowakei und Finnland – die Weimarer Republik als eine derjenigen, die gegen die autoritären Strömungen am längsten standhielt.
Wenn man die tiefgreifenden Umwälzungen vom November 1918 angemessen einschätzen will, darf man des weiteren nicht unberücksichtigt lassen, dass das untergegangene wilhelminische Imperium 1918 von einem postimperialen Nationalstaat ersetzt wurde. Tatsächlich handelte es sich beim Kaiserreich sogar um ein Imperium in mehr als einem Sinn.
–Erstens war es nach innen ethnisch-hierarchisch geordnet.50 Die Bevölkerung des Deutschen Reiches umfasste beträchtliche nichtdeutsche Minderheiten, darunter etwa 3,5 Millionen polnischsprachige Bürger vor allem in Westpreußen, Posen und an der Ruhr, 200000 Elsass-Lothringer, deren Muttersprache Französisch war, und darüber hinaus 150000 Nordschleswiger, die Dänisch sprachen. Zumindest kulturell wurden diese Minderheiten nie als vollwertige deutsche Staatsbürger anerkannt, und die Behörden schätzten sie generell als potenziell illoyal und sezessionistisch ein.51 Durch den Verlust Posens, Westpreußens und Elsass-Lothringens wurde die Zahl der ethnisch nichtdeutschen Bewohner des Reiches erheblich reduziert, und aus dem Imperium wurde ein postimperialer Nationalstaat, der ethnisch deutlich weniger durchmischt war als seine östlichen Nachbarn.
–Zweitens sollte nicht vergessen werden, dass Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg ein globales Kolonialreich war mit Überseegebieten in Afrika, Asien und dem Pazifik, die größtenteils im späten 19. Jahrhundert kolonialisiert worden waren. Noch zu Beginn des Ersten Weltkriegs erstreckte sich die Herrschaft Deutschlands auf all diese imperialen Besitzungen, und zwar von der deutschen Konzession im chinesischen Shandong bis nach Samoa im Pazifik.
–Drittens stieg das Kaiserreich vom Herbst 1915 an mit der Zurückdrängung der russischen Armee zu einem europäischen Landimperium auf, das sowohl über annektierte Territorien (Ober-Ost) als auch über eine ganze Reihe von abhängigen Satellitenstaaten herrschte. Insbesondere der Vertrag von Brest-Litowsk sollte Deutschland die Kontrolle über ausgedehnte Gebiete im Westen des einstigen Zarenreichs bescheren. Die Niederlage vom November 1918 verhieß das jähe Ende dieser vielfältigen kolonialen Projekte, wenn freilich auch nicht jener imperialen Großmachtphantasien, in denen speziell Ostmitteleuropa als Sehnsuchtsort künftiger kolonialer Eroberungen weiter eine bedeutende Rolle spielen sollte.52
Erst aus dieser weiteren Perspektive wird deutlich, dass die historische Entwicklung Großbritanniens und Frankreichs – der beiden wichtigsten europäischen Siegerstaaten des Ersten Weltkriegs – nicht normativ, sondern überaus ungewöhnlich war. Die deutsche Revolution von 1918 war Teil einer Reihe von politischen Veränderungen, die in Europa eher die Regel als die Ausnahme waren, etwa die vielen gewaltsamen Umwälzungen in den ausgedehnten postimperialen Territorien des zusammengebrochenen russischen, österreichisch-ungarischen und osmanischen Großreiches. Die Novemberrevolution muss als Teil einer Epoche der Revolutionen begriffen werden, die 1917 in Petrograd begann und erst 1923 endete, als sich aus dem anatolischen Kern des Osmanischen Reiches ein republikanischer türkischer Nationalstaat formte. Allein zwischen 1917 und 1920 kam es in Europa zu 27 gewaltsamen Machtwechseln, viele davon begleitet von latenten oder offenen Bürgerkriegen.53 Russland im Besonderen erlebte in zwölf Monaten zwei Revolutionen, die das Land in einen Bürgerkrieg stürzten, der über drei Millionen Opfer forderte. Im benachbarten Finnland, ehemals ein autonomes Großfürstentum innerhalb des Romanow-Imperiums und im Ersten Weltkrieg noch neutral, kam 1918 bei einem kurzen, aber extrem blutigen Bürgerkrieg innerhalb von drei Monaten über ein Prozent der Bevölkerung des Landes ums Leben. Zwischen 1918 und 1923 starben bei bewaffneten Konflikten im Nachkriegseuropa über vier Millionen Menschen – mehr als die Weltkriegstoten Großbritanniens, Frankreichs und der Vereinigten Staaten zusammengenommen. Zudem streiften Millionen verarmter Flüchtlinge aus Mittel-, Ost- und Südeuropa auf der Suche nach Sicherheit und einem besseren Leben durch die kriegsgeschundenen Gebiete Europas. Mindestens 7,7 Millionen Menschen waren bereits während des Ersten Weltkriegs aus ihrer Heimat vertrieben worden; in der Nachkriegszeit kamen weitere Millionen hinzu.54
Zwischen 1918 und 1922 machten sich die Menschen in den Nachfolgestaaten der zusammengebrochenen Vielvölkerstaaten Europas in großen Massen auf die Flucht, da sie in ihrer Heimat nicht mehr leben wollten oder durften.55 So flohen etwa mehrere Hunderttausend Magyaren aus Rumänien, der Tschechoslowakei und Jugoslawien nach Ungarn, als man sie aus ihren Ländern verjagte. Nach der Rückgabe Elsass-Lothringens an Frankreich verwies die französische Regierung im Winter 1918/19 Tausende Deutschstämmige des Landes, selbst wenn diese keinerlei familiäre oder anderweitige Bindungen zu Deutschland mehr besaßen.56 Christliche Bürger des Osmanischen Reiches und muslimische Griechen – insgesamt weit über eine Million Menschen – mussten aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ihre Heimat verlassen. Aus Russland flohen die Menschen vor Verfolgung, Armut, Hunger und eskalierender Gewalt gen Westen. Nicht ohne Grund haben einige Historiker die ersten Jahre nach 1918 als Zeit eines »erweiterten europäischen Bürgerkriegs« bezeichnet.57
Im Vergleich zu den revolutionären Regimewechseln in anderen Ländern Europas und den darauffolgenden Bürgerkriegen in Russland, der Ukraine, Finnland oder gar Ungarn erwies sich die deutsche Revolution als erstaunlich unblutig. Doch die Ereignisse dort übten massiven Einfluss auf die Art und Weise aus, wie die Deutschen die Geschehnisse im eigenen Land wahrnahmen. Ältere, kulturell tief verwurzelte Revolutionsängste wurden etwa seit 1917 durch Berichte aus dem revolutionären Russland befeuert, was bei vielen Befürchtungen – und auf der extremen Linken Hoffnungen – nährte, Deutschland könne das nächste Land sein, in dem es zur bolschewistischen Machtergreifung kommt.58 Diese Befürchtungen beschränkten sich keineswegs auf die Anhänger der extremen Rechten, sondern reichten bis ins linke Lager hinein. So beklagte die eher gemäßigt linke Künstlerin Käthe Kollwitz Ende 1918 in ihrem Tagebuch die »fürchterlichsten Zustände in Rußland« und fragte sich besorgt: »Droht Deutschland eine ähnliche anarchistische Zukunft wie Rußland?«59 Warum die Auffassung, Deutschland drohten »russische Verhältnisse« – eine Annahme, die auch Eberts Entscheidungen der Jahre 1918/19 maßgeblich beeinflusste –, so weit verbreitet war, lässt sich nur verstehen, wenn man die deutsche Erfahrung in einen größeren mittel- und osteuropäischen Kontext stellt.
Eine solch weit gefasste Perspektive ist auch nötig, wenn man den »Rang« der deutschen Revolution in der neueren europäischen Geschichte ermitteln will. Sowohl die große europäische Revolution des Westens – die Französische Revolution von 1789 – als auch die große europäische Revolution des Ostens – die russische Revolution von 1917 – mündeten schon nach kurzer Zeit in Bürgerkriege und Diktaturen, was ihre historische Bedeutung aber keineswegs schmälert. Verglichen mit anderen europäischen Umstürzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts – in Finnland 1918 und in Ungarn 1919 – waren die revolutionären Ereignisse in Deutschland ungewöhnlich gewaltlos und gemessen an ihren Zielen – der Wiederherstellung des Friedens und der Ersetzung einer Monarchie durch ein demokratisches System – auch bemerkenswert erfolgreich. Während in Finnland und Ungarn die Konterrevolution triumphierte und es zu verheerenden Gewaltausbrüchen kam, vollbrachte die Regierung Ebert das Kunststück, die revolutionäre Energie zu kanalisieren, im Angesicht einer nie dagewesenen Niederlage die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten und Millionen von schwer bewaffneten Soldaten friedlich zu demobilisieren.
Betrachtet man die enormen Herausforderungen, vor denen die Weimarer Republik stand, scheint Theodor Wolffs Begeisterung über die »größte aller Revolutionen« maßlos optimistisch, wenn nicht gar naiv. Dass diese Stimmungslage allerdings weit verbreitet war, wird beim teleologischen Blick auf die Novemberrevolution gerne ausgeblendet. Hier soll daher keine umfassende Geschichte der Jahre 1918 bis 1923 vorgelegt, sondern der Versuch unternommen werden, diese Stimmungslage in die Politikgeschichte der Novemberrevolution einzubetten und so auf den Übergang vom Krieg zum Frieden zu blicken, sodass die immensen Hoffnungen und Erwartungen deutlich werden, von denen diese Phase der deutschen Geschichte – zumindest zu Beginn – erfüllt war. Um diese Hoffnungen und den damals herrschenden Optimismus verstehen zu können, muss man zunächst das Jahr 1917 betrachten, in dem sich der Charakter des Ersten Weltkriegs entscheidend wandelte und die Erwartungen der Deutschen für die Zukunft geprägt werden sollten.
KAPITEL I
1917 und die Revolution der Erwartungen
Am 19. Januar 1917 ging in der deutschen Gesandtschaft in Mexiko-Stadt ein Telegramm mit einer höchst bemerkenswerten und ebenso folgenreichen Anweisung ein. Der deutsche Außenminister Arthur Zimmermann forderte darin Heinrich von Eckardt, den deutschen Gesandten in Mexiko, auf, die Möglichkeiten einer militärischen Allianz mit Mexiko auszuloten. Sollte Mexiko aufseiten der Mittelmächte in den Krieg eintreten, das möge er der mexikanischen Regierung unter Venustiano Carranza ausrichten, werde Berlin dem Land finanzielle und logistische Hilfe zukommen lassen. Zudem werde man etwaige Bestrebungen unterstützen, die ehemals mexikanischen, im Jahr 1848 von den USA annektierten Gebiete Texas, Neumexiko und Arizona zurückzugewinnen. Neben dieser brisanten Offerte enthielt das Telegramm noch den Hinweis auf die militärische Rückendeckung durch die »rücksichtslose Anwendung unserer U-Boote« im Atlantik. In einer weiteren Depesche vom 5. Februar drängte Zimmermann seinen Gesandten dann, unverzüglich mit dem mexikanischen Präsidenten in Kontakt zu treten.60
Der scheinbar aberwitzige Vorschlag – eine Idee des jungen Außenamtmitarbeiters Hans Arthur von Kemnitz, die rasch Anklang in höchsten politischen und militärischen Kreisen fand – verdient eine eingehendere Erläuterung. Denn letztlich haben die »Zimmermann-Depesche« und die Erklärung des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs durch Deutschland, die einige Tage zuvor erfolgte, die USA zum Eintritt in den Ersten Weltkrieg aufseiten der Entente veranlasst.61 Zimmermann, ein Karrierediplomat, der im November 1916 deutscher Außenminister wurde, hatte schon 1914 dafür plädiert, indigene Aufstände in den imperialen Territorien der Alliierten zu provozieren. Tatsächlich schmiedete das Auswärtige Amt seit Kriegsbeginn insgeheim Pläne zur Destabilisierung der Alliierten, indem man revolutionäre Bewegungen unterschiedlicher politischer Couleur förderte: irische Republikaner, die sich von London lossagen wollten, Dschihadisten in den britischen und französischen Kolonialreichen sowie russische Revolutionäre, die sich gegen das autokratische Regime in Petrograd verschworen hatten.62 Die Regierung in Berlin stand den politischen Zielen all dieser Bewegungen im Grunde genommen ziemlich gleichgültig gegenüber und suchte diese lediglich für ihre eigenen Zwecke zu nutzen, und das hieß, die Alliierten von innen heraus zu schwächen.63 Zimmermann zeigte sich dabei von Anfang an sehr engagiert. Schon 1914 traf er mit dem Menschenrechtsaktivisten und Republikaner Roger Casement zusammen, der die britische Herrschaft über Irland gewaltsam beenden wollte. Mit diesem verhandelte er über Hilfe bei der Bewaffnung der irischen Revolutionäre. Darüber hinaus unterstützte er die Errichtung des sogenannten Halbmondlagers in Wünsdorf bei Zossen, in dem etwa 30000 kriegsgefangene Muslime aus der britischen und französischen Armee interniert waren. Diese sollten zum Überlaufen animiert und für den »Heiligen Krieg« gegen ihre Kolonialherren ausgebildet werden.64 Zum Leidwesen der Strategen im deutschen Außenamt schienen alle diese Bemühungen aber kaum zu fruchten. Den rund 3000 muslimischen Kriegsgefangenen, die von Wünsdorf in ihre Heimat zurückgeschickt wurden und dort Unruhe stiften sollten, gelang es nie, Dschihadisten in nennenswerter Zahl zu mobilisieren. Im Frühjahr 1916 erlitt Berlin einen weiteren Rückschlag, als der von Deutschland unterstützte Osteraufstand in Irland nicht zur erhofften landesweiten Revolution führte und Roger Casement, der die ersten beiden Kriegsjahre im Reich verbracht und versucht hatte, aus Landsleuten in deutscher Gefangenschaft eine »Irische Brigade« zu rekrutieren, kurz nach seiner geheimen Reise nach Irland in einem deutschen U-Boot und Landung an der Küste von Kerry verhaftet wurde.
Der so glücklos agierende Zimmermann war Ende November 1916 als Nachfolger Gottlieb von Jagows zum neuen Außenminister ernannt worden. Jagow war am 22. November aus Protest gegen die geplante Ausweitung des U-Boot-Kriegs durch die deutsche Militärführung zurückgetreten. Nach der Versenkung des amerikanischen Passagierschiffs Lusitania durch ein deutsches U-Boot im Mai 1915, bei der 1200 Menschen umkamen, hatte die kaiserliche Marine auf Druck des Reichskanzlers den Einsatz von U-Booten zurückgefahren, um den Kriegseintritt Washingtons nicht zu provozieren. Während der Jahre 1915 und 1916 war dies ein Hauptstreitpunkt zwischen Kanzler Bethmann Hollweg und der deutschen Admiralität. Der Kanzler hielt es politisch wie militärisch für erstrebenswert, dass Amerika neutral blieb, da die Vereinigten Staaten die einzige westliche Großmacht waren, die noch einen Verhandlungsfrieden vermitteln und die verfahrene Pattsituation auflösen konnten, in der sich die Kriegsparteien an der Westfront befanden.65 In dem Maße, wie die Aussicht auf einen Verhandlungsfrieden schwand, stieg allerdings der Druck der deutschen Armee- und Marineführung auf den Reichskanzler, die U-Boote für einen entscheidenden Schlag gegen Großbritannien einzusetzen. Am 9. Januar 1917 gab Bethmann Hollweg dem Drängen der Obersten Heeresleitung (OHL) schließlich nach und stimmte der Wiederaufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs zu.66
Außenminister Zimmermann, der die Pläne der OHL und der Seekriegsleitung (Skl) schon seit Längerem unterstützte, traf nun – unter anderem mit der Depesche an die deutsche Gesandtschaft in Mexiko – seine eigenen Vorbereitungen für den Fall einer Kriegserklärung Washingtons. Doch zu Zimmermanns Pech wurde das Telegramm vom britischen Geheimdienst abgefangen, dechiffriert und dem amerikanischen Botschafter in London, Walter Hines Page, vorgelegt, der es umgehend an US-Präsident Woodrow Wilson weiterleitete.67 Wilson ließ den Text der Depesche veröffentlichen, deren Authentizität Zimmermann zu allem Überfluss auch noch bestätigte. Die Kunde von der deutschen Offerte an die Mexikaner schlug in den USA ein wie eine Bombe, und dafür gab es vor allem zwei Gründe: Erstens zeigte die Depesche nach Wilsons Auffassung die Unaufrichtigkeit der deutschen Regierung, die sich nach außen hin offen gab für eine amerikanische Vermittlung bei der Suche nach einem Kompromissfrieden, aber insgeheim ein Bündnis gegen die Vereinigten Staaten schmiedete.68 Anstatt sich nach Kräften um eine Friedenslösung zu bemühen, gieße Deutschland Öl ins Feuer und stachle Amerikas Nachbarn auf, zu dem die USA ohnehin ein schwieriges Verhältnis hatten. Mexiko war seit Beginn des Jahrhunderts ein von revolutionären Umtrieben geschütteltes Land. Bereits zweimal, 1914 und erneut 1916, hatten US-Truppen dort militärisch eingegriffen, um die Interessen der Vereinigten Staaten zu wahren.69 Der zweite Grund, der die Zimmermann-Depesche so bedeutend wie brisant machte, war deren unglücklicher Zeitpunkt. Die Nachricht des britischen Geheimdienstes über das abgefangene Fernschreiben erreichte Washington am 1. Februar 1917, just als Deutschland die Wiederaufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs verkündete, was die öffentliche Meinung in den USA noch weiter zum Eintritt der USA in den Konflikt tendieren ließ.
Die Wiederaufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs hatte eine längere Vorgeschichte. Kurz nachdem die Deutschen ihre U-Boot-Angriffe gegen britische Frachtschiffe verstärkt hatten, die sie – oft zu Recht – verdächtigten, im Frachtraum Rüstungsgüter geladen zu haben, torpedierten sie am 24. März 1916 den britischen Dampfer Sussex im Ärmelkanal, wobei achtzig Menschen starben und etliche Amerikaner verletzt wurden. Washington reagierte darauf ungewöhnlich scharf, indem man der Berliner Führung ein Ultimatum stellte: Falls Deutschland die Attacken auf Passagier- oder Handelsschiffe nicht einstelle, erfolge der Abbruch aller diplomatischen Beziehungen. Damit rückte die Kriegserklärung der USA gefährlich nahe. Daraufhin erklärte Reichskanzler Bethmann Hollweg den verstärkten U-Boot-Krieg für beendet. Des Weiteren legte er das »Sussex-Gelöbnis« ab, das deutsche Unterseeboote zur Einhaltung der Prisenordnung verpflichtete, nach der U-Boote auftauchen, Handelsschiffe auf Kriegsgüter untersuchen und die Mannschaften in Sicherheit bringen mussten, bevor sie das Schiff versenkten. Die Deutschen hatten diese Prisenordnung nicht mehr befolgt, seitdem Großbritannien sogenannte Q-Ships einsetzte, vermeintliche Handelsschiffe, die U-Boote an die Oberfläche lockten und dann mit verdeckten Bordgeschützen angriffen. Nach Schätzungen sollen diese »U-Boot-Fallen« im Verlauf des Krieges vierzehn deutsche U-Boote versenkt und über sechzig beschädigt haben. Im Gegenzug für sein Zugeständnis forderte Bethmann Hollweg daher von den USA ein strengeres Vorgehen gegen die illegale, gegen die deutsche Zivilbevölkerung gerichtete Seeblockade der Briten. Denn nach Ansicht der Deutschen verhielt sich Washington gegen die Briten und ihren Einsatz von Q-Ships und Seeblockaden weitaus nachsichtiger als gegen die Deutschen.70
Als Ende August 1916 der Chef der Obersten Heeresleitung, Erich von Falkenhayn, wegen Erfolglosigkeit an der Westfront entlassen und durch den beliebten »Sieger von Tannenberg«, Paul von Hindenburg, ersetzt wurde, verlor Bethmann Hollweg aber zunehmend an Einfluss. Denn Hindenburg und seine rechte Hand, Erich Ludendorff, griffen viel direkter in das Regierungshandeln ein und errichteten bald de facto eine Militärdiktatur. Gegen die Zivilregierung setzten sie sich in der Frage des verstärkten Einsatzes von U-Booten schließlich durch mit dem Argument, dass die Seeblockade durchbrochen werden müsse, die für die Hungerkrise an der Heimatfront verantwortlich war. Ein Ende der Seeblockade könne zudem wieder Bewegung in die festgefahrene militärische Lage an der Westfront bringen.71
Die anhaltende Blockade und die Angst vor besser koordinierten alliierten Offensiven waren Anfang 1917 die zentralen Argumente für die Wiederaufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs, den die aggressiv agierende deutsche Marineleitung unter Admiral Reinhard Scheer seit geraumer Zeit forderte. Die Zahl der deutschen U-Boote war bereits von 41 im Januar 1916 auf 103 im Januar 1917 gestiegen und erreichte im Oktober 1917 mit 140 Booten ihren Höhepunkt.72 Zu diesem Zeitpunkt kontrollierten die Alliierten den Großteil der Seewege und konnten sich über ihre Kolonien und neutrale Staaten – allen voran die USA – ausreichend mit Industriegütern, Lebensmitteln und Rohstoffen versorgen, während lebenswichtige Importe der Mittelmächte blockiert wurden. Dagegen gab es nach Ansicht der Marineführung nur eine Waffe: Deutschland musste seine U-Boote einsetzen und entgegen internationalen Gepflogenheiten die Schiffe der Gegenseite versenken, ohne die zivilen Opfer zuvor zu warnen und in Sicherheit zu bringen. US-Präsident Wilson beharrte aber nach wie vor auf der strikten Anwendung des Seerechts. Das werteten die Deutschen als eine Verletzung der Neutralität, zumal die amerikanischen Waffenlieferungen an die Alliierten einen wesentlichen Beitrag zu dem Geschosshagel leisteten, der tagtäglich auf die deutschen Stellungen an der Westfront niederging.73
Schätzungen der deutschen Admiralität zufolge waren die deutschen U-Boote in der Lage, monatlich rund 600000 Tonnen Fracht zu versenken und somit die britischen Versorgungslinien derart zu beeinträchtigen, dass London innerhalb von fünf Monaten um Frieden ersuchen würde. In diesem äußerst optimistischen Szenario spielte der Eintritt der USA in den Krieg keine Rolle, da dieser vorüber sein würde, bevor Washington seine Truppen mobilisiert und nach Europa verschifft hatte. Ein Verzicht auf den uneingeschränkten U-Boot-Krieg hätte dagegen eine schleichende wirtschaftliche Strangulation Deutschlands zur Folge. Hindenburg, Ludendorff und der Kaiser beschlossen, das Risiko einzugehen – gegen den ausdrücklichen Wunsch der Zivilregierung, darunter Außenminister von Jagow und Reichskanzler Bethmann Hollweg, der das Risiko für unverhältnismäßig hielt.
Am 31. Januar 1917 wurde international bekannt, dass Deutschland den uneingeschränkten U-Boot-Krieg tags darauf wieder aufnehmen würde. In einer »Sperrzone« um die Britischen Inseln und Frankreich mussten fortan so gut wie alle Schiffe damit rechnen, ohne Vorwarnung torpediert zu werden. Bethmann Hollweg warnte, dass man es der alliierten Propaganda damit leicht mache, Deutschland als Kriegsverbrecher zu brandmarken.74 Denn vom 1. Februar 1917 an richtete sich der uneingeschränkte U-Boot-Krieg Deutschlands auch gegen alle unter US-Flagge fahrenden Schiffe im Atlantik, egal ob Passagierdampfer oder Handelsschiffe. Als bereits im Februar zwei Schiffe versenkt wurden, beließen viele amerikanische Reedereien ihre Schiffe in den Häfen.75
In Deutschland war man sich durchaus bewusst, dass der uneingeschränkte U-Boot-Krieg den Kriegseintritt der USA wenn nicht unvermeidlich, dann doch zumindest höchstwahrscheinlich machte. So schrieb etwa die australische Musikerin Ethel Cooper, die während des Krieges in Leipzig lebte, in einem durch die Schweiz geschmuggelten Brief an ihre Schwester Emmie in Adelaide: »Der erste Februar ist gekommen und gegangen, der U-Boot-Krieg ist erklärt worden, und wir warten, wie alle Welt, auf die weitere Entwicklung.« Weiter heißt es, ihre amerikanischen Nachbarn hätten »zum vierten Mal gepackt und ihren Hauswirten gekündigt, und die beiden holländischen und dänischen Familien, die ich kenne, diskutieren, ob sie nicht besser das gleiche tun sollten, und alle halten den gegenwärtigen Zeitpunkt für den kritischsten seit dem 1. August 1914. Die Amerikaner sagen, daß sie vor Scham vergehen müßten, wenn Mr Wilson wieder einen Kompromiß schließt.«76 Und in Bern notierte der stets gut unterrichtete Harry Graf Kessler am 1. Februar 1917 in sein Tagebuch: »Im Ganzen ist die Stimmung bei uns gedrückt, aber entschlossen; Stimmung des Mannes, der einer lebensgefährlichen, aber nicht mehr aufzuschiebenden Operation entgegengeht.«77
Die Nachricht von dem deutschen Bündnisangebot an die Mexikaner, die Washington fast gleichzeitig mit der Ankündigung des erneuten uneingeschränkten U-Boot-Krieges erreichte, brachte das Fass schließlich zum Überlaufen. Angesichts der Stimmungslage in den USA und aufgrund seiner allseits bekannten Einstellung zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg blieb Wilson wenig anderes übrig, als den Neutralitätskurs der USA aufzugeben. Am 2. April 1917 unterrichtete er den Kongress von seiner Absicht, Deutschland den Krieg zu erklären. Vier Tage später wurde die offizielle Erklärung unterzeichnet.78
Die deutschen Entscheidungsträger hatten damit gerechnet, dass der uneingeschränkte U-Boot-Krieg ein amerikanisches Eingreifen in den Krieg nach sich ziehen würde, aber kalkuliert, dass Großbritannien und Frankreich geschlagen sein würden, bevor die ganze Tragweite des amerikanischen Engagements spürbar wurde. Die gravierende Fehleinschätzung der deutschen Führung betraf also nicht die Frage, ob Amerika in den Konflikt eintreten würde, sondern welche Folgen das haben würde. Denn selbst wenn es noch bis zum Frühjahr 1918 dauern sollte, bis eine maßgebliche Anzahl von US-Soldaten in Frankreich landete, verschob die amerikanische Kriegserklärung das Kräfteverhältnis doch sofort zugunsten der Alliierten. Der Kriegseintritt der USA trug, wie sich zeigen sollte, entscheidend zur deutschen Niederlage bei.
Ebenso entscheidend hat Wilsons Versprechen eines Friedens ohne Besiegte die Zeit nach dem Krieg geprägt. Wilson war kein Berufspolitiker und sein Weg ins höchste Staatsamt eher ungewöhnlich. Im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger war er nicht als erfolgreicher Geschäftsmann in die Politik gegangen, sondern hatte zuvor eine akademische Laufbahn absolviert. Der im Jahr 1856 als Sohn eines presbyterianischen Pfarrers in Virginia geborene und streng calvinistisch erzogene Präsident hatte den Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) als Kind miterlebt. Sein politisches Denken sollte zeitlebens von der protestantischen Theologie und dem Liberalismus des 19. Jahrhunderts geprägt bleiben.79 Nach dem Jurastudium in Princeton wurde er 1885 mit einer politikwissenschaftlichen Arbeit zum Thema Congressional Government promoviert, in der er sich kritisch mit undemokratischen Aspekten des amerikanischen Parlamentarismus auseinandersetzte. Die Arbeit trug ihm in akademischen Kreisen viel Anerkennung ein, ebenso die zweite Studie The State (1899). Sie beruhte maßgeblich auf der Rezeption deutscher politikwissenschaftlicher Schriften, die Wilson im Original lesen konnte. Nachdem er mehrere Jahre als Professor in Princeton gewirkt hatte, wurde er 1902, mit 46 Jahren, zum Rektor der Universität berufen. Seine Amtszeit endete jedoch vorzeitig, als er sich 1910 mit einem Großteil der Professoren überwarf, die ihm dogmatischen Eifer und mangelnde Flexibilität vorwarfen.80
Noch im selben Jahr, 1910, wurde Wilson zum Gouverneur von New Jersey gewählt. Bald hatte er sich als einer der Führer des »progressiven Flügels« innerhalb der Demokratischen Partei etabliert, der sich für einen aktiven Staat, staatliche Sozialleistungen und wirtschaftliche Regulierung einsetzte. Als Gouverneur führte er etwa die Unfallversicherung für Arbeiter ein. Bei den Präsidentschaftswahlen von 1912 errang er als Kandidat der Demokraten den Sieg. Im Jahr 1916 wurde er wiedergewählt unter dem Wahlkampfslogan »Er hat uns aus dem Krieg herausgehalten«– ein Versprechen, das er nach wenigen Monaten brechen sollte.81
Obwohl Wilson stets die strikte Neutralität seines Landes beteuerte, war es für die Vereinigten Staaten schwer, sich gänzlich aus dem Krieg herauszuhalten. Fünfzehn Prozent der US-Bürger waren im Ausland geboren. Seit dem Kriegsausbruch in Europa hatten zahlreiche europäische Einwanderer mit britischen, irischen, deutschen oder italienischen Wurzeln wiederholt öffentlich Unterstützung für ihre Herkunftsländer bekundet und über die Frage von Einmischung oder Nichteinmischung gestritten.82 Weder die irischstämmigen Amerikaner – größtenteils Unabhängigkeitsbefürworter, die London nach der Hinrichtung der Anführer des gescheiterten Osteraufstandes von 1916 noch feindseliger gegenüberstanden – noch die osteuropäischen Juden in den USA, die vor antisemitischen Pogromen im zaristischen Russland und dem Ansiedlungsrayon geflohen waren, hegten große Sympathien für die Alliierten. Und die deutschstämmigen Amerikaner standen ebenfalls kaum aufseiten der Alliierten, was zu beachten war, weil sie die größte ethnische Minderheit im Land darstellten: Von den 92 Millionen US-Amerikanern im Jahr 1910 waren 2,5 Millionen in Deutschland zur Welt gekommen; weitere 5,8 Millionen der im Land Geborenen hatten deutsche Eltern.83 Obwohl Wilson überzeugt war, dass neunzig Prozent der US-Bevölkerung die Alliierten favorisierten, hatte er dennoch allen Grund zu der Befürchtung, dass rivalisierende ethnische Loyalitäten erhebliche Spannungen im Land zur Folge haben könnten.
Schwerer noch wogen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges: Die britische Seeblockade Deutschlands schränkte amerikanische Exporte massiv ein. Auch um diese Exportverluste auszugleichen, hatte Wilson Großbritannien und Frankreich bereits 1914 gestattet, amerikanische Waren auf Kredit zu kaufen – Kredite, die im Laufe des Krieges dramatisch anwuchsen. Je länger der Krieg dauerte, desto abhängiger wurden London und Paris von amerikanischen Lieferungen und Krediten. Andererseits war Washington auf Waffenexporte und sonstigen Handel mit Großbritannien und Frankreich dringend angewiesen, um seine boomende Wirtschaft am Laufen zu halten.84
Im Laufe des Krieges sollte sich die amerikanische Haltung gegenüber Deutschland durch den U-Boot-Krieg immer weiter verschlechtern. Doch obgleich die Torpedierung des britischen Ozeandampfers RMS Lusitania am 7. Mai 1915 – bei dem 1100 Passagiere und Besatzungsmitglieder, darunter 128 amerikanische Staatsbürger, ums Leben kamen – sowie der erste deutsche Giftgasangriff an der Westfront in den USA Empörung auslösten, befürwortete die Mehrheit der Amerikaner weiterhin Wilsons Politik der Nichteinmischung. Wilson signalisierte Kampfbereitschaft, bemühte sich aber zugleich um Verhandlungen zwischen den verfeindeten Seiten. Nach dem Untergang der Lusitania sollte der U-Boot-Streit sogar in den Hintergrund treten und beide Seiten nach einem Ausweg aus dem verlustreichen Stellungskrieg an der Westfront suchen lassen.85
Zu diesem Zeitpunkt glaubte Wilson noch, Deutschland sei bereit, an einer Friedenslösung unter seiner Vermittlung mitzuarbeiten. Nach dem knappen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen Ende 1916 bemühte er sich weiterhin um einen Verhandlungsfrieden und unterhielt geheime Kontakte zu Deutschland und Österreich-Ungarn.Gleich zu Beginn seiner zweiten Amtszeit sandte er seinen Vertrauten und inoffiziellen Berater, den texanischen Geschäftsmann und politischen Strippenzieher Edward House, nach Europa mit dem Auftrag, die Chancen für einen Kompromissfrieden ohne Sieger und Besiegte auszuloten. Doch die ernüchternden Ergebnisse dieser Unterredungen brachten ihn allmählich zu der Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten dem Frieden und der Nachkriegsordnung ihren Stempel nur würden aufdrücken können, wenn sie selbst in den Krieg eintraten – und zwar aufseiten Frankreichs und des Vereinigten Königreichs, Staaten, mit denen die USA enge wirtschaftliche Beziehungen unterhielten und deren politische Systeme Wilson näherstanden als die der Mittelmächte. Da er sich von London oder Paris aber nicht vor den Karren spannen lassen wollte, beharrte er auch weiterhin auf einer eigenständigen amerikanischen Politik mit eigenen Zielen.86
Diese Ziele präsentierte der Präsident der Öffentlichkeit am 8. Januar 1918 in einer programmatischen Rede vor beiden Häusern des US-Kongresses. Es war seine Vision der künftigen Friedensordnung, die im Kern auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker basierte. Einige der von Wilson aufgelisteten und in vierzehn Punkten aufgeführten Forderungen – etwa nach einem unabhängigen polnischen Staat mit Zugang zum Meer, der Räumung der von den Mittelmächten besetzten Gebiete und der Preisgabe Elsass-Lothringens – waren sehr konkret, andere wiederum – wie die nach der Freiheit der Meere, nach Rüstungsbeschränkungen und der Errichtung eines Völkerbunds – blieben vergleichsweise abstrakt. Bereits in seiner berühmten »Frieden ohne Sieg«-Rede vor dem US-Senat am 22. Januar 1917 – hatte Wilson verkündet, er strebe einen Verhandlungsfrieden, keinen Beutefrieden an. Versöhnung statt Triumph, Gerechtigkeit statt Rache – das seien die Prinzipien, auf denen die neue Weltordnung aufgebaut werden solle. »Sieg würde einen Frieden bedeuten, den man dem Verlierer aufzwinge«, erklärte der US-Präsident den anwesenden Senatoren. »Solch ein Frieden würde niemals halten. Er wäre auf Treibsand gebaut.«87 Wilson verknüpfte den Friedensschluss schon jetzt mit der Forderung nach Volkssouveränität und Demokratisierung. Hieraus ergab sich bereits die Rechtfertigung, warum ein unabhängiges Polen notwendig sei, in dem »fortan allen Völkern, die bislang unter der Herrschaft von Regierungen gelebt haben, die ihren eigenen Überzeugungen und Bestrebungen feindselig gegenüberstehen, das Recht auf Unantastbarkeit von Leib und Leben, Ausübung des Glaubens sowie wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung zugestanden werden soll«. Ein gefestigtes Polen und damit einhergehend ein stabiles europäisches und internationales System mit Polen könne es nur geben, so fuhr der Präsident fort, wenn »Polen« in Zukunft aus einer Gemeinschaft freier Individuen bestehe.88
Wilson verband den Krieg zunehmend mit einem weltweiten Kreuzzug für die Demokratie. Nach seiner Ansicht konnte nur eine grundlegende Umgestaltung zwischen- wie innerstaatlicher Machtverhältnisse dem Ausbruch eines derart grausamen Konflikts im Rückblick einen Sinn verleihen. Wilsons Vision zukünftiger staatlicher Souveränität, tief verwurzelt im Liberalismus des 19. Jahrhunderts, ruhte auf den Schultern rational denkender, autonomer und moralisch verantwortlicher Individuen. Wie bereits von Adam Smith in Wealth of Nations (1776) vorgedacht, schwebte ihm eine Welt vor, in der »befreite« Individuen Märkte zu gerechten und effizienten Instrumenten der Verteilung von Ressourcen machen. Wie schon John Stuart Mill in On Liberty (1859) postuliert hatte, würden diese Individuen durch den verantwortlichen Gebrauch ihrer Wählerstimmen dafür sorgen, dass sich das politische System ständig weiter verbesserte. Auf das internationale Staatenwesen übertragen waren gebildete Individuen imstande, eine neue Weltordnung zu schaffen.89
In einer Rede vor beiden Häusern des Kongresses am 2. April 1917 empfiehlt US-Präsident Woodrow Wilson die Kriegserklärung an Deutschland. Das Verhältnis der beiden Staaten hatte sich in den Monaten zuvor rapide verschlechtert, insbesondere durch die Wiederaufnahme des uneingeschränkten U Boot-Krieges von deutscher Seite und die Zimmermann-Depesche.
Nach Wilsons Auffassung waren politisch reife Individuen Menschen, die »Bundesschlüsse« eingehen konnten – ein Begriff, der in der amerikanischen Politik weder vor noch nach Wilsons Amtszeit viel Verwendung fand. Freie und mündige Menschen schließen dabei einen Bund, leisten einen ebenso heiligen wie unverbrüchlichen Schwur vor anderen und vor Gott. Das macht sie zu einer Art geheiligter Gemeinschaft. Auf diese Weise etwa wurden die biblischen Hebräer zu einem Volk, ebenso die Pilgerväter im Massachusetts der Kolonialzeit. Amerikaner wurden durch die De-facto-Bünde der Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung der Vereinigten Staaten zur Nation. Wilson selbst sah sich hier vor allem in der Tradition seiner schottischen Vorfahren, der Covenanters des 17. Jahrhunderts, die per Treueeid bezeugt hatten, den presbyterianischen Glauben gegen die Eingriffe der anglikanischen Kirche zu verteidigen. Gleichgültig ob religiös oder staatsbürgerlich fundiert, barg ein solcher Bundesschluss für Wilson eine quasireligiöse Qualität und stellte eine individualisierte, absolute Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft dar.90
Bei allen politischen Reflexionen über die künftige Ordnung von Staaten und deren Verhältnis zueinander hatte Wilson stets das Modell der Vereinigten Staaten im Sinn, das nach Kriegsende auf die besiegten Staaten und die internationale Ordnung ausgedehnt werden sollte. Seine idealistischen Ideen spielten 1919 bei den Friedensverhandlungen in Paris eine wichtige Rolle, und zwar sowohl was die Erwartungen der Deutschen an den erhofften Wilson-Frieden anging – also einen Frieden ohne Sieger und Besiegte – als auch was die Neuordnung der Welt betraf.
Keine 72 Stunden nach der amerikanischen Kriegserklärung an Deutschland kam es in der neutralen Schweiz zu einem Ereignis, das im Laufe des folgenden Jahres ebenso große Auswirkungen auf den Fortgang des Krieges und die deutschen Vorstellungen von der Nachkriegswelt haben sollte: Am 9. April 1917, es war der Ostersonntag, trat Wladimir Iljitsch Uljanow mit seiner Frau und Mitstreiterin Nadja sowie dreißig seiner engsten Mitarbeiter auf dem Bahnhof in Zürich die lange Reise nach Russland an.91
Die Machthaber in Berlin, die die streng geheime Eisenbahnfahrt aus der neutralen Schweiz durch deutsches Staatsgebiet genehmigt und die Weiterfahrt nach Russland organisiert hatten, setzten große Hoffnungen in diesen Mann, der seine journalistischen Artikel in obskuren linksradikalen Blättern mit Kleinstauflage unter dem Pseudonym »Lenin« veröffentlichte und von dem bis dahin über den Kreis der Sozialistischen Internationale hinaus nur wenige gehört hatten. Ausgestattet mit einer beträchtlichen Geldsumme, sollte sich dieser Lenin an die Spitze der kleinen bolschewistischen Bewegung in seinem Heimatland setzen, die Februarrevolution radikalisieren und den Krieg Russlands gegen die Mittelmächte beenden.92





























