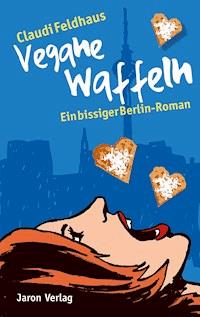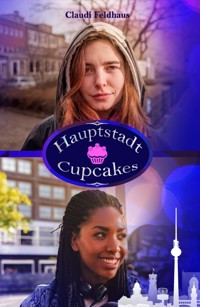Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Annegold." Ja, ich heiße wirklich so. Annegold Erol. Mein Bruder hieß Aurel. Und meine Eltern betreiben seit seinem Tod einen Kult um die Kraft des großen Dichters, der die goldene Energie in uns allen fließen lassen kann. So ein Unsinn! Aber ja, mit Gold haben sie's. Meine Nichte heißt Gina, das bedeutet Silber. Sie liebt mich, trotzdem ich Schuld am Tod ihres Vaters habe. Ich und mein Größenwahn, mit einer Kontraktur Auto fahren zu können. So als wäre ich ganz normal." Annegold Erol ist am Tiefpunkt angekommen. Doch trotz Beinbehinderung, Scheidung und einem leeren Konto weigert sie sich, mit 35 wieder von ihren Eltern abhängig zu werden. Sie zieht zu Jakob und Mexx und ist so sehr damit beschäftigt, normal sein zu wollen, dass sie gar nicht merkt, wie die größte Energie des Universums von ihr Besitz ergreift.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum neobooks
Claudi Feldhaus
Die Güte des Goldes
Impressum
©2020 Claudi Feldhaus
kakaobuttermandel.de, [email protected]
Claudi Feldhaus
Der Kleinste Buchladen
Reinsberger Dorf
Am Weinberg 1
99938 Plaue
4. Auflage 2021
Lektorat/Korrektorat: Bettina Bergmann, Juliet May
Buchsatz: Claudi Feldhaus
Coverfoto: Adobe Stock
Coverdesign: Mika M. Krüger
ISBN: 978-3-7502-2581-7
Triggerwarnungen (Content Notes) befinden sich auf der letzten Seite des Buches und ständig aktualisiert unter https://www.kakaobuttermandel.de/content-note/.
Das Buch
»Annegold.«
»Ja, ich heiße wirklich so. Annegold Erol. Mein Bruder hieß Aurel. Und meine Eltern betreiben seit seinem Tod einen Kult um die Kraft des großen Dichters, der die goldene Energie in uns allen fließen lassen kann. So ein Unsinn! Aber ja, mit Gold haben sie‘s. Meine Nichte heißt Gina, das bedeutet Silber. Sie liebt mich, trotzdem ich Schuld am Tod ihres Vaters habe. Ich und mein Größenwahn, mit einer Kontraktur Auto fahren zu können. So als wäre ich ganz normal.«
Annegold Erol ist am Tiefpunkt angekommen. Doch trotz Beinbehinderung, Scheidung und einem leeren Konto weigert sie sich, mit 35 wieder von ihren Eltern abhängig zu werden. Sie zieht zu Jakob und Mexx und ist so sehr damit beschäftigt, normal sein zu wollen, dass sie gar nicht merkt, wie die größte Energie des Universums von ihr Besitz ergreift.
Die Autorin
Claudi Feldhaus, anno 1987, studierte Belletristik und veröffentlichte Romane in verschiedenen Verlagen. Die Güte des Goldes war 2020 ihr erstes Selfpublishing-Projekt und 5. Romanveröffentlichung.
Unter ihrem anderen Pseudonym, Amalia Frey, schreibt sie feministische Romance und eine Herstory-Reihe. Von ihr als Claudi Feldhaus erscheinen zeitgenössische Berliner Frauenromane, Fantasy und Krimis.
Sie ist Mitglied der Autorinnenvereinigung Deutschland e.V. und Schwester des Nornennetzes, dem größten Bund deutschreibender Phantastik-autor:innen.
Frau Feldhaus lebt, liebt und trinkt Kaffee in Berlin.
Für Mika.
Claudi Feldhaus
Die Güte des Goldes
Die Güte des Goldes erprobe im Feuer,
die des Menschen im Unglück.
- aus China
I
Hier saß ich nun. 35 und frisch geschieden. Mein Kabuff unter dem Dach eines Einfamilienhauses im Wedding, eine Isomatte, ein paar Kleider, keine Kohle.
Ich blickte mich im Raum um. Karg sah es aus, staubig. Ich hatte mir andere WG-Zimmer in dieser Preiskategorie angesehen. Dieses war das Einzige ohne Schimmel auf der Tapete, ohne sechsspurige Zubringerstraße vor dem Fenster. Ohne sexuelle Dienstleistungen als Zuschuss zur Miete. Aber den Gedanken, mich gegen körperliche Liebe und einen kleinen Obolus dort wohnen zu lassen, hatten wohl alle über Bord geworfen, spätestens als sie mein Bein gesehen hatten.
Am Ende, schon völlig entkräftet, kam ich in diesem Haus an. Ein Mann weit von meiner Liga entfernt öffnete die Tür. »Du bist Annegold Erol?«
Ja, ich heiße wirklich so. Annegold. Jetzt wieder Erol. Auf Jobsuche. Bis auf Weiteres auf die Gunst meiner semireichen Eltern angewiesen. Der hübsche Typ reichte mir die Hand: »Ich bin Jakob. Komm doch rein.«
Ich verbarg mein Schlurfen nicht. Überraschenderweise schien er es gar nicht mitzukriegen. Wie er mir erzählte, war er Krankenpfleger, woraus ich schloss, dass er mit Menschen wie mir umgehen konnte.
»Tja, möchtest du dir gleich das Zimmer ansehen oder erstmal einen Tee?«
Nach diesem Tag kamen mir bei seiner Freundlichkeit fast die Tränen, und Tee wäre klasse gewesen. Doch ich wollte erst das Zimmer sehen. Er dirigierte mich durch die kurze Diele zur Treppe. Eine steile Treppe. Ich biss mir auf die Lippen und folgte ihm dann, zog mein rechtes, steifes Bein die Stufen hoch. Während ich mich so am Geländer festklammerte, dachte ich darüber nach, dass er mir das Zimmer sowieso nicht geben würde und ich mich hier gerade völlig umsonst bloßstellte. Aber er gab es mir. Er fragte indes nicht einmal, ob ich einen Job hätte, nur nach meiner Familie und erwähnte, dass er von meinem Vater Jasper gehört hätte.
Das verwunderte mich nicht großartig. Er und meine Mutter Oda publizierten esoterische Bücher, alternative Medizin für die Gedanken oder sowas, und hatten einen Youtube-Kanal sowie eine ansehnliche Fangemeinde. Angefangen hatte es mit einem kleinen Kult, den sie betrieben, um die Trauer um ihren Sohn aufzuarbeiten. Mittlerweile finanzierten ihre sogenannte spirituelle Wissenschaft, ihre Bücher und der Zubehör wie Schmuck und Figuren, ihr Leben. Jakob zeigte mir, dass er eines der Armbänder trug. Von meiner Gegenwart, von der Tochter seines Helden, schien er regelrecht begeistert zu sein. Dass ich meinem Namen zum Dank an etwas so Positives wie ein günstiges Zimmer herankam, war eine ganz neue Erfahrung. Und so saß ich hier. Müde - müder als gewöhnlich - von all den Absagen und den Blicken des heutigen Tages. Als ich noch verheiratet war, hatte ich von zuhause gearbeitet und war immer seltener rausgegangen. Ich hatte in den paar Jahren vergessen, wie tief die Blicke der Menschen bohren können.
Ich hörte ein Auto auf den Hof fahren. Ob das meine Eltern und meine kleine Nichte Gina waren? Die Türglocke schellte. Ich wartete. Mit einer Beinbehinderung wägte man sehr genau ab, wann es sich lohnte, aufzustehen. Ich vernahm Jakobs aufgeregte Stimme. Offenbar doch nur Bekannte von ihm. Also widmete ich mich wieder meiner Arbeit. Die Möbel im Zimmer, zwei Schränkchen und ein Tisch, kein Stuhl, waren verstaubt. Wie lange hatte hier niemand gewohnt? Oder hatte ich das Zimmer eines Dreckschweines geerbt? Bevor mein Vater mir meine restlichen Sachen brachte, wollte ich alles sauber gewischt haben.
»Ann?«, vernahm ich eine Kinderstimme und wirbelte herum. »Hast du mein Klopfen nicht gehört?«
Gina stand in der Tür, nahm ihre farbigen Brillengläser ab und blickte mich mit ihren großen Augen an. Die Gesichtszüge der Zehnjährigen erinnerten schmerzhaft an meinen Bruder.
Mein Herz zog sich zusammen und noch ein Stück mehr, als sie mich ohne zu zögern umarmte. Trotzdem sie durch meine Schuld den wohl größten Verlust in dieser Familie erlitten hatte, liebte sie mich aufrichtig und zeigte das stets durch körperliche Nähe. Ich strich über ihr farbloses Haar und erwiderte die Umarmung so lange, bis sie mich losließ.
»Opa und Oma sind noch unten. Sie kommen gleich. Wir sollen hier warten.«
Meine Verwunderung darüber hielt sich in Grenzen, die beiden hatten öfter solche Allüren.
Vielleicht mussten sie, was am Auto machen oder telefonieren? Wer weiß ...
Gina half mir beim Putzen der niedrigen Schubladen. Sie ging auf die Knie, kroch halb in den Schrank hinein, als sie ihn auswischte. Der Segen ihres gesunden, schlanken Körpers, der Gabe stets durchschlafen zu können. Womöglich würden mir so alltägliche Aufgaben leichter fallen, wenn ich zu meiner Behinderung nicht auch noch chronisch übermüdet wäre.
Als alles sauber war, setzen wir uns auf die Isomatte, lehnten an der Wand, ich streckte schwer seufzend beide Beine aus. Gina holte ihr Telefon hervor. »Die Eule war wieder da, ganz nah am Fenster, guck mal, das war heute Morgen.«
Ich sah mir das Foto an. Es zeigte den herbstlichen Baum vor Ginas Fenster im zweiten Stock meines Elternhauses, darauf ein Riesenvieh von Vogel. Ich sah genauer hin. »Gina, das ist sogar ein Uhu.«
»Oh, aber ich dachte, es wäre ein Mädchen.«
Ich lachte. »Uhus sind sehr große Eulen.«
»Der Uhu. Die Eule.«
»Der Tisch, das Bett, die Lampe, das Leben, der Baum, die Birke ... die Zeit. Irgendjemand hat das mal festgelegt, das hat meistens wenig mit einem Geschlecht zu tun.«
»Das Bein, die Hand ...«, murmelte sie und legte ihre schneeweiße Hand auf mein Knie. Mit der anderen fasste sie sich an den kleinen Anhänger an ihrer dünnen goldenen Halskette. Genau so einen, nur einiges größer, trugen meine Eltern. Ich hatte auch so ein Ding, aber ich trug grundsätzlich keinen Schmuck.
Ich lächelte und streichelte wieder Ginas Kopf. »Zeig mir das Foto bitte nochmal.«
Sie hatte noch mehr von dem Tier gemacht. Da ich die Ausmaße ihres Fensters und des Baumes davor kannte, war mir bewusst, wie gewaltig dieser Vogel sein musste. »Ein Uhu in der Stadt?« Zwar wohnte meine Nichte zusammen mit meinen Eltern Oda und Jasper in ihrem Haus am Rand des Grunewalds, aber es kam mir dennoch unwirklich vor, dass so ein Brocken hier leben und jagen konnte.
Ich nahm Ginas Telefon und googelte ‚Uhuvogel‘. Das Kind lehnte sich an meine Schulter, während ich schnell einen Text las. »Ah, hier steht‘s. Die Weibchen werden größer als die Männchen.« Ich sah mir nochmal das Foto an. »Du hattest also einen guten Riecher, das scheint ein Mädchen zu sein.«
Gina grinste und sagte dann: »Ich hab sie Silvina genannt.« Ich schluckte schwer und erwiderte ihren Blick. Sie lächelte noch breiter. »Guck, findest du nicht, ihre Augen ähneln Mamas?«
Nun schmunzelte ich. Kinder hatten wirklich Fantasie!
»Und sie ist sooft da. Wenn ich morgens aufwache, schaut sie in mein Fenster, wenn ich zur Schule gehe, sehe ich sie auf dem Baum sitzen. Und letztens als mich die anderen in die Ecke getrieben haben, da war sie plötzlich da und ist wild um uns geflattert. Da haben sie Angst bekommen und sind weggelaufen.«
»Wen meinst du mit den anderen?«, fragte ich.
»Na die anderen. Aus meiner Klasse.« Gina kuschelte sich in meinen Schoß. Ruhig sprach sie, trotzdem hörte ich, wie sie mit den Zähnen knirschte. »Sie haben es diesmal nicht geschafft, mir die Brille wegzunehmen ... weil Silvina da war ... sie hat sie verjagt.«
Ich atmete schwer aus. Mir war klar, dass die Kleine sich in ihre Fantasiewelt stahl, sich eine Beschützerin vorstellte, um den Hänseleien anderer zu entgehen. Ich sollte mit meinen Eltern sprechen. Sie mussten irgendetwas gegen diese Typen in Ginas Klasse tun. Elterngespräche, die Direktorin aufsuchen, was weiß ich? Mein Kopf schwirrte mir. Die verdammte Übermüdung versagte mir sogar, diesen einfachen Gedanken zu vollenden.
»Weißt du, ich kenne das«, sagte ich dann ruhig. Wenn ich Gina schon nicht direkt helfen konnte, wollte ich ihr wenigstens das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. »Als Kind habe ich mir einen Wolf vorgestellt, der mir überallhin folgte. Der mich beschützt, vor den Kindern, vor dem Sportlehrer ...« Bestimmt war meine Situation kaum mit ihrer vergleichbar. Ein lahmes Bein erkannte man erst im Gehen, eine Albina auch, wenn sie saß.
»Ich stelle mir Silvina nicht vor. Schau doch, jetzt habe ich Fotos!« In ihrem Gesicht konnte ich sehen, wie sie die Wut unterdrückte.
Schnell wiegelte ich ab: »Natürlich nicht. Es ist schön, eine Beschützerin zu haben. Erzähl mir ruhig mehr von Silvina und von den anderen. Wann immer etwas ist, sagst du es mir, ja?«
»Ja, okay«, flüsterte sie und hob den Kopf. Ich sah die Tränen in ihren Augen. Gerade wollte ich sie in den Arm nehmen, als es klopfte. Rasch wischte Gina sich übers Gesicht und ich sagte: »Herein.«
Meine Mutter Oda wirbelte ins Zimmer, wie so oft im langen Rock, gothic-hippie-chic, wenn es so etwas gab, kurzes metallicblondes Haar. Gefolgt von meinem Vater Jasper in schwarzer Jeans und passendem Rollkragenpullover. Abgerundet wurde sein Look stets durch eine exzentrische Designerbrille. Er hatte etwas von Steve Jobs auf dem Höhepunkt seiner Karriere, nur dass mein Vater volles silbernes Haar besaß. Sie waren beide stolz, dass sie aussahen wie Ende 40 und nicht Anfang 60. Wenn ich mich so betrachtete, musste ihre Vitalität allein von ihrem Lebenswandel herrühren, denn genetisch hatten sie mir nichts davon zukommen lassen. Jasper half mir auf die Beine, dann umarmten sie mich nacheinander, als hätten sie mich wochenlang nicht gesehen. Dabei hatte ich erst heute Morgen ihr Haus verlassen. Oda streichelte meinen Rücken. Ihr Blick ruhte auf mir. »Und, wie geht‘s dir denn?«
Ich presste die Lippen zu einem Lächeln aufeinander. Sicher dachte sie nicht so über mich, aber ich stellte mir vor, dass mein Anblick zwangsläufig Mitleid erregen musste. Pummelig, behindert und nun auch noch geschieden.
»Geeeht«, erwiderte ich.
Sie hatten meine Säcke mit den übrigen Kleidern und eine Bananenkiste mit meinen Büchern mit nach oben gebracht. Das war alles, was mir geblieben war. Thomas hatte während unserer Ehe das Materielle gekauft, ich hatte nur das Geld für Essen, Strom, Wasser, Therapiekosten beisteuern können.
Diese Bücher hatte ich vor acht Jahren in sein Haus mitgebracht, die Kleider konnte er nicht verwenden, darum hatte ich sie mitnehmen dürfen.
»Komm, Annegold«, weckte Jasper mich aus meinen Gedanken, »komm Töchterchen, wir laden dich zum Essen ein.«
Er reichte mir die Hand. Mein Herz wärmte sich, als ich sie ergriff, aber ich schüttelte den Kopf.
»Vati, ihr habt mich fast ein Jahr durchgefüttert, ich bekomme langsam ein schlechtes Gewissen.« Noch bevor ich geendet hatte, machte er eine wegwerfende Handbewegung, doch ich fuhr fort: »Total lieb, ich wäre jetzt aber gerne für mich. Ich werde versuchen zu schlafen ... ihr wisst ja ...«
Da lächelte er und streichelte meinen Schopf, wie ich es bei Gina getan hatte. »Mein tapferes Mädchen. Du machst das schon. Und wie wir sehen, ist diese Wohnung eine wirklich glückliche Fügung. Der große Dichter ist dir zugetan!«
Ich verkniff mir einen Kommentar. Im Augenwinkel sah ich Gina heftig nicken.
Oda umarmte mich noch einmal lange und sagte: »Geh schlafen, Annegold. Morgen ist ein neuer Tag, an dem das Gold der Erde dich wieder erfüllen kann.«
»Und das Silber des Universums auf dich regnet«, setzte mein Vater lächelnd nach. Während sie das sagten, fassten sie simultan nach den goldenen Amuletten, die sie trugen: dem Symbol des großen Dichters. Ich unterdrückte ein Augenrollen. Sie meinten es natürlich nur gut, aber ihre goldigen Geister aus dem Kosmos hatten mich noch nie gefunden, wie sollten sie mich dann erfüllen?
»Ruf an, wenn du etwas brauchst«, endete er.
Ich rang mir ein Lächeln ab, beugte mich zu meiner Nichte herunter und küsste ihre Stirn.
»Grüß Silvina von mir«, flüsterte ich in ihr Ohr und sie nickte.
Niemand verlangte von mir, die Treppen nach unten zu steigen, um sie am Auto zu verabschieden. Das tat in dieser Familie keine:r. Trotzdem ich auf so vielen Ebenen das schwarze Schaf war, unterstützten sie mich, wo sie konnten, nahmen auf mich die Rücksicht, die ich nicht verdient hatte. Ich wusste, was für ein verdammtes Glücksschwein ich war. Vielleicht hatte ich mit ihnen all das Gold verbraucht, von dem meine Eltern immer fantasierten. Ich lachte in mich hinein. Bis ich das Auto vom Grundstück fahren gehört hatte, wartete ich und legte mich dann ungewaschen ins Bett. Auf so viele Arten, müde zu sein, hielt mich sogar vom Zähneputzen ab. Vor meinem Fenster hörte ich ein Flattern. Für einen Moment dachte ich, ich hätte im Schein der Straßenlaterne einen Uhu emporsteigen sehen.
Seitdem Thomas nachts nicht mehr meine Hand hielt, sind die Albträume zurück. Die Erinnerungen in verzerrten und immer intensiveren Farben von mir hinter dem Steuer. Aurel im Beifahrersitz, Silvina, die sich von hinten an seinen Sitz lehnt und seine Hand hält. Wir lachen, die beiden sind wunderschön. Als Nächstes höre ich den Knall, spüre den Aufprall. Der Wagen meines Bruders schleudert umher, mein Magen rebelliert, das Blut schießt mir in den Kopf. Ich sehe schwarz, dann blaues Licht, das im Hintergrund rotiert, ihre zerschnittenen Gesichter, Rot, das ihre schneeweiße Haut überströmt. Verzerrt und doch so klar sehe ich meinen Zwillingsbruder und meine beste Freundin sterben. Nacht für Nacht sehe ich sie wieder. Bis ich aufschrecke.
Schweiß bedeckte meinen Körper, als ich die Augen öffnete. Seitdem Thomas nicht mehr meine Hand hielt, hatte ich kaum mehr als vier Stunden am Stück geschlafen. Das war meine Strafe. Ich setzte mich auf, zog mein bewegliches linkes Bein an und legte die Stirn auf dem Knie ab. Die Tränen kamen. Noch immer zitterte ich, fror und schwitze gleichzeitig. Stumm bat ich um Verzeihung. Seit zehn Jahren bat ich um Verzeihung.
Erst ein Rumpeln aus dem Zimmer unter mir holte mich aus dem Nebel. Der Raum lag im Dunkeln, die Straßenlaterne vor meinem Fenster reagierte nach Mitternacht auf Bewegungen; ich erinnerte mich, dass Jakob mir das gesagt hatte. Dass sie nachts nicht durchweg in mein Zimmer leuchten würde. Stattdessen erkannte ich den Mond am Himmel. Eine nicht volle, aber riesige Scheibe, ungewöhnlich gelb. Gold mit silbernen Flecken.
Der Name meines Zwillings bedeutete Gold. Noch offensichtlicher wollten meine Eltern mich benennen. Im Haus neben uns wohnte Silvina, ein Mädchen mit farblosem Haar, farbloser Haut und farblosen Augen. Von kleinauf spielten wir drei miteinander. Wir verbrachten gemeinsam endlose Sommer, in denen wir durch den Grunewald streiften, im See spielten, Buden bauten. Zweimal Gold und einmal Silber. Wir wurden erwachsen. Silvina und Aurel verliebten sich ineinander ...
Wieder rumpelte es unten. Jemand heulte auf. Das holte mich endgültig aus meinen Erinnerungen. Ich lauschte. Aus dem Zimmer unter mir kamen die Geräusche, ich hörte eine männliche Stimme. Klagend. Flehend. Jakob! Ich biss die Zähne zusammen und erhob mich. Wenn ich mich länger nicht bewegte, tat das steife Bein weh. Anders, als wenn ich eine Weile gelaufen war, dann schmerzte das Linke. Die Müdigkeit hing zäh an mir. Ich schleppte mich zur Tür, schaltete das Licht ein und zwang mich die Treppe hinunter. Ich erinnerte mich, dass er mir erklärt hatte, welches sein Zimmer war. Je näher ich kam, desto deutlicher kamen die Laute von dort. Zaghaft klopfte ich an seine Tür.
»Brauchst du Hilfe?«
Erneut rumpelte es, als ob er etwas umgeworfen hatte. Er klagte, unverständliches Genuschel.
»Ich komme jetzt rein«, rief ich durch die Tür und drückte langsam die Klinke herunter. Der Raum lag im Dunkeln, nur zwei Kerzen leuchteten. Dennoch konnte ich ihn deutlich mitten auf dem Fußboden, den Kopf zur Tür ausgerichtet, ausmachen. Er schien mich gar nicht wahrzunehmen, sondern bewegte sich, streckte alle Gliedmaßen von sich, flehte und keuchte.
»Jakob, ich schalte jetzt das Licht ein.«
Von ihm kam keine Reaktion, also tastete ich nach dem Schalter und sah ihn im nächsten Moment nackt am Boden, auf dem gekrümmten Rücken liegen. Auf das Licht reagierte er mit einem unmenschlichen Schrei. Ich schreckte zurück, spürte, wie mein Herz noch tiefer rutschte. Um ihn herum lagen goldene Kerzen in verschiedenen Größen, erloschen bis auf die zwei. Er schaute mich an, die Pupillen geweitet, sodass seine Augen fast schwarz waren. Was hatte der sich bitte eingeschmissen? Er hatte auf mich überhaupt nicht so gewirkt, als würde er harte Drogen nehmen. Seine hellbraune Haut war über und über mit Zeichen in dunkelroter Farbe bemalt. Verschlungene Symbole, die keine genauen Bilder oder Buchstaben ergaben. Sein Bauch war unwirklich aufgebläht. Ich blinzelte, denn ich wollte nicht glauben, dass ich sah, wie sich unter der Haut etwas wellte und bewegte.
»Jakob? Hörst du mich?«
Daraufhin gab er ein gurgelndes Geräusch von sich und stütze sich mit Fersen, Schultern und Hinterkopf vom Boden ab. Ich wich zurück. Mit diesen schwarzen Augen starrte er mich an, aber sah durch mich hindurch.
Er hatte vorhin von einer weiteren Person erzählt, die mit in diesem Haus wohnte. »Hallo?«, rief ich deutlich den Flur hinunter, »ich könnte hier Hilfe gebrauchen.« Nichts rührte sich.
Jakob stieß auf, schnappte nach Luft. Dann trat Erbrochenes aus seinem Mund hervor.
»Scheiße, scheiße, scheiße!«
Ich ging zu ihm und drehte ihn auf die Seite, damit alles aus seiner Mundhöhle herausfloss und er nicht ersticken konnte. Er spie braunschwarze Flüssigkeit, wie Teer, heraus und zwischen den Schüben, formte er Worte. »Dicht. Er. Kommt. Er. Höre. Dicht. Er. Ich. Flehe. Er. Leuchtung.«
Das war der Moment, in dem ich meine Berührungsängste endgültig verlor und ihn von hinten packte. »Jakob, bitte komm zu dir, wach auf. Ich kann dir sonst nicht helfen.«
Aber er wurde nur lauter, erbrach sich weiter. Das Zeug stank schlimmer als die Gosse, es war überall. Und dennoch schien immer noch ein großer Klumpen davon in ihm festzustecken, der sich nur stoßweise aus ihm ergoss.
Ich zwang mich, mit ihm im Arm aufzustehen, und wendete den Heimlichgriff an. Die Flüssigkeit entlud sich in einem harten Strahl aus seinem Inneren. Ich fiel zurück, er mir nach. Ich knallte mit Hinterkopf und Rücken gegen den Schrank und schließlich auf meinen Hintern. Jakob sackte vor mir zusammen, ich berührte seine festen Oberarme. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, ich spürte mein Blut in den Ohren rauschen. Ich bemühte mich, bei Verstand zu bleiben und mich nicht zu sehr zu ekeln. Unwillkürlich registrierte ich seine glatte Haut, heiß, mit kaltem Schweiß überdeckt. Mit Mühe richtete ich seinen Oberkörper auf, hielt seine breiten Schultern fest. Mehr Flüssigkeit troff aus seinem Mund. Immer wieder sagte ich seinen Namen und flehte ihn an, zu sich zu kommen. Dann fiel sein Kopf nach hinten, sein Rücken sank gegen meinen Bauch. Jakobs Lider waren geschlossen und vibrierten, die Lippen standen halb geöffnet und zitterten. Ich zwang mich, nicht auf seinen Schwanz zu starren, und redete weiter auf ihn ein.
Alles tat mir weh. Unmöglich, jetzt aufzustehen! Ich war endgültig zu ermattet, diesen Mann so weit aufzurichten, dass ich freikam. Also zog ich ihn an mir hoch und legte seinen Kopf an die Seite, dass der Mist abfließen konnte. Auf mich drauf, auf den hellen Teppich. Es stank zur Hölle und ich musste meine übrigen Kräfte bündeln, mich nicht auch noch zu übergeben. Ich atmete durch den Mund, redete weiter mit ihm. Durch sein Gewicht rutschte er immer wieder an mir runter, ich zog ihn immer wieder hoch.
Stunden mussten vergangen sein, als das Zeug aus seinem Körper endlich versiegt war und sein Gemurmel endete. Ich spürte, wie sein Leib sich beruhigte, wie er gelöst atmete. Er schlief. Ich biss die Zähne zusammen und drückte ihn mit letzter Kraft von mir weg, legte ihn auf die Seite. Dann zog ich mein steifes Bein unter ihm hervor und rollte mich auf den Rücken.
Die Deckenleuchte blendete mich, draußen begannen die ersten Vögel zu singen, der Himmel hellte sich auf. Nach einigen Minuten Erholung richtete ich meinen Oberkörper auf. Meine Schultern, meine Arme schmerzten wie Muskelkater, meine Beine prickelten. Und überall dieses Zeug, ein Gestank, wie ich ihn noch nie wahrgenommen hatte. Vorsichtig drehte ich Jakob zu mir, konnte der Versuchung nicht widerstehen und streichelte sein Gesicht. Ich spürte den Bartschatten unter meinen Fingern, ansonsten war seine Haut babyzart. Unwirklich, er hatte offensichtlich den krassesten Drogentrip seines Lebens hinter sich, war vollgekotzt und ausgezehrt, und dennoch ... ein schlafender Dornenros.
Bei der Erkenntnis, dass ich außer Thomas nie einem nackten Mann so nahe gewesen war, unterdrückte ich ein Lachen. Endlich wurde mir klar, dass ich meine Kräfte lieber dafür aufwenden sollte, einen Rettungswagen zu rufen.
II
Man hatte mich mit ins Krankenhaus genommen, denn meine Vitalwerte waren auffällig niedrig. Was natürlich niemanden überraschte. Weder war ich eine solche körperliche Anstrengung gewohnt, noch war mein Organismus dazu überhaupt geschaffen. Eine Schwester half mir, mich zu waschen, ich bekam eine Schlaftablette und wurde ins Bett gesteckt. Ich liebte Schlaftabletten! Sie bescherten mir traumlose Nächte.
Am Nachmittag kam ich zu mir, mein erster Blick fiel aus dem Fenster, wo es dunkelte. Das sagte mir, dass ich offenbar endlich mehr als vier Stunden geschlafen hatte. Ich spürte eine Berührung an meiner Hand und sah auf. Meine Mutter saß an meinem Bett und lächelte herzlich. »Annegold, wie schön, du bist wieder bei dir.«
Um nicht loszuweinen, presste ich die Lippen aufeinander. Wer wusste, wie lange sie hier auf mich gewartet hatte? Unsere Finger verschlungen sich ineinander. »Wie geht es dir?«
»Ich bin gerädert. Aber ich weiß nicht, ob es der lange Schlaf oder Muskelkater ist.«
»Vielleicht beides.« Sie beugte sich zu mir herab und küsste meine Stirn. »Die Ärztin hat uns erzählt, was du getan hast. Du warst sehr stark und tapfer!« Sie sah mich fest an. »Ich bin stolz auf dich.«
Das Gefühl, das unwillkürlich in einem emporstieg, wenn Eltern einem das sagten, erfüllte mein Innerstes. Oda hatte mir zum letzten Mal gesagt, dass sie stolz war, als ... ich meinen Führerschein geschafft hatte. Und ein halbes Jahr später hatte ich ihren Sohn und ihre Schwiegertochter umgebracht. Ich biss mir auf die Lippen und das warme Gefühl in mir wurde von der allzu bekannten Reue verdrängt. »Es tut mir so leid«, flüsterte ich.
Meine Mutter schüttelte lächelnd den Kopf. Sie war daran gewöhnt, dass ich mich ständig entschuldigte, und wusste, woran ich gedacht hatte. Aber sie hatte vor ein paar Jahren aufgegeben, mir zu sagen, dass ich mich nicht zu entschuldigen brauchte.
»Du wirst heute Nacht nochmal zur Beobachtung hier bleiben, was meinst du?«
Ich nickte müde. Vielleicht würde ich noch eine Tablette bekommen. Dann kam mir ein Gedanke.
»Hast du von Jakob gehört?«, fragte ich leise, sie erblasste, augenblicklich bildete ihr Mund eine dünne Linie. Das konnte nichts Gutes bedeuten!
»Oh nein, ist er an der Überdosis gestorben?«
»Über ...? Oh, nein, nein. Sie kriegen ihn wieder hin. Soweit ich weiß, hängt er am Tropf und schläft.« Sie streichelte meine Wange. »Du hast ihm das Leben gerettet.«
Ich atmete auf und hauchte: »Gut.«
Meine Mutter lächelte. »Natürlich ist das gut. Drogenmissbrauch ist gefährlich, er hatte wirklich Glück, dass du ihn gefunden hast.«
»Weißt du, was er sich da eingeschmissen hat?«
Sie wich meinem Blick aus und griff nach der Fernbedienung für mein Bett. Während sie meinen Oberkörper aufrichtete, antwortete sie: »Nein und ich möchte auch nicht danach fragen, ehrlich gesagt. Möchtest du etwas essen? Musst du auf die Toilette?«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Dann trink wenigstens was.« Sie füllte mein Glas mit stillem Wasser und reichte es mir.
Brav nahm ich ein paar Schlucke und stellte, als die Flüssigkeit meine Verdauung aufweckte, fest, dass ich wirklich hungrig war und kurz darauf auch, dass ich aufs Klo musste.
Meine Mutter blieb noch bis zum Ende der Besuchszeit. Während ich geschlafen hatte, hatte sie sich mit meinen Zimmergenossinnen angefreundet und mich in das weitere Gespräch integriert. Sowas war immer ihr Talent. Gegen acht kam mein Vater mit einem riesigen Blumenstrauß und Süßigkeiten für mich. Er streichelte mir die Wange. Auch er sagte mir, dass ich sehr tapfer gewesen und er stolz wäre, während meine Mutter heftig nickte und strahlte. Sie gaben mir wie so oft jene Liebe, die ich vor zehn Jahren verspielt hatte. Wäre die Besuchszeit nicht schon zu Ende, wären sie vermutlich noch ewig geblieben.
Ich fragte den Nachtpfleger nach einer Pille, kaum dass meine Eltern gegangen waren und er gab mir guten Stoff, der mich bis 5 Uhr morgens ausknockte. Als ich mich nach dem Duschen und Zähneputzen im Spiegel sah, fand ich mich frisch wie lange nicht. Das sah die Ärztin bei der Morgenvisite ebenso und entließ mich nach Hause. Über Jakob konnte sie mir allerdings nichts sagen. Oda und Jasper hatten mir neben den Toilettenartikeln frische Wäsche mitgebracht und die beschmutzte gleich mitgenommen. Ich packte mein Täschchen; die übrigen Süßigkeiten, die meine Eltern angeschleppt hatten, spendierte ich dem Schwesternzimmer und hinkte zur Straßenbahnstation.
Vom Virchowklinikum war es nur eine kurze Strecke bis Rehberge. Ich durchquerte den tiefsten Wedding, um dann in einen Block zu kommen, der aussah wie ein Dorf im abgelegensten Umland. Dass ich hier erst gestern mein neues Zuhause gefunden hatte, kam mir unwirklich vor. Jakob hatte mir erzählt, dass dies das Haus seiner Eltern sei, sie aber mittlerweile aufgrund ihres Alters in eine behindertengerechte Wohnung zwei Tramstationen weiter umgezogen waren. Ich öffnete das kleine Tor und passierte einen kurzen Steinplattenweg zu dem zweigeschossigen Haus. Als ich gerade nach meinem Schlüssel suchte, öffnete sich die Tür und eine androgyne, sehr hellhäutige Person in schwarzen Skinny-Jeans, einem Trikot der Eisbären und dazu stark getuschten Wimpern blickte mich an. Das Erste, was mir einfiel, war, dass dieser Mensch wunderschön war und weder als Frau noch als Mann eindeutig zuzuordnen, da sich Reizvolles aller Geschlechter in diesem Antlitz wiederfand. Und dass diese Persönlichkeit darauf zu bestehen schien.
»Du bist Annegold?«, fragte mein Gegenüber, kniff erst die Augen zusammen und lächelte dann.
»Du bist Mexx?«, erwiderte ich.