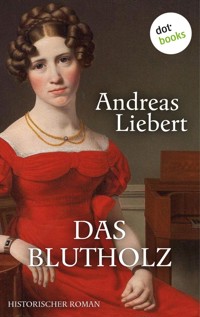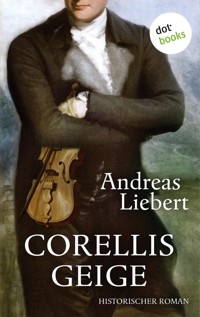Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein verzweifelter Kampf gegen Aberglauben und Verrat: Der historische Roman »Die Hexe von Tübingen« von Andreas Liebert jetzt als eBook bei dotbooks. Tübingen, 1562: Nachdem ihr Vater angeklagt wurde, mit dem Teufel im Bunde zu stehen, versucht die junge Anne alles, um ihn aus dem Kerker zu befreien. Doch gerade als sie die abergläubischen Tübinger von seiner Unschuld überzeugen konnte, wird die Leiche einer Dirne gefunden – getötet durch einen Hexenstab. Böse Zungen behaupten, das mörderische Werkzeug stamme aus Annes Besitz, und schon bald entbrennt eine erbitterte Jagd. Einzig Lukas, die rechte Hand des Obervogts, scheint auf Annes Seite zu stehen – doch seine Stellung verlangt von ihm, sie anzuklagen. Ist es ein tödlicher Fehler, ihm zu vertrauen, oder sind Hoffnung und Mut stärker als jedes Unheil? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Historienroman »Die Hexe von Tübingen« von Andreas Liebert – auch bekannt unter dem Titel »Die Tochter des Hexenmeisters«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Tübingen, 1562: Nachdem ihr Vater angeklagt wurde, mit dem Teufel im Bunde zu stehen, versucht die junge Anne alles, um ihn aus dem Kerker zu befreien. Doch gerade als sie die abergläubischen Tübinger von seiner Unschuld überzeugen konnte, wird die Leiche einer Dirne gefunden – getötet durch einen Hexenstab. Böse Zungen behaupten, das mörderische Werkzeug stamme aus Annes Besitz, und schon bald entbrennt eine erbitterte Jagd. Einzig Lukas, die rechte Hand des Obervogts, scheint auf Annes Seite zu stehen – doch seine Stellung verlangt von ihm, sie anzuklagen. Ist es ein tödlicher Fehler, ihm zu vertrauen, oder sind Hoffnung und Mut stärker als jedes Unheil?
Über den Autor:
Andreas Liebert, von Kindheit an von Tübingen fasziniert und geprägt, ist Kulturwissenschaftler mit dem Schwerpunkt 18. und 19. Jahrhundert. Seit Jahren arbeitet er als Schreibcoach für eine bundesweite Romanwerkstatt, gleichzeitig engagiert er sich als Lehrkraft im zweiten Bildungsweg.
Bei dotbooks veröffentlichte Andreas Liebert seinen Weinkrimi »Schwarze Reben« sowie seine historischen Romane »Die Pianistin von Paris«, »Die Töchter von Sankt Petersburg«, »Das Blutholz«, »Die Töchter aus dem Elbflorenz«, »Corellis Geige«, »Die Tochter des Komponisten« und »Die Hexe von Rothenburg«.
***
eBook-Neuausgabe März 2021
Dieses Buch erschien bereits 2007 unter dem Titel »Die Tochter des Hexenmeisters« und dem Autorennamen Kay Cordes bei Wunderlich sowie auch unter diesem Titel 2016 bei dotbooks.
Copyright © der Originalausgabe 2007 Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter verwendung von Shutterstock/Picksell, GUSAK OLENA; AdobeStock/faestock und einer Illustration von Johann Poppel
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-95824-625-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Hexe von Tübingen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Andreas Liebert
Die Hexe von Tübingen
Historischer Roman
dotbooks.
»Auff den dritten Tag Augusti zwischen 11. vnd 12. vhr zu Mittag / Ist ein solch grausam erschrecklich wetter / verfinstert als wann es Nacht wer gewest / mit Wolcken / Sausen / Wind / vnd anfencklich mit wenig regn … / Gleich darauff ein solches grausambs haglen / mit vilen stralen augenblicklich / Das menigklich darob erschrocken / vnnd nit gewust was man tun oder lasen solt … / vnd gewerd bis auff zwelff vhr / ist es alles viruber / vnd der schad geschehen … / Insonderheit zum Romsthal / vnd was es auff dem feld ergriffen von gefuegel / Hasen / Hiener Tauben Raiger / Rappen als wir gemeld zu tod geschlagen / desgleichen die Fenster / Decher / abgedeckt vnnd der Massen zerrissen / Das meniglich gemeint der Juengstag sei vorhanden / vnd sind die Leut gar derschlagen … / Wirttenberg ist in 100 Jaren nit so arm vnd der Massen erschlagen verderbt an Leib vnd Gut / als ietzunder …«
Erschreckliche Nuewe Zytung, 1562
Kapitel 1
Es war am ersten Sonntag im Monat August des Jahres 1562, dem heißesten Tag in Tübingens fünfhundertjähriger Geschichte. Ein Wanderprediger stand in der glühenden Hitze der Mittagsstunde auf dem Kornmarkt und rief in die Menge: »Habt ihr nicht Augen, zu sehen, und einen Leib, zu spüren? So fühlt es sich an, wenn ihr in Gottes Haus auf Geschäfte, Macht und Buhlschaften sinnt. So ächzen Körper und Seele, wenn der Herr den Deckel der Hölle einen Spalt zur Seite schiebt. So brennt das Blut, wenn ihr vergesst, wer Himmel und Erde gemacht hat. Wappnet euch also mit Buße! Reißt alles Schlechte mit Stumpf und Stiel aus euch heraus!«
Sieben Stunden zuvor war Anne Wecker, die zwanzigjährige Tochter des Tübinger Nachtwächters, aus dem Schlaf geschreckt. Sie hatte im Traum geweint, doch warum, das fiel ihr, so angestrengt sie auch nachdachte, nicht mehr ein.
So schloss sie die Augen wieder, streckte sich und gähnte ausgiebig. Andere können jetzt liegen bleiben, dachte sie. Andere aber sind auch keine barmherzigen Schwestern des Tübinger Spitals.
Schließlich stand sie auf, kniete sich vor das Kruzifix und sprach ihr Morgengebet.
Da ihre Kammer gen Osten lag, leuchteten die Vorhänge, wenn die Sonne schien, dass es eine Pracht war. Heute aber, wie schon so oft in den letzten Wochen, blieben sie dunkel. Anne schob sie zur Seite und schaute hinaus. Der Himmel war hellgrau wie ein frisch angeschnittenes Stück Blei. Regenwolken waren nicht zu sehen; *ein Glück für die Getreidebauern! Jeder weitere Tag, der das Korn trocknen ließ, war ein Gottesgeschenk. Denn obwohl es reif auf den Feldern stand, konnten die Bauern es nicht einfahren. Sie klagten, es sei so feucht, dass man es zwischen Daumen- und Fingernagel zerdrücken könne. Mit der Folge, dass es dann in der Scheuer verschimmeln oder zu früh auskeimen würde.
Und damit würde wieder einmal der Hunger das Land regieren.
Anne zog sich das Nachthemd über den Kopf und krümmte die Zehen auf dem kalten Lehmboden. Frisches Stroh gab es noch nicht, und Dielen auf dem Boden waren ein Luxus, den sich nur Patrizier oder Professoren leisten konnten. Doch Anne war auch so zufrieden. Der Spitaldienst erfüllte sie ganz, und sie konnte sich keine schönere Arbeit vorstellen.
Es klopfte.
»Nur herein.«
Die Tür ging auf, und die alte Elisabeth, ihre Tante, streckte den Kopf in die Kammer. Zwar war sie schon morgens reichlich geschwätzig, aber Anne machte das wenig aus, im Gegensatz zu ihrem Vater, der vor acht Uhr kein Wort hören wollte.
»Deine Mutter müsste dich einmal so sehen, Anne. Was wäre sie stolz auf dich. Du bist wirklich eine Augenweide!«
»Kaum, Else. Du weißt doch: Sie wünschte sich immer nur Söhne.«
Sie schlug den Deckel ihrer Truhe zurück, suchte ein sauberes Kleid heraus und strich es auf ihrem Bett glatt. Weil ihr als Spitalschwester im Jahr ein Kleid zustand, brauchte sie ihr Geld nur für Unterwäsche und Strümpfe. Jetzt freute sie sich darauf, bald ihren ersten eigenen Rock beim Schneider in Auftrag zu geben: aus festem Straßburger Tuch, mit vielen schönen Falten. Ein Rock, der ihre schmale Gestalt fülliger wirken ließ und Würde verlieh. Als Nächstes käme dann vielleicht ein neues Kragenjäckchen in Frage, denn ihres wurde an Kragen und Ärmeln immer fadenscheiniger.
»Ach, lass doch diese alten Geschichten. Deine Mutter war besser, als du denkst.«
Tante Else seufzte unwillig auf, als Anne Wasser in den ausgehauenen Wurzelstock füllte, der ihr als Waschtisch diente. So sonderbar und fast furchterregend Else und die Nachbarn ihn fanden, Anne sah an ihm nur das Praktische. Denn an den kreuz und quer stehenden Wurzelstrünken ließen sich ausgezeichnet Strümpfe und Leibchen trocknen.
»Was für dich alte Geschichten sind, Tante«, sagte Anne und begann, sich von Kopf bis Fuß einzuseifen. »Und dann hat Mutter auch noch die Pest geholt, gerade heute vor acht Jahren.«
»Daran war nur ihre Reinlichkeit Schuld«, brauste Else auf. »Und du machst jetzt denselben Unsinn. Da seid ihr beide gleich. Aber deine Mutter hatte wenigstens einen Mann. Die mögen es, wenn das Fleisch rosig ist und duftet. Oder hast du etwa …?«
»Nein, Else.«
»Herr Jesus! Das viele Wasser weicht dir die Haut auf. Das macht krank. Halte dein Blut lieber frisch und trocken. Das ist wichtig. Purgieren, Aderlass und Schlaf sind das Beste. Aber natürlich gibt es noch andere Mittel.«
»So?«, fragte Anne spöttisch und ließ schaumige Rinnsale an sich herunterlaufen. »Du hast also ein neues Wundermittel gefunden?«
»Und was für eines. Warte.«
Else kletterte die Stiege bis unters Dach hoch, während Anne sich abtrocknete und ankleidete. Als sie ihr Haar zu bürsten begann, war Else bereits zurück. Freudestrahlend hielt sie Anne ein hufeisenförmiges Stück Holz hin.
»Was ist das?«
»Apfelbaumholz. Das Beste, um den Körper von innen trockenzuhalten. Gleichzeitig hilft es nachts gut gegen überflüssige Hirndämpfe, die uns böse Träume machen.«
»Einfaches Holz?«
Anne wog das glattgeschliffene Stück in den Händen und beschaute es von allen Seiten. Es hatte so gar nichts Medizinisches an sich, aber vielleicht lag sein Geheimnis ja in der magischen Form? Anne dachte an die Alraune, die Menschengestalt hatte. Half sie nicht gerade deswegen bei Frauenbeschwerden und gegen den Wahnsinn? Die weisen Frauen sagten sogar, die Alraunenwurzel schreie, wenn man sie aus der Erde reiße.
»Stecke es einmal in den Mund«, redete Else ihr zu. »Nur einmal.«
»Aber nur weil du es bist.«
Widerwillig schob sich Anne das Holz in den Mund. Sofort begann ihr der Mund zu wässern. Sie musste schlucken, einmal, zweimal, immer wieder. Dabei wurde ihr Hals immer rauer.
Kopfschüttelnd nahm sie das Holz wieder heraus, eilte in die Küche und trank ein paar Schluck Wasser. Als sie zurückkam, band sie ihr Haar zu einem Zopf, schlang ihn sich um den Kopf und versteckte ihre blonde Pracht unter der Haube. »So etwas Dummes habe ich ja noch nie gesehen!«, sagte sie.
»Wenn ich es doch ausprobiert hab!«, entgegnete Else. »Seit ich es mir vor dem Einschlafen in den Mund stecke, geht es mir besser. Die Leibesfeuchtigkeit zieht ab, und meine Laune ist sonniger.«
»Leibesfeuchtigkeit? Das muss man in diesem Fall wohl Spucke nennen, Tante. Aber nun weiß ich wenigstens, warum du nachts so oft hustest.«
»Unsinn. Das träumst du. Ich vertraue dem Apotheker.«
»Dr. Schäfer? Ausgerechnet! Unser Professor Fuchs vom Spital sagt, dieser Schäfer mische wahllos sämtlichen Unrat, den Mensch und Tier ausscheiden, zu Arzneien. Aber wenn er euch dummen Weibern jetzt auch noch mundgerecht geschnitztes Apfelbaumholz aufschwatzt, geht er zu weit. Das setzt dem Ganzen die Krone auf. Ich werde ihm sagen, was ich von solcher Geldschneiderei halte. Verlass dich drauf!«
Anne stürmte an Else vorbei in die Küche und klaubte sich ein paar Stücke Brot aus dem Brottopf zusammen: ihr Frühstück für unterwegs, denn sie musste sich beeilen. Hatte es nicht gerade drei viertel geschlagen? Seit die Sankt-Gallus-Kirche vor zwei Jahren abgebrannt war, mussten sich die Derendinger an den Tübinger Uhren orientieren. Doch wenn der Wind aus der falschen Richtung wehte, waren diese kaum zu hören.
Anne schalt Else in Gedanken eine dumme abergläubische Gans, der sie viel zu lange zugehört hatte. Aber dieser Apotheker Dr. Schäfer war viel schlimmer, weil er klüger war. Er konnte Latein und Griechisch und hatte herausgefunden, dass man mit einer Apotheke, die Dreck und Abfälle als Medizin verkaufte, am leichtesten Geld verdienen konnte.
Die zwanzig Minuten von Derendingen nach Tübingen legte Anne im Laufschritt zurück, und so kam sie abgehetzt im Spital an und war doch zu spät. Zum Glück lief ihr die Oberschwester nicht über den Weg. Schnell huschte sie in die Küche, wo Tag und Nacht ein Feuer brannte, damit immer heißes Wasser vorrätig war. Sie griff Eimer und Kelle, mischte etwas kaltes Wasser hinzu und würzte mit Wein, darauf eilte sie in den Speicher und stellte den Brotkorb zusammen. Wöchnerinnen bekamen gebuttertes Weißbrot und Quarkkuchen, weil das gut für den Milchfluss war, die Kranken altbackenes Schwarzbrot. Es gehörte zu ihren Aufgaben, das steinharte Brot bröckchenweise in das Wasser-Wein-Gemisch zu stippen und diejenigen damit zu füttern, die zu schwach waren, selbst zu essen.
Gerade hatte sie den mer Wöchnerinnen ihre Mahlzeiten ausgeteilt, als Schwester Mechthild, die Oberschwester, ins Zimmer kam.
»Anne, du musst mir jetzt helfen. Bei Gudrun, der Rotgerberfrau, haben die Wehen eingesetzt.«
»Aber Mechthild, ich bin doch keine Hebamme!«
»Nein. Aber Barbara hegt zu Hause im Bett und kämpft mit Koliken und Krämpfen. Ihre Tochter sagt, sie hat gestern auf einer Feier zu viel gegessen und getrunken.«
»Schon. Aber sie ist nicht die einzige Hebamme in der Stadt…«
»Du wirst es schon schaffen«, sagte die Oberschwester, und ihr Ton ließ keine Widerrede zu. »Im Übrigen hat Gudrun Erfahrung. Sie hat doch schon zwei Kinder. Leider kann ich dir nicht helfen. Ich hab zu tun. Für zwei halbtote Findelkinder, die gestern Nacht hier abgelegt wurden, muss ich schnellstens eine Amme finden. Warmes Wasser und Wermut-Wein gibt es hier, Tücher und Schere habe ich schon bereitgelegt. Die Latwerge im Tiegel ist von Dr. Schäfer. Gudrun hat da eine entzündete Stelle …«
»Dann muss ich es wohl tun«, seufzte Anne, »der liebe Gott steh mir bei!«
Sie war zwar bei so mancher Geburt dabei gewesen und hatte der Hebamme geholfen, aber ein Hebammenexamen hatte sie nicht abgelegt. Nun gut, versuchte Anne sich zu beruhigen, allzu schwierig wird diese Geburt schon nicht werden. Ich werde es schon schaffen.
Das Entbindungszimmer war gelüftet, die Vorhänge bis auf einen Spalt zugezogen. Neben den üblichen Utensilien stand dort auch der Tiegel mit einer hellen Paste, die einen schwachen Minzgeruch verströmte. Richtig, dachte Anne. Gudrun hat ja am Bein diesen nässenden Fleck …
Als sie sich über die Rotgerberfrau beugte, sah sie, dass sich deren Lippen kaum vom bleichen Gesicht abzeichneten. Sie waren ebenso graublass wie das milchige Dämmerlicht, das durch die Scheiben fiel. Auf der Oberlippe glänzten feine Schweißtröpfchen.
»Du bist nicht die Hebamme«, flüsterte sie, als sie endlich die Augen öffnete.
»Heute schon«, sagte Anne und strich Gudrun beruhigend über den zum Bersten gespannten Bauch. »Hab Vertrauen, ich bin erfahren genug, dich gesund zu entbinden. Barbara, unsere Hebamme, ist krank. Also werden wir beide uns zusammenreißen.«
»Wie heißt du? Ich glaube, ich kenne dich.«
»Das ist jetzt nicht wichtig.«
Anne versuchte, ihrer Stimme einen energischen Ausdruck zu geben. So sicher, wie sie klang, fühlte sie sich längst nicht. Doch sie durfte jetzt auf keinen Fall schwach wirken. Sie legte einen harten Kanten Brot zurecht, auf den Gudrun bei der nächsten Wehe beißen konnte. Sie drehte sie auf die Seite, kniete sich neben sie aufs Bett und massierte ihr mit geballten Fäusten Lenden und Steißbein. Gudrun begann zu stöhnen, aber ihr Gesicht bekam bald wieder Farbe.
»So, und jetzt auf alle viere.«
»Das schaff ich nicht mehr«, jammerte Gudrun.
»Und ob du das schaffst«, sagte Anne bestimmt.
Gudrun schluchzte auf, rollte sich wieder auf den Rücken und schloss die Augen. Anne biss sich auf die Lippen. Dann eben nicht, sagte sie sich und begann zu überlegen, bis ihr die Lösung einfiel: Sie fasste erst Gudruns einen und dann ihren anderen Fuß und schob beide nach oben. Gudruns Schenkel klappten auf, sodass Anne ihr bequem unter das Hemd langen konnte, um zu erfühlen, wie weit das Kind schon vorgerutscht war.
»Das fühlt sich ja ganz vielversprechend an«, schwindelte sie und schickte ein Stoßgebet gen Himmel, denn Gudruns Scham stand zwar fühlbar unter Spannung, doch wo der Kopf des Kindes war, das wusste Gott allein. Oder eben eine richtige Hebamme.
Aber so schnell wollte Anne nicht aufgeben. Sie erinnerte sich an eine Geburt, bei der sich Barbara vor die Gebärende gekniet und dieser befohlen hatte, ihr die Füße auf die Schultern zu setzen und dann so stark zu pressen, wie sie könne.
Genauso würde sie es jetzt mit Gudrun machen.
Tatsächlich stemmte sich Gudrun gehorsam gegen ihre Schultern. »Stärker!«, feuerte Anne sie an. »Du kannst noch mehr drücken!« Mit aller Kraft hielt sie dagegen. Bald lief beiden der Schweiß übers Gesicht. Gudrun klebte das Haar an den Schläfen, und sie stöhnte markerschütternd. Dann begann sie zu wimmern, sie müsse jetzt sterben. Da wurde Anne zornig: »Bei Gott, du wirst nicht sterben, aber deinem Kind schadest du, wenn du dich länger so anstellst.« Mit zwei Fingern tastete sie sich in den Geburtskanal vor. An den Fingerspitzen fühlte sie, wie sie gegen etwas Hartes stieß: den Kopf des Kindes. »Die Presswehen haben eingesetzt«, rief sie erleichtert. »Komm, streng dich noch einmal an. Ich habe schon das Köpfchen gespürt.« Sie angelte mit der freien Hand nach ihrem Korb, fand das harte Stück Brot und schob es Gudrun in den Mund. »Pressen, nicht schreien. Reiß dich zusammen. Ein letztes Mal!«
Gudrun schien endlich zu begreifen, dass sie keine andere Wahl mehr hatte. Sie holte tief Luft, schloss die Augen und biss in das harte Brot. Es kostete Anne all ihre Kraft, Gudruns Stemmen standzuhalten, aber ihre Standhaftigkeit zahlte sich aus. Mit einem kehligen Schrei trieb Gudrun den Kopf ihres Kindes aus dem Schoß, dann folgten in einer weiteren Wehe die Schultern und schließlich die Beine.
Fast gleichzeitig fühlte Anne das zarte Gewicht des Neugeborenen in ihren Händen.
»Ein Junge!«, rief sie und hob das Kind der Mutter entgegen.
Dann schnitt sie die Nabelschnur durch, band sie ab, hielt den Jungen an den Beinen hoch und gab ihm einen Klaps auf den zerknitterten Po. Tatsächlich begann er mit seinem dünnen Sümmchen zu schreien. Sein Gesicht mit den nach oben stehenden Augenwinkeln sah sie nicht, genauso wenig wie ihr der flache Hinterkopf auffiel. Als sie ihn Gudrun freudestrahlend reichte, starrte diese sie feindselig an und zischte böse: »Fass ihn nie wieder an. Mich hast du gequält. Meinen Jungen wirst du in Ruhe lassen.«
Anne schoss das Blut ins Gesicht. Am liebsten hätte sie Gudrun für diese Unverschämtheit geohrfeigt, aber so viel wusste auch sie: Frauen, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hatten, führten sich auf wie Betrunkene. Die einen weinten, andere lachten, wieder andere wollten ihr Kind gar nicht sehen, und dann gab es noch die Frauen, die nach überstandener Entbindung die Hebammen beschimpften, weil sie glaubten, sie hätten die Geburt aus Neid oder schlicht aus Grausamkeit zu lange hinausgezögert.
Trotzdem war Anne erschrocken. Benommen drückte sie auf Gudruns Bauch, die sich aufbäumte, als die Nachgeburt kam. Gudrun lag still da, wie tot. Ihr Atem war so flach, dass sich ihre Brust nicht bewegte.
Anne erschrak. Doch dann blinzelte die Wöchnerin, und Anne griff erleichtert zum Krug mit dem Wein-Wermut-Auszug und wischte ihr über das Gesicht. Zum Schluss langte sie in den Tiegel mit der Latwerge und versorgte damit Gudruns angerissenen Damm: »Sei ein wenig vorsichtig und schone dich. Morgen kannst du schon nach Hause gehen.«
»Verschwinde«, zischte Gudrun und wandte den Kopf ab. Vor Angst, Anne könnte ihrem Kind etwas antun, drückte sie es so fest an ihre Brust, als wollte sie es ersticken.
»Du versündigst dich«, stieß Anne hervor.
Unter größter Selbstbeherrschung packte sie alle Utensilien in einen Korb. Doch schließlich konnte sie die Tränen nicht länger zurückhalten. Aufschluchzend schlug sie die Hände vors Gesicht und lief, ohne sich noch einmal nach Gudrun umzuschauen, ins Freie. Die Hitze, die ihr entgegenschlug, machte sie schwindelig. Kein Lüftchen wehte mehr. Ermattet lagen Stadt und Land unter einem sonnenblassen Himmel. Es war still.
Irgendetwas lag drohend in der Luft.
Vom Turm der Stiftskirche schlug es sieben, als Nachtwächter Martin Wecker auf das Stadttor zuschritt. Er war siebenundvierzig Jahre alt und von kräftiger Statur, doch der Dienst hatte ihn gezeichnet. Kälte und Dunkelheit hatten seine Haut gebleicht und tiefe Furchen in sein Gesicht gegraben. Auch sein Haar war schütter und fahl geworden – fahl wie die Sonne dieses Sonntags, als sie endlich hinter milchig grauen Wolken unterging.
Hinter der Stadtmauer wird es kaum kühler sein, dachte Martin, als er in das zugige Gewölbe des Neckartors trat. Selbst das magere Lüftchen hier fühlt sich an wie der Glutatem eines Backofens.
Er stützte sich an der Gewölbemauer ab und bewegte vorsichtig den verstauchten rechten Fuß. Tübingens größtenteils ungepflasterte Gassen und Straßen waren schon tagsüber gefährlich, nachts aber musste man einen sechsten Sinn entwickeln, um sich auf ihnen nicht die Knochen zu brechen. Trotz Laterne kam es immer wieder vor, dass man sich vertrat, und in ganz Tübingen gab es niemanden, der nicht wenigstens alle halbe Jahre einmal hinkte.
Martins Blick fiel aufs Pflaster, auf dem eine Schar Ameisen einen vertrockneten Regenwurm zerlegte. Eine Katze strich zwischen seinen Beinen hindurch und rieb ihren Kopf an seinen Waden. Er entdeckte eine Zecke in ihrem Fell, riss sie ab und zertrat sie. Das Tier zerplatzte wie eine hohle Pille und hinterließ einen hellen Blutfleck. Martin verzog das Gesicht und rollte die Schultern. Auch wenn sich der Wind wie gekocht anfühlte: Es war angenehm, ihn an Nacken und Rücken zu spüren. Er wartete, bis sein Hemd nicht mehr auf der Haut klebte und der Schweiß in seinen Kniekehlen getrocknet war, dann setzte er seinen Weg in Richtung Stiftskirche und Holzmarkt fort.
Vor drei Tagen noch haben alle lamentiert, es sei kalt wie im März, nun werden wir mit dem Gegenteil bestraft, dachte er. Trotzdem ist das Wetter heute genauso falsch. Diese Hitze ist eine Lüge. Es liegt Gefahr in der Luft.
Plötzlich blieb erstehen, runzelte die Stirn und lauschte. Dann nickte er. Ja, er hatte sich nicht getäuscht. Aber aus welcher Richtung das Grollen gekommen war, hätte er nicht sagen können. Und so geduldig er auch wartete: Es schien bei diesem einen Mal zu bleiben.
Ein Windstoß wehte ihm fauligen Fischdunst in die Nase. Er beschleunigte seine Schritte und bog in die Bursa-Gasse ein. Herumstreunendes Federvieh stob vor seinen Füßen davon, in den Hinterhöfen gurrte eine Taube. Hunde kläfften. Vor der Bursa selbst, wo die Studenten hausten, war es ein wenig kühler als am Neckar-Tor, dafür aber stank es erbärmlich. Martin rümpfte die Nase, kein Zweifel, hier quollen die Latrinen über. Offenbar grassierte in den Schlafsälen wieder der Durchfall.
In der Oberstadt wird es sicher besser werden, dachte er.
Auf den steilen und ausgetretenen Stufen der Münzgassen-Treppe kam er etwas ins Schnaufen, aber sein Herz beruhigte sich rasch, als er weiterging. Plötzlich zischte ein Schwalbenpaar an ihm vorbei durch die Gasse. Es flog so tief, dass die Flügel fast das Pflaster streiften. Martin traute seinen Augen nicht: Die Schwalben wurden von einer Fledermaus verfolgt. Spukhaft schnell huschte das unheimliche Tier durch die Gasse und verschwand wie die Schwalben hinter einem Giebel.
Jetzt fielen ihm die Spinnennetze auf der Obstbaumwiese an seinem Haus wieder ein. Am Morgen waren sie alle zerrissen gewesen, ein sicheres Zeichen, dass ein Gewitter in der Luft lag. Aber wo blieben die Wolken? Und es gab ja noch nicht einmal einen richtigen Wind! Wenn Fledermäuse Schwalben jagten, dann stand möglicherweise Schlimmeres als nur ein Sommergewitter bevor.
»Das sind die Zeichen«, flüsterte Martin. »Gott steh uns bei.«
Mit den Augen untersuchte er das Fachwerk eines Gebäudes. Mittags waren an seinem Haus in Derendingen Tausendfüßler das Ständerwerk hochgekrochen. Taten sie das hier auch? Da entdeckte Martin die Asseln. Sie krabbelten in Scharen über das Feldsteinfundament an der Traufseite hoch, verschwanden eine Weile in den Holzrissen und kamen ein Stück weiter oben wieder ans Licht. Niemand hatte hier auf dem Boden einen Stein umgedreht oder irgendwo Erde weggekratzt. Warum verließen die Bewohner des kalten Moders dann bei dieser Wärme ihre Höhlungen?
Martin fand keine Antwort. Da streifte ihn ein kühler Windstoß, der, wie er sich einbildete, nach Regen roch. Ein schwächerer zweiter und dritter folgten. Die Luft kam in Bewegung, die Hitze ließ nach.
Also doch, dachte er fast erleichtert, es gibt Gewitter.
Er ging die Münzgasse bis zum Ende und trat auf den Kirchenvorplatz. Etliches Volk hatte sich vor der Stiftskirche versammelt, wo eine in bunte Narrenkostüme gekleidete Gauklertruppe für Zerstreuung sorgte. Zwei schmächtige Burschen balancierten auf einem Seil, das zwischen galgenhohe, ankerlose Pfosten gespannt war. Diese wurden von je einem Mann senkrecht gehalten. Breitbeinig hingen sie als Gegengewichte an langen Riemen, wobei ihre Kunst darin bestand, das Seil so ruhig und straff zu halten, dass die Burschen sicheren Stand hatten, um mit Bällen und Dolchen zu jonglieren. Sie alle wurden von einer Frau angefeuert, deren Sprache Martin nicht verstand. Ihm entgingen ihre scharfen Blicke nicht, die sie zwischendurch zwei halbwüchsigen und glutäugigen Mädchen in geflickten Kittelkleidern zuwarf, die flache Holzteller vor sich hertrugen und die Reihen der Zuschauer abliefen. Bekamen sie eine Münze, knicksten sie artig, schüttelte ein Zuschauer den Kopf, schauten sie betrübt zu Boden.
Martin hielt sich nicht lange bei ihnen auf. Er wollte zum Holzmarkt, wo er mit Anne verabredet war. Ihr Dienst im Spital war heute um sieben Uhr zu Ende.
Inzwischen hatte sich der Himmel sattgrau gefärbt, und auf einmal setzte der Wind ein. Böen jagten durch die Stadt, wirbelten Staub auf und schoben die noch immer heiße Luft durch Gassen, Höfe und Zimmer. Türen schlugen, Fensterläden klapperten. Die Menschen seufzten erleichtert auf, die gelähmte Stimmung war wie weggefegt. Kinder breiteten die Arme aus, drehten sich im Kreis und begannen zu singen. Junge Männer pfiffen den Frauen hinterher, die ihre Röcke bis über die Knie hoben und sich kokett Luft zufächelten.
Wankelmütige Tröpfe, dachte Martin, während es vom Turm acht schlug. Alle wissen, wie uns das Wetter seit Jahren straft. Jetzt tun sie gerade so, als würde der Heilige Geist Geschenke verteilen.
Er grüßte einen Stadtbeamten, der sein schwarzes Barett lupfte, um sein schweißnasses Haar zu trocknen. Da er aber weder Hellebarde noch Laterne trug, erkannte ihn der Beamte im ersten Augenblick nicht. Begriffsstutzig runzelte er die Stirn. Als er schließlich in ihm den Nachtwächter erkannte, nahm sein Gesicht einen mürrischen Zug an. Martin sah ihm nach, wie er durch die Lange Gasse eilte und erst auf der Höhe der Kirchgasse seine Schritte wieder verlangsamte.
So kann es noch lange gehen, dachte er bitter. Selbst die, die sonst auf meiner Seite gestanden haben, wenden sich ab. Niemand will mehr etwas mit mir zu tun haben. Und das nach zweiundzwanzig brandlosen Jahren! Aber so geht es, wenn einen der böse Ruf wieder einholt.
Mit Schaudern erinnerte er sich an die Hatz des Jahres 1541. Hätte der Rat ihn nicht unter Schutz gestellt, der Mob hätte ihn und seine schwangere Frau damals in seinem Haus verbrannt. Kurz nach seinem Dienstantritt im September 1540 nämlich hatte ein Feuer das Franziskanerkloster und neunundsechzig Wohnungen zwischen Marktplatz und Kornhaus verwüstet. Im Jahr darauf hatte auch noch die Pest die Stadt heimgesucht, und damit war das Maß für das abergläubische Volk voll: Man habe es ja immer schon gewusst, hieß es plötzlich, dass Martin Wecker es mit den dunklen Mächten halte. Und das könne auch gar nicht anders sein, schließlich sei er der Wiedergänger seiner 1505 als Hexe verbrannten Großmutter. Mit anderen Worten: Das Gros des Tübinger Volkes war überzeugt, die Stadtväter hätten damals einen Hexenmeister in ihre Dienste genommen.
Zornig spuckte Martin aus, wie jedes Mal, wenn er daran dachte, was die Tübinger seiner Großmutter angetan hatten. Obwohl ihr Flammentod bereits mehr als ein halbes Jahrhundert zurücklag und er sie nie kennengelernt hatte, legte er jedes Jahr an ihrem Unglückstag an der Stelle, wo der Henker ihre verkohlten Überreste verscharrt hatte, einen Feldblumenstrauß nieder.
Alles wird von vorne losgehen, wenn noch einmal derartige Unglücke geschehen, dachte er.
Endlich gelangte er auf den Holzmarkt, wo sich fast so viele Menschen eingefunden hatten wie vor der Stiftskirche. Sorgten dort die Gaukler für Zulauf, war es hier ein Wanderprediger in brauner Kutte. Er hatte einen mönchisch geschorenen Schädel und hatte die Haltung eines antiken Redners angenommen: Der Zeigefinger seiner erhobenen Rechten wies gen Himmel, während seine Linke auf der Brust ruhte.
Als Podest diente ihm eine umgestülpte Kiste.
»Sünder, begreift die Zeichen, seid nicht länger verstockt! Seht, hört und fühlt ihr es nicht selbst? Seit Jahren wird es kälter, die Sommer nasser, die Ernten magerer. Das Korn reift nicht, das Heu modert, und auf den Speichern machen giftige Dünste Früchte und Kräuter faulig.«
»Amen«, rief Martin laut dazwischen. »Wer bist du, und wo kommst du her? Wir brauchen hier keinen, der uns sagt, wir seien Sünder.«
»Ich bin Jakob aus Reutlingen«, rief der Prediger. »Und du?«
»Martin, der Nachtwächter.«
»Ach! Dann kannst du nur der Hexenmeister sein! Aber das sehe ich auch an deinen blutunterlaufenen Augen und deinem Gang. Hinkt er nicht wie der Leibhaftige?«
Der letzte Satz war so höhnisch wie frech. Triumphierend blickte der Prediger in die Runde. Die Menschen rückten von Martin ab. Martin biss sich auf die Lippen. Er durfte jetzt nicht weichen, denn das käme einem Eingeständnis gleich. Aber wie sollte er sich wehren?
Er erinnerte sich daran, dass er im letzten Oktober auf dem Gallusmarkt einen Hahn verkauft hatte. Am nächsten Tag war die Käuferin, ein geschwätziges Weib, zu ihm gekommen und hatte sich beklagt: Sein weißer Hahn sei nur wenige Stunden später von einem Bussard geschlagen worden. Das allein sei ihr schon verdächtig vorgekommen, doch tausendmal schlimmer sei, dass sein Hahn ihr etwas wahrhaft Diabolisches hinterlassen habe: Er möge es glauben oder nicht, es sei ein Ei gewesen. Martin sah noch einmal ihren fanatischen Blick vor sich, als sie sagte, dies sei das sichere Zeichen dafür, dass der Basilisk in Tübingen sein Unwesen treibe.
Sie habe das Ei zwar sofort verbrannt und der Rauch, der dabei entstanden sei, habe ausgesehen wie der Basilisk selbst: eine Missgeburt aus Hahn und Drachen.
Martin schauderte, denn die feindselige Stimmung war jetzt fast greifbar. Er blickte zum Prediger, der stumm auf seinem Podest stand und mit seinem Finger auf niemand anders zeigte als auf ihn.
»Du hast den Basilisk freigelassen, Hexenmeister«, erhob er leise seine Stimme. »Meine Tante und ihr Mann wurden deshalb wenig später krank und starben. Aber ich weiß, warum du sie dir als Opfer aussuchtest: Du wolltest Rache. Rache dafür, dass ihre Eltern die ersten waren, die deine Hexen-Großmutter beschuldigten, auf dem Besen auszufahren.«
Obwohl Martin um seinen bösen Ruf wusste: Wer es wagte, ihn offen zu beleidigen, der forderte seinen Zorn heraus. Denn wie jeder andere Tübinger Stadtangestellte, und sei er noch so gering oder gar so verrufen wie Veit Ostertag, der Scharfrichter, war er stolz auf sein Amt.
»Du lügst!«, rief er und schüttelte die Faust. »Dich treibt die Rache. Nicht mich! Soll ich dir sagen, was du bist? Ein Aufwiegler! Wenn du deine falschen Worte nicht zurücknimmst, stecke ich dich ins Loch.«
»Nichts nehme ich zurück!«, donnerte der Prediger. »Vor all diesen rechtschaffenen Leuten behaupte ich: Du bist ein Unholder, Wiedergänger, Hexenmeister!«
In Martin kochte die Wut hoch. Er rief: »Wäre ich der, für den du mich hältst: Deine Zunge wäre längst blau, Jakob aus Reutlingen. Eine Elle lang hinge sie dir aus dem Maul, und dein Kopf säße verkehrt auf deinen Schultern.«
»Hört ihr es?«, eiferte der Prediger. »Er selbst reißt sich die Maske von der Fratze!«
»Ja, hört nur auf ihn!«, äffte Martin den Tonfall des Predigers nach. »Besucht mich vor der Stadt. Aber diesen Kerl hier nehmt mit! Ich werd einen Hexenknoten in seine Zunge machen und sie dann mit einem Athame durchstechen.«
»Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes: Sei verflucht!«, schrie der Prediger.
»Ich werd dir schon zeigen, Jakob aus Reutlingen, wer hier wen verflucht!« Rot vor Wut ging Martin auf den Prediger los, packte ihn am Ärmel und riss ihn von seinem Podest. »So wahr ich der Nachtwächter bin und in dieser Stadt auf Ordnung sehe: Wer mich zum Unholden machen will, ist ein Aufwiegler und gehört ins Loch.«
Mit eisernem Griff fasste Martin den Prediger am Ellenbogen und schickte sich an, ihn durch die Menge zu schieben. Der wehrte sich nicht, sondern schielte mit der Leidensmiene des Märtyrers zum Himmel.
»Jetzt gehst du zu weit, Nachtwächter!«, wetterte eine Frau.
»Nein. Er tut recht. Schließlich ist er Diener dieser Stadt.« Ein vornehmer junger Mann mit Samtbarett, Seidenstrümpfen und silberner Kette am Wams schaute in die Runde. »Glaubt ihr ihm weniger als einem Wanderprediger? Ist der, der eure Seelen aufwiegelt, mehr wert als der, der euren Schlaf bewacht?« Einige wenige murmelten zustimmend. Martin warf ihm einen dankbaren Blick zu. »Wisst ihr nicht mehr, was Tübingens großer Sohn, der Rektor und Stiftskirchenprediger Martin Plantsch, lehrte? Wenn ein Mensch leidet, ist dies nicht durch Hexerei verursacht, sondern allein durch Gottes Absicht, uns durch schmerzhafte Behandlung zu Einsicht und Heil zu führen. Hört alle genau zu: Hexen, wenn es sie denn gäbe, können von sich aus nicht fliegen. Und wenn, dann nur deshalb, weil Gott es zulässt. Was besagt: Es gilt nicht, Hexen oder Hexenmeister zu bekämpfen, sondern die Ursachen eures Leides, die Gott euch zu eurer Prüfung auferlegt hat.«
Beeindruckt von so viel Gelehrsamkeit und Redegewandtheit, nickten einige Zuhörer. Ihre Blicke flogen zwischen dem jungen Redner, Martin und dem Prediger hin und her. Martin warf seinem Verteidiger einen kurzen Blick zu, als wolle er sichergehen, dass er richtig handle, dann stieß er den Prediger vorwärts. Tatsächlich traten die Ersten zur Seite, um ihm Platz zu machen.
»Tu deine Pflicht, Nachtwächter«, begann der junge Mann noch einmal. »Aber nur wenn du wirklich überzeugt bist, vor deinem Gewissen richtig zu handeln.«
»Geschieht dem Prediger recht!«, rief darauf einer aus der Menge. »Was hetzt er uns hier auch mit seinen Geschichten auf.«
Vor Martin bildete sich eine Gasse. Niemand stellte sich ihm mehr in den Weg.
Da drängte sich eine junge Frau mit weißer Schleierhaube durch die Menge. Auf den ersten Blick sah sie aus wie eine Nonne, doch das schildartige Wams, das sie über dem Kleid trug, die kleine Schürzentasche und die weit über die Handrücken hochgekrempelten Ärmel zeigten eindeutig, dass sie eine der barmherzigen Schwestern des Tübinger Spitals war.
Entschlossen trat sie auf Martin zu und stellte sich vor ihm in Positur: »Lass ihn los, Vater.«
»Weißt du eigentlich, was er mich geschimpft hat?«
»Ich kann es mir vorstellen. Aber ist dir das neu? Glaubst du, dein Ruf wird besser, wenn du im Zorn einen Prediger ins Loch steckst? Selbst wenn du das Recht dazu hast?«
Martin schnaufte, doch nach kurzem Zögern ließ er den Prediger los.
»Eine kluge Tochter hast du, Hexenmeister«, sagte dieser spöttisch. Ohne mit der Wimper zu zucken, holte Anne aus und verpasste dem Prediger eine schallende Ohrfeige.
»Nimm dies für dein gewissenloses Mundwerk, Prediger«, sagte sie kalt. »Du bist der wahre Unheilsstifter. Nicht mein Vater.«
Hämisches Lachen brandete auf, irgendjemand klatschte sogar Beifall. Die Blicke der Leute wurden wohlwollend, endlich schwand die Ablehnung aus den Mienen. Für wenige Augenblicke glaubte Martin, die Tübinger brächten ihm wieder Sympathie entgegen – wie Vorjahren, nachdem er einen Einbrecher ertappt hatte, der erst den Hauseigentümer niedergeschlagen hatte und dann dessen Frau notzüchtigen wollte.
»Da hat dich die gerechte Strafe ereilt, Prediger.« Der junge Mann im Wams schaute sich um. Als sich seine und Annes Blicke begegneten, lächelte er sie offen an. Anne errötete und schlug die Augen nieder. »Aber in einem hast du recht, Prediger Jakob: Tübingens Nachtwächter hat eine kluge Tochter. Und ich darf hinzusetzen, auch eine hübsche.«
Anne wagte nicht mehr aufzusehen. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Noch nie hatte ein Mann von Stand ihr ein derartiges Kompliment gemacht. Dass er es in der Öffentlichkeit tat, war geradezu ungeheuerlich. Doch als sie schließlich wieder wagte, den Kopf zu heben, hatte der junge Mann ihr bereits den Rücken zugewandt. Zielstrebig bahnte er sich seinen Weg durch die Schar der Gaffer und verschwand in Richtung Marktplatz. Bald darauf zerstreute sich auch das Volk. Der Prediger klemmte sich seine Kiste unter den Arm und ging seines Weges. Martin und seine Tochter wandten sich zum Gehen.
Da krähte plötzlich eine heisere Stimme: »Für den Hexenmeister und sein Hexchen.«
Anne fuhr herum und konnte Martin noch im letzten Augenblick zur Seite reißen. Ein Aststück flog an seinem Kopf vorbei, ein massiver Prügel, der, hätte er sein Ziel erreicht, nicht nur eine Platzwunde, sondern eine schwere Gehirnerschütterung verursacht hätte. Vor Schreck brachte Anne keinen Ton heraus. Liebevoll schloss Martin sie in die Arme und sah mit versteinertem Gesicht den beiden Jungen nach, die, was das Zeug hielt, in die nächste Gasse rannten.
Johannes, Martins schlaksiger Gehilfe, schaute seinen Meister gespannt an, als dieser am Abend kurz vor neun in der Nachtwächterstube am Lustnauer-Tor an den Waffenschrank trat. In wenigen Minuten begann der erste Rundgang, den wie gewöhnlich Martin unternehmen würde.
Ob es ihm auffällt?, fragte sich Johannes. Oder ist es ihm auf seine alten Tage längst egal?
Er hatte die Klinge der Hellebarde poliert. Jetzt glänzte sie wieder und sah so gefährlich aus, wie es sich seiner Meinung nach gehörte.
»Zufrieden damit?«, fragte Johannes hoffnungsvoll.
»Schon recht. Gute Arbeit.«
Mit dem Daumen prüfte Martin die Schärfe des Blattes und untersuchte, ob es fest in Schaft und Tülle steckte und sich keine Niete gelockert hatte. Er fand nichts daran auszusetzen. Denn auch wenn er die Hellebarde jetzt nicht mehr mit demselben Stolz trug wie früher, achtete er doch darauf, dass sich das Statussymbol seines Standes in tadellosem Zustand befand.
»Lampen und Horn sind ebenfalls poliert«, sagte Johannes diensteifrig. »Außerdem habe ich die Dochte beschnitten und Tran aufgefüllt. Doch nicht nur das: Ich habe auch unsere Mäntel geflickt. Und wenn es dir noch nicht aufgefallen ist: Es ist gefegt, kein Viechzeug ist mehr zu sehen, und deine Stiefel haben wieder gerade Absätze.«
»Und ich dachte, heute sei Sonntag«, sagte Martin unbeeindruckt und griff zur Sturmlampe.
»Bin eben tüchtig«, sagte Johannes bestimmt.
Sehnsüchtig schielte er zu Anne, die sich in der Schlafkammer frisch gemacht hatte und nun in die Nachtwächterstube trat. Er konnte es kaum erwarten, endlich mit ihr allein zu sein. Denn heute war der Tag, an dem er sie etwas fragen wollte …
Martin lächelte still in sich hinein. Er wusste nur zu gut, dass Johannes sich den ganzen Tag darauf gefreut hatte, Anne nach Hause zu begleiten. Aber Anne wollte lieber in der Nachtwächterstube auf der Pritsche schlafen, als bei Dunkelheit noch einmal durch die Stadt zu laufen.
Es ist richtig, dass sie nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießt, dachte Martin. Leider glaubt Johannes, er könne ihr mit seiner Tüchtigkeit imponieren. Dabei ist er für sie nur ein guter Freund – nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Vielleicht hat sie sich zu lange Zeit gelassen, ihm reinen Wein einzuschenken. Sie mag ihn nicht enttäuschen und hofft, Johannes würde von selbst draufkommen, dass er sich falsche Hoffnungen macht. Aber da irrt sie sich. Johannes ist viel zu verliebt. Er bebt ja geradezu vor Ungeduld und Vorfreude.
Martin räusperte sich.
»Pass auf dich auf, Vater«, sagte Anne.
»Mach du dir keine Sorgen um mich«, antwortete Martin. »Eher muss ich fürchten, dass …«
»Ich bin doch da«, sagte Johannes treuherzig. »Du weißt doch, Martin, wer ihr nur ein Haar krümmt, wird sich wünschen, er wäre nie geboren.«
»Anne zieht es vor, bis morgen hierzubleiben, Johannes«, sagte Martin beiläufig und nahm eine der beiden Sturmlampen vom Haken. »Du musst sie nicht nach Haus bringen.«
»Was?« Johannes riss die Augen auf und sah aus, als hätte er gerade erfahren, das Rathaus stehe in Flammen. »Warum? Hier ist es doch viel zu stickig. Anne, du bleibst doch nur ganz selten hier, warum ausgerechnet heute?« Seine Blicke hetzten zwischen Martin und ihr hin und her.
In die plötzliche Stille schlug die Uhr der Stiftskirche. Anne klatschte in die Hände und sagte mit Nachdruck: »Selbstverständlich bringst du mich nach Hause, Johannes. Und du, Vater«, fuhr sie mit fester Stimme fort, »nimmst dein Horn und lässt uns jetzt in Ruhe.«
Sie nickte ihm aufmunternd zu. Martin runzelte die Stirn: »Wie du meinst. Bistja schließlich alt genug.«
Er stapfte aus der Nachtwächterstube. Kaum dass seine Schritte auf der Treppe verklungen waren, sprang Johannes auf und schloss die Tür.
»Was ist denn los?«, fragte er so aufgeregt wie hoffnungsvoll.
»Nichts«, sagte Anne. »Komm, es ist Zeit. Ich muss morgen Schlag neun wieder im Spital sein. Gib der Wache Bescheid und dann lass uns gehen.«
Keine Minute später liefen sie schweigend die Stadtmauer entlang. Dies war der kürzeste Weg zu Annes Haus, dabei wäre Johannes nur zu gerne alle möglichen Umwege gegangen. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Wie sehr er Anne begehrte und liebte! Er hätte alles für sie getan, aber so viel er ihr auch sagen wollte – plötzlich brachte er kein Wort mehr über die Lippen. Sein Herz war zu voll, sein Kopf dagegen zu leer.
Wie schön wäre es, dachte er, wenn ich dich jetzt einfach an mich ziehen könnte. Wie wunderbar, wenn ich dich küssen dürfte. Ich würde dich bis nach Hause tragen und dann immer weiter bis ans Ende der Welt …
»Dieser Wind«, sagte Anne. »Fast ein Sturm. Die Hitze ist fortgeweht, aber es gibt kein Gewitter. Seltsam.«
»Ja, das finde ich auch«, sagte Johannes gepresst, wollte dann noch etwas sagen, ließ es aber bleiben.
Er senkte die Laterne, denn in der Zwischenzeit war es so dunkel geworden, dass nur noch Schatten und Schemen zu erkennen waren. Anne hakte sich bei ihm unter. Das Pflaster war an vielen Stellen herausgerissen und der Weg voller Schlaglöcher. Erst vor kurzem hatte sie sich hier heftig den Fuß verstaucht. Drei Tage lang war sie gezwungen gewesen, zu Hause zu bleiben. Johannes hatte es bestimmt noch nicht vergessen, er würde ihre Geste also nicht falsch deuten … Anne spähte aus den Augenwinkeln zu ihm hoch. Sie gingen jetzt auf das Neckartor zu. Noch ein paar Schritte, und die Stadtmauer würde in ihrem Rücken liegen.
Wenn ich ihm doch bloß irgendetwas Nettes sagen könnte, dachte sie. Aber mir fällt beim besten Willen nichts ein. Er ist einfach nur lang und dünn und öde. Zwar auch lieb, aber ich fühle einfach nichts für ihn.
Sag es ihr draußen, machte Johannes sich im selben Moment Mut. Aber dann rede nicht lang herum, sondern sag nur den einen Satz. Mehr braucht es nicht. Alle Frauen sind so.
Kaum hatten sie die Neckarbrücke überquert, setzte heftiges Wetterleuchten ein. Für ein paar Sekunden war es hell wie am Tag. Bizarre Wolkenformationen wurden sichtbar, schwarze Inseln in einem grauen Meer, bedrohlich und gespenstisch. Noch unheimlicher jedoch war die Stille. Beide warteten sie auf den Donner, aber der blieb aus. Auch nach Minuten war nicht das geringste Grollen zu hören.
Als ob die geheimnisvolle Stille Johannes beflügelte, blieb er abrupt stehen, machte sich von Anne los und hielt die Laterne so weit von sich, dass sie ihn und Anne gerade noch beleuchtete, aber nicht blendete.
»Du weißt ja längst, was ich dir sagen will«, stieß er hastig hervor, während von der Baustelle der Derendinger Sankt-Gallus-Kirche der Geruch frischen Mörtels heranwehte. »Aber damit du es auch hörst: Anne Wecker, ich liebe dich. Und ich werde dich immer lieben.«
»Du lieber Johannes!«
Anne bemühte sich, so weich wie möglich zu klingen, doch damit schlich sich auch ein spöttischer Unterton in ihre Stimme. Um ihren Fehler wiedergutzumachen, zog sie Johannes Kopf zu sich herunter und küsste ihn auf die Stirn.
»Mehr nicht?«, flüsterte dieser heiser.
»Nein, Lieber«, sagte Anne ernst. »Weißt du das nicht selbst? Wenn nicht, ist es gut, dass wir uns jetzt aussprechen.«
»Aussprechen?«
»Ich will dich nicht verletzen, Johannes. Verzeih mir, sollte es so klingen. Aber sosehr ich dich schätze und mag, als Freund mag: Ich kann deine Zuneigung nicht erwidern. Das ist alles. Nichts braucht sich zwischen uns zu ändern. Mehr aber wird nicht dazukommen. Verstehst du?«
»Bloß weil ich ein Habenichts bin? In den nächsten zwei, drei Jahren gibt es in Rottenburg, Reutlingen, Nürtingen oder Herrenberg eine freie Stelle für mich. Bestimmt.«
Anne schüttelte den Kopf. »Das ist es nicht, Johannes.«
»Du lügst.«
»Nein. Und es gibt keinen anderen Mann, wenn es das ist, was du meinst!«, rief Anne heftig. »Aber auch wenn ich nur die Tochter eines Nachtwächters bin: Niemals werde ich einen Mann heiraten, den ich nicht liebe. Eher sterbe ich! Und das weiß auch mein Vater.«
»Dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeiten, Anne Wecker. Und wünsche dir, dass es dir anderswo bessergehen mag.«
Johannes hörte sich zwar sprechen, begriff aber nicht, was er da gerade sagte. Grenzenlose Enttäuschung erfasste ihn. Doch dann kam die Wut, und auf einmal schien es ihm, als weide sich Anne an seinem Schmerz. Plötzlich war es ihm unerträglich, noch länger vor ihr zu stehen. Am liebsten hätte er sie in den Graben gestoßen.
»Bringst du mich noch zur Tür?«, fragte sie zaghaft.
Johannes antwortete nicht. Ohne ein weiteres Wort machte er kehrt und ließ Anne in der Dunkelheit und Einsamkeit der Landstraße zurück.
»Johannes!«
»Es soll dir noch leidtun«, rief er in den Wind.
Stur ging er seines Weges und schaute nicht zurück. Obwohl sich schließlich sein Gewissen meldete, lief er immer weiter. Er konnte nicht anders, es war wie ein Zwang. Ein paarmal stampfte er mit dem Fuß auf und verlangsamte seine Schritte, doch statt durch das unheimliche schwarzgraue Licht zu Anne zurückzulaufen und ihr zu leuchten, begann er irgendwann wie ein Kind zu weinen. Wie ein Kind, dem man sein Spielzeug weggenommen hatte.
Kurz nach Mitternacht hatte sich der Wind gelegt. Martin setzte sein Horn ab und lauschte. Er hörte das Zirpen der Grillen und über den Dächern ein Katzenkonzert, doch als er in die Gasse an der kleinen Ammer einbog, schien es ihm, als sei es nicht zwölf Uhr in der Nacht, sondern zwölf Uhr am Mittag. Stimmengewirr und Lachen drangen durch die Nacht, und schon im nächsten Moment strich ihm ein verführerischer Bratenduft in die Nase. Als er näher kam, mischten sich Lavendel und Kiefernharz dazu, dann wurde alles von Bier- und Weindünsten überdeckt.
Gestalten in weiten Gewändern schälten sich aus der Dunkelheit und huschten auf einen breiten Hauseingang zu, der von zwei rußenden Laternen beleuchtet war.
Schau an, dachte Martin. Ein Fest im Badhaus. Wer gibt sich in einer Nacht wie dieser die Ehre? Ob er auch einen Erlaubnisschein hat?
Offiziell nämlich war der Badebetrieb verboten. Vor acht Jahren, nach der letzten Pestepidemie, mussten alle öffentlichen Badeinrichtungen schließen – zur größten Freude der Geistlichkeit, die nicht müde geworden war, die Badeanstalten sämtlich als Bordelle zu verdammen. Doch ob Pest, Franzosenkrankheit oder Aussatz: Wer Geld hatte und deftig feiern wollte, ging zur Stadtaufsicht und mietete das Badhaus privat, vor allem Studenten, Handwerksmeister oder Kaufleute.
»Hört, ihr Leut’, und lasst euch sagen: Der Nacht-Wächter ist da!« Ein spindeldürrer junger Mann mit öligem Haar breitete die Arme aus und verbeugte sich grinsend. In seinem Badhemd sah er aus wie ein Nachtgespenst in Bastsandalen. »Tretet ein. Stärkt euch und trinkt mit uns. Ich bin Hieronymus Viesler.«
»Bekanntlich laufe ich hier nicht zum Vergnügen durch die Nacht.«
»Ach zum Henker, nach so einem Tag muss man mal Fünfe gerade sein lassen und sich einen Affen gönnen.«
Martin konnte sich nicht erinnern, jemals so unverhohlen zum Trinken eingeladen worden zu sein. Das konnte nur am Wetter liegen, dachte er. Obwohl ihm Hieronymus’ Grinsen missfiel, ließ er sich überreden. Er scheint zwar ein verschlagener Hund zu sein, urteilte er, aber ich muss schließlich wissen, was hier los ist. Wo viel Licht ist, gibt es bekanntlich auch viel Schatten.
Mit Laterne und Hellebarde folgte er Hieronymus durch Auskleide und Vorstube, wo Bader und Baderin früher Haare geschnitten, geschröpft oder zur Ader gelassen hatten. Jetzt hatte man hier ein Büfett errichtet. Der Tisch war beladen mit Brot, Bratenplatten, üppigen Radieschenbüscheln und weißen Rübchen. Neben einem Stapel schmutziger Holzteller brannte ein fünfarmiger Kerzenleuchter und beleuchtete ein Tischfass mit aufwendig geschnitztem Boden, das auf zwei groben Kufen ruhte.
Wein, dachte Martin und leckte sich unfreiwillig die Lippen. Das Wetter machte durstig, kein vernünftiger Mann hätte etwas gegen einen guten Trunk einzuwenden gehabt.
»Greift zu, Nachtwächter. Unser aller geschätzter Universitätskellermeister feiert heute seinen Namenstag«, klärte ihn Hieronymus mit seinem schiefen Lächeln auf.
»Danke«, murmelte Martin, ließ sich einschenken und lugte in die kerzenerleuchtete Badestube.
Nebst Apotheker Dr. Gerold Schäfer und dem Ordinarius der medizinischen Fakultät, Professor Fuchs, waren unter anderen der Hofbraumeister, Vogtskommissar Balthasar Möstlinger sowie die Zunftmeister der Metzger- und Bäckerinnung geladen – allesamt ehrenwerte Tübinger, von denen freilich niemand seine Ehefrau mitgebracht hatte. Ein Fest ohne Frauen aber war fader noch als eine salzlose Suppe, weshalb Universitätskellermeister Stephan Hiltebrand sich etwas hatte einfallen lassen. Martin brauchte nicht lange zu suchen, um die weiblichen Gäste auszuspähen, die hier für gute Laune sorgten: In halbdurchsichtigen Gewändern schlängelten sich Badmaiden durch die Reihen, servierten Essen oder leisteten Bad- und Massagedienste. Sie salbten und kneteten der Herren Nacken und Rücken oder hockten mit ihnen bis zu den Schultern im Zuber.
Ob er wollte oder nicht: Martin seufzte leise auf. Die Badmaiden nämlich hockten nackt im Wasser, sie trugen nur einen Schleier über dem Haar. Ihnen zuzuschauen war fast wie ein schöner Traum. Zum Beispiel die Badmaid, die gerade den Hofbraumeister fütterte: Jedes Mal wenn sie sich erhob und vorbeugte, hingen ihre herrlichen Brüste dem Hofbraumeister gerade einmal fingerbreit vor der Nase.
»Schon mal so etwas gesehen?«, flüsterte Hieronymus. »Nachher wird der Hofbraumeister sie füttern. Aber auf seine Art.«
Heiser lachte er auf. Martin jedoch tat, als habe er seine Anspielung nicht verstanden und schaute sich weiter um.
»Macht Musik! Sonst schlafen wir ein!«, rief eine Frauenstimme. Sie gehörte der fünfzigjährigen Badersfrau. Es ging das Gerücht, dass sie ihren Mann vergiftet haben sollte. Splitterfasernackt schlurfte sie in hohen Holzpantinen zwischen Zubern und Tischen und sammelte leere Weinbecher und Bierkrüge ein. Weil sie schon immer so gearbeitet hatte, war ihr Ruf entsprechend schlecht. Längst galt sie als die erste Kupplerin der Stadt. Mit ihren Diensten hatte sie früher Ehen gestiftet, aber auch auseinandergebracht. »Los, einen neuen Becher Wein und ein Ständchen für unseren Nachtwächter!«
Applaus brandete auf. Das Ständchen begann mit einem Vorspiel von Krummhorn, Geige und Drehleier. Und dann stimmten alle lauthals das alte Nachtwächterlied an:
»Hört, Ihr Herr ’n, und lasst Euch sagen:
Unsre Glock ’ hat neun geschlagen!
Wehrt das Feuer und das Licht,
dass dem Haus kein Leid geschieht!
Menschenwache kann nichts nützen,
Gott muss wachen, Gott muss schützen.
Herr, durch deine Gut’ und Macht:
Schenk uns eine gute Nacht.«
Schön war’s, wenn all ihr Ehrenwerten tatsächlich so fromm wärt, wie ihr tut, dachte Martin und trank etwas Wein.
Seine Blicke kreuzten sich mit denen des Apothekers, der als Einziger nicht mitsang. Gerold Schäfer hatte die Augen zusammengekniffen, und ein verächtliches Lächeln spielte um seinen Mund.
»Wehe, du trägst einen Rock«, hatte Anne einmal bemerkt, »dann hat er drei Hände. Er ist so wenig ein Heiliger wie ein guter Apotheker.«
Sie hat recht, dachte er. Diesem Dr. Schäfer stehen die Bosheiten geradezu ins Gesicht geschrieben.
Und Martin täuschte sich nicht.
Kurz vor der vierten Strophe hob dieser den Finger. Bedeutungsvoll schaute er in die Runde und rief: »Ich habe mir ein eigenes Ständchen ausgedacht.« Er ließ frisch einschenken, hob den Becher und sang:
»Hört, Ihr Frau’n, und lasst Euch sagen:
Auf meiner Glock ’ will ich Euch tragen.
Zwölf Zoll ist mein Maß bereit:
Frau ’n, bedenkt solch Seligkeit!
Andre Größe tut nichts nützen,
Ihr müsst’s wissen, drum tut sitzen.
Schenkt mir Eure holde Pracht!«
Das Gelächter war ohrenbetäubend. Fricka, die Baderwitwe, ging vor Lachen in die Knie, während eine Badmaid bei einigen der Herren die Badhemden lupfte und tat, als wolle sie nachmessen. In Martin jedoch wallte der Zorn hoch. Musste er sich wirklich alles gefallen lassen? Sollte jeder bessere Tübinger ihn ungestraft demütigen dürfen? Mit voller Wucht schleuderte er seinen noch halbvollen Becher auf den Apotheker. Der aber wich ihm überraschend gekonnt aus, schnappte sich die nächstbeste Maid und küsste sie auf den Mund.
»Nimm ihn ruhig fest, Nachtwächter!« Das war Ordinarius Professor Leonhart Fuchs. Gemächlich stieg er aus seinem Zuber und ließ sich in ein bereitgehaltenes Laken hüllen.
»Ach was, lasst ihn, Nachtwächter!«, rief Hieronymus. »Er hat doch nur ein paar Becher zu viel.«
»Von wegen!«, hielt Professor Fuchs dagegen. »Er spielt den Berauschten nur. Habt Ihr nicht gesehen, Student, wie schnell er dem Becher ausgewichen ist?«
»Kein Streit in diesen Hallen, Leonhart«, mahnte der Gastgeber, Universitätskellermeister Stephan Hiltebrand. »Himmel, gerade habt ihr euch doch noch die Hand gereicht. Schon vergessen? Habe ich euch umsonst eingeladen?«
»Das nicht. Aber habe ich denn unrecht?«
»Und wie du unrecht hast!«, brauste der Apotheker auf, worauf die Badmaid ihm hastig die Schultern zu kneten begann. »Verstehst du denn keinen Spaß? Wohl nicht, wie mir scheint. Als ob der Humor mit den Rezepturen in deinem vermaledeiten Kräuterbuch verreckt ist.«
»Schweig lieber!«, schleuderte ihm Leonhart Fuchs entgegen. »Deine Drecksapotheke ist viel schlimmer.«
»Ach, und was schreibst du? Fingerhutkräuter, gesotten und getrunken, säubern, reinigen und bringen den Frauen ihre Zeit. Sie fördern den Auswurf und reinigen die Brust! Ähnlich wie der Enzian: Du empfiehlst Tee aus Enzianblättern und Fingerhutkraut. Bloß, wer’s trinkt, krepiert. Und das so elend, als würde er gespießt.«
»Du wagst es, mein Werk mit deinen Rezepturen zu vergleichen? Stercus columbarum, stercus muris, stercus laporis? Tauben, Mäuse und Hasenscheiße verkaufst du als Bartwuchsmittel und Aphrodisiakum. Und so einer trägt den Doktorgrad!«
»Schluss! Aus!«, fuhr Universitätskellermeister Hiltebrand aufgebracht dazwischen. »Muss ich euch schimpfen wie Hunde? Oder rauswerfen?«
Kurz wurde es still. Aber dann gingen Leonhart Fuchs und Gerold Schäfer mit geballten Fäusten aufeinander zu.
»Schneidet euch doch in Speckstreifen«, rief der Hofbraumeister.
Aller Augen waren jetzt auf die beiden Streithähne gerichtet, die sich zähneknirschend und geringschätzig maßen. Martin dagegen, der Anlass des Streits, war vergessen. Und da er zu stolz war, das Handgemenge abzuwarten, blieb ihm nichts anderes übrig, als mit nagender Wut im Bauch zu gehen.
»Sieh’s ihnen nach, Nachtwächter«, sagte Hieronymus, der ihn zur Tür brachte. »So sind sie eben, die Großkopfeten. Gönnen sich nicht die Butter auf dem Brot, aber im Spotten sind sie alle gleich fix. Die hochehrenwerten Tübinger, sag ich immer, sind überhaupt die allerfeinsten. Am Sonntagmorgen beten sie in der Stiftskirche, am Sonntagmittag aber schon zieht es sie zu den Mädchen des ältesten Gewerbes – und dann wollen sie es am Sonntagabend wiedergutmachen, indem sie ihren angebeteten Bürgerfrauen aus dem Gebetbuch vorlesen.«
Martin wollte eigentlich nichts auf das Geschwätz geben. Dennoch rutschte ihm die Frage heraus: »So? Wer denn?«
Er drückte die Türklinke und bemühte sich, mit der Hellebarde nicht an den Rahmen zu stoßen. Noch ein Schritt, und er stand wieder draußen in der Gasse an der kleinen Ammer.
»Hast eine hübsche Tochter, Nachtwächter«, hörte er Hieronymus lauernd hinter sich sagen. »Das richtige Alter hat sie auch. Schon lange.«
Martin traute seinen Ohren nicht. Doch als er gerade auf die freche Anspielung reagieren wollte, war es schon zu spät. Hieronymus Viesler hatte ihm schon die Tür vor der Nase zugeschlagen und den Riegel umgelegt.
Johannes lag in der Nachtwächterstube auf der Pritsche und starrte in die Dunkelheit. Er fand keinen Schlaf. Sein schlechtes Gewissen hielt ihn wach, und jetzt grübelte er, wie er sich am besten bei Anne entschuldigen konnte.
Ich werde ihr etwas schenken. Bloß was?
Da hörte er Martins Schritte.
Ist es schon Zeit?, fragte Johannes sich verwundert. Bis zwei Uhr ist doch noch eine ganze Stunde.
Als er sich aufstemmte, blinzelte er in Martins Lampe.
»Raus mit dir.«
»Seit wann …«
Weiter kam er nicht, denn Martin schlug ihm ins Gesicht. »Du fauler Hund! Meiner Tochter nachstellen, aber hier mit dem Arsch Fliegen fangen wollen, wie? Scher dich!«
Johannes hämmerte das Herz bis zum Hals. Er hätte schreien können vor Empörung: Erst hatte ihn Anne abgewiesen, jetzt ließ ihr Vater seine üble Laune an ihm aus. Warum nur? Hatte Anne ihm etwas erzählt? Unsinn. Johannes schob diesen Gedanken beiseite. Erstens würde Anne, so wie er sie kannte, alles mit sich allein ausmachen, zweitens war sie ja jetzt sicher zu Hause in Derendingen.
Johannes knirschte wütend mit den Zähnen. Jetzt konnte er beiden nicht mehr vergeben. Der Schmerz, den Anne ihm zugefügt hatte, brannte noch viel zu tief in seinem Herzen. Und jetzt noch die Demütigung durch ihren Vater!
So drang kein Ton über seine Lippen, als er die Stufen herabstieg und in die Nacht trat. Dafür aber war ihm schwindelig vor Hass.
Kapitel 2
Am nächsten Morgen war Barbara, die Hebamme, wieder im Spital. Sie gratulierte Anne zur erfolgreichen Entbindung und versuchte, sie zu trösten. Derlei böse Worte, wie Gudrun sie gesagt habe, kenne jede Hebamme, schwatzte sie und fügte dann verschwörerisch hinzu: »Vielleicht hättest du dich unter diesen Umständen auch so verhalten. Bedenke, das Kind ist keine Schönheit. Gudrun war entsetzt, als sie es sah: Ein Pfannkuchengesicht mit einem winzigen Mund und einer riesenhaften Kuhzunge drin. Aber das kommt davon, wenn Mann und Frau miteinander ins Bett steigen, die vorher miteinander gestritten haben. Sie hat sowieso nichts davon, und sein Erguss ist bloß ein lauer Ausfluss.«
»Bist du dir sicher?«, fragte Anne zweifelnd.
»Altes Hebammenwissen«, antwortete Barbara verschmitzt. »In solchen Dingen macht uns niemand etwas vor. Selbst ein Professor Fuchs nicht. Stell dir einmal vor:
Da hat er mir ein neues Hebammenbuch ausgeliehen. Von einem Anatomen aus Zürich, der Jacob Rueff heißt. Dieser Rueff habe einen Gebärstuhl erfunden, sagte er mir mit gewichtiger Miene. Ob es sinnvoll wäre, ihn anzuschaffen? Ich habe natürlich ja gesagt, aber wie sehr habe ich mir das Lachen verkneifen müssen! Da spaziert dieser weltberühmte Mann mehrmals die Woche in seinem Spital umher und hat noch nicht bemerkt, dass wir, seit ich denken kann, einen ähnlichen Stuhl im Entbindungszimmer stehen haben. Ist das nicht kurios? Trotzdem kannst du dir dieses Buch ruhig einmal anschauen. Mir ist es ohnehin zu schwer. Tu es gleich. Es wird dich ablenken.«
Anne ließ sich das nicht zweimal sagen. Doch als sie an die Tür des Turmzimmers klopfte, blieb es still. Professor Fuchs’ Arbeitszimmer war verwaist. Anne zögerte und griff dann nach der Klinke. Das Zimmer war nicht abgesperrt. Vorsichtig streckte sie den Kopf durch die Tür und schaute sich um. Rueffs Buch lag mitten auf dem Schreibtisch. Anne fasste sich ein Herz und trat ein. Natürlich wagte sie nicht, das Buch an sich zu nehmen, aber sie blätterte ein wenig darin herum und betrachtete den Holzschnitt, auf dem der Züricher Anatom seine Neuerung vorstellte: Eine Hebamme hockte vor einer Schwangeren, die auf einem ausgeschnittenen Stuhl saß. Die Arme der Hebamme hantierten unter dem Gewand der Gebärenden, die wiederum von einer hinter ihr stehenden Frau unter den Achseln gehalten wurde. Badezuber und ein Krug mit Wasser standen in Reichweite, auf einem Hocker daneben lagen Garn, Schere und Salbfläschchen.
Anne versank ganz in die Lektüre und bemerkte erst nach einer Weile, wie dunkel es geworden war. Sie klappte das Buch zu und trat ans Fenster. Der Himmel war grauschwarz, und an der Linde auf dem Platz vor dem Spital bogen sich die Aste im Wind. Als Anne das Fenster öffnete und sich hinausbeugte, schlug ihr eine kühle Bö entgegen.
Jetzt kommt das Gewitter doch noch, dachte sie. Die Bauern werden schön fluchen!
Sie schloss das Fenster und legte das Buch zurück an seinen Platz. Alles hat seine Zeit, dachte sie. Das Buch läuft mir schon nicht weg.
Sie begab sich wieder nach unten und trat vor die Tür. Ein Frösteln erfasste sie, aber das war bei dem Wetter auch kein Wunder: Der Wind war so frisch, als sei er über Eisfelder gefegt, und der Himmel glich einer grauvioletten Leinwand. Als die Böen Zunahmen, begann es zu tröpfeln, aber am Horizont blitzte ein goldener Streifen Licht auf.
Die Tür öffnete sich.
Im selben Moment zuckte ein Blitz.
»Lass es lieber wieder richtig hell werden, Herr«, sagte Anne.
»Dein Gebet, Anne Wecker, wird uns wohl nicht helfen«, ließ sich die Männerstimme hinter ihr vernehmen. »Dazu bedarf es anderer Zauberkünste.«
»Ach, welcher denn?«, fragte Anne, drehte sich um und schaute Apotheker Dr. Schäfer fest ins Auge.
»Pst, frag lieber nicht weiter«, flüsterte der Apotheker und lächelte sie so offen wie maliziös an.
Dr. Gerold Schäfer trug schweres schwarzes Tuch, auf dem sein silberbestickter Patrizier-Gürtel prächtig zur Geltung kam. Anne entging nicht, wie gut er gelaunt war. Aber er blickt so kalt wie der Wind, dachte sie. Und sein Wangenschmiss ist so schwarz, als sei er mit Kohle nachgezeichnet. In seinen Studentenjahren muss er ein draufgängerischer Fechter gewesen sein. Ich traue ihm zu, dass er zuschlägt, wenn ihm etwas nicht passt.
Ein neuer Blitz zerteilte die Wolken. Der Donner wurde stärker. Gleichzeitig verdunkelte sich der Himmel weiter, und der Regen nahm an Stärke zu.