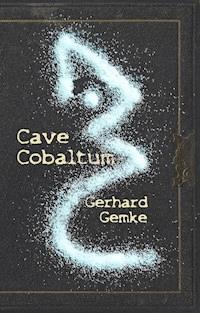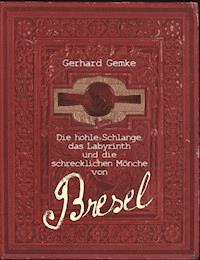
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bresel. Merkwürdige Dinge geschehen in dem Städtchen und auf Burg Knittelstein. Dort beobachtet Jo, wie Baronin Tusnelda eine rote Flüssigkeit in den berühmten Knittelsteiner Schlangenring füllt. Kurz darauf verabschiedet Tusnelda den alten Heimatforscher Oskar Sievers mit einem kräftigen Händedruck. Aber warum trägt sie dabei diesen Ring? Noch dazu verkehrt herum, mit der gespaltenen Schlangenzunge nach innen! Oskar stirbt noch in der folgenden Nacht mit zwei winzigen Einstichen in der rechten Handfläche. Jo will der Sache auf den Grund gehen. Weshalb wurde Oskar von der Baronin in das Labyrinth unter der Burg geschickt? Jo steigt selbst hinunter und rettet drei Breselner Kinder aus höchster Gefahr. Zusammen mit Lisa, Freddie und Jan stößt sie auf seltsame Fässer-Transporte und Mönche, die dunkle Geschäfte mit einem tödlichen roten Saft machen. Doch wer steckt hinter diesen Transporten? Warum musste Todd Emmerich auf eine ähnliche Weise sterben wie Oskar? Und wer, beim Kunibald, überfiel die Breselner Sparkasse?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Gemke
Die hohle Schlange, das Labyrinth und die schrecklichen Mönche von Bresel
Bresel-Krimi 1
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Chronik Burg Knittelstein
Roter Saft
Wassattassu
Jubiläum
Oskar
Burgfest
Im Verlies
Ein bunter Hund
Heiner
Carlo und Ede
Unbekannter Meister
Sternenkarte
Klumpp
Allfonz
Geh nicht hinein!
Der Ring
Überfall
Flucht
Ritter Ademar
Der O'Masie-Vers
Jo
Zwei Ballons
Himbeere, Erdbeere, Stachelbeere
Elfriede
Ampel rot
Ampel grün
Krötenmaulrötling
Fritz Morchel
Stiche
Himmelströpfchen
Bruder Girsch
Fass Nummer 17
Theophilus
Racletts Klaviermusikführer
Anhang
Impressum neobooks
Chronik Burg Knittelstein
Einst lebte ein armer Ritter im Namloser Tal unter der Knittelkarspitze. Das Einzige, was ihm vom Erbe seiner Väter blieb, war eine kleine Hütte, durch die der Wind pfiff. Und ein Ring: Eine goldene Schlange mit rubinroten Augen wand sich zweimal um den Finger und einmal um einen Lapislazuli. Ihr Kopf und die gespaltene Zunge ruhten auf dem tiefblauen Stein. Dieser Kopf aber war hohl bis in die Zungenspitzen, die steil aufragten, bereit jeden zu stechen, der ihnen zu nahe kam.
Eines Tages streifte der Ritter die goldene Schlange über den Finger, nannte sich Kunibald von Knittel und wanderte den Fluss Lech hinab bis in die Gegend von Augsburg. Dort baute er Burg Knittelstein auf dem Breselberg.
Jener Ring aber wurde seit der Zeit von einem Herrn auf Knittelstein zum nächsten weitergereicht. Bis auf den heutigen Tag.
Chronik Burg Knittelstein
Roter Saft
Sie träumte schlecht. Sehr schlecht. Von einem Schachspiel. Von der schwarzen Dame, die eine riesige Spritze in Händen hielt, randvoll blutroter Flüssigkeit. Mit einer lanzenlangen stählernen Nadel. Als die schwarze Dame sie dem weißen König ins Herz bohrte, wachte sie auf.
Es war noch früh, lange vor sechs. Draußen färbte das Morgenrot die Gipfel von Großhorn und Rotspitz. Freitag, 11. April. Eine Elster schrie vor dem Fenster. Das Mädchen stieg aus dem Bett und legte eine Wolldecke über die Schultern. Nahm die trockene Scheibe Brot vom Tisch und öffnete die Tür. Mit bloßen Füßen stieg sie die kalten Steinstufen der Wendeltreppe hinauf. Das Zimmer, in dem sie geschlafen hatte, lag unter dem höchsten Rundgang des Knittelsteiner Burgturms. Darüber stach das spitze Dach in den wolkenlosen Himmel. Als sie hinaus trat, bließ ihr ein eisiger Wind ins Gesicht. Sie beachtete ihn kaum. Sie war elf Jahre alt, hieß Josephine von Knittelstein-Breselberg und nannte sich selbst, weil es sonst niemand tat, Jo.
Die Elster flatterte heran, und Jo bröselte das Brot auf den breiten Sims zwischen den Zinnen. Ihr Blick glitt über den dunklen Wald hinab ins Tal, wo sich die Mauern, Dachgiebel und Kirchtürme von Bresel aus dem Morgennebel reckten. Eine Böe wehte ihr die langen dunklen Haare wie einen Schleier vor die Augen und brachte die Traumbilder zurück. Und mit ihnen den gestrigen Tag.
Hier oben hatte sie gestanden, wie jeden Morgen. Nicht so früh, gegen halb zehn. Jo erinnerte sich an die beiden hohen Glockenschläge der Burgkapelle. Sie hatte wie üblich die Elster gefüttert. Dann war sie die Wendeltreppe hinuntergestiegen. Leise hatte sie ein Cembalo gehört.
Herr Bogdanov übte.
Sie stolperte in ihr Zimmer. Für's Aufräumen war sie selbst zuständig, dementsprechend sah es hier aus. Ihr Bett, der Wäscheschrank, das Bücherregal, von den Fußbodendielen ganz zu schweigen. Und auf dem Schreibtisch stritten sich Mathebücher, irgendeine Grammatik, eselsohrige Notenhefte und ein Atlas um den spärlichen Platz.
Gut, dass das Fräulein von Oelmütz vor lauter Höhenangst sich nicht hier rauf traute. Das war eine verarmte Großtante, deren Aufgabe in den letzten Jahren darin bestanden hatte, Jo den Stoff der ersten fünf Schuljahre einzutrichtern. Irgendeine Ausnahmeregelung der Schulbehörde hatte das ermöglicht. Jo sah das entsetzte Gesicht des spitznasigen Fräuleins noch vor sich, blass mit roten Flecken. „Auf den Turm? Niemals!“ Was hatte sie gelacht. Natürlich erst, als das Fräulein außer Hörweite war.
Jo sah sich im Zimmer um. Ihre Geige hing an der Wäscheleine, die quer durch den Raum gespannt war. Der Geigenbogen hatte sich hartnäckiger versteckt. Sie fand ihn schließlich unter dem Bett, warum auch immer. Jetzt noch schnell eine Viertelstunde geübt, dann runter zu Bogdanov. Ihrem Geigenlehrer. Jeden Donnerstag wanderte er durch den Breselwald hinauf. Meistens viel zu früh, um vor dem Unterricht auf dem Cembalo zu spielen. Unwirklich zog sein Geklimper durch das Gemäuer.
Jo schob die Geige unters Kinn. Was stand da? ff – also Fortissimo! Sie holte aus. Und Zack und Strich und – ach du Scheibe! Der Bogen sauste ungebremst zwischen die alten Hefte im Regal, die dort ihrem staubigen Ende entgegen dämmerten. Genervt rupfte Jo ihn raus. Ein Papierschnipsel segelte zu Boden und landete zwischen der Tasse Kakao von gestern Abend und der lange vermissten Haarspange. Jo hängte Geige und Bogen an die Wäscheleine und klemmte die Spange dazu. Und goss mit dem Kakao den Kaktus.
Komischer Zettel. Jo hob ihn auf. Vergilbt, die Ränder fransig und spröde, das Papier so trocken, dass es bei jeder Berührung knisterte. Und eine Zeichnung darauf.
Kästchen wie auf einem Schachbrett, von eins bis fünf nummeriert. Wahllos darüber verstreut größere und kleinere Punkte, die unordentlich mit schwarzer Tinte verbunden waren. Am rechten Rand befanden sich drei kaum leserliche Buchstaben. Vermutlich A B C. Und links oben so etwas wie ein Turm mit einer Brücke. Doch das Merkwürdigste war, jemand hatte alle Punkte mit einer Nadel durchstochen.
Jo drehte den Zettel um.
Aha. Auf dieser Seite hatte der Jemand die Nadellöcher umkringelt und bemalt und wackelige Linien von links nach rechts gezogen. Na, und das da waren ohne Zweifel ein Violinschlüssel und ein Bassschlüssel. Klaviermusik also. Jo versuchte, die Melodie zu summen. Nett. So was ähnliches hatte sie schon mal auf der Geige gespielt. Vermutlich richtig altes Zeug.
Jo hielt das morsche Papier gegen das Licht. Ach nee! Da hatte sich der Jemand richtig Mühe gegeben. Die Taktstriche folgten genau den Kästchengrenzen auf der Rückseite. Machte fünf pro Zeile. Nur waren die Takte einiges höher als die Kästchen. Jo schätzte, dass zu den fünf Kästchenreihen nur drei mal fünf Takte passten. Also fünfzehn. Nicht sehr lang für ein Klavierstück.
Über den Noten gab's noch ein paar Wortreste. Jo versuchte sie zu entziffern.
Wo ng Theoph Zaroder so ähnlich.
Ein Zar? War ein russische Herrscher. Gewesen. Früher.
Jo blickte aus dem Fenster. Die ersten Sonnenstrahlen erreichten das Tor mit der Zugbrücke, der Burghof lag noch im Schatten. Sie versuchte, die Wörter zu ergänzen. Theo, Zar von Russland vielleicht. Oder: Wo hing Theo? Alles Blödsinn. Blick zurück. ph wird wie f ausgesprochen. Theoph – Theophi – Theophanes. Wonnigste Verehrung dir, Theophanes, Zar aller Russen.
Gequirlter Quark. Außerdem viel zu lang. Sie wurde aus dem Ganzen nicht schlau.
Jo sah wieder aus dem Fenster. Eine Elster verschwand im linken unteren Eck. Da stand der Wecker. Der große Zeiger auf der Zwölf und der kleine auf der Zehn. Ach du Schreck! Jo klemmte den Zettel in das Buch Britta und der Ritter und warf es vor ihr Bett. Jetzt aber los!
Sie rannte, als würde sie vom Kopflosen Kunz durch die endlosen Flure und Treppen der Burg gejagt. Die achtundachtzig Turmstufen hinunter, am Arbeitszimmer ihrer Stiefmutter vorbei, rechts in die Ahnengalerie rein, dem Porträt von Meinhardt dem Dicken (dem sie neulich drei schwarze Haare in jedes Nasenloch gemalt hatte) die Zunge rausgestreckt, drei Meter Rutschbremsung und scharfe Kurve in den Seitentrakt. Dort befand sich ein ehemaliger Wehrturm und darin (seit Heinrich dem Dichter) das Musikzimmer. In dem ein Cembalo immer ungeduldiger klimperte. Einen Moment lang keuchte Jo die dunkle Eichentür an. Dann klopfte sie.
„Herein!“
Mit dem rechten Ellenbogen drückte Jo den Messinggriff runter und schob die Tür auf. Das Quietschen kannte sie. Ein Tröpfchen Öl war seit Raubritter Arnulfs Zeiten überfällig. Ihr Blick fiel auf das Cembalo und die klapperdürre Gestalt mit der schwarzen Mähne dahinter. In einem altmodischen Frack und abgewetzter Jeans, die mit reichlich Hochwasser über ausgelatschten Turnschuhen endete, steckte mit kritischem Blick zur Uhr Rubens Bogdanov. Klavier- und Geigenlehrer der Breselner Musikschule.
„Hereinspaziert, junge Dame, der Unterricht begann vor zwei Minuten.“
Super Laune!, dachte Jo. Herr Bogdanov streckte den Rücken und spielte ein a auf dem Cembalo. Geräuschvoll sortierte er ein paar Notenblätter, bis Jo ihre Geige gestimmt hatte. Dann nahm er seine Violine, lächelte schmal, und gab den Einsatz. Sie fiedelten durch drei Duette, deren Oberstimme Jo einigermaßen drauf hatte. Immerhin wanderten Bogdanovs Augenbrauen eine Winzigkeit in die Stirn. Lob war nicht gerade seine Stärke.
Nach dem Geigenunterricht trabte Jo zurück zum Burgturm. Beim Arbeitszimmer ihrer Stiefmutter verriet ein schmaler Lichtstreifen unter der Tür die Anwesenheit der Baronin.
„Autsch!“
Jo blieb stehen und blickte sich um. Das konnte nur aus dem Zimmer gekommen sein. Jo war die Neugier in Person, wie üblich. Auf Zehenspitzen schlich sie näher, hockte sich hin und spähte durch das riesige Schlüsselloch. Als sich ihr Auge an das trübe Licht im Zimmer gewöhnt hatte, sah sie die Burgherrin. Baronin Tusnelda. Sie saß hinter einem mächtigen Schreibtisch aus dunkler Eiche und starrte regungslos auf die gegenüberliegende Wand. Mit ihren aschegrauen Augen. Spitze Knochen spannten die Haut der Wangen wie Segel und standen in merkwürdigem Gegensatz zu den hängenden Mundwinkeln. Den immer hängenden Mundwinkeln.
Noch viel merkwürdiger aber war, was sie in den Fingern hielt. Eine Spritze, ganz eindeutig. Silbern und schmal mit einer langen stählernen Nadel. Damit hatte sie sich offenbar gestochen. Jo hielt den Atem an, während Tusnelda langsam die Hand hob und einen Tropfen Blut von der Fingerkuppe leckte. Dann beugte sich die Baronin hinunter und zog etwas aus ihrer Handtasche. Ein kleines Fläschchen. Sie betrachtete es von allen Seiten. Ein dünnes Lächeln wanderte über ihre Lippen. Mit spitzen Fingern schraubte Tusnelda den Deckel von dem Glas und steckte die Nadel hinein. Millimeter für Millimeter zog sie die Spritze auf, bis sie dunkelrot glänzte. Zufrieden betrachtete sie ihr Werk. Dann griff sie in die Schublade und holte einen matt schimmernden Gegenstand heraus.
Gut, dass alte Türen so riesige Schlüssellöcher hatten. Jo ging noch dichter heran. Tusnelda drehte den Gegenstand vor ihren Augen. Sie bewegte den Mund, als spräche sie zu ihm. Es war ein Ring. Eine goldene Schlange, den Kopf auf einem tiefblauen Stein. Jo spürte kaum ihre Fingernägel, die sich in die Handballen drückten. Der Knittelsteiner Burgring! Das alte Erbstück von Ritter Kunibald! Aber was machte die da?
Die Baronin stach die Stahlnadel in eine Spitze der gespaltenen Zunge. Die Zunge war hohl. Jo kannte die ersten Sätze der Burgchronik auswendig. Langsam drückte Tusnelda die rote Flüssigkeit in den Schlangenkopf.
Jo verlagerte ihr Gewicht von einem Fuß auf den andern. Ein Stein knirschte unter ihrer Sohle. Tusnelda blickte auf. Wie in Zeitlupe erhob sie sich. Schritt für Schritt durchquerte sie den Raum. Rumms! riss sie die Tür auf und starrte den Flur entlang. Niemand war zu sehen.
Nur ein Schatten oben auf der Wendeltreppe zitterte.
Um halb drei musste Jo beim Fräulein von Oelmütz französische Vokabeln wiederholen und schriftliches Dividieren pauken. Später half sie Emma in der Küche. Was sie gern tat, denn Emma hatte Jo in ihr großes Herz geschlossen. Um halb fünf räumte Jo das Gästezimmer auf, das ihre Cousins Kurt und Knut beim letzten Besuch als Schlachtfeld hinterlassen hatten. Abends spielte sie Schach, wie immer gegen sich selbst. Aber es ging heute nicht wie sonst. Es war ihr, als starrte sie die schwarze Dame unentwegt an. Warum hatte Tusnelda etwas in Kunibalds Ring gespritzt? Und vor allem was?
In der folgenden Nacht träumte sie schreckliche Dinge.
Das laute Krächzen der Elster brachte Jo zurück in die Kälte des Freitagmorgens. Flatternd stürzte sich der Vogel in den Wind und glitt über die Wipfel des Breselwaldes hinunter aufs Städtchen zu. Bresel. Mit Schulen und normalen Lehrern. Freundinnen und Nachmittagsverabredungen. Jo seufzte. All das konnte man in einer Burg vergessen. Sie verteilte die letzten Brotkrumen auf der Mauer und machte sich an den Abstieg.
Wassattassu
„Wassattassubedeuten – nichwa – wassollassiermittaTasche – imRosenbeet!!!“
Jan starrte auf die klobigen Lederschuhe. Blaue Arbeitsklamotten wuchsen von dort über eine fußballrunde Wampe und endeten unter einem ausladenden Vorsprung: dem Bratpfannenkinn von Radolf Müller-Pfuhr. Oberhalb der Bratpfanne öffneten sich zwei Reihen goldgefüllter Zähne.
„DuTunichgut – kommsinneBesserungsanstalt – anstattassueinmalaufpasst – ungezogenerBengel – ichwerdemitteinerMuttermalüberdichreden – numachassuwekkommst!!!“
Jan wusste, jetzt musste schnell gehandelt werden. Es war völlig zwecklos dem bellenden Müller-Pfuhr zu erklären, dass er genauestens die Flugbahn der Schultasche berechnet hatte. Oben vom ersten Stockwerk aus. Sie hätte eigentlich exakt zwischen Rosenbusch und Lavendel landen müssen. Eigentlich. Irgendwas war schief gelaufen. Vielleicht hatte sich die Erde unter dem fliegenden Ranzen weiter bewegt. Nur ein kleines gemeines Stückchen. Aber das hatte gereicht, um ihn mit voller Wucht in den knospenden Rosen landen zu lassen. Mist! Demnächst also weiter links.
Jetzt aber nichts wie weg, denn schon öffnete sich das Küchenfenster. Agathe streckte das lockengewickelte Haupt heraus und erblickte ihre Blümchen, die – naja – deutlich gelitten hatten. Und wenn Agathe erst loslegte … Jan rupfte die Tasche aus den Dornen und rannte, was die Beine hergaben. In seinem Rücken schepperten Agathes Kreischen und Radolfs Gebell die Breselner Landstraße entlang. Eine Damen-Doppelkopfrunde, die in der Frühlingssonne stadtauswärts radelte, schüttelte die Köpfe über die Ruhestörung. Und die Elster, die von Burg Knittelstein über die Wipfel des Breselwaldes auf das Städtchen zuschwebte, ließ erschrocken etwas fallen. Das Kaninchen darunter war sehr ärgerlich.
Aber nicht halb so ärgerlich wie Franziska Fesenfeld, die jetzt aus dem Fenster über Agathes Locken lehnte. Jans Mutter. Sie blickte besorgt ihrem Sprössling nach und ahnte bereits, was sie in wenigen Minuten von den Müller-Pfuhrs zu hören bekommen würde.
Und Jan ahnte, was ihm nach der Schule blühte.
Keuchend und voll düsterer Gedanken rannte er in die Schulstraße hinein – und um ein Haar in das nächste Unglück. Das nahte in Form eines wandelnden Kamelhaarmantels, aus dem unten ein Paar Pantoffeln hervorschaute und oben ein zerknittertes Gesicht. Mit zwei unruhigen Augen. Das Ganze gekrönt von einem sorgfältig gesteckten Dutt, also einem jener tennisballgroßen Haarknoten am Hinterkopf von älteren Damen, die längst aus der Mode waren. Und nicht nur die Haarknoten, da war sich Jan ganz sicher.
„Hallo Oma Sievers“, japste Jan und ein waghalsiges Ausweichmanöver rettete den Mantel samt Inhalt.
„Aber Jan!“ Elfriede Sievers rückte entrüstet ihre Kopfzierde zurecht und schickte der Staubwolke, die Jan hinterließ, ein Duttwackeln hinterher. Dann schlurfte sie weiter. Schnitzel kaufen. Für ihren Oskar.
Sekunden später erreichte Jan die rotlackierte Tür, auf der Haustenbeck stand. Schellte Sturm und drückte sie auf.
„Los Freddie, mach hin!“ , rief er in den dunklen Flur. „Ist schon kurz vor halb!“
„Alles im grünen Bereich“, kam die Antwort von oben, und ein Beben der Stärke zehn krachte die Holztreppe herunter. Mit einem Sprung über die letzten fünf Stufen erschien ein ungekämmter Wischmopp, Sommersprossen um die Nase und ein breites Grinsen darunter.
„Mach dir nicht ins Hemd!“, röhrte Freddie und klatschte seine rechte Handfläche in Jans. „Mittag gibt's Ferien.“
Und weiter ging's, die Schulstraße entlang und rein in die Eisdiele Favretti. Lisa hatte eben die Kaffeetasse und den Fruchtbecher von Oma Sievers weggeräumt und die Stühle wieder zurechtgerückt.
„Na endlich, da seid ihr ja“, sagte sie genervt und warf ihre blonden Zöpfe auf den Rücken. Die Unpünktlichkeit der Jungs wurde von Tag zu Tag schlimmer. Aber dann drängeln! Kaum hatte Lisa die Schultasche über der Schulter, packte Freddie ihren rechten Zopf und Jan den linken, „He, lasst das!“, und ab ging's über Schleichwege zur Haltestelle Augsburger Tor. Die Türen schlossen schon, der Bus fuhr ruckelnd an, als Freddie mit beiden Fäusten gegen das Fahrerfenster trommelte. Beinahe hätten sie den nächsten nehmen müssen. Nicht zum ersten Mal.
Anke Rufus war seit über zehn Jahren Lehrerin. Die letzten fünf hier in Bresel-Neustadt am Adalbertinum. Und wenn sie ehrlich war, hatte sie keine Lust, zu unterrichten. Jedenfalls nicht heute, am Tag vor den Osterferien und bei strahlendem Sonnenschein. Weder Mathe noch Deutsch. Deswegen hatte sie etwas Besonderes vorbereitet. Die Klasse war versammelt, Anke Rufus holte Luft und – die Tür wurde aufgerissen.
„Der Bus hatte Verspätung!“, keuchte Freddie, und drei verschwitzte Kinder stürzten zu ihren Plätzen. Anke Rufus' Blick wanderte aus dem Fenster zu den hohen Bäumen im Schulpark, folgte einem Schwarm kreischender Krähen, bis sie aus dem gläsernen Rechteck verschwunden waren, und landete wieder in ihrer Klasse.
„Sitzt ihr gut?“
Ein vielstimmiges „Ja!“
„Also. Wie ich euch versprochen habe, geht's heute um Burg Knittelstein. Ihr braucht nicht mitzuschreiben, mir reicht schon, wenn ihr zuhört und nicht unter dem Tisch Mau-Mau spielt.“
Ein paar schuldbewusste Hände wanderten auf die Tischplatte zurück. Die Lehrerin drehte sich zur Tafel und klappte sie auf. Dort ritt ein Kreideritter in voller Rüstung mit gezücktem Schwert übers Tafelgrün, und ein „Ohhh!“ ritt durch die Klasse.
„Also“, sprach Anke Rufus, „hört zu. Es gab mal einen Ritter, der hieß Kunibald und lebte im Namloser Tal. Das liegt heute in Österreich, in den Lechtaler Alpen. Eines Tages stand er vor der Wahl, dort zu verrosten, oder sein Glück woanders zu suchen. Da tat er, was Leute seines Schlages damals so machten. Er sammelte in den Kaschemmen der Umgebung ein paar Spießgesellen und lebte prächtig. Und zwar auf Kosten aller, die nicht bei drei das Weite gesucht hatten. Als in seiner Heimat nichts mehr zu holen war, zog er den Lech hinab. Genauer: er fiel in unsere Gegend ein und raffte alles zusammen, was die Schwaben nicht schnell genug im Breselwald vergraben konnten. Dann ließ er für sich und seinen Haufen ein Häuschen mit Turm und Zugbrücke bauen. Oben auf dem Breselberg. Ihr ahnt es schon: Burg Knittelstein. Die wurde vor exakt eintausend Jahren fertig und von der Ritterhorde bezogen, da sind sich die Experten einig. Das Jubiläum soll in diesem Jahr, wie ich hörte, ganz groß gefeiert werden.“
Und mehr zu sich selbst fügte sie hinzu: „Falls unser Stadtrat endlich in die Gänge kommt.“ Dann wandte sie sich zurück an die Klasse.
„Ungefähr zur selben Zeit gründeten ein paar Handwerker und Bauern ein Dorf und nannten es nach dem Berg. Nämlich Bresel. Kunibald ließ sie gewähren. Er schloss mit ihnen sogar einen Vertrag. Der hängt noch heute in der Rathaushalle. Nach den Ferien werden wir ihn besichtigen und einen Aufsatz darüber schreiben.“
Die Klasse stöhnte. Anke Rufus überhörte es.
„Dieser Vertrag besagt, dass die Knittelsteiner Ritter all denen ein friedliches Leben zusicherten, die einen Teil ihrer Ernte oder sonstigen Einkünfte auf der Burg ablieferten. Das kann man nett finden, weil die Breselner wenigstens den Rest behalten durften. Man kann das natürlich auch Schutzgelderpressung nennen. Heutzutage würde Kunibald dafür hinter Schloss und Riegel landen. Damals aber errichteten ihm die erleichterten Breselner ein Denkmal. Einen Brunnen mit Kunibald als eisernem Ritter oben drauf. Den kennt ihr ja. Der steht auf unserem Marktplatz. Freddie, lies mal den Zettel vor, den dir Jan eben rübergeschoben hat.“
Freddie wurde knallrot und breitete langsam einen Wisch auf seinem Tisch aus. Irgendwas stand in krakeliger Schrift darauf.
„Nun?“ Die Lehrerin knipste ungeduldig mit ihren Kugelschreiber.
„Es kam eines Tages nach Bresel, ein …“ Freddie stockte und schaute verzweifelt zu Frau Rufus hinüber. Die Lehrerin nickte ihm zu, ohne eine Miene zu verziehen. „Weiter.“
„… ein ausgemachter Esel. Der hatte ein Kinn wie die Schnauze vom Wolf – und hieß Radolf.“
Immerhin lächelte Frau Rufus. Wenn auch sparsam. „Ist dieser Radolf ein Ritter?“
„Nee.“ Jan grinste verlegen. „Unser Vermieter.“
„Aha. Der wird nicht erfreut sein, das zu lesen. Freddie, den Zettel!“
„Aber – Frau Rufus …“ Jan sah sie flehentlich an.
„Also“, die Lehrerin war verhandlungsbereit, „wenn ihr versprecht, bis zum Schluss der Stunde …“
„Soll nicht wieder vorkommen“, beeilte sich Freddie, und Jan nickte hastig.
Anke Rufus kassierte den Zettel und ging zur Tafel zurück. In der folgenden halben Stunde erzählte sie von den blutigen Kreuzzügen im 11. Jahrhundert, an denen sich auch die Knittelsteiner beteiligten. Bis auf einen gewissen Ritter Ademar, der die Hosen voll hatte, und sich unter der Burg im Breselberg verkroch. In irgendwelchen Stollen, aus denen er nie wieder auftauchte. Man munkelt, seine Rüstung halte noch heute Wache im Berg und stürze sich auf ungebetene Besucher.
Anke Rufus berichtete von den grausamen Raubzügen des Arnulf von Breselberg-Zoffhausen, dessen Stammbaumverästelungen vermutlich bis zu Clemens Zuffhausen reichten.
„Unser Direktor?“, krähte ein Mädchen aus der letzten Reihe.
Frau Rufus nickte. „Jawohl, so sieht's aus. Direktor Zuffhausen ist mit einem Raubritter verwandt. Keine dummen Bemerkungen, Freddie, sonst …“ Sie wedelte mit dem Zettel vor seiner Nase.
Freddie klappte auf der Stelle seinen Mund wieder zu und betrachtete treuherzig den erhobenen Zeigefinger der Lehrerin.
„Aufgrund dieser fernen Verwandtschaft“, fuhr sie fort und ließ dabei Freddie nicht aus den Augen, „ist die Breselner Geschichte dem Herrn Zuffhausen gewissermaßen in die Wiege gelegt worden. Ihr wisst, dass er auch Vorsitzender des Historischen Museums ist. Übrigens immer einen Besuch wert.“
Endlich ließ Frau Rufus von Freddie ab und nahm ihre Wanderung durch die Klasse wieder auf. „Es gibt da noch eine Reihe weiterer Verbindungen der Knittelsteiner zu unserer Stadt“, fuhr sie fort und erzählte ausführlich vom sanften Adalbert Stifterstein zu Bresel, der im 16. Jahrhundert ein Jesuitenkloster vor den nördlichen Stadtmauern gründete.
„Mit einem wunderschönen Park dahinter.“ Anke Rufus' sehnsüchtiger Blick fand wie von selbst den Weg aus dem Fenster. „Heute ist das Adalbertinum eine Schule. Unsere Schule.“
Und schließlich lachte sich die Klasse kringelig über den verrückten Aimo Rochefort de Bresèl. Dieser Spross einer französischen Seitenlinie derer von Knittelstein wollte im 17. Jahrhundert tatsächlich eine Rutsche bauen. Vom Burgturm durch den Breselberg bis runter zum Rathaus.
„Oh Mann, das hätt' ich auch gemacht“, seufzte Freddie.
Jan schlug sich vor die Stirn und brach stöhnend auf dem Schultisch zusammen. „War klar!“
Und Lisa zappelte: „Können wir in die Burg nicht mal rein? Ich meine so richtig, bis oben auf den Turm!“
Anke Rufus lächelte. „Da müssten wir mal mit den derzeitigen Bewohnern verhandeln. Aber – und das soll das Letzte für heute sein – früher war das Problem eher umgekehrt.“
Fragende Gesichter.
„Wie kommt man aus der Burg raus?“
„Ganz einfach. Über die Zugbrücke.“
„Und wenn davor der Feind stand? Die alten Ritter lagen sich alle Nase lang in den Haaren. Das wurde eine solche Landplage, dass schließlich die Bischöfe eingriffen und eine Waffenruhe verordneten. Von Mittwoch Abend bis Montag früh.“
Lisa kicherte. „Direktor Zuffhausen sollte mal 'ne Schulruhe verordnen. Von Mittwoch Abend bis Montag früh!“
„Jetzt habt ihr bald zwei Wochen Schulruhe. Reicht euch das nicht?“
Alles neete und nööte durcheinander.
Anke Rufus war die Geduld in Person. Noch drei Stunden, dann begannen die Ferien.
„Also. Am Montag Morgen ging dann bei den Rittern wie bei uns in der Schule das Hauen und Stechen wieder los. Wer sich nicht an die Pause hielt, musste zur Strafe nach Jerusalem pilgern. Und so eine Pause, wird erzählt, rettete ein paar Rittern im Jahre 1087 das Leben und die Burg. Da griff nämlich Wolfram von Trutzlingen, genannt Wolfram mit dem Buckel, Burg Knittelstein an. Die wurde von Meinhardt dem Dicken verteidigt. Wolfram hatte Wurfmaschinen den Berg hinauf schaffen lassen. Eine irrsinnige Plackerei, könnt ihr euch vorstellen. Am Mittwoch Abend dann waren die Mauern der Burg durchlöchert wie ein Sieb und die Zugbrücke kurz vorm Zusammenbruch. Doch die beiden Raufbolde hatten wenigstens vor dem Bischof Respekt. Naja, und bis nach Jerusalem war es verflixt weit. So hielten sie sich notgedrungen an die Ruhezeit. Aber Meinhardt der Dicke war schlau. Er nutzte die vier folgenden Tage und Nächte und – das berichten die alten Legenden – haute eine Spalte im Berg so aus, dass sie für dicke Ritter begehbar wurde. Oder wahrscheinlich eher bekriechbar. Plötzlich kamen am Montag Morgen irgendwo unterhalb der Burg ein paar finstere Gesellen aus einem Stollen geschlüpft. Sie fielen dem überraschten Wolfram und seiner Truppe in den Rücken und – man darf es kaum sagen – warfen sie mit allem Gerät die Südklippen runter. Hinter der Burg, bei der Teufelsnase. Ihr kennt das dort? Ihr wisst, was das bedeutet. Noch Fragen?“
„Klar! Wo kommt der Gang denn raus?“
Anke Rufus machte ein geheimnisvolles Gesicht und blickte Timo ernst in die Augen. „Ich vermute,“ sagte sie langsam, „im Keller von Direktor Zuffhausen.“
Es dauerte eine Weile, bis die ersten grinsten.
„Und nun ab mit euch in die Pause. Aber nicht bis Montag früh!“
Meinhardt der Dicke verdrehte die Augen. Ja damals! Da hatten sie sich durch den Berg gewühlt. Und dann erging's dem Wolfram schlecht!
Und heute? Hing er in der Knittelsteiner Ahnengalerie! Und blickte hinunter auf diese Göre, die ihm neulich drei schwarze Haare in jedes Nasenloch gemalt hatte. Beim verklemmten Visier! Da rannte sie schon wieder die Galerie entlang. Streckte ihm die Zunge raus und verschwand in der Wendeltreppe zum Burgturm.
Jubiläum
Montag, 14. April, Punkt 10 Uhr. Rathaus Bresel.
Bimmelebimmelebim! Die goldene Rathausglocke in der Hand von Bürgermeister Aloisius Schwobenhammer läutete die letzte Sitzung des Stadtrats vor der Osterpause ein. Versammelt hatte sich die komplette Bürger-Partei-Bresel. BPB. Allesamt alteingesessene Breselner und stolz darauf, viel für das Ansehen der Stadt geleistet zu haben. Zum Beispiel Bäcker Blume, der neben Schneider Böck saß und sorgfältig die Mehlreste aus seinem Anzug klopfte. Frisör Fernandel betrachtete missbilligend die Glatze von Sparkassendirektor Schönemann, die sich unter wenigen nassgekämmten Haaren zu verstecken versuchte. Martina Dall vom Dalli-Markt schäkerte mit Fridolin Rausch vom Kaufhaus Rausch. Der alte Todd Emmerich saß etwas abseits und kämpfte mit dem Schlaf. Der Totengräber von Bresel musste seit langem schon alle Nachtwachen selbst übernehmen. Es hatte sich einfach niemand gefunden, der in sein Geschäft einsteigen wollte.
Die Versammlung wartete gespannt auf die Rede des Bürgermeisters. Und das hatte seinen Grund. Aloisius feierte im letzten Jahr seinen 65. Geburtstag und war – wie er nicht müde wurde zu betonen – nur noch bis Oktober im Amt. Dann würde er seinen Posten für einen Jüngeren räumen. Das hatte eine gewisse Unruhe im Stadtrat ausgelöst. Bürgermeister zu werden, das lockte so manchen. Aber bis Oktober floss noch viel Wasser den Breselbach hinunter.
Zu Aloisius' Linken saß seine rechte Hand Radolf Müller-Pfuhr, langjähriges Mitglied der BPB, Kassenwart und Protokollführer. Nicht anwesend heute Radolfs Frau Agathe, der weibliche Teil der BPB. Mal abgesehen von Frau Dall.
Bimmelebimmelebim! Aloisius Schwobenhammer schwang die goldene Glocke und Ruhe kehrte ein.
„Meine Dame, meine Herren!“ Er ließ seinen grauen Blick unter den buschigen Augenbrauen von einem zum andern wandern. „Wie ich sehe sind wir nahezu vollzählig. So wenden wir uns …“, er drehte seinen Kopf zu einer beschrifteten Tafel an der einzigen fensterlosen Wand des Saals, „… wenden wir uns einer neuen Aufgabe zu.“
Oben auf der Tafel stand in handgroßen LetternJUBILÄUM.
Einige Gesichter zeigten unverhohlene Enttäuschung. Das klang nicht nach Vorschlägen für einen Bürgermeisterkandidaten. Aloisius Schwobenhammer, der seine Breselner nur zu gut kannte, zögerte höchstens einen Wimpernschlag, um dann ungerührt fortzufahren.
„Wie Sie wissen, wird unsere schöne Stadt in diesem Jahr eintausend Jahre alt.“
Zaghaftes Kopfnicken.
„Und Burg Knittelstein ebenfalls.“
Leises Gemurmel.
„Ich habe mich bereits mit Baronin Tusnelda von Knittelstein-Breselberg in Verbindung gesetzt.“
Vereinzeltes Stühleknarzen. Bäcker Blume hüstelte eine Mehlwolke.
„Und wir schlagen für die Jubiläumsfeierlichkeiten das erste Wochenende im Mai vor. Irgendwelche Gegenstimmen?“
Die Sonnenstrahlen, die durch die bleiverglasten Rathausfenster fielen, begleiteten die Staubflöckchen, bis sie auf den geschlossenen Augenlidern von Todd Emmerich zu liegen kamen.
Schweigen.
„Radolf, schreib ins Protokoll: Jubiläumsfeiern Anfang Mai. Keine Gegenstimmen. Wir benötigen ein fünfköpfiges Festkomitee. Ich bitte um Handzeichen.“
Als die Versammlung das Rathaus verließ, legte Aloisius seinen Arm um Radolfs Schultern und dirigierte ihn über den Marktplatz zum Kunibald-Brunnen. Ritter Kunibald glänzte in der Frühlingssonne. In seiner rechten Faust reckte sich siegesgewiss die eiserne Lanze, um deren Schaft sich eine zierliche goldene Schlange ringelte, die gespaltene Zunge angriffslustig vorgestreckt. Der Bürgermeister hielt diesen Ort für geeignet, ein paar vertrauliche Worte an seinen Parteikollegen zu richten.
„Radolf“, sprach er, „wir kennen uns nun schon viele Jahre. Und wie du weißt, trete ich am 19. Oktober ab.“ Er zog die Augenbrauen hoch und blinzelte verschwörerisch. „Und so ein Bürgermeisteramt bedeutet nicht nur Arbeit. Es hat auch seine angenehmen Seiten. Denk mal darüber nach. Und mach den Mund zu.“
Sprach's und ließ den verdutzten Radolf in der Vormittagssonne stehen.
Als die Glocken von Sankt Urban elf schlugen, rieb sich Radolf Müller-Pfuhr die Augen und eilte zu seiner Kehrmaschine. Die Neuigkeit musste so schnell wie möglich mit Agathe besprochen werden. Er sprang hinters Lenkrad, und bald ruckelte das leuchtend orange lackierte Gefährt los, auf dessen Rückfront in breiten Buchstaben STÄDTISCHE MÜLLABFUHR zu lesen war. Denn Radolf war Angestellter der Stadtreinigung und ritt tagein tagaus auf seinem Kehrdrachen durch die Straßen. Jetzt führte ihn sein Weg durchs Augsburger Tor, die Breselner Landstraße hinaus, am Dalli-Markt, an der Feuerwehr und der Polizeiwache vorbei, bis zum Haus Nummer 153, wo er rechts ran fuhr und parkte.
Radolf Müller und Agathe Pfuhr hatten die Nummer 153 vor Jahren erworben. Sie hatten ganz modern mit Doppelnamen geheiratet und keine Kinder bekommen. (Was manche Nachbarn für ein Glück hielten. Für die Kinder.) Radolf fuhr jeden Morgen den Müll. Agathe beschäftigte sich. Im Haus, im Garten, im Rosenzüchterverein. Ihre wahre Hingabe galt jenen duftenden, dornigen Blumen. Besonders den violett-weiß gefüllten vor dem Küchenfenster, die – nun ja – vor nicht allzu ferner Zeit deutlich gelitten hatten.
Vor einem Jahr hatten die Müller-Pfuhrs sich Untermieter ins Haus geholt, die das erste Stockwerk und das Dachgeschoss bewohnten. Franziska und Ferdinand Fesenfeld. Mit Jan, elf Jahre, Lotte sieben und Jonny muntere vier.
RUMMS – rattaratta – taptaptap – RUMMS – rattaratta – tiptiptip
RUMMS – rattaratta – taptaptap – RUMMS – rattaratta – tiptiptip
Das Haus wackelte und der Schornstein wankte bedrohlich. Die Tür öffnete sich sperrangelweit, zwei Blondschöpfe mit zwei Handbreit Höhenunterschied stürmten heraus und liefen Radolf in die Arme.
„Also könnt ihr denn nicht ein einziges Mal …“
„Tschüss, Onkel Radolf!“
„Schüssonkeladoff!“
„… leise die Treppe runtergehen?“ Weg waren sie. Radolf Müller-Pfuhr schüttelte den Kopf. Als er noch ein Kind war, da – da versagte auch schon seine Erinnerung.
Radolf betrat die Müller-Pfuhrsche Wohnung. „Hallo Schatz! Du wirst es nicht glauben, was Aloisius zu mir gesagt hat!“
„Nein.“
„Er hat gesagt …“
„Hast du an die Eier gedacht?“
„Oh! … aber Aloisius hat …“
„Da brauchst du erst gar nicht deine dreckigen Schuhe am Teppich abwischen. Zehn Eier!“
„Ja, gleich. Aloisi …“
„Jetzt!“
„… Aloi …“
Es gibt Blicke, die können Gehirnmasse verdampfen lassen. Radolf schluckte mühsam und tat, was er immer tat, wenn er sich gegen Agathes Gewitterstimmung nicht zu helfen wusste.
„Also … ich geh ja schon.“
Als Radolf die Wohnungstür von außen geschlossen hatte, schnaufte Agathe noch einmal entrüstet. Dann ging sie in die Küche. Holte ein kleines Fläschchen aus dem Kühlschrank, in dem eine rubinrote Flüssigkeit schwappte. Prüfend hielt sie es gegen das milchige Licht der Aprilsonne, das zum Fenster hereinsickerte, und kicherte leise. Dann schnitt sie ein Stück Schwarzbrot in Würfel, träufelte den roten Saft auf die Bröckchen – nur einen, höchstens zwei Tropfen – und stieg damit hinunter in den Keller.
Zu den Ratten.
Denn Agathe wusste sich zu helfen.
Dienstag, 15. April.
Baronin Tusnelda von Knittelstein-Breselberg stand an einem Fenster der Burg, die Lippen zu einem Strich gepresst. Gestern Morgen hatte der Bürgermeister angerufen. Dieser Schwobenhammer. Wegen der Tausend-Jahr-Feier von Bresel und der Burg. Ob man nicht ein gemeinsames Fest am ersten Wochenende im Wonnemonat Mai und so weiter blablabla. Er hätte schon mit diesem Herrn Zuffhausen vom Historischen Museum gesprochen. Der könne doch die Feier auf dem Burghof organisieren. Der kenne doch ihren Gatten gut, hatte Schwobenhammer gesagt. Die Stadt würde sich selbstverständlich an den Kosten beteiligen. Großzügig.
Mit ärgerlichen Schritten ging Tusnelda die Ahnengalerie entlang. Vor Kunibald blieb sie stehen. „Nur weil du vor tausend Jahren diesen Laden gebaut hast, kommt jetzt das ganze Pack hier rauf. Und will feiern!“
Sie stapfte weiter am dicken Meinhardt und dem verschwundenen Ademar vorbei. Mit halb geschlossenen Lidern giftete sie Arnulf von Breselberg-Zoffhausen an: „Und weil du ein Ururur-Ahn von diesem Zuffhausen bist – was noch niemand bewiesen hat! – tut der jetzt wichtig. Will sich um das Burgmuseum kümmern. Und was sonst noch alles. Und weil er meinen Gatten so gut kennt. Ha!“
Noch ein paar Schritte weiter, hinter dem sanften Adalbert, hing Aimo Rochefort de Bresèl. „Und du bist der Allerklügste gewesen. Eine Rutsche bauen! Vom Burgturm zum Rathaus!“ Tusnelda verbog verächtlich die Gesichtszüge. „Dazu ist es zum Glück nie gekommen. Hast stattdessen den Berg durchlöchert wie einen Käse. Deine einzige gute Tat!“
Tusnelda schnaubte. Dieser Löcherkäse war nichts weniger, als das legendäre Knittelsteiner Labyrinth. Jahr für Jahr flatterten unzählige Forschungsgesuche in den Burgbriefkasten und direkt weiter in Tusneldas Papierkorb. Bis vor drei Wochen. Wie aus heiterem Himmel hatte die Baronin dem hartnäckigsten Bittsteller nachgegeben. Diesem Oskar Sievers. Und hatte ihm erlaubt, in die Stollen unter Knittelstein einzusteigen. Warum? Tusnelda hatte ihre Gründe! Die gingen niemandem sonst etwas an.
Nur schade, dass Oskar nicht ihre Erwartungen erfüllte. Nein, ganz und gar nicht. Tusnelda schritt langsam weiter. Längst hatte sie ihr Nachgeben bereut. Wie man es auch drehte, Oskar war sogar ein Problem geworden. Ein Problem, dass sie lösen musste, früher oder später. Ihr Blick blieb an den Händen Heinrich II. hängen. An dem Ring, den er trug. An der doppelten Zungenspitze.
Ein freudloses Lachen hallte die Galerie entlang und klatschte gegen eine kahle Stelle an der Wand. Von dort würde einmal ihr Bild neben dem ihrer Schwester Adelgunde auf die Nachwelt herabblicken. Adelgunde von Breselberg-Rummelpott, die mit einem Lackvertreter und ihren zwei Blagen in Augsburg wohnte. In einer kleinen schmucken Villa. Und sich nicht mit neugierigen Touristen und feiernden Breselnern herumschlagen musste. Und einem Problem namens Oskar.
Tusnelda grunzte und verschwand.
Oskar
„Der schräge Oskar“, sagte Freddie. Er hatte das Fernglas auf die Friedhofsmauer gerichtet. Von dort stapfte ein Mann auf den Saum des Breselwaldes zu.
„Gib mal her.“ Jan kletterte einen Ast höher und nahm Freddie das Glas aus der Hand.
Im Geäst ihrer Lieblingseiche reckten sich gerade die ersten grünen Spitzen aus den Knospen. Es würde noch ein paar Wochen dauern, bis die freie Sicht auf die Fischteiche zugewachsen war.
Jan hielt das Fernglas vor die Augen. „Letzte Woche hätte ich Oskar fast zum Witwer gemacht.“
„Ja klar.“ Freddie war nicht sonderlich beeindruckt.
Jan breitete die Arme aus und begann mit dramatischer Stimme: Wie er um Haaresbreite in den stadtbekannten Kamelhaarmantel gerauscht wäre, und nur ein kühner Sprung in allerletzter Sekunde Oma Sievers vor der Pulverisierung gerettet hätte. Triumphierend blickte er durch die Zweige des Breselwaldes hinunter zum Friedhof, als erwartete er von dort donnernden Beifall. Freddie rollte die Augen, aber Jan war nicht zu bremsen.
„Und auch ich lebe noch!“, verjagte er mit schriller Stimme die Vögel aus den umliegenden Bäumen. „Denn so höre! Agathe die Schreckliche versucht, mich und meine gesamte Familie auszurotten!“ Und düster fügte er hinzu: „Mit Gift!“
Freddie lehnte den Kopf an den Eichenstamm und hielt sich die Ohren zu. Wie aus weiter Ferne vernahm er, dass es den Fesenfeld-Kindern unter Androhung strenger Strafen verboten war, den Keller zu betreten. Agathe die Schreckliche hatte dort Köder mit Rattengift ausgelegt, was bekanntlich auch für Menschen keine bekömmliche Kost war. Jan dichtete ihr eine Warze auf die Nase und spielte mit krummen Gichtfingern, wie Agathe Nacht für Nacht in die Unterwelt des Hauses Nummer 153 stieg und den röchelnden Ratten die Hälse …
„Aufhören!“ Freddie kniff ihm ins Bein. „Halt endlich den Schnabel!“ Und leiser fügte er hinzu: „Guck mal, wer da die Maiglöckchen zertrampelt.“
Oskar Sievers war nur noch wenige Buchen entfernt. Langsam setzte er Fuß vor Fuß, denn er war nicht mehr der Jüngste. Den Schlapphut tief ins Gesicht gezogen, stützte er sich bei jedem Schritt auf einen knorrigen Eichenstock. Ob er Jans Vorstellung mitbekommen hatte, ließ er sich zumindest nicht anmerken.
„Der schräge Oskar“, flüsterte Freddie noch einmal.
Jan machte wieder sein Schauspielergesicht. „Auf der Suche nach dem verlorenen Schatz von Knittelstein!“
„Pssst!“
Die Jungs duckten sich hinter die Äste und hielten den Atem an. Sie hatten gehörigen Respekt vor dem schweigsamen Alten. Langsam kam er näher. Das Laub raschelte unter seinen Wanderstiefeln. Leise summte er ein Lied. Knapp vor der Eiche hielt Oskar an. Drehte sich halb im Kreis und musterte die Baumstämme. Wenige Meter über ihm presste sich Jan mit Daumen und Zeigefinger die Nasenlöcher zu.
Ein vorwitziges Eichhörnchen sauste den Stamm hoch, bis es Freddies Turnschuhe bemerkte. Oskar Sievers hob den Kopf gerade so weit, dass das Tierchen unter seiner Hutkrempe erschien. Wenige Zentimeter noch, und Freddies Quadratlatschen würden ihm ins Bild hängen.
Das Eichhörnchen beäugte einige lange Sekunden die merkwürdigen neuen Baumbewohner. Dann sprang es an ihnen vorbei in die Krone. Jetzt hat er uns gleich, dachte Jan. Doch Oskars Hut senkte sich. Der alte Heimatforscher hatte seinen Knochen genug Pause gegönnt und nahm seine Wanderung zur Burg wieder auf.
Als die Jungs wenig später um die Fischteiche herum schlenderten, kam Jan noch einmal auf die Müller-Pfuhrs zu sprechen. Seine Eltern verstanden sich gar nicht mit den Vermietern. Die hatten an allem was auszusetzen. Mal war das Treppenhaus nicht ordentlich gewischt, dann krähten die Kinder zu laut und meistens zur falschen Zeit, und im Vorgarten spielen durfte eh niemand. Wegen Agathes kostbaren Rosen.
„Naja“, grinste Freddie, der die Geschichte mit der Schultasche kannte. Aber Jan war in diesem Punkt längst das Lachen vergangen. Das Donnerwetter seiner Mutter war nicht von Pappe gewesen. Und nachher hatte der Familienrat getagt. Auf Dauer gab es nur eins: Die Müller-Pfuhrs oder wir.
Den weiteren Weg schwiegen sie. Als die Fischteiche umrundet waren, lenkten sie ihre Schritte, ohne dass es einer Verabredung bedurfte, an der Grundschule vorbei Richtung Eisdiele Favretti. Lisas Vater hatte immer eine Kugel für sie übrig.
Tags drauf waren alle Ratten tot. Im Keller von Haus Nummer 153 an der Breselner Landstraße.
Agathe Müller-Pfuhr hatte drei Versuche gebraucht. Zuerst mit Schwarzbrot, dann mit Weißbrot. Mit Rosinenstuten hatte es dann geklappt. Ganz schön wählerisch, die Biester. Agathe hatte das süße Brot gewürfelt, mit dem roten Saft aus dem kleinen Fläschchen beträufelt, und die Bröckchen im Keller verteilt. Und die verflixten Ratten hatten sie genussvoll verspeist. Mmh, lecker! Vierundzwanzig Stunden später: Aargh! Tot! So kann's gehn!
Nett von Agathe wäre nun gewesen, den Keller für die Kinder wieder frei zu geben. Zum Beispiel zum Verstecken spielen. Doch Agathe war nicht nett. Und auch darüber war Agathe sehr zufrieden!
Burgfest
Es kamen die Ostertage. Bürgermeister Schwobenhammer wurde 66, und kurz darauf trieb der erste Mai mit strahlendem Sonnenschein die Breselner Bürger ins Grüne. Die ganze Stadt summte wie ein Bienenkorb und bereitete sich auf das kommende Wochenende vor. Auf die Tausend-Jahr-Feier von Stadt und Burg und das große Fest auf Knittelstein, zu dem alle Breselner geladen waren.
Freitag, 2. Mai.
Die Sonne lachte über dem Breselner Land. Alles war auf den Beinen, hatte sich herausgeputzt und flanierte mit frischgewaschenen Gesichtern zur Sankt-Urban-Kirche. Am Portal winkte Pastor Ambros Himmelmeyer seine Schäfchen ins geweihte Gewölbe.
Vorne im Westchor hatte schon das spärliche Trüppchen der Sankt-Florian-Mönche Platz genommen. Abt Florestan blinzelte mit altersmüden Augen zur Apsis empor. Bruder Bramsch mit der Narbennase und der kleine Bruder Girsch spielten Schiffeversenken unter der Betbank. Der Koch Bruder Schorff steckte dem Kellermeister Bruder Klumpp eine Packung Zigaretten zu. Für danach. Der breite Bruder Bankratz schlief.
Nun betrat die Knittelsteiner Baronenfamilie das Kirchenschiff. Tusnelda mit turmhoch toupiertem Haar am Arm ihres Gatten Eduard. Dicht gefolgt von Jo mit langem dunklen Zopf, quietschrosa Rüschenkleid und einem Ich-ertrage-das-alles-ohne-mit-der-Wimper-zu-zucken-Blick. Dahinter im mausgrauen Kostüm Fräulein Sibylle von Oelmütz. Selbstverständlich nahmen sie in der erste Reihe Platz. Rechts. Die war für sie reserviert, wie schon für alle Knittelsteiner zuvor.
Die zweite Reihe füllten Bürgermeister Aloisius Schwobenhammer, seine Frau und die zwei erwachsenen Töchter. Nebendran Agathe und Radolf Müller-Pfuhr. Radolf mit kecker Fliege unterm Kinn und einem strahlenden Lächeln darüber. Jeder sollte sehen, wer neben dem Bürgermeister sitzen durfte.
Der Rest der rechten Bankreihen war grün. Grüne Hosen, grüne Jacken, grüne Mützen mit grünen Plastikeichenblättern: Sankt Luitprand, die Schützenbruderschaft von Bresel. Und ihre Frauen in den Reihen dahinter.
In der letzten Bank auf der äußersten Kante hockte Friedrich Morchel, schneuzte sich die Triefnase und winkte den Heiligenbildern zu. Ehemaliger Schnapsbrenner und in Bresel bekannt und beargwöhnt als der alte Fritz.
Pastor Himmelmeyer ließ seinen Blick durch das barocke Kirchengewölbe gleiten. Auf der linken Seite ganz vorn, brav und mucksmäuschenstill die Klassen eins bis vier der Friedrich-von-Spee-Grundschule. Dahinter die Unterstufe des Adalbertinums.
In Klasse 5b stieß Freddie Jan in die Seite und flüsterte: „Guck mal, die Grafen!“
„Quatsch, das sind Barone.“
Lisa kicherte: „Hat die aber ein bescheuertes Kleid an.“
„Pssst!“ Das war Anke Rufus, die ihre Schüler von der allerbesten Seite präsentieren wollte. Also ebenfalls mucksmäuschenstill.
Die folgenden Bankreihen ertrugen einen ungeordneten Haufen Schüler höherer Klassen unter den wachsamen Augen von Direktor Zuffhausen. Vier Vincentinerinnen vom Vincenzkrankenhaus versteckten sich dahinter. Eine weitere Reihe füllte sich mit den Betreibern der besten Eisdiele weit und breit. Annamaria und Giacomo Favretti und ihre bereits volljährige Tochter Franka, neben die sich Elfriede Sievers (wie immer im braunen Kamelhaarmantel) und ihr Oskar pflanzten. Die Damen-Doppelkopfrunde Hilde Pomsell, Ludmilla Reisich, Martina Dall und Monika Ziehar rutschte neben Sparkassendirektor Schönemann und Kaufhausbesitzer Fridolin Rausch. Dahinter mit leicht angestrengter Miene Hauptkommissar Franz van der Velde und mit leicht abwesendem Blick auf den Hinterkopf von Franka Favretti sein Assistent Hinrich. Es folgten noch ein paar Reihen Eltern und sonstige Breselner. Den Abschluss bildeten traditionsgemäß die Vertreter der Handwerksberufe. Frisör Fernandel, Bäcker Blume, Schneider Böck und Totengräber Todd Emmerich, dem wie üblich die Augen schon zufielen, sobald er seinen betagten Rücken an die Kirchenbank lehnte.
Alle da? Dann konnte es ja losgehen. Pastor Ambros Himmelmeyer schloss die Kirchentür und gab dem Herrn Bächle einen Wink. Der griff in die Tasten der Sankt-Urban-Orgel und stimmte jenes herzerweichende und augenbefeuchtende Kirchenlied an, in das die versammelte Gemeinde mit Wonne einfiel: Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh der ewigen Heimat zu.
Nach anderthalb Stunden hatten die Breselner genug fürs Seelenheil getan. Die Schützenkapelle nahm im Mittelgang Aufstellung, spielte den berühmten Breselner Defiliermarsch und wanderte zum Marktplatz hinaus. Das Volk folgte und vergnügte sich den restlichen strahlenden Maitag zwischen Kirmesbuden und Karussels, Zapfhähnen und Würstchenbratereien. Die höheren Klassen des Adalbertinums führten ein Ritterspiel um den Marktbrunnen auf, das Ritter Kunibald von Knittel schmunzelnd begutachtete. Wie gern hätte er mitgetan. Freddie stand auf dem Brunnenrand und klopfte Kunibald auf die eiserne Schulter. Tja, vorbei ist vorbei.
Freddies Blick fiel auf den rauchenden Florian-Mönch, der vor dem Kirchenportal stand und sich mit dem alten Fritz unterhielt. Fritz kramte umständlich etwas aus seiner Hosentasche. Was das war, konnte Freddie auf die Entfernung nicht erkennen. Damit fuchtelte der Alte dem Mönch vor der Nase herum. Angewidert wich der Kapuzenmann zurück. Schließlich zog er ein paar Geldscheine aus seiner Kutte. Fritz ergriff sie hastig. Als jenes Ding in Fritzens Hand den Besitzer in umgekehrter Richtung wechselte, blitzte es kurz in der Maisonne auf.
Etwas kleines Rotes, dachte Freddie, hätte das aber nicht beschwören können. Fritz packte die Hände des Mönchs und schüttelte sie überschwänglich. Dann verschwand er im Gewühl. Freddie schaute der Mönchskapuze nach, bis sie in die Altstadtgassen einbog. Richtung Kloster.
Soso, dachte Freddie. Was für Geschäfte macht ein Mönch mit der alten Triefnase Morchel? Und viel später glaubte Freddie sich zu erinnern, dass er in diesem Moment zum ersten Mal ein ungutes Gefühl gehabt hatte. Dass etwas in Bresel nicht stimmte. Als ob das Sonnenlicht eine falsche Färbung bekommen hätte. Vielleicht lag das auch nur daran, dass ihm der alte Fritz (wie den meisten Breselnern) unheimlich war. Oder dass er in der Kirche zu lange Agathe angestarrt und an das Rattengift in ihrem Keller gedacht hatte.