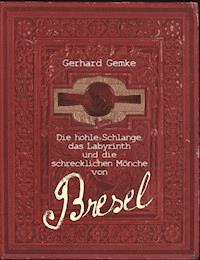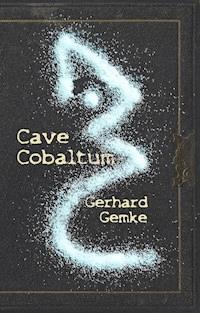Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spät nachts ist die Tür von Frau Regenbrecht unverschlossen und eine seltsame Pappfigur sitzt am Wohnzimmertisch. Freddie betritt die Wohnung und wird von Frau Regenbrecht beinahe erschlagen. Es ist bereits der dritte Einbruch dieser Art, sagt die Polizei, aber diesmal ist eine Perlenkette verschwunden. Ein böser Verdacht fällt auf Freddie, aber er bestreitet, irgendetwas gestohlen zu haben. Lisa und Jo versuchen ihrem Freund zu helfen und hinter das Geheimnis dieser Einbrüche und der Pappfiguren zu kommen. Sie geraten immer tiefer in die Breselner Geschichte, bis sie auf Hausenteignungen während der Nazi-Herrschaft und den dunklen Weg dieser Kette stoßen. Auf Burg Knittelstein hält Köchin Emma die Stellung und bittet ausgerechnet Elfriede Sievers ihr Gesellschaft zu leisten. Gemeinsam entdecken die beiden Miss Marples in einem abgelegenen Burgflur das Geheimnis eines riesigen Spiegels, hinter dem sich eine Kammer mit einer düsteren Geschichte befindet. Emma ahnt jedoch nicht, dass Elfriede einen ähnlichen Spiegel kennt, der sich im Rosenhaus am Breselner Markt befindet, in dem Elfriede an einem Abend im Jahre 1949 diese Spiegeltür fest verschloss ... Elfriede beginnt an drei langen Knittelsteiner Abenden zu erzählen - und verlässt die Burg in anderen Nächten, in denen wieder neue Pappfiguren auftauchen. Lisa und Jo kommen hinter die Logik dieser Einbrüche, und Freddie macht einen unheimlichen Fund hinter dem Spiegel in der Bäckerei am Breselner Markt. In diesem Augenblick taucht der Einbrecher wieder auf und singt ein altes Lied. "Vor der Laterne, vor dem großen Tor ..." Eine manchmal urkomische, manchmal traurige und berührende Geschichte, deren Wurzeln bis in die Nazi-Jahre zurück reichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Gemke
Die Kammer hinter dem Spiegel
Bresel-Krimi 4
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Meeresglück
Pappe
Beichte
Basspfeife
Blume
Bella Napoli
Kette
Bruno
Emma
Spiegel
Archibald
Himmel
Regenbrecht
Rudi Schuricke
Tharalios
Brötchen
Paulus
Rose
Änne
Bartold
Sicher ist Sicher
Sonnenbrand
Gespenster
Donnerstag, 8. Juli
… stand eine Laterne
Emilie
Julius
Moderne Musik
Anhang
Impressum neobooks
Meeresglück
RAWOMMM!
Die Explosion zerstörte die gesamte Kombüse und riss ein gewaltiges Loch in die Schiffswand. DieMS Meeresglück war nicht mehr zu retten. Der Smutje, ein Klotz von einem Kerl, und sein Gehilfe, klein und klapperdürr mit einem runden Kindergesicht, das viel zu wackelig auf seinem Hals saß, standen am Kai der schönen italienischen Stadt Ancona. Die Sonne schien, die Möwen schrien, und vor ihnen versank das brennende Kreuzfahrtschiff im Hafenbecken. Und mit ihm der Versuch, ein neues Leben zu beginnen. Als Schiffsköche.
Der Kleine winkte.
„Lass das“, knurrte der Klotz.
Der Kleine ließ den Arm sinken. Ja, das war die Strafe! Sie hätten das alte, schlechte Leben erst bereinigen müssen. Vorher. Vor dem neuen Leben in Ehrlichkeit. Sie hätten beichten sollen. Vielleicht sogar, sich der Polizei stellen. In einem Ort namens Bresel. Allein das Wort verursachte ihm eine Gänsehaut.
„Fang nicht schon wieder damit an.“
„Ich hab doch gar nichts gesagt.“
„Aber gedacht.“
Der Kleine nickte. Na und? Jetzt war erstmal alles Essig. Und der mühsam gefundene Job ins Wasser gefallen. Konnte man so sagen. Mit knurrendem Magen betrachtete er die Bläschen, die an der Unglücksstelle aufstiegen. Letzte Grüße vom Unterseeboot. Und von dem Hefezopf, der in diesem Schrottteil von einem Gasherd lag, rostig, wackelig und mit undichten Schläuchen. Also der Herd, nicht das lecker duftende Gebäck. Hatte er eigentlich den Herd ausgestellt, bevor er von Bord ging?
Sein Magen knurrte lauter als das Möwengeschrei. Mindestens. Der Kleine hatte solchen Hunger. Eigentlich hatte er immer Hunger, aber besonders, seit er sich von seiner Erdkugelform zu einem Hänfling herunter gefastet hatte. Wegen dem neuen Leben halt. Ede, die Bohnenstange, hatte aus Freundschaft alles aufgegessen, was Carlo in heldenhafter Überwindung verschmäht hatte, und war zum Ausgleich aufgegangen wie ein Hefezopf. Carlo lief schon wieder das Wasser im Mund zusammen.
„Vielleicht hast du sogar recht“, brummte Ede.
Carlo schüttelte den Kopf. Er hatte niemals recht; nicht, seit er mit Ede unterwegs war. Er hatte sich offensichtlich verhört.
„Gut.“ Ede hob seine Hand. Er wollte doch wohl nicht dem Wrack zuwinken? „Gehn wir.“
„Aber … wohin?“ Carlo starrte ungläubig auf Edes Hand.
„Hast du eigentlich den Herd ausgestellt?“
Carlos Kopf folgte den Bewegungen von Edes Hand, was wie eine Verneinung aussah.
„Ein Grund mehr.“ Es klang wie: Eine Sünde mehr.
„Nein!“, hauchte Carlo. Er befürchtete das Schlimmste. Seit Ede zugenommen hatte, war er unberechenbar geworden. Da kam er manchmal auf Ideen, an die er früher nicht im Traum …
„Wir tun es, du hast recht.
„Du willst doch nicht etwa …“
„Doch, ich will.“
„Nach Bresel?“
„Beichten!“
Pappe
Traudl Regenbrecht hatte sich so gefreut.
Drei Wochen ohne die Gespenster, ohne die Schatten, die sie jede Nacht heimsuchten. In diesem Haus, dieser düsteren Wohnung. In dem knarzenden Holzbett, in dem schon Traudls Großmutter gestorben war. Und in dem Traudl vor siebenundachtzig Jahren das Licht dieser ungerechten Welt erblickte. Lange bevor sie Wilhelm heiratete, lange bevor sie mit ihm und dem Bett in dieses Haus einzog, in dieses Gespensterhaus. Traudl wusste es einfach: Eines Tages würden SIE zurückkommen. SIE, die früheren Bewohner. Die das Haus verlassen mussten, damals.
Wir haben es rechtmäßig erworben!, hatte Wilhelm gesagt, und Traudl hatte ihm geglaubt, damals.
Und jetzt erwartete Traudl SIE. Beinahe täglich. SIE würden an die Tür klopfen und ihren Besitz zurückverlangen: das Haus Schulstraße Nummer 23 in Bresel.
Traudl Regenbrecht saß an ihrem Wohnzimmertisch. Vom Marktplatz hörte sie die Glocken von Sankt Urban. Zwölf Schläge, Mitternacht. Traudl starrte in den dunklen Flur und auf die neue Wohnungstür, die sie hatte einbauen lassen. SIE sollten es nicht zu leicht haben. Das hatte Elfriede auch gesagt. Elfriede Sievers, die sie manchmal besuchen kam. Die einzige, abgesehen von den unvermeidlichen Mietern. Elfriede, die ihr auch zu der neuen Tür geraten hatte. Mit Sicherheitsschloss. Trotzdem traute Traudl ihr nicht. Ehrlich gesagt weder der Tür, noch Elfriede.
Und auch deshalb hatte sie sich auf die Kreuzfahrt gefreut! Wegen all dem. Drei Wochen raus hier, von Morgen an. Und dann kam vor zwei Stunden dieser Anruf. Die Reederei war am Apparat. Das Schiff sei aus noch ungeklärter Ursache gesunken, im Hafen von Ancona. Frau Regenbrecht hätte die Möglichkeit, für einen geringen Aufpreis einen Platz auf dem nächsten Schiff zu buchen.
Traudl hatte enttäuscht den Hörer auf die altertümliche Telefongabel geknallt. Das müsse sie sich noch überlegen, hatte sie gekeift. In ihrem Alter könne das nächste Schiff schon eins zu spät sein. Rums!
Seit dem saß Traudl am Wohnzimmertisch und starrte durch die Flurschatten auf die neue Wohnungstür. Argwöhnisch beobachtete sie die Klinke. Hatte sie von dort ein Klicken gehört? Hatte sich die Klinke bewegt? Kamen SIE schon heute? Heute Nacht?
Hätte Traudl das Schiff sowieso nicht mehr erreicht?
Baron Eduard rüttelte an der rostigen Klinke. Er drückte und zerrte an dem schmiedeeisernen Griff, warf sich mit der rechten Schulter gegen die Eichentür und biss die Zähne zusammen. Beim dritten Versuch endlich sprang das Schloss auf. Quietschend öffnete sich ein schmaler Durchgang in dem riesigen Knittelsteiner Burgtor. Baron Eduard kletterte hinaus auf die Zugbrücke, die in schwindelerregender Höhe über dem Burggraben hing. Trotz der nächtlichen Stunde floss ihm der Schweiß in den Hemdkragen. Aber es half ja nichts. Die schweren Flügel unter dem Knittelsteiner Torbogen ließen sich nur noch von außen aufschieben. Morgen früh würde er dieser Türenfirma Dampf machen, schwor sich Eduard. Seit Wochen vertrösteten die ihn schon. Viel zu tun, hieß es wieder und wieder. Was man so kennt.
Unten im Tal schlug die Turmuhr von Sankt Urban Mitternacht. Schüchtern bimmelten die Glöckchen der Knittelsteiner Burgkapelle hinterher. Auf dem Burghof tuckerte im silbernen Mondlicht der Volvomotor. Freddie, Jan und Strothkötter junior quetschten sich auf die Rückbank, vom Beifahrersitz versuchte der langhaarige Ulli die Hupe zu erreichen. Klassenkameraden und sonstige Bekannte von Eduards Tochter Jo, die das Ende des siebten Schuljahres und Lisas dreizehnten Geburtstag gefeiert hatten. Obwohl die Ferien erst in einer Woche begannen, und Lisa Favrettis Jahrestag bereits einen Monat zurücklag, wenn Baron Eduard seine Tochter richtig verstanden hatte. Dreizehnjährige drücken sich manchmal etwas merkwürdig aus. Jedenfalls für gestresste Väter.
Doch jetzt war wieder Frieden eingekehrt und die Mauern der Burg standen nicht schräger als am Tag zuvor. Trotz Schnürs Enkel, oder wie auch immer diese Musikgruppe hieß. Der langhaarige Bengel gehörte zum Beispiel dazu. Er hatte eine elektrische Gitarre bearbeitet, und der andere (der irgendwas mit Stroh hieß) hatte in ein Saxophon getrötet. Freddie spielte dazu ein Klavier mit Strom und ein Mädchen namens Jenny hatte getrommelt. Der Bassist hieß Robin, hatte ein Gesicht blasser als der Mond über der Burgturmspitze und trug selbst im Auto einen schwarzen, breitkrempigen Hut. Naja.
Eduard wischte sich den Schweiß aus dem Nacken. Die Tageshitze hatte kaum nachgelassen. Erst allmählich machte sich ein kühler Wind von Westen wohltuend bemerkbar. Natürlich hatte nicht einer von Jos Bekannten daran gedacht, dass sich um diese Zeit kein Bus mehr die Serpentinen der Breselbergstraße hinaufquälte, um vor der Knittelsteiner Zugbrücke auf Fahrgäste zu warten. Mit was für einer Selbstverständlichkeit die Jugend von heute seine Fahrdienste in Anspruch nahm. Und im Auto sitzen blieb, während er das Tor aufwuchtete!
Baron Eduard unterdrückte sein übliches Ächzen, als er seine Leibesfülle hinter das Lenkrad platzierte. Elvira sagte immer, er sei wie ein Baum, der Jahresringe ansetze. Nicht sehr schmeichelhaft, fand er.
Genauso wenig wie das besorgte „Geht's denn?“ dieses langhaarigen Schnösels neben ihm. Baron Eduard brummte irgendwas, das wie Anschnallen klang, was der Schnösel auch augenblicklich befolgte. Immerhin.
Sie rumpelten über die Zugbrücke. Mit schlafwandlerischer Sicherheit kurvte Baron Eduard um die Schlaglöcher der Breselbergstraße. Unterwegs vernahm er verwundert, dass die vier Bengel ausgiebig Emmas Bewirtung würdigten. Auch wenn sie die Schnittchen und Frikadellen als cooles Catering bezeichneten, und die leicht angekokelten Würstchen mit dieser traurigen Nachricht entschuldigten. Die Knittelsteiner Köchin hatte nämlich während des Abends erfahren, dass ihre Mittelmeerkreuzfahrt ins Wasser gefallen war. Und zwar wörtlich. Das Schiff, mit dem sie zu Wochenbeginn von Ancona aus starten wollte, war gesunken. Was waren dagegen schon ein paar verkohlte Würstchen?
Die Breselbergstraße mündete in die Ulmer Allee in Höhe der Schrebergärten. Im Vereinshaus der Rosenzüchter brannte noch Licht, und beim Kaufhaus Rausch war es Eduard, als winkten ihm die Schaufensterpuppen zu, so lebensecht hatte sie Fridolin Rausch dekoriert. Oder so übermüdet war Eduards Fantasie.
Kurz hinter dem Ulmer Tor stiegen Strothkötter und der langhaarige Ulli aus. Nicht ohne die nächste Geburtstagsparty anzukündigen.
„Donnerstag“, sagte Ulli. „Am achten.“
Baron Eduard nahm an, dass der 8. Juli gemeint war. Hauptsache nicht wieder in der Burg.
„Nee, bei mir“, beruhigte ihn der haarige Gitarrenspieler.
Der Volvo folgte dem Breselbergring um die halbe Innenstadt und bog am Augsburger Tor in die Breselner Landstraße ein. An der Schulstraße bat Freddie den Baron anzuhalten. Hier könne er Jan und ihn rauslassen und am günstigsten wenden. Außerdem bedankte sich Freddie so formvollendet für den Chauffeurdienst, dass Baron Eduard nachher Stein und Bein schwor, es bestehe doch noch Hoffnung bei der Jugend von heute.
„Mensch Freddie“, lästerte Jan, als sich die Volvorücklichter Richtung Augsburger Tor entfernten, „das klang ja wie 'ne Empfehlung als Schwiegersohn.“
Jan war gerade schnell genug, um Freddies Boxhieben zu entkommen. Er rannte lachend die Breselberger Landstraße stadtauswärts. Die Nummer 153 war nicht weit.
„Blödmann!“, und Schlimmeres knurrte Freddie, als er in die Schulstraße einbog. Von hier konnte er bereits die Eingangsstufen des Hauses sehen, in dem Familie Haustenbeck im dritten Stock zur Miete wohnte. Und den Schatten, der sich aus dem Türrahmen löste!
Freddie blieb augenblicklich stehen. Das Mondlicht reichte, um eine gebückte Gestalt zu erkennen, die offensichtlich Mühe hatte, die Stufen hinunter zu klettern. Als sie ohne Unfall die Gehwegplatten erreichte, meinte Freddie ein Kichern zu hören. Gleichzeitig schlang die Gestalt einen vermutlich hellbraunen Kamelhaarmantel um die klapprigen Glieder. Und das tennisballgroße Ding an ihrem Hinterkopf war so ein Haarknoten, den alte Leute Dutt nennen.
Das Gespenst hörte auf den Namen Elfriede Sievers. Eindeutig.
Freddie entspannte sich und schlenderte der tüdeligen Schachtel entgegen. Anscheinend hatte sie sich auf den Stufen eine Verschnaufpause gegönnt. Alte Leute können oft nicht schlafen und geistern durch die Nacht. Besonders bei Vollmond.
„Guten Abend, Oma Sievers“, sagte Freddie.
„Hachja“, kicherte Elfriede Sievers und wackelte an ihm vorbei.
Musste er Mitleid mit ihr haben? Freddie schüttelte den Kopf und trabte zum Hauseingang. Beinahe hätte er das kleine Ding zertreten, das dort im Schatten einer Stufe lag. Freddie hob es auf. Es hatte in etwa die Größe und die Form eines MP3-Players. Allerdings ohne Display. Auch eine Kopfhörerbuchse konnte Freddie nirgends entdecken. Dafür ein paar Knöpfe. Freddie drückte auf den größten.
Er konnte später nicht mehr sagen, ob er das feine Klicken tatsächlich gehört, oder sich nur eingebildet hatte. Gleichzeitig sah er, dass Oma Sievers unter einer Laterne stehen geblieben war. Mit beiden Händen kramte sie in ihren Manteltaschen und blickte sich unruhig um. Freddie war mit wenigen Schritten bei ihr.
„Suchen Sie das hier?“ Er hielt ihr das längliche Ding hin.
Hastig griff Elfriede zu. Etwas zu hastig, fand Freddie.
„Ja, ja“, murmelte die Alte. „Da ist er ja, mein … ähm …“
Freddie hatte den Eindruck, als wäre Elfriede in Gedanken ganz weit weg. „MP3-Player“, half er der mondsüchtigen Oma.
„Ja, ja“, kicherte es wieder unter dem Dutt. Der MP3-Player, oder was es war, verschwand in einer Tasche des Kamelhaarmantels, ohne den man sich in ganz Bresel die Oma gar nicht vorstellen konnte.
„Hachja.“ Drehte sich um und wackelte um die Straßenecke.
Freddie blieb einen Moment still stehen. Er spürte noch die Kühle des Metalls an den Fingern. So war er sich sicher, dass er keinem Spuk begegnet war. Seit ihr Oskar vor zwei Jahren verstarb, wurde Elfriede Sievers immer wunderlicher. Kein Wunder, eigentlich.
Jetzt aber zügig. Freddie hatte versprechen müssen, um Mitternacht im Bett zu liegen. Mittlerweile war es fast halb eins.
Die Haustür war wie üblich unverschlossen. Freddie betrat das Treppenhaus. Direkt gegenüber befand sich die Wohnung der Vermieterin. Frau Traudl Regenbrecht. Vor ein paar Tagen erst hatte sie eine neue Tür einbauen lassen. Dick wie für einen Banktresor und potthässlich, fand Freddie. Aber einbruchsicher, wie Frau Regenbrecht jedem im Haus mit erhobenem Zeigefinger erzählte, auf dass sich auch wirklich jeder angesprochen fühlte.
Und mit einem Löwenkopf als Türgriff. Das würde SIE wahlweise abschrecken oder besänftigen, je nach dem, ob Traudl Regenbrecht gerade ihre mutigen oder ängstlichen fünf Minuten hatte. Im Haus war es gut bekannt, dass sich Frau Regenbrecht vor IHNEN fürchtete. Wer auch immer das sein mochte. Fünfundachtzig war sie geworden, wenn man ihr glauben konnte. Letzte Woche. Wackelig auf den Beinen und – keine Frage – auch im Hirn.
Freddie blieb stehen. Was für ein geschmackloser Griff. Freddie strich mit dem Zeigefinger über das Löwenmaul. Vorsichtig umfasste er ihn mit der Hand. Er ließ sich spielend leicht drehen. Die Tür öffnete sich fast von selbst.
Kaum war der zwölfte Glockenschlag von Sankt Urban verklungen, hatte Traudl Regenbrecht dieses feine Klicken gehört. Ächzend hatte sie sich um den Wohnzimmertisch geschoben. Die neue Tür war abgeschlossen. Ganz sicher. Doppelt! So klar war sie schon noch im Kopf. Da konnte zweifeln, wer wollte.
Aber da! Waren das nicht Schritte? Draußen im Treppenhaus! Nein, keine Schritte, wie Menschen sie machten. Mehr ein Schlurfen, ein Ziehen. Traudl schlug das Herz bis zum Hals. Langsam bewegte sie sich rückwärts. Ins Schlafzimmer.
Es war also so weit!
Traudl schloss die Schlafzimmertür und drehte auch hier den Schlüssel zweimal herum. Dann kroch sie, vollständig bekleidet wie sie war, ins Bett und zog die Decke über den Kopf. Drunter war es heiß und stickig. In diesen Sommernächten kühlte es erst in den Morgenstunden ab. Traudl lüftete die Decke, bis sie durch den Schlitz die Zimmertür sah. Und den Lichtstreifen in Fußbodenhöhe!
Jemand befand sich im Wohnzimmer. Deutlich hörte Traudl einen Stuhl rücken. Und – Traudl kroch das Grauen den Rücken hinauf – SIE sangen! Leise, aber in der Stille der Nacht klar und deutlich zu vernehmen. Mit zittriger Gespensterstimme.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne …
Das Lied, das die Soldaten immer gesungen hatten. Damals. 1943. Als ihr Wilhelm mit ihr in dieses Haus zog …
Traudl biss in die Bettdecke, um nicht zu schreien. Gleich! Gleich kamen SIE auch zu ihr. Da half auch keine Bettdecke.
Aber SIE kamen nicht. SIE gingen wieder. Löschten das Licht. Zogen die Tür zu. Und wieder dieses Klicken, wenn Traudl sich das nicht einbildete. Traudl war nass geschwitzt. Sie rührte sich nicht vom Fleck. Was, wenn sie aufstand und SIE kamen zurück! Traudl lauschte dem Ticken der Wanduhr.
Zehn Minuten.
War da schon wieder ein Klicken gewesen?
Zwanzig Minuten.
Nein. Alles still.
Allmählich entspannten sich ihre Glieder. Sie würde das Bett neu beziehen müssen, es war klatschnass. Vorsichtig hob sie die Bettdecke. Ein Blick zur Wanduhr – kurz vor halb eins.
0 Uhr 28.
Freddie zog die Tür etwas weiter auf. Wie unvorsichtig von Frau Regenbrecht. Jetzt hatte sie schon eine neue Tür, und dann war sie nicht mal abgeschlossen. Freddie warf einen Blick in den Flur dahinter. Bis ins Wohnzimmer konnte er sehen. Fast hätte er geschrien.
Regungslos saß sie da. Ohne Licht. Ein dunkler Schatten gegen das fahle Mondlicht. Jeden Augenblick erwartete Freddie das wohlbekannte Zetern. Aber sie rührte sich nicht. Saß einfach nur da und starrte ihn an. Freddie nahm seinen ganzen Mut zusammen.
„Frau Regenbrecht? Ihre Tür war …“
Keine Reaktion.
Etwas lauter: „Frau Regenbrecht! Ihre Tür …“
Der Schatten bewegte sich keinen Millimeter. Wie Eis durchfuhr Freddie der Gedanke: Vielleicht ist sie ja … um Himmels willen! Freddie tastete nach einem Lichtschalter. Er fand keinen. Mit drei Schritten war der Flur durchquert. Ah, hier. Das Licht blendete ihn für Sekunden. Dann verließ Freddies Kehle eine Art Gurgeln. Hinter dem Wohnzimmertisch saß nicht Frau Regenbrecht. Da saß – eine Pappfigur! Eine Pappfigur mit einem Foto als Gesicht. Und quer über der Brust ein Name.
Löwenstein
In diesem Augenblick bekam Freddie einen Schlag auf den Hinterkopf. Nicht sehr stark, aber für eine Beule würde es reichen. Freddie fuhr herum. Frau Regenbrecht stand da, leibhaftig, mit einem Wanderstock in der Hand, und holte erneut aus. Freddie duckte sich, der Schlag sauste über seinen Kopf hinweg. Mit wirren verschwitzten Haaren und weit aufgerissenen Augen starrte die Alte an ihm vorbei.
„Verschwindet!“, schrie sie. Meinte sie tatsächlich die Pappfigur? „Verschwindet!“
Freddie reagierte blitzschnell, als sie zusammensackte. Er konnte die schwere bewusstlose Frau nicht halten, aber immerhin verhindern, dass ihr Kopf auf den Boden schlug. Jetzt erst bekam Freddie Panik. Frau Regenbrechts Augen waren so verdreht. Und Freddie wurde das Gefühl nicht los, dass die Pappfigur alles scharf beobachtete.
Freddie angelte ein Kissen von einem Stuhl und legte Frau Regenbrechts Kopf darauf. Und rannte. Nahm drei Stufen auf einmal bis in den dritten Stock und schellte Sturm.
Kommissar van der Velde gähnte und rieb sich mit dem rechten Handrücken die Augen. Die linke Hand umfasste das Lenkrad. Als er die schlafverklebten Augen wieder öffnete, stieg er mit aller Kraft auf die Bremse. Die Reifen des Polizeiautos quietschten, ein Pfleger sprang zur Seite. Wenige Zentimeter hinter dem Krankenwagen kam van der Velde zum Stehen.
Hör auf zu meckern, dachte der Kommissar und würdigte den Pfleger keines weiteren Blickes. Wehe, wenn es hier nichts Wichtiges gab, für das man ihn aus dem Bett geholt hatte! Mitten in der Nacht. Van der Velde dachte an Hinrich, seinen Assistenten. Hinrich schnarchte vermutlich glücklich in seine Kissen. Van der Velde nahm sich vor, dem Rettungsdienst eine andere Telefonnummer zuzustecken. Die von einem gewissen schnarchenden Assistenten …
Als er die Wohnung von Frau Regenbrecht betrat, schleppten gerade zwei Sanitäter die Frau auf einer Trage nach draußen. Der begleitende Arzt teilte ihm mit, dass Frau Regenbrecht die restliche Nacht lieber im Vincenzkrankenhaus verbringen solle. Sie stehe offensichtlich unter Schock und brauche fachkundige Betreuung.
Franz van der Velde nickte müde, unterdrückte ein Gähnen und wandte sich an Gerlinde Haustenbeck. Freddies Mutter hatte sich in einen Sessel fallen lassen und betrachtete fassungslos die Pappfigur, die immer noch hinter dem Wohnzimmertisch saß. Freddie stand mit dunkel geränderten Augen neben ihr.
„Was …“, setzte Gerlinde Haustenbeck an. „Was soll das?“
Van der Velde zuckte mit den Schultern. „Wenn wir das bloß wüssten“, brummte er schließlich und ergänzte: „Bereits der dritte Fall dieser Sorte.“
„Der dritte?“
Kommissar van der Velde nickte wieder und umrundete langsam den Tisch. Er beugte sich zu der Pappe hinab, um besser lesen zu können.
„Löwenstein“, murmelte er. „Im März war es Bublanski, im November … ist mir grad entfallen. Und nun Löwenstein.“
„Wer … ist Löwenstein?“ Frau Haustenbeck sah ihn entsetzt an.
Kommissar van der Velde gab keine Antwort. Stattdessen gähnte er wieder und legte seine rechte Hand schwer auf Freddies Schulter. „Nun zu dir.“
Freddie schluckte. Auf einmal kam er sich wieder richtig klein vor. Die nächste Frage brauchte der Kommissar gar nicht zu stellen.
„Die Tür war offen“, flüsterte Freddie und wünschte, der Kommissar nähme seine Hand wieder fort.
„Offen?“
„N-nein“, stotterte Freddie, „ich hab halt so probiert, und dann …“
„Und dann?“
„War sie offen.“
„Und du bist rein.“
Freddie nickte. Als er merkte, dass van der Velde ihn weiterhin erwartungsvoll anschaute, ergänzte er. „Weil sie doch da so saß. So wie … tot.“
„Freddie …“, murmelte Gerlinde Haustenbeck.
„Und da hab ich Licht gemacht und …“
„Da war sie das gar nicht.“
Freddie schüttelte den Kopf. „Da hat sie mir den Stock auf den Kopf gehauen.“
„Ach, nee“, grinste van der Velde. „Aber sonst hast du hier nichts angefasst?“
Freddie verneinte wieder, und seine Mutter beeilte sich zu sagen: „Nein, nichts, Herr Kommissar.“
„Gut“, sagte van der Velde und kämpfte mit dem nächsten Gähnen. Und verlor. „Das werden wir ja anhand der Fingerabdrücke feststellen. Danke soweit.“
Er machte eine Handbewegung zur Tür. Frau Haustenbeck und Freddie folgten ihm aus der Wohnung. Draußen schloss van der Velde sorgfältig ab und klebte ein amtliches Siegel auf die Ritze zwischen Rahmen und Tür.
„Morgen früh kommt die Spurensicherung“, erklärte er, und dass er eventuell noch einige Fragen an Freddie habe. „Aber jetzt“, van der Velde schüttelte sich, „Gute Nacht.“
„Gute Nacht“, wünschte auch Gerlinde Haustenbeck und schob Freddie die Treppe hinauf.
„Hab ich nicht gesagt, du sollst spätestens um zwölf zuhause sein?“, hörte van der Velde noch, als er das Haus verließ. Er stieg in sein Auto.
„Kraans“, murmelte er, als ihm der Name wieder einfiel. Vergangenes Jahr, am neunten November, stand auf der ersten Pappfigur der Name Kraans. Dann im März beim zweiten Einbruch dieser seltsamen Sorte Bublanski. Und jetzt Löwenstein. Und bei keinem dieser nächtlichen Besuche war etwas gestohlen worden. Nicht ein Staubkorn. Und noch viel merkwürdiger war, dass es eigentlich gar keine Einbrüche waren. Zumindest waren weder ein Fenster, noch eine Tür aufgebrochen worden. Neu war jetzt nur, dass die Wohnungstür unabgeschlossen war. Jedenfalls nach dem, was Freddie Haustenbeck behauptete. Bei den beiden vorherigen war auch die fest verschlossen gewesen.
Van der Velde riss seine Kiefern weit auseinander. Elfriede Sievers, die gerade wie ein Geist vorbei wackelte, schüttelte missbilligend den Kopf. Van der Velde zog eine Grimasse und startete den Motor.
Beichte
Sonntag, 27. Juni.
Die Leute von der Spurensicherung fluchten, wie nicht anders zu erwarten war. Van der Velde tat kräftig mit. Was Besseres fiel ihm auch nicht ein, um sich am Sonntagmorgen bei Laune zu halten. Sie hatten sich um neun in der Regenbrechtschen Wohnung getroffen. Hinrich kam zehn Minuten zu spät und war zu allem Überfluss ausgeschlafen und glänzend aufgelegt, was ihm der Kommissar wochenlang nicht verzeihen würde, das nahm er sich fest vor.
Erst recht nicht, als Hinrich gegen elf verkündete, dass die Sanitäter Frau Regenbrecht in ihre Wohnung zurückbrächten. Jetzt gleich. Und noch ehe van der Velde das wutentbrannt verhindern konnte, standen sie auch schon in der Tür.
Die alte Dame war anscheinend mit allen Mittelchen der ärztlichen Kunst aufgepäppelt worden und stürzte wie eine Furie in ihre Wohnung. Zum Glück hatten die Experten von der Spurensicherung ihre Arbeit bereits abgeschlossen. In letzter Sekunde konnten sie ihre Instrumente zur Seite schaffen. Dann machte sich Frau Regenbrecht über ihre Schränke her.
Sämtliche Schubladen wurden herausgezogen und unzählige Deckelchen geöffnet. Exakt um 11 Uhr 14, wie Kommissar van der Velde mit einem schnellen Blick zur Armbanduhr festhielt, verkündete Traudl Regenbrecht das Verschwinden einer Kette. Dreiundfünfzig wertvolle Amethyst-Perlen.
„Ganz bestimmt!“, ergänzte sie, als sie den Blick des Kommissars bemerkte. Die Kette habe ihr Frau Blume geschenkt. Vor Jahren. Also Mia Blume, nicht Änne Blume, wenn der Herr Kommissar verstehen würde. Der Herr Kommissar verstand nur Bahnhof, notierte aber pflichtschuldig Mia Blume. Aber dass die Kette sehr wertvoll sei und obendrein verschwunden, das könne sie mit Sicherheit sagen. Und dass der Kerl genau neben dieser Schublade gestanden habe.
Neben welcher Schublade genau?
Na, wo die drin war, die Kette.
Und … der Kommissar war so baff, dass er kaum zu fragen in der Lage war … welchen Kerl meine sie denn bitte? Doch nicht …
„Doch, doch!“ Frau Regenbrecht nickte eifrig, und im Verlauf des folgenden Wortschwalls lernte Franz van der Velde so einiges über die Jugend von heute. Und dass das damals nun wirklich anders gewesen sei.
„Damals?“, hakte van der Velde nach.
Irritiert hielt Frau Regenbrecht inne und sah van der Velde in die Augen. Plötzlich wurde ihr Blick starr.
„Oder ob SIE es waren?“ Und bevor der Kommissar irgendetwas antworten konnte, kreischte sie: „Was stand auf der Pappe?“
Frau Regenbrecht packte den Leiter der Spurensicherung, der sich auf eben jenen Stuhl gesetzt hatte, wo kurz vorher noch der Pappkamerad gesessen hatte. Frau Regenbrecht schüttelte ihn. Die Jungs im Krankenhaus hatten sie vielleicht ein wenig zu sehr aufgepäppelt, fand van der Velde. Genauso unvermittelt, wie Traudl den panisch nach Hilfe Ausschau haltenden Mann gepackt hatte, ließ sie ihn auch wieder los und sackte wie ein Sack Mehl auf den Stuhl, den ihr van der Velde in letzter Sekunde unter den Hintern schob.
„Was stand da drauf?“, flüsterte sie.
Van der Velde legte seine Hand auf ihre Schulter, eine Angewohnheit, die er für beruhigend hielt. Traudl Regenbrecht war blass wie eines ihrer Bettlaken. Und zitterte.
„Stand da Löwenstein?“
Der Kommissar antwortete nicht. Traudl Regenbrecht schrie, lange und schrill.
Zehn Minuten später hielt der Krankenwagen wieder vor der Haustür und brachte Frau Regenbrecht zu einer zweiten Nacht ins Vincenzkrankenhaus. Van der Velde schickte die Kriminaltechniker nach Hause und beauftragte Hinrich, alles über eine Person oder Familie namens Löwenstein herauszufinden.
„Ja, alles. Und bevor du nachfragst: Ja, bis morgen!“
Hinrich holte noch einmal tief Luft, aber da war der Kommissar schon unterwegs. Hinrich warf noch einen Blick in die Wohnung. Die Pappfigur hatte die Spurensicherung mitgenommen. In Hinrichs Fantasie aber saß sie noch immer hinter dem Wohnzimmertisch. Wie ein böses Omen, eine dunkle Anklage.
Hinrich zog die Tür zu. Diese hässliche Sicherheitstür, von der Frau Regenbrecht steif und fest behauptete, sie habe sie abgeschlossen. Selbstverständlich! Zweimal! Sein Blick streifte den Türgriff. Einen Löwenkopf. Der sollte IHNEN Angst einjagen, hatte Frau Regenbrecht gewispert. IHNEN?, hatte Hinrich gefragt. Und sie hatte nur stumm genickt.
Hinrich verließ das Haus.
Löwenstein.
Er ging die Schulstraße entlang. Bis zu Favretti, der besten Eisdiele weit und breit, waren es nur ein paar Schritte. Dort hatte er sein Fahrrad geparkt. Auf halbem Weg kamen ihm zwei merkwürdige Gestalten entgegen. Der eine mindestens einsneunzig und ein Bär von einem Kerl. Er nahm fast die komplette Bürgersteigbreite ein. Daneben versuchte ein kleines schmächtiges Männlein mit ihm Schritt zu halten.
„So warte doch“, hörte Hinrich ihn flehen, aber der Bär kümmerte sich nicht um das mückenbeindürre Anhängsel. Wäre es umgekehrt gewesen, also der Große dünn und der Kleine dick und rund, hätte Hinrich möglicherweise genauer hingesehen. Hätte sie vielleicht sogar erkannt. So aber wich der Kriminalassistent in den Rinnstein aus und ließ das abenteuerliche Gespann vorbeitrudeln.
Als Hinrich sein Fahrrad aufschloss, war er in Gedanken längst wieder bei dem Job, den ihm der Kommissar aufgebrummt hatte.
Löwenstein.
„Nicht so schnell“, bettelte Carlo und versuchte Ede am Hemdzipfel festzuhalten.
„Halt den Mund“, knurrte der Bär und wischte ärgerlich Carlos Hand beiseite. „Wir sind gleich da.“
Dem kleinen Dünnen mit dem viel zu großen Kopf, der gefährlich kippelig auf dem dürren Hals balancierte, lief der Schweiß in Strömen herab.
„Hätten wir nicht woanders anfangen können?“, maulte er.
„Zum Beispiel?“ Der Große drehte sich nicht mal nach ihm um.
„In … in …“
„Ja?“
„Egal.“ Der Kleine stolperte, fing sich wieder. „In Paderborn.“
„Auch nicht besser“, raunzte der Große. „Jetzt reiß dich mal zusammen. Da vorne ist es schon.“
Sie stiefelten quer über den Marktplatz auf Sankt Urban zu. Ritter Kunibald auf seinem eisernen Zossen blickte streng vom Brunnen auf Carlo herab, dass ihm heiß und kalt wurde. Gleichzeitig. Dann die Stufen zum Portal des Doms hinauf (Ede immer drei auf einmal, Carlo zwei Schritte pro Stufe) und rein in die dunkle Kirche. Ein neues Leben anfangen, nächster Versuch. Diesmal begonnen mit einer Beichte am Ort ihrer größten Missetat: Dem bis heute unaufgeklärten Überfall auf die Breselner Sparkasse vor zwei Jahren. Als Ede noch lang und klapperdürr gewesen war, und Carlo eine Kugel auf zwei Beinen. Heute bekam Ede seine ausladenden Formen kaum in eine Sitzreihe gezwängt, während für Carlo das Fußbänkchen gereicht hätte.
Sie mussten sich noch gedulden. Gerade verabschiedete Pastor Himmelmeyer einen hutzeligen Alten mit Triefnase und bat eine der beiden älteren Damen in den Beichtstuhl, die noch vor Ede dran waren. Die Dame kicherte, wickelte sich noch fester in ihren Kamelhaarmantel, rückte den grauen Dutt zurecht und schickte der anderen Dame einen triumphierenden Blick in die Bankreihe.
Erster!
Die andere, deutlich korpulentere Dame mit lila Locken (die Ede unglaublich und Carlo hinreißend fand) sah eisern an dem Kamelhaarmantel vorbei zum Altarkreuz. Sie hatte es ja wohl nicht nötig, auf so etwas zu reagieren.
Pastor Himmelmeyer nahm im Beichtstuhl auf der einen Seite eines Holzgitters Platz, Elfriede auf der anderen.
„Nun, Frau Sievers“, begann er in behäbigem Pastorenton, „die Beichte ist dazu da, alles was das Herz beschwert loszuwerden. Also meine Liebe, wo drückt der Schuh?“
„Hachja.“ Elfriede drückte ihre Kopfzierde in Form. „Nun ja.“
„Bitte, meine Liebe.“ Pastor Himmelmeyers Ton wurde noch eine Spur väterlicher. „Wir haben nicht ewig Zeit. Dort warten noch andere mit ihren Sorgen.“
„Ja“, sagte Elfriede, „das ist es ja gerade. Ich habe mich vorgedrängelt. Eigentlich wäre die Emma dran. Die kennen Sie sicher. Die Köchin von Burg Knittelstein. Aber, tja, also, ich habe die Abkürzung durch die achte Bankreihe genommen, da wo's ein bisschen breiter ist, nicht wahr, und schwupps!“
„Und schwupps?“
„War ich Erster.“
„Tja“, machte Pastor Himmelmeyer.
„Wissen Sie, weil ich noch einkaufen muss und der Dalli-Markt am Sonntag nur eine einzige Stunde geöffnet hat. Sehen Sie, seit ihr Mann, der Karl, den Kletterunfall hatte, und was müssen diese Kerls auch immer versuchen, an der Teufelsnase vorbei durch die Westwand, wissen Sie wie gefährlich das ist? Also mein Oskar selig sagte immer, wenn schon den Breselberg rauf, dann durch den Wald. Aber der Archibald, also der auch im Alpenverein ist, wie der Karl, also die ließen sich ja nicht reinreden, ließen die sich nicht, da musste der Karl erst abstürzen und sich ein Bein brechen. Na, und jetzt? Die arme Frau Dall schafft das ja nicht mehr. In ihrem Alter. Den ganzen Laden alleine schmeißen, wissen Sie, und das macht oft einsam, und wer kann das besser verstehen, als ich, wo ich doch auch oft so bin. So einsam. Hachja.“
„Ja“, sagte Pastor Himmelmeyer so verständnisvoll er konnte.
Emma saß in der Bank und rutschte, so unauffällig es ihr möglich war, zur äußersten Kante. Da konnte sie Elfriedes Beichte am besten verfolgen. Außerdem vergrößerte sich so der Abstand zu dem gewaltigen Kerl mit seinem spiddeligen Freund. Die zudem gar nicht so besonders gut rochen. Mehr so wie abgestandene Milch, dachte Emma, die Köchin.
„… wo ich doch auch oft so bin. So einsam. Hachja“, drang aus dem Beichtstuhl
Nun, dachte Emma, in deinem Alter, du klapprige Schachtel, sollte man auch nicht so allein wohnen. Was schnabbelte Elfriede da noch?
„… der Kommissar in seinem Wagen, so ein attraktiver Kerl, wissen Sie?“
„Nicht so laut“, flüsterte Pastor Himmelmeyer.
Elfriede nickte und wisperte: „Ach, Herr Pastor, und da wurde mir plötzlich so anders.“
„Mmh“.
„So wie in jungen Jahren, wenn Sie verstehen.“
Pastor Himmelmeyer räusperte sich umständlich.
„Aber weiter war nichts“, zwitscherte Elfriede, „ehrlich. Und der Herr Kommissar musste ja auch seiner Arbeit nachgehen. Mitten in der Nacht. Gestern, in einem dieser Häuser.“
„In einem welcher Häuser?“, fragte der Pastor, offensichtlich froh, das Thema wechseln zu können.
Elfriede schaute ihn mit großen Augen an. „Aber Herr Pastor, das wissen Sie nicht? Gerade Sie? Von diesen Häusern, die sie gestohlen haben. Damals im Krieg.“
„Jaja, natürlich, ich weiß“, ging Pastor Himmelmeyer hastig dazwischen.
„Und ich weiß, dass Sie das wissen“, beharrte Elfriede schlitzohrig. „Sie wohnen ja selbst in so einem …“ Das mühsame Keuchen des betagten Priesters ließ Elfriede abbrechen.
„Ich hab mein Leben lang dafür gebüßt“, presste Himmelmeyer hervor. „Deshalb bin ich Priester geworden.“
Elfriede schwieg und beobachtete aus den Augenwinkeln, wie Pastor Himmelmeyer sich den Schweiß von der Stirn wischte. Jetzt hatte sie ihn genau da, wo sie ihn haben wollte.
„Finden Sie es nicht sogar richtig, was dieser Einbrecher tut?“
Das ganze Gerede zuvor war nur der Anlauf gewesen. Trotzdem war Elfriede von der Heftigkeit überrascht, mit der es aus Pastor Himmelmeyer herausbrach.
„Sie meinen diese Pappfiguren? Diese schrecklichen …“
„War er auch schon bei Ihnen? Im Haus, das Rabbi Dillinger gehörte?“
Jetzt zitterte Pastor Himmelmeyer so stark, dass Elfriede es durch das Holzgitter sehen konnte. Ich muss jetzt aufhören, dachte sie. Ich bin schon zu weit gegangen.
„Gestern“, stöhnte Pastor Himmelmeyer, „gestern hab ich eine neue Tür einbauen lassen. Eine Hochsicherheitstür.“
Weiß ich doch, dachte Elfriede und erhob sich.
„Aber was will dieser Einbrecher? Was um Himmels willen …“
„Auf Wiedersehen“, flüsterte Elfriede, als sie den Beichtstuhl verließ. „Haben Sie eigentlich die neue Tür auch abgeschlossen?“, hörte Pastor Himmelmeyer noch.
Oder glaubte, es zu hören.
Emma blickte immer noch starr geradeaus auf das Altarkreuz. Elfriede kam ganz dicht an sie heran.
„Haben Sie gelauscht?“
„Ich?“ Emma fasste sich erschrocken an den Blusenkragen.
„Ich rede nicht mit der Mücke in Ihrem Ohr.“
Unwillkürlich griff sich Emma ans Ohr. „Neinnein“, beeilte sie sich zu sagen, „so was würde ich niemals …“
„Sie sind jetzt dran!“, unterbrach sie Elfriede. Ihr Blick glitt über die zwei seltsamen Vögel in der Bank. „Passen Sie auf, sonst drängeln die vor.“
Elfriede schlurfte durch das riesige Kirchenschiff davon.
Pastor Himmelmeyer war nicht recht bei der Sache. Was wollten die beiden? Der dicke Riese und der Hänfling, der sich neben ihm in den Beichtstuhl quetschte. Ein neues Leben anfangen, soviel hatte Pastor Himmelmeyer verstanden. Sollten sie doch. Und dass sie eine Bank geraubt hatten, war ja nicht gar so schlimm.
Pastor Himmelmeyer zupfte seine Soutane zurecht. Er musste schnellstens nach Hause. Diese Alte hatte ihm einen Stachel ins Fleisch gebohrt. Je länger er darüber nachdachte, um so sicherer war er, dass er die neue Tür nicht abgeschlossen hatte. Überhaupt, was nützte so eine Stahlplatte ohne ein stabiles Schloss. Ja, der Boss dieser Firma, Julius Porter, hatte ihm sein Leid geklagt. Dass man heutzutage keine zuverlässigen Leute mehr findet. Deshalb könne das neue Spezialschloss erst nächsten Montag oder möglicherweise erst Dienstag und so weiter.
„Ausgeraubt“, korrigierte der Kleine.
Pastor Himmelmeyer sah ihm irritiert auf die Glatze. „Woraus denn?“
„Jetzt hören Sie mal zu“, knurrte der Koloss.
Aber Pastor Himmelmeyer wollte nicht mehr zuhören. „Meine Herren“, sagte er kurzatmig, „ich schreibe Ihnen hier …“, schon hatte er einen Zettel und einen Stift in der Hand, „… die Telefonnummer einer Firma auf. Dort werden Leute gesucht. Sie sind doch zuverlässig?“
Der Pinocchio wackelte mit dem dicken Kopf.
„Ja, natürlich!“, schimpfte der Dicke.
„Hier.“ Pastor Himmelmeyer schob den Zettel durch das Holzgitter. „Und jetzt … äh … starten Sie in Ihr neues Leben. Viel Glück.“
Sekunden später sahen Ede und Carlo den nervösen Priester aus der Kirche eilen. Ede strich den Zettel glatt.
„SICHERistSICHER“, las er. „Türen aller Art. Inhaber Julius Porter.“
„Sicher ist sicher“, wiederholte Carlo und lauschte dem Echo seiner Stimme bis hinauf ins barocke Deckengewölbe. Bis zu den unzähligen Pfeifen der Breselner Domorgel. Den kleinen silbernen und den viele Meter hohen Holzschächten. Für Orgeltöne, so tief, dass man sie kaum hören konnte, nur als Flattern im Magen spürte.
Basspfeife
Montag, 28. Juni,
Breselner Volksblatt.
Unheimliche Einbruchserie fortgesetzt
In der Nacht zum Sonntag drangen Unbekannte in die Wohnung von Frau R. in der Schulstraße. Frau R. hatte verdächtige Geräusche gehört und sich daraufhin im Schlafzimmer eingeschlossen. Der oder die Einbrecher hinterließen wie bei zwei vorherigen Straftaten (im November und März, wir berichteten) im Wohnzimmer eine Pappfigur mit einem aufgeklebten Fotogesicht. Kommissar van der Velde, der am Sonntagmorgen die kriminaltechnische Untersuchung leitete, fehlt jeglicher Hinweis auf die Täter und das Motiv. Sachdienliche Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen bitte an das Kommissariat, Breselner Landstraße 110.
Unter dem Artikel waren drei Schwarzweiß-Fotos abgedruckt. Sie zeigten eine Frau mit altmodischer Flechtfrisur und zwei junge Männer mit streng nach hinten gekämmten Haaren, wie es in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts üblich gewesen war.
Hannes Bastian Bächle trat auf das ganz linke Pedal, das für den tiefsten Ton der Breselner Domorgel zuständig war. Die riesige Basspfeife bullerte. Einige Sekunden lauschte Hannes Bastian Bächle den körperlich spürbaren Schwingungen. Dann griff er in die Manuale und baute in einem gewaltigen Crescendo einen himmelhochschreienden Klang auf. Der Kirchenchor von Sankt Urban fügte einen kreischenden Akkord hinzu. Fünffaches Fortissimo. Musik des 21. Jahrhunderts. Hannes Bastian Bächle war stolz auf seine Komposition.
Doch was war das? Gut, er hatte den Chormitgliedern So laut ihr könnt eingeschärft und ihnen zehn verschiedene Wörter aufgeschrieben, die sie in beliebiger Reihenfolge auf beliebigen Tonstufen singen sollten. Oder rufen. Aber Aufhören! und Gnade! gehörten nicht dazu. Definitiv. Und wer – um aller verbogenen Pedale willen – waren die beiden zotteligen Gestalten, die hinter der längsten Pfeife hervor krochen, sich die Ohren mit den Handballen zupressten, und mitten durch den Sopran stürzten?
Die Damen mit den hohen Stimmen schrien jetzt ebenfalls einige nicht abgesprochene Ausdrücke und schubsten den Dicken und den kurzen Spiddel die Treppe der Orgelempore hinunter. Sekunden später krachte die Eingangstür von Sankt Urban. Der Knall brach sich an den Säulen und Deckenstreben, verzog sich in die dunklen Seitenkapellen, und hinterließ eine atemlose Stille.
„Genau so“, sagte Hannes Bastian Bächle, „genauso leise muss es nach diesem Anfang werden. Und dann“, er zeigte auf Frau Reisich.
Ludmilla Reisich füllte die Lungen. Bald schwebte ihr glockenreiner Sopran durch die bunten Sonnenstrahlen, die wie Bänder von den Glasfenstern bis hinab zu den Grabplatten im Kirchenboden reichten.
„Was war denn das?“, bibberte Carlo.
„Musik“, knurrte Ede. „Davon verstehst du nichts.“
„Aber du!“, maulte Carlo, als sie am Kunibald-Brunnen vorbei stapften.
„Du wolltest ja unbedingt hinter dem Ding übernachten.“
„Ich konnte doch nicht ahnen …“
„