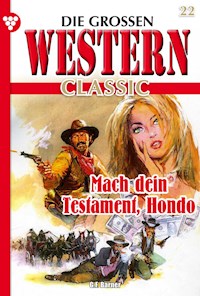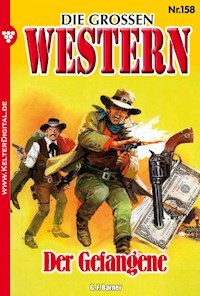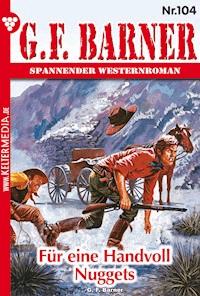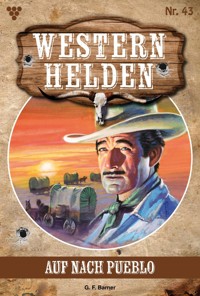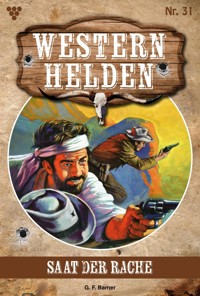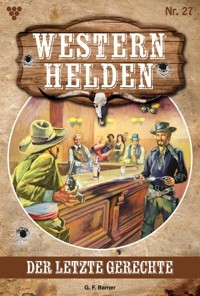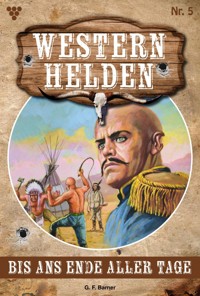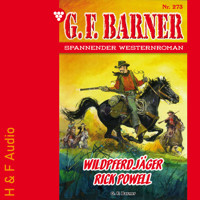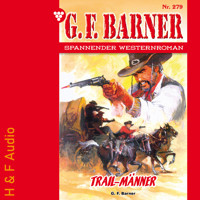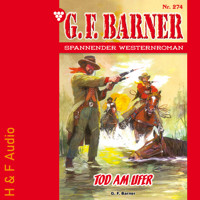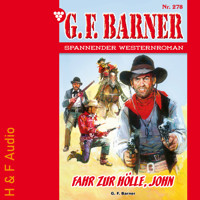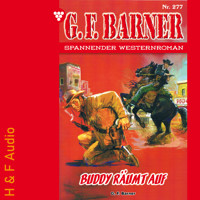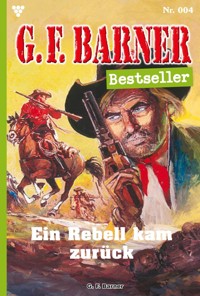Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Wer nach Yuma kommt, der hat jemanden ermordet. Niemand kommt hierher, der nicht durch Beweise überführt und von einem ordentlichen Gericht verurteilt worden ist. Dies ist Yuma, zu dieser Zeit ein Block, ein großes Viereck mit Adobelehmmauern außen herum. Aufgeteilt in vier Bezirke, die die Grundlinien eines im Kreuz geteilten Vierecks haben. Auf jeder Ecke der Mauer erhebt sich ein Turm aus Holz oder Ziegeln. Auf jedem Turm, es sind mit den beiden am Eingang genau sechs, stehen ständig zwei Wachen. Nach Vorschrift tragen die Wachmänner einen Revolver Smith und Wesson vom Kaliber 38, geladen mit fünf Patronen. Dazu besitzt jeder Wachmann ein Gewehr vom Typ Spencer. Das Gewehr wird bei Antritt der Wache entsichert. Im Block links des Eingangs liegen nur Einzelzellen, anderthalb Schritt breit und zwei Schritte lang. Auf dem Boden ist ein Holzgestell und auf diesem sind Latten. Darauf liegt eine Decke und auf der Decke ein Mensch. 37 Menschen oder 37 Mörder. Es ist vier Uhr, und der Mann in Nummer sechzehn hebt langsam den Kopf. Er kann den Posten auf dem linken Turm sehen und den dünnen Strich des Gewehres ausmachen, das der Posten über dem Rücken trägt. Vier Schritt im Quadrat kann der Posten auf seinem Turm machen, dabei kreuzt sich seine Bahn mit der seines Partners. Sechzehn Schritte zusammen, nach acht Schritten treffen sie sich. Der Mann in der Zelle auf der Pritsche sieht nun, wie sich die beiden Wächter treffen. Er beobachtet sie bereits seit einer Stunde und weiß, daß er doch nicht mehr schlafen kann. Der Wind steht von links vom Kochhaus herüber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 321 –…die im Staub sterben
G.F. Barner
Wer nach Yuma kommt, der hat jemanden ermordet. Niemand kommt hierher, der nicht durch Beweise überführt und von einem ordentlichen Gericht verurteilt worden ist.
Dies ist Yuma, zu dieser Zeit ein Block, ein großes Viereck mit Adobelehmmauern außen herum. Aufgeteilt in vier Bezirke, die die Grundlinien eines im Kreuz geteilten Vierecks haben.
Auf jeder Ecke der Mauer erhebt sich ein Turm aus Holz oder Ziegeln. Auf jedem Turm, es sind mit den beiden am Eingang genau sechs, stehen ständig zwei Wachen. Nach Vorschrift tragen die Wachmänner einen Revolver Smith und Wesson vom Kaliber 38, geladen mit fünf Patronen. Dazu besitzt jeder Wachmann ein Gewehr vom Typ Spencer. Das Gewehr wird bei Antritt der Wache entsichert.
Im Block links des Eingangs liegen nur Einzelzellen, anderthalb Schritt breit und zwei Schritte lang. Auf dem Boden ist ein Holzgestell und auf diesem sind Latten. Darauf liegt eine Decke und auf der Decke ein Mensch. 37 Menschen oder 37 Mörder.
Es ist vier Uhr, und der Mann in Nummer sechzehn hebt langsam den Kopf. Er kann den Posten auf dem linken Turm sehen und den dünnen Strich des Gewehres ausmachen, das der Posten über dem Rücken trägt. Vier Schritt im Quadrat kann der Posten auf seinem Turm machen, dabei kreuzt sich seine Bahn mit der seines Partners. Sechzehn Schritte zusammen, nach acht Schritten treffen sie sich.
Der Mann in der Zelle auf der Pritsche sieht nun, wie sich die beiden Wächter treffen. Er beobachtet sie bereits seit einer Stunde und weiß, daß er doch nicht mehr schlafen kann. Der Wind steht von links vom Kochhaus herüber. Man kann den dünnen und faden Geschmack der Morgenbrühe, die dort aufgewärmt wird, bereits am Geruch spüren, der zu ihm hinweht. Dazu wird es Maisbrot geben. Es gibt viermal in der Woche Tee in Yuma. In den Schluchten Arizonas wächst die amerikanische Minze in wilden Flächen, und die Indios sammeln sie gegen ein geringes Entgelt.
Der Mann liegt still und denkt an Kaffee, richtigen Kaffee. Es ist nun vier Monate und drei Tage her, daß er zuletzt richtigen Kaffee erhielt. Das war im Jail von Phoenix, und der Sheriff sagte dazu: »Trink, Steens. Du wirst vier Jahre und sechs Monate keinen Kaffee mehr bekommen, keinen, der so ist wie dieser hier. Was bist du für ein Narr, Mann, daß du bis zuletzt geleugnet hast. Du hättest dir zwei Jahre abhandeln können, weißt du das nicht? Gestehen und Reue zeigen, das beeindruckt jede Jury.«
Und es war wie eine Spur Mitleid in der Stimme des Sheriffs von Phoenix in Arizona, Mitleid mit Jeff Steens, dem Mörder.
Kaffee, denkt Steens, richtigen, duftenden Kaffee und keine Brühe.
Sie gehen da oben wieder und kreuzen die Bahn ihrer Schritte. Steens kann in der aufkommenden Helligkeit des beginnenden Tages deutlich John Warks viereckigen Kopf erkennen. Und er fragt sich in dieser Sekunde, ob er nicht, hätte er ein Gewehr oder einen Revolver, auf John Warks Kopf zielen würde.
Dann wendet ihm Wark auch schon den Rücken zu, und Jose Blando geht an ihm vorbei, verdeckt ihn. Jose hat elf Kinder und tut niemandem etwas, er ist das ganze Gegenteil von dem bulligen John Wark. Vielleicht bekommt Mrs. Blando bald wieder ein Baby, denkt Jeff Steens, es sah so aus, als ich sie neulich sehen konnte. Dann haben sie ein Dutzend, und Jose hat neulich am Fluß gesagt, daß er mit einem Dutzend genug hätte.
Es muß gleich läuten, denkt Steens, es kann nicht mehr lange dauern, dann werden sie bimmeln und uns hochscheuchen. Ob ich den Block heute teilen kann?
Nun denkt er an den Quaderblock, einem Ding von vielen Tonnen Gewicht. Sie sägen nun schon drei Tage an ihm, er und Phil Yonker. Die Steinsäge schnurrt einschläfernd, und die Hitze läßt sie schwitzen, aber der Block muß entzwei, er wird bei irgendeinem Haus in Yuma, Somerton oder Kofa sicher gut für den Träger des Portals sein. Und die Leute, die unter dem Portal durchgehen und die vielleicht eingemeißelte Jahreszahl lesen, die Leute werden keine Ahnung haben, daß zwei Sträflinge diesen Block in seine Form sägten – zwei aus Yuma.
Sie werden nicht wissen, daß zwei Männer bis an die Fußknöchel im roten Staub standen.
Die Glocke über dem Turm bimmelt, und Steens zieht die Beine an. Irgendwoher aus den Schatten der Wachbauten tauchen einige Männer auf. Die Glocke bimmelt noch immer, verstummt dann aber. Und links neben Steens sagt Phil Yonker, sagt es als Morgengruß von Yuma: »Verdammte…«
Und dann nach einer Pause etwas leiser: »Lebst du noch, Steens?«
Das ist absolut nicht lächerlich in Yuma. Es ist schon vorgekommen, daß die Glocke bimmelte und der in der Nachbarzelle sich nicht rührte. Dort lag er dann und sagte nichts mehr.
»Ja«, gibt Steens leise zurück und lauscht den Geräuschen des erwachenden Jails. »Was macht deine Hand, Phil?«
»Wasser müßte ich haben. Die Schwellung geht nicht zurück, Jeff. Was meinst du, bekommen wir heute Jose?«
»Am Nachmittag, schätze ich. Brand wird uns hinausbringen und Jose ihn am Mittag ablösen. Vielleicht läßt Jose dich zum Fluß hinunter oder besorgt dir Wasser. Jose hilft dir schon.«
Einen Augenblick ist es still, dann sagt Yonker mit einem Unterton, der seine mörderischen Gedanken verrät: »Und dann kommt Wark wieder her und wirft seine Zigarrenkippe neben mich. Und wenn ich sie auflesen will und er scheinbar wegsieht, dann…«
»Wer redet denn da?« fragt jemand von links und kommt dicht an den Zellen vorbei. »Yonker, warst du das?«
Phil Yonker gähnt und hustet dann heiser.
»Was ist? Ich schlafe doch noch, wie soll ich da reden können, Mr. Fraith?«
»Du lügst, Mensch, du hast gesprochen, es kam von hier. Ich laß mich hängen, wenn du es nicht warst.«
»Wärst ’ne schöne Leiche«, flüstert Yonker leise zwischen zwei Atemzügen und sagt dann laut: »Ich war’s aber nicht, Chief, wo werde ich reden, wenn’s doch verboten ist?«
»Ach, du Windhund, du redest doch dauernd, ich gewöhn es dir aber noch ab, kannst Gift drauf nehmen.«
»Dann wär ich wenigstens tot.«
»Mensch, halt deine Klappe.«
Und Fraith geht brummend weiter, bleibt am Gitter von Steens Verschlag stehen und sieht ihn kurz an. Der Chiefaufseher für den Block links betrachtet Steens jeden Tag mit irgendeiner Erwartung im Blick, so auch heute.
Fraith sieht Steens langsam hochkommen und starrt auf die dunkelbraune, von der Sonne verbrannte Haut von Steens, dessen helles Haar in seltsamem Kontrast zu der Farbe des Gesichtes steht. Steens ist groß, wiegt 180 Pfund und hatte einmal fast 200 Pfund Gewicht, ehe er nach Yuma kam.
Vielleicht war es Zufall, daß losbröckelndes Gestein gerade in dem Augenblick von der Wand kam, unter der die Sträflinge in der Sonne arbeiteten, als Fraith zwei Schritte vor Steens mit dem Rücken zur Wand dastand und seine Pfeife anbrannte. Und vielleicht würde Fraith ohne den Sprung von Steens, der ihn weiterschleuderte, heute ein toter Mann sein. Einige Steine auf dem Kopf bringen selbst den härtesten Schädel zum Zerbrechen.
»Hast du es dir überlegt, Steens?«
Fraith fragt knapp und kühl. Er ist ein beherrschter Mann, der selten wild wird und meist nicht mehr als seine Pflicht tut. Er hat eine ruhige Frau und zwei Kinder in Yuma, die ihm alles bedeuten.
Jetzt blickt er Steens mit leicht zusammengezogenen Brauen an und hat die linke Hand am Gitter.
»Ja«, sagt Steens heiser, mehr nicht.
»Also gut, dann sage ich nachher dem Schließer Bescheid, daß er dich losmacht, Steens.«
»Nein, Chief!«
»Was?«
Fraith zieht beide Brauen hoch und starrt Steens wie einen Irren an.
»Soll das heißen, daß du nicht in die Kammer willst, Steens? He, soll es das heißen?«
»Ich will keine Bevorzugung, Mr. Fraith. Meine Arbeit ist im Steinbruch und nicht in der Kammer, ich bin kräftig genug, es auszuhalten, so ist das.«
Der Chiefaufseher starrt Steens sekundenlang verwirrt an, dann zuckt er die Achseln und wendet sich ab, seine Hand rutscht vom Eisenstab.
»Steens, die Chance bekommst du nie wieder. Ich habe schon andere gesehen, die an den Steinen starben.«
»Ich bin nicht besser als die anderen, Mr. Fraith!«
Fraith wirft ihm einen müden Blick zu und geht weiter. Und er ist kaum außer Hörweite, als Phil Yonker zu Jeff Steens sagt: »Du verdammter Idiot, warum hast du es nicht angenommen? Mensch, ich wollte, ich wäre an deiner Stelle gewesen. Sagt dieser Narr, daß sein Platz an den Steinen ist, wo er doch in die Kammer kommen kann. Weißt du nicht, daß du dort dick und fett werden kannst? Die Wachen brauchen ab und zu mal eine neue Hose und neue Hemden, die versorgen sich doch mit unseren Klamotten, und wir bekommen nie neue Sachen, nur gebrauchtes Zeug. Steens, du bist verrückt!«
»Nicht nur verrückt«, meldet sich nun von rechts Mitch Halloway zischend. »Der hätte uns alle versorgen können, von der Kammer aus kann man hundert kleine Geschäftchen machen. He, du kompletter Idiot, ruft Fraith zurück!«
»Kümmere dich nicht um meine Dinge, Halloway, das ist ein Rat!«
Steens sagt es kühl und setzt sich wieder auf seine Pritsche. Er will nicht, daß nur einige wenige durch ihn Hilfe bekommen können, auch ist er nicht der Mann, der heimliche Geschäfte mit den Wachen treiben würde.
Vielleicht würden die meisten der anderen Sträflinge ihn um seine neue Position nicht nur beneiden, sondern anfangen, ihn zu hassen.
Jeff Steens will keine Vorzugsstellung, weil er andere Pläne hat. Die einzige Möglichkeit, aus dem Jail hier zu entkommen, ist die Flucht aus dem Steinbruch am Fluß nördlich von hier.
Aber jetzt stört der finstere Halloway schon wieder seine Gedanken.
»He, Steens, ich sage dir, du nimmst den Job an, wir brauchen ihn, Mann. Du nimmst ihn, sonst…«
»Sonst?« fragt Steens leise. »Soll das eine Drohung sein, Mitch? Du kannst die anderen Männer einschüchtern, aber mich nicht, merke dir das für die erste Zeit. Ich will nicht, das ist alles.«
Halloway stößt einen Fluch aus und schweigt danach wirklich. Nur Phil Yonker sagt mürrisch: »Jeff, so eine Chance hat man hier nur einmal, warum nimmst du sie nicht wahr? Stell dir vor, du brauchst dann keine Kette mehr, Mann.«
Unwillkürlich blickt Steens auf die Kette an seiner Fußschelle. Eine dicke Kette an einer runden Eisenschelle, die mit den Ketten anderer Sträflinge gekoppelt werden kann.
Er schiebt den rechten Fuß vor und stößt leicht an die Blechschüssel, die vorn am Gitter steht und in die das wenige Wasser zur Morgenwäsche von außen her bald eingegossen wird.
»Ich will nicht, Phil, es hat keinen Zweck so.«
»Was hat dann Zweck? Mann, du hast abgenommen, du wirst nie hier rauskommen.«
»Vielleicht nicht, wer weiß das schon.«
In den Zellen weiter links klappert es. Diese Zellen, die alle nach der einen Seite auf sind, liegen mit den Öffnungen nach Norden hin, so daß die Sonne nicht in sie hineinfallen kann. Außerdem ist das Dach so gebaut, daß es anderthalb Schritt weit in den freien Raum ragt.
Von links her nähern sich nun Schritte, und eine mürrische Stimme sagt schrill: »He, Ferrus, schieb schon die Schlüssel heran!«
Im nächsten Augenblick kann Steens den Mann sehen, der einen Handkarren vor sich her schiebt. Auf dem Karren steht ein Blechkübel, in dem Wasser ist. Und mit einem dosenartigen Behälter hebt der Kalfaktor jedesmal eine Füllung Wasser aus dem Kessel, um sie dann durch das Gitter in die Schüsseln zu gießen.
Er kommt zu Phil Yonker, der einen abwägenden Blick auf den Wächter wirft, der den Kalfaktor begleitet, und unterdrückt sagt: »Du, Loyd, gib mir zwei Töpfe voll. Wark hat auf meine Hand getreten, sieh dir das an, Mann. Zwei Töpfe, hörst du?«
Loyd, ein kleiner, dürrer Mann mit einem traurig herabhängenden Bart, füllt die erste Lage in Yonkers Schüssel, aber da meldet sich der Wachmann auch schon und sagt barsch: »Eine Füllung ist genug, ist Vorschrift, verstanden? Laß das sein, Loyd!«
Loyd zaudert, Yonker flucht leise zwischen den Zähnen, bekommt aber keinen zweiten Topf mehr und zieht sich etwas vom Gitter zurück, denn der Wachmann hebt drohend seine schwere Peitsche, die jeder Wächter trägt.
Sie sind nun bei Steens, der wortlos sein Wasser bekommt und sich zu waschen beginnt. Nebenan erklärt Phil Yonker wütend, wenn auch leise, daß alle Aufseher Schufte und verdammte Sklaventreiber seien.
»Hast du das gehört, Jeff?« fragt er nach einer Weile mißmutig. »Du bist der letzte Dreck für diese Burschen, von denen aus kannst du im Staub sterben, die fragen nicht danach, ob du arbeiten kannst. Laß mich hier heraus sein, dann kaufe ich mir sie einzeln. Und wenn ich in Yuma auf sie warten muß, aber ich kaufe sie mir.«
»Du wirst froh sein, wenn du lebendig herauskommst, Phil«, erwidert Steens träge. »Mach dir nichts vor, es hat schon Narren genug gegeben, die sich für die Behandlung hier bedanken wollten und wieder im Loch landeten, das weißt du doch. Wasch dich und nimm dein Handtuch mit, tauche es ins Wasser.«
»Wenn die Sonne da ist, dann verdunstet es doch in fünf Minuten«, antwortet Yonker bissig. »Ich sage dir, sie behandeln uns wie…«
»Wie Mörder, Phil!«
Einige Sekunden schweigt er, aber dann kommt Yonkers Stimme doch wieder auf.
»Was hättest du denn mit dem Kerl gemacht, der dir Hörner aufgesetzt hat, he? In der ersten Wut dann kenne ich mich selber nicht mehr. Und das nennen sie dann Mord!«
Es ist das erste Mal, daß Phil über seine Strafe spricht. Es ist hier ein ungeschriebenes und doch ständig eingehaltenes Gesetz, den anderen nie nach der Tat zu fragen, die ihn ins Jail brachte. Man erfährt die Strafe und den Grund, aber Einzelheiten gibt kaum einer von sich.
»Deine Frau?« fragt Steens heiser. »War sie es wert?«
»Natürlich nicht, keine Frau ist das wert. Aber der Kerl lachte mich noch aus. Da sah ich rot und schoß, obwohl er keine Waffe hatte, nur’n Messer. Vielleicht war’s auch meine Schuld, ich war drei Jahre kaum zu Hause.«
»Und was macht sie jetzt?«
Drüben plätschert Wasser, und Yonkers sagt: »Wie das brennt, verflucht, wie das brennt! Und damit soll man eine Säge halten können, was?
Was sie jetzt macht? Sie ist fein heraus, sage ich dir. Meinen Wagen und meine Pferde hat sie verkauft. War so eine billige Kneipe bei uns zu Hause, die hatte einen zu alten Besitzer. Der ist gestorben, nachdem sie ihm drei Monate die Wirtschaft geführt hat. Was meine Frau unter Wirtschaft führen verstanden haben mag, oha, ich kenne sie doch. Na, nun hat sie die Kneipe allein, hat sie gekauft und steht hinter dem Tresen. Klar doch, daß alle Kerle aus dem Nest bei der lustigen Witwe Zerstreuung suchen. Und ich sitze dafür noch anderthalb Jahre im Jail. Verdammte Hand, Hundesohn von Wark!«
Er flucht und plätschert heftiger. Das war es also, denkt Steens. Hätte ich Phil nicht zugetraut, aber die Wut ist schlimm, wenn man nicht Beherrschung genug besitzt und immer gleich in die Wolken geht.
Er wäscht sich und trocknet sich an dem Lappen ab, den sie Handtuch nennen und der alle acht Tage umgetauscht wird.
»Wenn du Glück hast, erlassen sie dir acht Monate, Phil.«
Drüben hört das Geplätscher auf, Yonker hält die Hand in die Blechschüssel und hebt den hageren Kopf.
»Ich und Glück? Kennst du Wark, Jeff?«
»Ja«, sagt Jeff Steens und schweigt dann, denn es gibt nichts mehr zu sagen. Er kennt Wark und weiß um den Haß, den Wark gegen Yonker in sich hat. Warum das so ist, weiß er auch. Yonker kann nie seinen Mund halten, es ist einer seiner Fehler. Und er hat Wark einmal einen verdammten, gelbgestreiften Stinktierbastard genannt. Seit dieser Minute liebt ihn Wark so sehr, daß er keine Gelegenheit vorübergeben läßt, um Yonker zu quälen.
Yonker ist nun still und schnauft nur laut. Er knetet seine Hand und beißt die Zähne zusammen.
Es ist Vorschrift, daß das Wasser aus den Blechschüsseln nach dem Gebrauch ausgegossen werden muß. Irgendwann einmal sollen ein paar Narren das Wasser gesammelt und zum Aufweichen der Mörtelfugen zwischen den Lehmziegeln benutzt haben. Seit dem Tag muß alles Wasser ausgegossen werden, und ein Wächter kontrolliert regelmäßig, ob es auch wirklich geschieht.
Von links wird nun der zweirädrige Karren herangeschoben, auf dem die Kübel mit dem Essen stehen. Einige Körbe, in denen Brot liegt, stehen neben den beiden Kübeln mit Kaffee und der ewigen dünnen Bohnensuppe, in der nur am Sonntag die kümmerlichen Reste von Fleisch mit einem Vergrößerungsglas zu finden sind.
Auf die Fettaugen dieser Suppe anspielend, die manchmal aus Maisbohnen oder auch Hirse mit Graupen besteht, hat das bittere Wort seinen Umlauf, daß mehr Augen in die Suppe als Augen aus der Suppe sehen.
Der Kalfaktor hält vor den Verschlägen an, nimmt jedesmal einen Becher, füllt ihn mit jenem Gerstenkaffee, der zu neunzig Prozent aus gebrannter Gerste besteht, läßt eine Kelle voll Suppe in den Napf und kommt dann an das Gitter.
»Was denn?« fragt Yonker grollend. »Da habt ihr ja schon wieder mit zehn Gallonen Wasser gepanscht, ihr haarigen Beutelratten! Das nennst du ’ne Suppe, Mann? Gleich schütte ich dir…«
»Yonker, wenn du nicht deinen Mund zu halten lernst, dann wird man ihn dir eines Tages noch zumauern. Halt die Klappe, Fünfzehn!«
Fünfzehn, das ist Yonkers Nummer. Und der da redet, das ist wieder Fraith.
Schweigend nimmt Yonker die Sachen, Fraith wirft einen Blick auf seine Hand und zieht die linke Augenbraue hoch.
»Ist dir ein Stein draufgefallen, Yonker?«
»Hähä«, sagt Yonker bissig. »Schöner Stein, das sage ich. Sah aus wie der Absatz von ’nem Stiefel, und das Bein mit dem Fuß dran, das gehörte zu Wark, Mr. Fraith.«
Fraith tritt etwas näher, blickt auf die Hand und hat eine steile Falte zwischen den Augenbrauen. »Lernst du noch mal, dein Maul zu halten? Wark ist nachtragend, das hättest du wissen müssen. Kannst du damit arbeiten?«
»Ja«, sagt Yonker, fast mit der Stimme überkippend. Zu schnell, um nicht seine Angst erkennen zu lassen. »Damit arbeite ich noch ganz prima, Mr. Fraith, wirklich!«
»So?«
Es klingt zweifelnd, aber Fraith ist kein Unmensch, er könnte Yonker von der Arbeit befreien, das liegt in seiner Macht, aber er macht es nicht, denn er weiß genau wie alle anderen einige Dinge.
Am Fluß und im Steinbruch weht manchmal wenigstens eine etwas kühlere Brise. Aber wenn die Hitze gegen Mittag mit aller Gewalt auf das Jail niedersinkt, dann weht nicht der geringste Luftstrom innerhalb des Jails. Die Sonne prallt dann so heiß herunter, daß ein Mann in der Zelle glaubt, ersticken zu müssen.
»Ich kann arbeiten, ehrlich«, sagt Yonker verzweifelt, als Fraith anscheinend nachdenklich auf den Boden blickt. »Mr. Fraith, wirklich…«
»Na gut, Fünfzehn, du mußt es wissen! Brand hat den Vormittagsposten, Jose löst ihn ab. Ich werde beiden sagen, daß sie dir ab und zu Wasser vom Fluß heraufbringen lassen. Schon gut, halt die Klappe, Fünfzehn, halt sie endlich mal!«