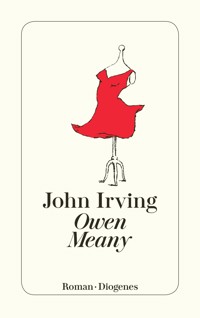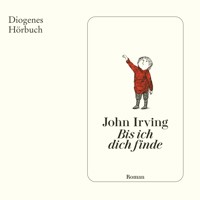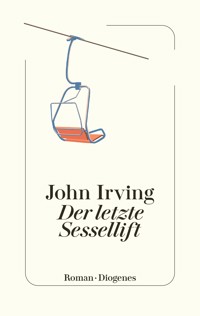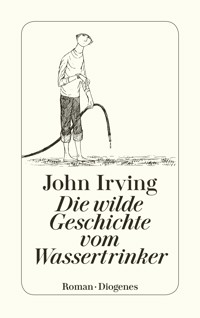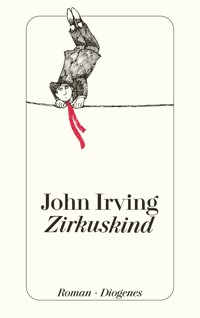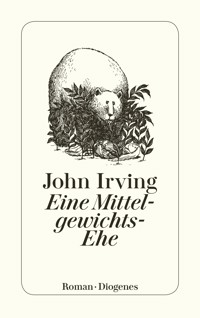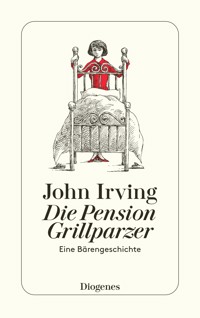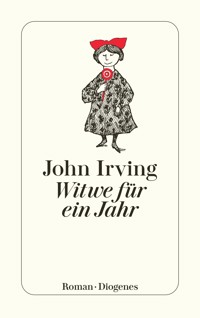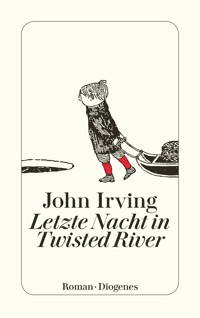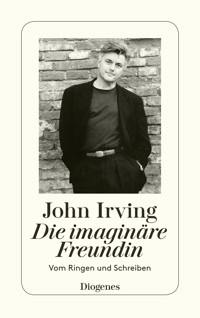
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit 19 wusste Irving schon genau, was er wollte: ringen und Romane schreiben. Bis zum Durchbruch von Garp machte er Wien mit seinem Motorrad unsicher und trainierte an amerikanischen Universitäten Ringermannschaften und angehende Schriftsteller. John Irving ganz privat, unspektakulär und sympathisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
John Irving
Die imaginäre Freundin
Vom Ringen und Schreiben
Aus dem Amerikanischen von
Irene Rumler
Die Originalausgabe erschien 1996
unter dem Titel ›The Imaginary Girlfriend‹
innerhalb der Kurzgeschichten- und Essaysammlung
›Trying to Save Piggy Sneed‹
bei Arcade Publishing, Inc., New York
Copyright © 1996 by Garp Enterprises, Ltd.
Die deutsche Erstausgabe
erschien 1996 im Diogenes Verlag
Fotonachweis am Schluß des Bandes
Die Übersetzerin dankt Herrn Josef-Karl Neudorfer
für seine fachliche Unterstützung
Umschlagfoto von
Isolde Ohlbaum
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23308 7 (4. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60128 2
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Zur Erinnerung an Ted Seabrooke Cliff Gallagher Tom Williams
[7] Inhalt
Lehrersproß [9]
Der ewig Unterlegene [14]
Die Halbpfund-Scheibe Toast [20]
Was ich damals las [30]
Der Ersatzmann [39]
Die Hundert-Dollar-Taxifahrt [47]
Ein Dieb [55]
Das Halbfinale [61]
Ein kurzes Gespräch in Ohio [69]
Ein Jahr im Ausland [74]
Kein Vietnam und keine Motorräder mehr [83]
Nicht mal ein Zebra [87]
Die Gewinner der Goldmedaille [97]
Der Tod eines Freundes [107]
Was Vonnegut sagte [112]
Die Abstimmung über den Doktortitel [116]
Mein erster Roman [123]
Meine beiden Champions [125]
Mein letzter Gang auf die Waage [132]
Nur ein Mensch [142]
Anmerkungen des Autors[149]
[9] Lehrersproß
Zu meiner Zeit gab es an der Exeter Academy, einer sogenannten Prep-School, die der Vorbereitung aufs College dient, noch keine Kurse für freies, kreatives Schreiben – hier wurden in erster Linie Aufsätze und Essays verlangt –, aber trotzdem schrieb ich damals mehr Short Stories als andere Texte. Die zeigte ich nicht meinem Lehrer, sondern George Bennett, dem Vater meines besten Freundes. Mr. Bennett war damals Leiter des Fachbereichs Englisch und der erste, der mich kritisierte und ermutigte – ich brauchte seine Unterstützung. Da ich sowohl in Latein als auch in Mathematik durchfiel, mußte ich ein fünftes Jahr dranhängen, was an der Academy noch nie vorgekommen war. Immerhin hatte ich wenigstens in einem Kurs gute Karten; er nannte sich Englisch 4W – »W« stand für »Writing«, also genau die Art des Schreibens, die ich lernen wollte. In diesem erlauchten Kreis wurde ich aufgefordert, kreativ zu sein, was mir selten gelang.
Wenn ich mich recht erinnere (auf mein Gedächtnis ist nicht immer Verlaß), war der Starautor in Englisch 4W, der auch als Kritiker kein Blatt vor den Mund nahm, mein Ringerkamerad Chuck Krulak, genannt »Brute«, der spätere General Charles C. Krulak, Kommandierender General des U.S. Marine Corps und Angehöriger der Joint Chiefs of [10] Staff, des Führungsgremiums der US-Streitkräfte. Eine nicht weniger beeindruckende Persönlichkeit und ein ebenso sarkastischer Kritiker war mein Klassenkamerad in Englisch 5, der zukünftige Schriftsteller G. W. S. Trow. Damals hieß er schlicht George, aber seine Kritik war so scharfzüngig und bissig, daß ich sie fürchtete. Erst kürzlich hat mir George zu meiner Verwunderung gestanden, daß er in Exeter todunglücklich gewesen war. Mir war er immer viel zu selbstbewußt vorgekommen, um unglücklich sein zu können – während ich mich damals andauernd genierte.
Hätte für mich das normale Zulassungsverfahren gegolten, wäre ich nie in der Exeter Academy angenommen worden, denn ich war schwacher Schüler und Legastheniker, nur wußte man das damals noch nicht. Doch als ›Lehrerkind‹ wurde ich automatisch aufgenommen. Mein Vater unterrichtete Geschichte; er hatte in Harvard Slawistik studiert und war der erste Lehrer, der in Exeter Russische Geschichte unterrichtete. Meine Leistungen waren Dad gerade ein C+ wert.
Zu behaupten, Exeter sei für mich hart gewesen, ist eine Untertreibung. In Genetik war ich der einzige Schüler, der sein Fruchtfliegenexperiment vermasselte. Die roten und die weißen Augen kreuzten sich so wahnwitzig schnell, daß ich den Überblick über die Generationen verlor. Um das, was dabei herauskam, loszuwerden, kippte ich es in den Wasserspender vor dem Labor, nicht ahnend, daß Fruchtfliegen noch tagelang in den Wasserrohren weiterleben (und brüten) können. Als der unbrauchbar gewordene Wasserspender für »verseucht« erklärt wurde – er wimmelte [11] buchstäblich vor glitschigen Fruchtfliegen –, meldete ich mich zerknirscht und beichtete.
Mr. Mayo-Smith, der Biologe, der Genetik unterrichtete, verzieh mir, weil ich der einzige Townie (sprich Externe) unter seinen Schülern war, der ein Gewehr besaß, und er mich brauchte – genauer gesagt, er brauchte mein Gewehr. Den Internatsschülern war der Besitz von Feuerwaffen verständlicherweise untersagt. Aber da ich aus New Hampshire stammte – »Lebe frei oder stirb«, wie es auf den Zulassungsschildern heißt –, stand mir ein ganzes Waffenarsenal zur Verfügung. Ich diente dem Biologielehrer als Scharfschütze, der seinen Einführungskurs mit Tauben versorgte; normalerweise schoß ich sie vom Dach seiner Scheune herunter. Zum Glück wohnte Mr. Mayo-Smith ein Stück außerhalb der Stadt.
Doch selbst in meiner Eigenschaft als Mr. Mayo-Smiths Scharfschütze war ich ein Versager. Ich sollte die Tauben abschießen, unmittelbar nachdem sie gefressen hatten, damit die Schüler, die sie sezieren mußten, die Nahrung in ihren Kröpfen untersuchen konnten. Folglich gestattete ich den Tauben, sich auf dem Maisfeld des Biologen vollzufressen. Aber sie waren so dumm, daß sie jedesmal, wenn ich sie wegscheuchte, auf das Dach seiner Scheune flogen. Wenn ich sie dann eine nach der anderen herunterschoß und dabei sorgfältig vermied, die Kröpfe zu treffen – ich hatte ein Gewehr mit einem vierfach vergrößernden Zielfernrohr und verwendete Kaliber .22 Sportpatronen –, rutschten sie rechts oder links vom Dach herunter. Eines Tages schoß ich ein Loch ins Dach; von da an ließ mich Mr. MayoSmith nie mehr vergessen, daß seine Scheune undicht war. [12] Die Fruchtfliegen im Wasserspender waren das Problem der Schule, aber nun hatte ich ein Loch in des Biologen ureigene Scheune geschossen – »persönliches Eigentum und alles, was dazugehört«, wie mein Vater in Russischer Geschichte zu sagen pflegte.
Daß ich ein Loch in Mr. Mayo-Smiths Scheune geschossen hatte, war weniger demütigend als die jahrelange Sprachtherapie, der ich mich unterziehen mußte. Rechtschreibschwäche war in Exeter unbekannt, was bedeutete, daß man wenig über die Hintergründe wußte. Natürlich war meine Legasthenie dafür verantwortlich, aber da es diese Diagnose Ende der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre noch nicht gab, stufte der Sprachtherapeut, der meinen rätselhaften Fall beurteilen sollte, meine miserable Orthographie als psychologisches Problem ein (ein Befund, durch den sich meine schulische Situation nicht gerade verbesserte). Als ich nach zahlreichen Sprachtherapiesitzungen den Unterschied zwischen ›Allegorie‹ und ›Allergie‹ noch immer nicht erkennen konnte, wurde ich dem Schulpsychiater übergeben.
Ob mir die Schule ein Greuel sei, wollte er wissen.
»Nein.« (Ich war in der Schule aufgewachsen!)
Warum nannte ich meinen Stiefvater »Vater«?
»Weil ich ihn sehr gern habe, und weil er der einzige ›Vater‹ ist, den ich je hatte.«
Aber warum wehrte ich mich dagegen, daß andere Leute meinen Vater als Stiefvater bezeichneten?
»Weil ich ihn sehr gern habe, und weil er der einzige ›Vater‹ ist, den ich je hatte – da muß ich mich doch wehren!«
[13] Warum wurde ich wütend?
»Weil ich nicht buchstabieren kann.«
Und warum konnte ich nicht buchstabieren?
»Fragen Sie mich was Leichteres.«
Empfand ich es als »problematisch«, meinen Stiefvater – das heißt, meinen Vater – als Lehrer zu haben?
»Ich hatte meinen Vater ein Jahr lang als Lehrer. In der Schule und schlecht in Orthographie bin ich seit fünf Jahren.«
Aber warum wurde ich wütend?
»Weil ich nicht richtig schreiben kann – und weil ich zu Ihnen kommen muß.«
»Wir sind wirklich ganz schön wütend, was?« sagte der Psychiater.
»Und ob ich wütend sind«, entgegnete ich. (Ein Versuch, die Unterredung auf das Thema meiner Störung zurückzubringen, die schließlich mit Sprache zu tun hatte.)
[14] Der ewig Unterlegene
Es gab nur einen Ort in Exeter, an dem ich nie wütend wurde: In der Ringerhalle ging mir nie der Gaul durch – wahrscheinlich weil ich mich dort nie genierte. Es ist erstaunlich, daß ich mich beim Ringen so wohlfühlte, denn ein hervorragender Athlet war ich nie. Schon als Kind war es mir ein Greuel gewesen, in der Little League Baseball zu spielen. (Überhaupt habe ich eine Aversion gegen sämtliche Ballsportarten.) Etwas weniger zuwider waren mir Skifahren und Schlittschuhlaufen. Kaltes Wetter kann ich nur begrenzt ertragen. Merkwürdigerweise hatte ich schon immer ein Faible für Körperkontakt und genoß den Adrenalinstoß beim Zusammenprall mit anderen Leuten, doch für Football war ich zu klein; außerdem ist da ja auch ein Ball mit im Spiel.
Wenn man etwas sehr gern mag, neigt man dazu, alle Leute mit Begründungen zu langweilen – dabei spielen die gar keine Rolle. Ringen ist, wie Boxen, ein Gewichtsklassensport, bei dem man mit Leuten gleicher Größe aufeinanderprallt. Manchmal prallt man recht heftig mit ihnen zusammen, landet aber relativ weich. Und obwohl das Ringen ein Kampfsport ist, hat es auch seine zivilisierten Seiten. Eine seiner, wie ich meine, bewundernswerten Grundregeln lautet: Wenn man seinen Gegner von der Matte hebt, ist man [15] auch dafür verantwortlich, daß er »unbeschadet dorthin zurückkehrt«. Aber die ehrlichste Antwort auf die Frage, warum mir das Ringen solchen Spaß machte, ist die, daß es das erste war, was ich einigermaßen gut konnte. Meine bescheidenen Erfolge in diesem Sport verdanke ich jedoch ausschließlich meinem ersten Trainier, Ted Seabrooke.
Coach Seabrooke war während seiner Zeit in Illinois einmal Big 10-Champion und zweimaliger All-American. (Die Big 10 sind ein Sportverband, zu dem sich zehn Hochschulen zusammengeschlossen haben; ein All-American war damals einer der vier – heute sechs – Besten seiner Gewichtsklasse in den gesamten Vereinigten Staaten). Als Ringertrainer in Exeter war er absolut überqualifiziert; seine Mannschaften dominierten jahrelang die Ringerszene der Prep-Schools und High-Schools von New England. Ted Seabrooke, zweiter Sieger des nationalen Hochschulsportverbandes NCAA in der Gewichtsklasse bis 70 Kilo, war ein gutaussehender Mann; zu meiner Academy-Zeit wog er 90 Kilo und mehr. Meistens saß er mit gegrätschten Beinen auf der Matte, hatte die Arme an den Ellbogen abgewinkelt und streckte sie einem in Brusthöhe entgegen. Selbst in einer so leicht angreifbaren Stellung konnte er sich perfekt verteidigen. Ich habe nie erlebt, daß es jemandem gelungen wäre, hinter ihn zu kommen. Er konnte wie eine Krabbe auf seinem Hinterteil umherrutschen – und einen dabei mit den Füßen zu Fall bringen, mit den Beinen umklammern, einem die Hände festhalten oder den Kopf nach unten reißen. Er konnte seinen Trainingspartner kontrollieren, indem er ihn mit gespreizten Beinen auf seinen Schoß herunterzog (Hüftklammer) oder sich sein vorderes Bein und den [16] hinteren Arm schnappte (Beingriff mit Armklammer). Er ging immer sanft mit uns um und legte es nie darauf an, uns zu frustrieren. (Jahre später wurde Coach Seabrooke zunächst zuckerkrank und starb schließlich an Krebs. Ich hatte einen Nachruf geschrieben, brachte bei der Gedenkfeier aber nur ein paar Sätze über die Lippen, weil mir sonst die Tränen gekommen wären.)
Ted Seabrooke brachte mir nicht nur das Ringen bei; wichtiger war, daß er mir von Anfang an klarmachte, daß ich wegen meines beschränkten athletischen Talents als Ringer bestenfalls »halbwegs passabel« sein würde. Und er schärfte mir ein, daß ich mein mangelndes Talent wettmachen könnte, wenn ich nur intensiv und gründlich trainierte. »Talent wird häufig überschätzt«, erklärte mir Ted. »Daß du nicht besonders begabt bist, braucht nicht das Ende vom Lied zu sein.«
Auf High-School-Ebene dauert ein Ringkampf sechs Minuten, aufgeteilt in drei Runden zu je zwei Minuten, ohne Pause. Die erste Runde beginnen beide Ringer im Stand – eine neutrale Stellung, in der keiner der beiden einen Vorteil hat. Zu Beginn der zweiten Runde durfte damals einer der beiden Ringer zwischen Oberlage und Bodenlage wählen; in der dritten Runde konnte dann der andere die Ausgangsstellung bestimmen. (Heutzutage umfassen die Alternativen auch die neutrale Stellung, und der Ringer, der sich in der zweiten Runde die Kampfstellung aussuchen darf, kann seine Entscheidung bis zur dritten zurückstellen.)
Coach Seabrooke brachte mir vor allem bei, daß es darauf ankam, in den ersten zwei Runden die Punktdifferenz [17] möglichst gering zu halten – so gering, daß ich mit einem Wurf oder einer Wende in der dritten Runde den Kampf gewinnen konnte. Und er warnte mich dringend vor jeglichem »Gerangel« – also vor allen Situationen, in denen nur gerangelt wird und die keiner der beiden Ringer kontrollieren kann. (Solche Balgereien gehen meist zugunsten des Stärkeren aus.) Ich sollte alles daran setzen, das Tempo des Kampfes – eine Kombination aus Technik, richtiger Stellung und körperlicher Kondition – zu bestimmen. Ich weiß, daß das langweilig klingt, aber ich war eben ein langweiliger Ringer. Das Tempo, mit dem ich gut zurechtkam, war recht langsam. Ich mochte Kämpfe, bei denen wenig Punkte vergeben wurden.
Ich habe selten einen Schultersieg erzielt; in den fünf Jahren als Ringer in Exeter konnte ich höchstens ein halbes Dutzend Gegner schultern. Und selbst mußte ich auch kaum eine Schulterniederlage einstecken – eigentlich nur zweimal.
Wenn ich einem Gegner überlegen war, gewann ich 5 zu 2; wenn ich Glück hatte, gewann ich 2 zu 1 oder 3 zu 2, und hatte ich weniger Glück, unterlag ich 3 zu 2 oder 4 zu 3. Wenn mir der erste Niederwurf gelang, konnte ich normalerweise gewinnen; gelang meinem Gegner der erste Niederwurf, hatte ich enorme Mühe, mich davon zu erholen – ich gehörte nicht zu denen, die am Schluß noch zulegen können. Auch beim Kontern war ich, wie Coach Seabrooke es ausdrückte, »halbwegs passabel«. Doch wenn ich es mit einem sehr kräftigen Ringer zu tun hatte, durfte ich mich keinesfalls darauf verlassen, daß ich es schaffte, seine ersten Griffansätze zu kontern; dafür waren meine Konteraktionen nicht schnell genug – meine Reflexe waren einfach zu [18] langsam. Hatte ich es mit einem Gegner zu tun, der mir an Körperkraft überlegen war, unternahm ich den ersten Angriffsversuch; war mir der andere technisch überlegen, versuchte ich seinen ersten Angriff zu kontern.
»Oder vice versa, wenn es nicht funktioniert«, pflegte Coach Seabrooke zu sagen. Er hatte Sinn für Humor. »Wenn der Kopf in eine Richtung geht, muß der Körper folgen – normalerweise«, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu. Und: »Ein ewig Unterlegener kann einen gesunden Biß verkraften.«
So hatte ich mich bis dahin noch nie gesehen. Ich war ein ewig Unterlegener, folglich mußte ich das Tempo bestimmen – in allen Dingen. Das war mehr, als ich in Englisch 4W lernte, aber dieses Prinzip ließ sich auch auf das Schreiben anwenden – und auf die schulische Arbeit insgesamt. Wenn meine Mitschüler das Geschichtspensum in einer Stunde bewältigen konnten, gestand ich mir zwei oder drei Stunden zu. Da ich mit der Rechtschreibung weiterhin auf Kriegsfuß stand, legte ich eine Liste der Wörter an, die ich am häufigsten falsch schrieb; die trug ich dann ständig bei mir, so daß ich sie sogar für unangekündigte Kurzarbeiten griffbereit hatte. Vor allem schrieb ich alles ein zweites Mal; erste Entwürfe waren wie das erste Ausprobieren eines neuen Griffs – man mußte ihn hart trainieren, wieder und immer wieder, bevor man auch nur im Traum daran denken konnte, ihn in einem Wettkampf anzuwenden. Allmählich fing ich an, meinen Mangel an Begabung ernst zu nehmen.
Ein autoritärer Spanischlehrer warf denen von uns, die in seinen Augen nicht alles perfekt machten, mit Vorliebe die unsensible (und ausgesprochen elitäre) Beleidigung an den [19] Kopf, wir würden noch alle auf der Wichita State University landen. Damals wußte ich nicht, daß Wichita in Kansas lag; ich wußte nur, daß er einen damit herunterputzen wollte: Wer für Harvard nicht begabt genug war, hatte nichts Besseres verdient als das Wichita State College. Du kannst mich mal, dachte ich, in dem Fall würde ich mir eben vornehmen, meine Sache am Wichita State gut zu machen. Ted Seabrooke war ans Illinois College gegangen. Vermutlich hatte dieser Spanischlehrer von Illinois auch keine allzu gute Meinung.
Ich erinnere mich, daß ich Ted einmal erzählte, ich hätte zwei sympathische Spanischlehrer und einen unsympathischen. »Über solche Lappalien würde ich mich nicht aufregen«, meinte er.
[20] Die Halbpfund-Scheibe Toast
Während meiner Zeit an der Exeter Academy erlebten die Ringer unter Coach Seabrooke zwei entscheidende Veränderungen. Als erstes wurde die Ringerhalle aus dem Souterrain der alten Sporthalle in den oberen Bereich der Hallenbahn verlegt, die allgemein ›der Käfig‹ hieß. Der neue Raum mit seinen hohen Deckenbalken war extrem warm. Von der Laufbahn unter uns, die aus gestampfter Erde bestand, und von der Holzbahn, die um das obere Geschoß herumlief, kam das gleichmäßige Trampeln der Läufer. Doch sobald wir mit dem Mattentraining begannen, hörten wir die Läufer nicht mehr, da die Ringerhalle durch eine schwere Schiebetür von der Holzbahn abgetrennt wurde. Vor und nach dem Training stand diese Tür offen; solange wir trainierten, war sie geschlossen.
Die zweite Veränderung, die die Ringer betraf, waren die Matten. Ich habe auf Roßhaarmatten zu ringen angefangen, die mit einer hauchdünnen, elastischen Plastikschicht überzogen waren. Als vorbeugende Maßnahme gegen Mattenbrand war diese Plastikverkleidung einigermaßen wirkungsvoll, nur gab sie nach – wie ein Betttuch –, sobald man sich darauf bewegte. Die losen Falten führten zu Knöchelverletzungen; und aufpralldämpfende Eigenschaften besaßen diese alten Roßhaarmatten im Vergleich zu den [21] komfortablen neuen Matten, die rechtzeitig zur Einweihung der neuen Ringerhalle eintrafen, so gut wie gar nicht.
Die neuen Matten hatten eine weiche Oberfläche ohne Überzug. Wenn sie warm waren, konnte man aus Kniehöhe ein Ei darauf fallen lassen, ohne daß es zerbrach. (Wenn doch einmal ein Ei kaputt ging, behaupteten wir einfach, die Matte sei nicht warm genug gewesen.) Auf einem kalten Hallenboden veränderte sich die Beschaffenheit der Matte grundlegend. In späteren Zeiten hatte ich in meiner ungeheizten Scheune in Vermont eine Ringermatte, die im Winter beinhart war.
Die meisten unserer Freundschaftskämpfe wurden in der sogenannten ›Grube‹ ausgetragen und nicht in der Ringerhalle, in der wir trainierten. Von der Holzbahn, die an einer Stelle eine über die Grube reichende Ausbuchtung hatte, zweigte außerdem eine L-förmige, hölzerne Galerie ab. Von dort oben konnten insgesamt zwei- bis dreihundert Zuschauer auf ein nicht ganz der Normgröße entsprechendes Basketballfeld hinunterblicken, auf dem wir unsere Matten ausgerollt hatten. Daneben blieb kaum ausreichend Platz für ein rundes Dutzend Zuschauerstühle, so daß sich die meisten Fans über unseren Köpfen befanden, auf der Holzbahn und der Galerie. Es war, als würde man auf dem Boden einer Teetasse ringen, während die Zuschauer über den Tassenrand spähten.
Dieser Raum, in dem unsere Wettkämpfe stattfanden, wurde zu Recht ›die Grube‹ genannt. Der Erdgeruch der angrenzenden Laufbahn rief seltsamerweise Erinnerungen an den Sommer wach, obwohl Ringen ein Wintersport ist. Da die Tür nach draußen ständig auf und zu ging, war es in [22] der Grube nie warm, und die Matten, die in der Ringerhalle so warm und weich waren, fühlten sich bei den Wettkämpfen kalt und hart an. Und wenn unsere Freundschaftskämpfe zeitlich mit Wettkämpfen der Läufer im Käfig zusammenfielen, hallte der Knall der Startpistole in der Grube wider. Ich habe mich oft gefragt, was die Ringer, die bei uns zu Gast waren, von den Schüssen halten mochten.
Mein erster Kampf in der Grube war eine lehrreiche Erfahrung. An halbwegs niveauvollen Mannschaftswettkämpfen der Prep-Schools und High-Schools nehmen nur selten Leute teil, die erst ein oder zwei Jahre ringen. In den fünfziger Jahren gehörte Ringen – im Gegensatz zu Baseball, Basketball, Hockey oder Skifahren – nicht zu den Sportarten, mit denen jedes Kind in New Hampshire selbstverständlich aufwuchs. Bei jedem Sport muß man bestimmte unlogische Dinge lernen; speziell Ringen fällt einem nicht auf Anhieb leicht. Denn ein Doppelbeingriff mit folgendem Niederwurf ist eben nicht dasselbe wie wenn man beim Football versucht, den Gegner frontal zu stoppen. Beim Ringen geht es nicht darum, den Gegner zu Boden zu werfen – es geht darum, ihn zu kontrollieren. Will man den anderen mit einem Beinangriff zu Boden bringen, gehört mehr dazu, als ihm die Beine unter dem Körper wegzuschlagen: Man muß die eigenen Hüften unter den Gegner bekommen, damit man ihn von der Matte heben kann, bevor man ihn zu Boden bringt – und das ist nur ein Beispiel. Eins jedenfalls steht fest: Beim Ringen befindet sich ein Anfänger, auch wenn er noch soviel Kraft und Kondition hat, einem erfahrenen Gegner gegenüber immer im Nachteil.
Ich habe vergessen, welche Kombination aus [23] Krankheiten, Verletzungen oder Todesfällen in der Familie mir meinen ersten Wettkampf in der Grube bescherte; da ich erst in dem Jahr zu ringen begonnen hatte, genügte es mir völlig, mit anderen Anfängern oder etwas Geübteren zu ringen. In der Ringerhalle war eine nach Gewichtsklassen gestaffelte ›Leiter‹ aufgehängt, auf der ich im ersten Jahr als vierter oder fünfter in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo weit unten rangierte. Aber die Nummer Eins war krank oder verletzt, der zweitbeste Mann konnte das Gewichtslimit nicht erreichen, und der nächste auf der Liste war vermutlich übers Wochenende nach Hause gefahren, weil sich seine Eltern scheiden ließen. Wer weiß? Jedenfalls war ich aus irgendwelchen Gründen der beste verfügbare Mann in der 60-Kilo-Klasse.
Diese unerfreuliche Nachricht erreichte mich im Speisesaal, wo ich an einem der Lehrertische bediente; zum Glück hatte ich noch kein Frühstück im Magen, sonst hätte ich es garantiert ausgespuckt. Da ich knapp zwei Kilo über dem Gewichtslimit lag, lief ich zunächst eine knappe Stunde auf der Holzbahn des Käfigs – in Skianorak und Winterkleidung. Dann absolvierte ich, in Schwitzanzug und einem Kapuzen-Sweatshirt darüber, eine halbe Stunde Seilspringen in der Ringerhalle. Beim Wiegen – ich lag knapp 50 Gramm unter 60 Kilo – sah ich zum ersten Mal meinen Gegner, Vincent Buonomano von der Mount Pleasant High School in Providence, Rhode Island, einen amtierenden New-England-Champion.
Hätten wir die Gewichtsklasse unbesetzt gelassen, hätten wir nicht schlechter abschneiden können, denn Nichtantreten wurde genauso bewertet wie ein Schultersieg – mit sechs Punkten. Coach Seabrooke hatte die Hoffnung, daß ich [24] keine Schulterniederlage hinnehmen mußte. Wenn man zu jener Zeit einen Kampf aufgab, bedeutete das einen Verlust von drei Punkten für die Mannschaft, egal wie groß die Punktdifferenz bei den Einzelkämpfen ausfiel. Mein Ziel war es mit anderen Worten, mir eine Schlappe beibringen zu lassen, damit die Mannschaft statt sechs Punkten nur drei einbüßte.