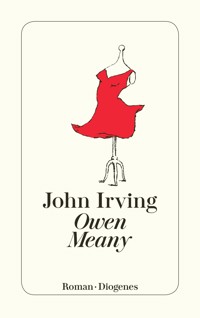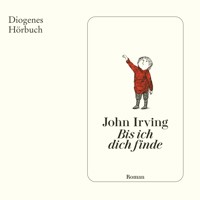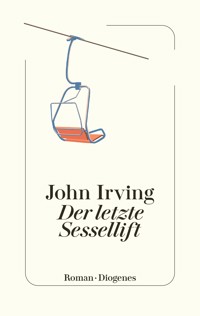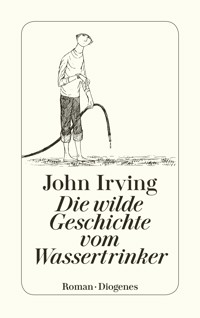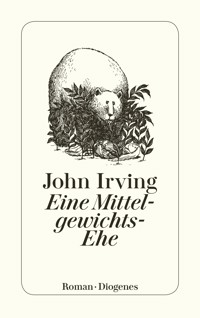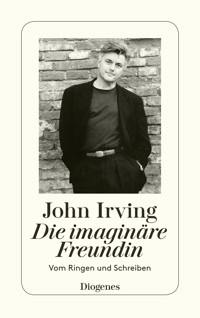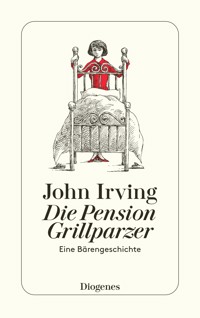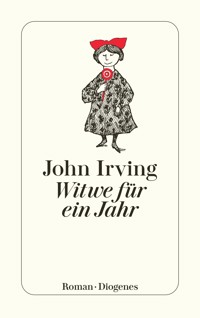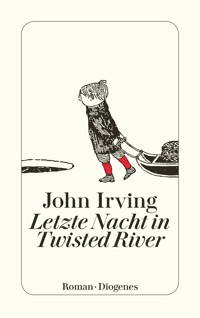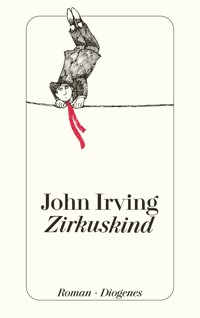
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verführerisch bunt und schillernd wie Bombay, unberechenbar magisch und spannend wie ein akrobatischer Seiltrick, das ist John Irvings großartiges Buch, ein Arzt- und Zirkusdrama der ganz anderen Art. Dr. Daruwalla sucht nach einem ganz speziellen Gen – und nach einem Golfplatzmörder. Was er findet, ist Possenspiel und Grusel zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1220
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
John Irving
Zirkuskind
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Irene Rumler
Titel der 1994 bei Random House, Inc., New York, erschienenen Originalausgabe: ›A Son of the Circus‹ Copyright © 1994 by Garp Enterprises, Ltd.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 im Diogenes Verlag
Abdruck der Auszüge aus James Salters RomanA Sport and a Pastime mit freundlicher Genehmigung der Verlage North Point Press und Farrar, Straus & Giroux, New York
Übersetzung von Irene Rumler
Copyright © 1967 by James Salter
Umschlagillustration von Edward Gorey
Mit freundlicher Genehmigung des Edward Gorey Charitable Trust, New York
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 22966 0 (11. Auflage)
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]
[7] Inhalt
Vorbemerkung des Autors [13]
1 Die Krähe auf dem Deckenventilator
Zwergenblut[17]
Der Doktor sinnt über Lady Duckworths Brüste nach[27]
Mr. Lal hat das Netz verfehlt[42]
2 Die beunruhigende Nachricht
Sie tingeln noch immer[51]
Der berühmte Zwilling[57]
Der Doktor als heimlicher Drehbuchautor[63]
Dr. Daruwalla beginnt an sich zu zweifeln[76]
Nur weil ein Elefant auf eine Wippe getreten ist[80]
3 Der echte Polizist
Mrs. Dogar erinnert Farrokh an jemand anderen[91]
Unklug, solche Leute zu beleidigen[99]
Ein echter Kriminalbeamter bei der Arbeit[103]
Wohin die Gedanken des Doktors schweifen[115]
4 In alten Zeiten
Der Tyrann[118]
Zwischenspiel in Österreich[126]
Unerklärliche Unbehaartheit[134]
In der Vergangenheit verhaftet[140]
[8] 5 Die Parasiten
Bekanntschaft mit dem Filmgeschäft[144]
Hatte er denn irgend etwas Wissenswertes gelernt?[159]
Es war nicht der Curry[164]
Ein Slum entsteht[171]
Der Kampfermann[182]
6 Der erste, der kommt
Bei der Geburt getrennt[184]
Ein Talent, Leute zu beleidigen[193]
Und wenn Mrs. Dogar ein ›hijra‹ wäre?[200]
Fahrradpyramide[205]
7 Dr. Daruwalla versteckt sich in seinem Schlafzimmer
Da werden die Elefanten aber böse sein[217]
Die Hunde aus dem ersten Stock[228]
Inoperabel[235]
8 Zu viele Nachrichten
Ausnahmsweise wissen die Jesuiten nicht alles[244]
Derselbe alte Schrecken – und eine brandneue Drohung[253]
Der Deckenlauf[261]
9 Die zweiten Flitterwochen
Vor seiner Bekehrung verspottet Farrokh die Gläubigen[264]
Der Doktor wird animiert[269]
Der Doktor wird Zeuge einer noch unvollständigen Geschlechtsumwandlung[278]
10 Wege, die sich kreuzen
Ein Syphilistest[288]
Eine literarische Verführungsszene[291]
[9] Auf den Lunch folgt Niedergeschlagenheit[299]
Ein schmutziger Hippie[307]
11 Der Dildo
Hinter jeder Reise steckt ein Grund[315]
Eine denkwürdige Ankunft[321]
Unser Freund, der echte Polizist[333]
Der ahnungslose Kurier[344]
12 Die Ratten
Vier Bäder[349]
Dieter[357]
Nancy wird krank[365]
13 Kein Traum
Eine wunderschöne Fremde[372]
Nancy ist Tatzeugin[374]
Die Flucht[380]
Die falsche Zehe[389]
Farrokhs Bekehrung[393]
Der Arzt und seine Patientin begegnen sich wieder[404]
14 Zwanzig Jahre
Eine komplette Frau, die Frauen verabscheut[407]
Erinnerungen an Tante Promila[414]
Ein kinderloses Ehepaar sucht nach Rahul[417]
Die Polizei weiß, daß nicht der Film schuld ist[424]
Ein Blick auf zwei Ehen in einer kritischen Phase[427]
Was der Zwerg so alles sieht[432]
15 Dhars Zwillingsbruder
Drei alte Missionare schlafen ein[437]
[10] Erste Anzeichen für eine Verwechslung[443]
Der falsche Taxifahrer[450]
Bekehrungsversuche bei den Prostituierten[453]
Alle beisammen – in einer kleinen Wohnung[463]
Freier Wille[466]
Stillstehen: eine Übung[476]
Der Vogeldreckjunge[480]
16 Mr. Gargs Mädchen
Irgendeine kleine Geschlechtskrankheit[488]
Martin Luther wird anfechtbar zitiert[495]
Noch eine Warnung[502]
Madhu macht von ihrer Zunge Gebrauch[505]
Eine Unterredung im Kriminalkommissariat[508]
Kein Motiv[519]
Martins Mutter macht ihn krank[525]
Ein halbes Dutzend Kobras[530]
Die Missionsstation inspiriert Farrokh[534]
Tetracyclin[547]
17 Merkwürdige Sitten
Südkalifornien[551]
Ein Truthahn und ein Türke[566]
Zwei grundverschiedene Männer, beide hellwach[580]
18 Eine Geschichte, die von der Jungfrau Maria ins Rollen gebracht wird
Limo-Roulette[585]
Heilige Maria Muttergottes[596]
Gibt es denn überhaupt irgendein Gen dafür?[600]
Der rätselhafte Schauspieler[607]
Etwas recht Eigenartiges[615]
[11] 19 Unsere Liebe Frau die Siegreiche
Noch ein Autor auf der Suche nach einem Schluß[623]
Wie es Mr. Lal erwischte[630]
Eine kleine Tragödie[637]
Keine romantische Komödie[644]
Ein falscher Tod – die echten Kinder[656]
20 Die Bestechung
Zeit zu verschwinden[663]
Wanzen ahoi![666]
Tobende Hormone[669]
Das Hawaiihemd[672]
Der Schauspieler tippt richtig[675]
Farrokh erinnert sich an die Krähe[688]
Eine Drei-Dollar-Note?[695]
Die alte Geschichte mit der Haßliebe[698]
21 Flucht aus Maharashtra
Gegen die Tollwut gewappnet[701]
Ein Glückstag[703]
Fehl am Platz im Taj Mahal[705]
Zu laut für eine Bibliothek[712]
Ein Mißverständnis am Pinkelbecken[720]
Fürchte kein Unheil![726]
22 Die Versuchung des Dr. Daruwalla
Auf der Straße nach Junagadh[735]
Ein rassistischer Schimpanse[742]
Ein perfekter Schluß[748]
Die Nacht der zehntausend Stufen[756]
23 Abschied von den Kindern
Nicht Charlton Heston[766]
[12] Jesus auf dem Parkplatz[773]
Little India[783]
24 Die Teufelin höchstpersönlich
[13] Vorbemerkung des Autors
Dieser Roman handelt nicht von Indien. Ich kenne Indien nicht. Ich war nur einmal dort, knapp einen Monat. Damals verblüffte mich die Fremdartigkeit des Landes; es ist und bleibt mir fremd. Doch lange bevor ich nach Indien reiste, habe ich mir gelegentlich einen Mann vorgestellt, der dort geboren und dann fortgezogen ist. Ich habe mir jemanden vorgestellt, der wieder und immer wieder dorthin zurückkehrt, wie unter Zwang. Aber mit jeder Rückkehr vertieft sich sein Eindruck von der Fremdartigkeit Indiens nur noch mehr. Selbst ihm bleibt Indien absolut unzugänglich und fremd.
Meine indischen Freunde meinten: »Mach doch einen Inder aus ihm – eindeutig einen Inder, aber eben doch keinen Inder.« Sie meinten, daß diesem Menschen jede Umgebung – sein Wohnort außerhalb Indiens eingeschlossen – fremd vorkommen müsse; der springende Punkt sei, daß er sich überall als Ausländer fühle. »Du mußt nur die Details richtig hinkriegen«, sagten sie.
Auf Wunsch von Martin Bell und seiner Frau, Mary Ellen Mark, fuhr ich nach Indien. Die beiden hatten mich gebeten, für sie ein Drehbuch über die Kinder zu schreiben, die in indischen Zirkussen auftreten. An diesem Drehbuch und dem Roman habe ich vier Jahre lang parallel gearbeitet; derzeit überarbeite ich das Drehbuch – es hat denselben Titel wie der Roman, obwohl es nicht dieselbe Geschichte erzählt. Wahrscheinlich werde ich das Drehbuch immer wieder umschreiben, bis der Film gedreht wird – falls es überhaupt dazu kommt. Da Martin und Mary Ellen mich dazu veranlaßt haben, nach Indien zu [14] fahren, haben in gewisser Weise sie den Anstoß zu Zirkuskind gegeben.
Viel verdanke ich auch den indischen Freunden, die mich im Januar 1990 in Bombay herumgeführt haben – besonders Ananda Jaisingh –, und den Angehörigen des Great Royal Circus, die mir sehr viel Zeit geopfert haben, als ich bei ihnen im Zirkus lebte. Ganz besonders dankbar bin ich vier indischen Freunden, die das Manuskript wiederholt gelesen haben. Ihre Bemühungen, mit meinem Unwissen und zahlreichen Fehlern fertig zu werden, haben es mir überhaupt erst ermöglicht, dieses Buch zu schreiben. Ich möchte ihnen namentlich danken, denn ihre Verdienste um Zirkuskind sind unschätzbar.
Mein Dank geht an Dayanita Singh in Neu-Delhi, an Farrokh Chothia in Bombay, an Dr. Abraham Verghese in El Paso, Texas, und an Rita Mathur in Toronto. Außerdem möchte ich meinem Freund Michael Ondaatje danken, der mich mit Rohinton Mistry bekanntmachte – dieser wiederum machte mich mit Rita bekannt. Und mein Freund James Salter war so großzügig und gutmütig, mir zu erlauben, mit einigen Abschnitten aus seinem erstklassigen Roman A Sport and a Pastime frech zu spielen. Danke, Jim.
Wie immer habe ich auch Schriftstellerkollegen zu danken. Meinem Freund Peter Matthiessen, der die erste Version gelesen und mir einige kluge chirurgische Eingriffe empfohlen hat. Meine Freunde David Calicchio, Craig Nova, Gail Godwin und Ron Hansen (nicht zu vergessen sein Zwillingsbruder Rob) haben ebenfalls frühere Fassungen über sich ergehen lassen. Und Ved Mehta hat mir brieflich mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Wie üblich muß ich mich auch bei mehreren Ärzten bedanken. Für die aufmerksame Lektüre der vorletzten Fassung danke ich Dr. Martin Schwartz aus Toronto. Außerdem bin ich Dr. Sherwin Nuland aus Hamden, Connecticut, und Dr. Burton [15] Berson aus New York dankbar, daß sie mir klinische Studien über Chondrodystrophie zur Verfügung gestellt haben.
Die Großzügigkeit von June Callwood und John Flannery – dem Pflegedienstleiter des Casey House in Toronto – weiß ich ebenfalls sehr zu schätzen. Und drei Assistenten haben in den vier Jahren, in denen Zirkuskind entstand, hervorragende Arbeit geleistet: Heather Cochran, Alison Rivers und Allan Reeder. Doch es gibt nur einen Leser, der jede Fassung dieser Geschichte gelesen oder sich angehört hat: meine Frau Janet. Für die buchstäblich Tausende von Seiten, die sie ertragen hat – von den zwangsläufigen Reisen ganz zu schweigen –, danke ich ihr von ganzem Herzen.
Schließlich möchte ich noch meinen herzlichen Dank an meinen Lektor, Harvey Ginsberg, zum Ausdruck bringen, der sich offiziell zur Ruhe gesetzt hatte, bevor ich ihm das 1094-Seiten-Manuskript aushändigte. Ruhestand hin oder her, er hat es lektoriert.
Ich wiederhole: Ich »kenne« Indien nicht. Und Zirkuskind ist kein Buch »über« Indien. Es ist jedoch ein Roman, der in Indien spielt – eine Geschichte über einen Inder (aber eben doch keinen Inder), für den Indien immer ein unbekanntes und unergründliches Land bleiben wird. Wenn es mir gelungen ist, die Details richtig hinzubekommen, verdanke ich das meinen indischen Freunden.
J. I.
[17] 1
Die Krähe auf dem Deckenventilator
Zwergenblut
Normalerweise sorgten die Zwerge dafür, daß er immer wieder zurückkam – zurück zum Zirkus und zurück nach Indien. Inzwischen kannte der Doktor das Gefühl, Bombay immer wieder »endgültig« zu verlassen; fast jedes Mal, wenn er abreiste, schwor er sich, nie mehr nach Indien zurückzukehren. Dann vergingen ein paar Jahre – grundsätzlich nie mehr als vier oder fünf –, und irgendwann nahm er wieder den langen Flug von Toronto nach Indien auf sich. Daß er in Bombay geboren war, war nicht der Grund; wenigstens behauptete er das. Seine Eltern waren beide tot. Seine Schwester lebte in London, sein Bruder in Zürich. Die Frau des Doktors war Österreicherin, ihre Kinder und Enkelkinder waren in England und Kanada zu Hause. Keines wollte in Indien leben – sie kamen auch nur selten zu Besuch dorthin –, und nicht ein einziges war dort geboren. Dem Doktor jedoch war es vom Schicksal bestimmt, nach Bombay zurückzukehren. Er würde immer und immer wieder herkommen – wenn nicht bis an sein Lebensende, dann zumindest so lange, wie es im Zirkus Zwerge gab.
Die meisten Zirkusclowns in Indien sind chondrodystrophe Zwerge. Sie werden oft als Zirkusliliputaner bezeichnet, sind aber keine richtigen Liliputaner, sondern Zwerge. Chondrodystrophie ist die häufigste Erscheinungsform von Minderwuchs mit verkürzten Extremitäten. Ein chondrodystropher Zwerg kann normalgewachsene Eltern haben, doch die Wahrscheinlichkeit, daß seine eigenen Kinder Zwerge sind, beträgt fünfzig [18] Prozent. Diese Form des Zwergwuchses ist in vielen Fällen das Ergebnis einer seltenen genetischen Veränderung, einer Spontanmutation, die bei den Kindern des Zwergs dann zu einem dominanten Merkmal wird. Bisher hat man noch keinen genetischen Marker für dieses Merkmal entdeckt, und keine Koryphäe auf dem Gebiet der Genetik macht sich die Mühe, nach einem solchen Marker zu suchen.
Sehr wahrscheinlich hatte Dr. Farrokh Daruwalla als einziger die abwegige Idee, einen genetischen Marker für diese Art von Zwergwuchs zu suchen. Da es sein sehnlichster Wunsch war, einen solchen zu entdecken, mußte er notgedrungen Blutproben von Zwergen sammeln. Daß es sich um ein sonderbares Vorhaben handelte, war klar: Immerhin war Dr. Daruwalla ein orthopädischer Chirurg, und vom orthopädischen Standpunkt aus war sein Zwergenblut-Projekt uninteressant. Genetik war nur eines seiner Hobbys. Doch trotz seiner seltenen und stets kurzen Besuche in Bombay hatte kein Mensch in Indien jemals so vielen Zwergen Blut abgenommen; niemand hatte so viele Zwerge angezapft wie Dr. Daruwalla. So kam es, daß er in den indischen Zirkussen, die durch Bombay kamen oder auch in kleineren Städten in Gujarat und Maharashtra gastierten, liebevoll »der Vampir« genannt wurde.
Natürlich hat ein Arzt mit Dr. Daruwallas Spezialgebiet in Indien ohnehin häufig mit Zwergen zu tun, da diese zumeist unter chronischen orthopädischen Beschwerden leiden – schmerzenden Knie- und Fußgelenken, von Kreuzschmerzen ganz zu schweigen. Die Symptome verstärken sich mit zunehmendem Alter und Gewicht; je älter und schwerer ein Zwerg wird, desto mehr strahlt der Schmerz ins Gesäß, in die Rückseite der Oberschenkel und in die Waden aus.
In der Kinderklinik in Toronto bekam Dr. Daruwalla sehr wenige Zwerge zu sehen; in der Klinik für Verkrüppelte Kinder in Bombay jedoch – wo er von Zeit zu Zeit, bei seinen sich [19] wiederholenden Besuchen, unentgeltlich als chirurgischer Konsiliar arbeitete – hatte er viele zwergwüchsige Patienten. Doch obwohl sie ihm ihre Familiengeschichten erzählten, wollten sie ihm nicht ohne weiteres ihr Blut geben. Und ihnen gegen ihren Willen Blut abzunehmen hätte Farrokhs Berufsethos widersprochen. Bei der Mehrheit der orthopädischen Beschwerden, die bei chondrodystrophen Zwergen auftreten, erübrigen sich Blutuntersuchungen. Folglich war es nur recht und billig, daß der Doktor den wissenschaftlichen Aspekt seines Forschungsprojekts erklärte und diese Zwerge um ihr Blut bat. Fast immer verweigerten sie es ihm.
Ein typischer Fall war Dr. Daruwallas bester zwergwüchsiger Bekannter in Bombay. Farrokh und Vinod kannten sich schon sehr lange, denn der Zwerg stellte die engste Verbindung des Doktors zum Zirkus dar – Vinod war der erste Zwerg, den Dr. Daruwalla um Blut gebeten hatte. Sie waren sich im Untersuchungszimmer des Arztes in der Klinik für Verkrüppelte Kinder begegnet. Ihre Unterredung fiel mit dem religiösen Feiertag Diwali zusammen, anläßlich dessen der Great Blue Nile Circus ein Gastspiel auf dem Cross Maidan in Bombay gab. Ein zwergwüchsiger Clown (Vinod) und seine normal gewachsene Frau (Deepa) hatten ihren zwergwüchsigen Sohn (Shivaji) in die Klinik gebracht, um dessen Ohren untersuchen zu lassen. Vinod wäre nie auf die Idee gekommen, daß man sich in der Klinik für Verkrüppelte Kinder ausgerechnet mit Ohren beschäftigt – Ohren sind nicht unbedingt ein Fall für die Orthopädie –, war aber zu Recht davon ausgegangen, daß alle Zwerge Krüppel sind.
Trotzdem gelang es dem Doktor nicht, Vinod davon zu überzeugen, daß sowohl sein Zwergwuchs als auch der seines Sohnes genetische Ursachen hatte. Daß Vinod von normalen Eltern abstammte und trotzdem ein Zwerg war, hatte – nach Vinods Ansicht – nichts mit einer Mutation zu tun. Er glaubte fest an die Geschichte, die ihm seine Mutter erzählt hatte: Am Morgen, [20] nachdem sie schwanger geworden war, hatte sie aus dem Fenster geschaut und als erstes Lebewesen einen Zwerg gesehen. Die Tatsache, daß Vinods Frau Deepa eine normal gewachsene Frau war – Vinod zufolge »schon fast schön« –, konnte nicht verhindern, daß Vinods Sohn Shivaji ein Zwerg war. Das war jedoch – nach Vinods Ansicht – nicht auf ein dominantes Gen zurückzuführen, sondern auf die unglückliche Tatsache, daß Deepa seine Warnung vergessen hatte. Am Morgen nach Deepas Empfängnis war das erste Lebewesen, das sie ansah, Vinod, und das war (nach Vinods Ansicht) der Grund, warum Shivaji ebenfalls ein Zwerg war. Vinod hatte Deepa eingeschärft, ihn am Morgen ja nicht anzusehen, aber sie hatte es vergessen.
Daß Deepa »schon fast schön« (oder zumindest eine normal gewachsene Frau) war und trotzdem einen Zwerg geheiratet hatte, kam daher, daß sie keine Mitgift mitbrachte. Ihre Mutter hatte sie an den Great Blue Nile Circus verkauft. Und da Deepa am Trapez noch eine blutige Anfängerin war, verdiente sie fast nichts. »Nur ein Zwerg hätte sie geheiratet«, meinte Vinod.
Zu ihrem Sohn Shivaji ist anzumerken, daß bei chondrodystrophen Zwergen periodisch auftretende und chronische Mittelohrentzündungen bis zum Alter von acht oder zehn Jahren an der Tagesordnung sind. Werden sie nicht behandelt, führen sie häufig zu erheblichem Gehörverlust. Vinod selbst war halb taub. Aber es gelang Farrokh einfach nicht, Vinod anhand dieses oder auch anderer Symptome klarzumachen, daß die bei ihm und Shivaji vorliegende Form von Minderwuchs genetische Ursachen hatte. Dies belegten zum Beispiel seine sogenannten Dreizackhände – die typisch gespreizten Stummelfinger. Dr. Daruwalla wies Vinod auf seine kurzen, breiten Füße und seine leicht angewinkelten Ellbogen hin, die sich nicht durchstrecken ließen. Er versuchte ihn zu dem Eingeständnis zu bewegen, daß seine Fingerspitzen, genau wie bei seinem Sohn, nur bis zu den Hüften reichten, daß sein Unterbauch [21] vorstand und die Wirbelsäule – selbst wenn er auf dem Rücken lag – die typische Vorwärtswölbung aufwies. Diese lumbale Lordose sowie das gekippte Becken sind der Grund, warum alle Zwerge watscheln.
»Zwerge watscheln eben von Natur aus«, entgegnete Vinod, der starr an seinem Credo festhielt und absolut nicht dazu zu bewegen war, sich auch nur von einem einzigen Röhrchen Blut zu trennen. Er saß auf dem Untersuchungstisch und schüttelte über Dr. Daruwallas Zwergwuchstheorie den Kopf.
Vinod hatte, wie alle chondrodystrophen Zwerge, einen unverhältnismäßig großen Kopf. Sein Gesicht wirkte auf Anhieb nicht unbedingt intelligent, es sei denn, man setzt eine vorgewölbte hohe Stirn von vornherein mit großer Geisteskraft gleich; die mittlere Gesichtspartie wich, ebenfalls typisch für diese Form von Minderwuchs, zurück. Vinods Backen waren abgeflacht, und er hatte eine Sattelnase mit aufgestülpter Spitze; der Unterkiefer stand so weit vor, daß einem Vinods Kinn recht markant vorkam, und obwohl sein vorgereckter Kopf ihn eher dümmlich erscheinen ließ, verriet sein ganzes Auftreten eine sehr zielstrebige Persönlichkeit. Seine aggressive Erscheinung wurde noch durch ein anderes, für chondrodystrophe Zwerge typisches Merkmal betont: Da die Röhrenknochen verkürzt sind, schiebt sich die Muskelmasse zusammen, so daß der Eindruck geballter Kraft entsteht. In Vinods Fall hatten lebenslanges Purzelbaumschlagen und andere akrobatische Kunststücke zu einer besonders ausgeprägten Schultermuskulatur geführt; Unterarme und Bizeps traten ebenfalls deutlich hervor. Vinod war ein altgedienter Zirkusclown, sah aber aus wie ein Schläger im Kleinformat. Farrokh hatte ein bißchen Angst vor ihm.
»Was genau wollen Sie eigentlich mit meinem Blut machen?« fragte der zwergwüchsige Clown den Arzt.
»Ich suche nach diesem geheimnisvollen Ding, das aus dir einen Zwerg gemacht hat«, antwortete Dr. Daruwalla.
[22] »Ein Zwerg zu sein ist doch nichts Geheimnisvolles!« konterte Vinod.
»Ich suche nach etwas in deinem Blut, das, falls ich es entdecke, anderen Menschen helfen kann, keine Zwerge zur Welt zu bringen«, erklärte der Doktor.
»Warum wollen Sie, daß es keine Zwerge mehr gibt?« fragte der Zwerg.
»Blutabnehmen tut nicht weh«, gab Dr. Daruwalla zurück. »Die Nadel tut nicht weh.«
»Alle Nadeln tun weh«, sagte Vinod.
»Haben Sie Angst vor der Nadel?« fragte Farrokh den Zwerg.
»Ich brauche mein Blut im Augenblick selbst«, antwortete Vinod.
Die »schon fast schöne« Deepa erlaubte dem Arzt ebenfalls nicht, ihr Zwergenkind mit einer Nadel zu pieksen. Allerdings meinte sowohl sie als auch Vinod, im Great Blue Nile Circus, der noch eine Woche in Bombay gastierte, gebe es eine Menge anderer Zwerge, die Dr. Daruwalla ja vielleicht etwas von ihrem Blut geben würden. Vinod sagte, es wäre ihm eine Freude, den Arzt mit den Clowns vom Blue Nile bekanntzumachen. Dar-über hinaus empfahl er ihm, sie mit Alkohol und Tabak zu bestechen, und gab ihm den guten Rat, den Zweck, für den er ihr Blut benötigte, anders zu formulieren. »Sagen Sie ihnen, Sie brauchen das Blut, um einem sterbenden Zwerg neue Kraft zu geben«, schlug Vinod vor.
So war das Zwergenblut-Projekt in Gang gekommen. Fünfzehn Jahre war es her, daß Dr. Daruwalla das erste Mal zum Zirkusgelände auf dem Cross Maidan gefahren war. Er hatte seine Nadeln, seine Nadelaufsätze aus Plastik und seine gläsernen Röhrchen (sogenannte Vacutainer) dabei. Um sich die Zwerge gewogen zu machen, nahm er zwei Kisten Kingfisher Bier und zwei Stangen Marlboro mit; letztere waren laut Vinod bei seinen [23] Clownkollegen besonders beliebt, weil ihnen der Marlboro-Mann so imponierte. Wie sich herausstellte, hätte Farrokh das Bier besser zu Hause gelassen. In der windstillen Hitze des frühen Abends tranken die Clowns vom Great Blue Nile Circus zuviel Kingfisher. Zwei von ihnen fielen in Ohnmacht, während ihnen der Doktor Blut abnahm, was Vinod als weiteren Beweis dafür wertete, daß er sein Blut besser bis auf den letzten Tropfen für sich behielt.
Sogar die arme Deepa pichelte ein Kingfisher. Kurz vor ihrem Auftritt klagte sie über leichten Schwindel, der sich verstärkte, als sie an den Knien vom fliegenden Trapez hing. Sodann versuchte Deepa, im Sitzen zu schwingen, aber die Hitze war nach oben in die Zeltkuppel gestiegen, so daß sie das Gefühl hatte, mit dem Kopf in der unerträglich heißen Luft steckenzubleiben. Sie fühlte sich erst ein wenig besser, als sie den Holm mit beiden Händen umklammerte und immer kräftiger hin und her schwang. Ihre Passage war die einfachste, die jeder Luftakrobat beherrschte, aber Deepa hatte noch nicht gelernt, wie sie es anstellen mußte, daß der Fänger sie an den Handgelenken zu fassen bekam, bevor sie seine packte. Sie brauchte einfach nur den Holm loszulassen, sobald sich ihr Körper parallel zum Boden befand, und den Kopf nach hinten zu werfen, so daß ihre Schultern tiefer waren als die Füße, damit der Fänger sie an den Knöcheln packen und auffangen konnte. Im Idealfall befand sich ihr Kopf in diesem Augenblick etwa fünfzehn Meter über dem Netz, doch da die Frau des Zwergs eine Anfängerin war, ließ sie das Trapez los, bevor ihr Körper ganz gerade war. Der Fänger mußte sich nach ihr strecken, erwischte sie nur an einem Fuß und noch dazu in einem unglücklichen Winkel. Deepa schrie so laut, als sie sich das Hüftgelenk ausrenkte, daß der Fänger es für das beste hielt, sie ins Netz fallen zu lassen. Dr. Daruwalla hatte nie einen ungeschickteren Sturz gesehen.
Deepa, eine zierliche, dunkelhäutige Frau aus dem ländlichen [24] Maharashtra, mochte achtzehn sein, wirkte auf den Arzt aber wie sechzehn; ihr zwergwüchsiger Sohn Shivaji war knappe zwei Jahre alt. Deepa war mit elf oder zwölf Jahren von ihrer Mutter an den Great Blue Nile verkauft worden – in einem Alter also, in dem ihre Mutter sie ebensogut an ein Bordell hätte verschachern können. Die Frau des Zwergs wußte, daß sie Glück gehabt hatte, bei einem Zirkus gelandet zu sein. Sie war so dünn, daß man im Blue Nile zunächst versucht hatte, eine Kontorsionistin aus ihr zu machen – ein Mädchen ohne Knochen, eine Gummifrau. Doch mit zunehmendem Alter wurde Deepa zu ungelenkig für ein Schlangenmädchen. Selbst Vinod war der Ansicht, daß Deepa zu alt war, als sie mit dem Training als Fliegerin begann; die meisten Trapezkünstler lernen das Fliegen als Kinder.
Die Frau des Zwergs war zwar nicht »schon fast schön«, aber aus einiger Entfernung doch zumindest hübsch. Sie hatte die Stirn voller Pockennarben und wies die typischen Merkmale des Rachitikers auf – den nach vorn gewölbten Thorax und den rachitischen Rosenkranz. (»Rosenkranz« nennt man das deshalb, weil sich an jeder Nahtstelle zwischen Rippe und Brustbeinknorpel eine murmelartige Verdickung befindet, ähnlich einer Perle.) Deepa hatte so kleine Brüste, daß ihr Brustkorb fast so flach war wie bei einem Jungen. Ihre Hüften jedoch waren fraulich, und weil das Sicherheitsnetz unter ihrem Gewicht durchhing, sah es so aus, als läge sie mit dem Gesicht nach unten im Netz, während das Becken nach oben gekippt war – in Richtung auf das einsam schwingende Trapez.
So wie die Fliegerin gefallen war und jetzt im Netz lag, war Farrokh ziemlich sicher, daß Deepas Hüfte das Problem war – nicht der Hals oder das Rückgrat. Doch bevor sie nicht jemand daran hinderte, weiter im Netz herumzuzappeln, wagte sich der Doktor nicht an sie heran. Vinod war sofort ins Netz gekrabbelt, und Farrokh wies ihn nun an, den Kopf seiner Frau zwischen die Knie zu klemmen und sie an den Schultern [25] festzuhalten. Erst als der Zwerg sie so festhielt – erst als Deepa weder den Hals noch den Rücken bewegen noch die Schultern drehen konnte –, wagte sich Dr. Daruwalla ins Netz.
Die ganze Zeit, die Vinod brauchte, um zu seiner Frau ins Netz zu klettern und ihren Kopf zwischen seine Knie zu klemmen und dort festzuhalten – während Dr. Daruwalla in das durchhängende Netz krabbelte und sich langsam und ungeschickt zu den beiden vorarbeitete –, hörte das Netz nicht auf zu schwanken, während das leere Trapez darüber in einem anderen Rhythmus hin und her schwang.
Dr. Daruwalla war noch nie in einem Sicherheitsnetz gewesen. Für einen unsportlichen Menschen wie den Doktor, der (auch schon vor fünfzehn Jahren) ziemlich rundlich war, bedeutete diese Klettertour einen gigantischen Kampf, den zu bestehen ihm nur die Dankbarkeit für seine ersten Zwergenblutproben half. Als er sich in dem schwankenden, bei jedem Tritt nachgebenden Netz auf allen vieren zu der armen, von ihrem Mann fest umklammerten Deepa vorarbeitete, glich er einer zaghaften, fetten Maus, die ein riesiges Spinnennetz überquert.
Farrokhs unsinnige Angst, aus dem Netz geschleudert zu werden, lenkte ihn wenigstens von dem Gemurmel des Zirkuspublikums ab; die Leute warteten ungeduldig darauf, daß die Rettungsmaßnahmen zügig vorangingen. Daß Dr. Daruwalla der unruhigen Menge über Lautsprecher vorgestellt wurde, bereitete ihn keineswegs auf die Schwierigkeit seines Unterfangens vor. »Und da kommt auch schon der Doktor!« hatte der Zirkusdirektor lauthals verkündet, ein melodramatischer Versuch, die Menge bei Laune zu halten. Aber es dauerte eine Ewigkeit, bis der Arzt die abgestürzte Fliegerin erreichte. Dazu kam, daß das Netz unter Farrokhs Gewicht noch weiter durchhing, so daß er aussah wie ein unbeholfener Liebhaber, der sich auf einem weichen, in der Mitte einsackenden Bett an das Objekt seiner Lust heranpirscht.
[26] Dann plötzlich fiel das Netz so steil ab, daß der korpulente Dr. Daruwalla das Gleichgewicht verlor und ungeschickt nach vorn fiel. Seine Finger stießen durch die Maschen im Netz, und da er seine Sandalen ausgezogen hatte, bevor er ins Netz geklettert war, versuchte er, auch die Zehen (wie Klauen) durch die Löcher zu stecken. Doch so sehr er sich auch bemühte, seinen Schwung abzubremsen (der jetzt endlich ein für das gelangweilte Publikum interessantes Tempo erreicht hatte): die Schwerkraft siegte. Dr. Daruwalla landete kopfüber auf Deepas Bauch, der in einem paillettenbestickten, enganliegenden Trikot steckte.
Ihr Hals und ihre Wirbelsäule waren unverletzt – der Doktor hatte die Verletzung von seinem Platz aus aufgrund der Art des Falls richtig diagnostiziert. Deepas Hüftgelenk war ausgerenkt, so daß es ihr ziemlich weh tat, als er auf ihren Unterleib fiel. Die rosafarbenen und knallroten Pailletten, die auf Deepas Bauch einen Stern bildeten, hinterließen Schrammen auf Farrokhs Stirn, und sein Nasenrücken wurde von ihrem Schambein abrupt abgebremst.
Unter grundsätzlich anderen Voraussetzungen hätte dieser Zusammenprall vielleicht prickelnd sein können, nicht jedoch für eine Frau mit ausgerenkter Hüfte (deren Kopf fest zwischen den Knien eines Zwergs klemmte). Dr. Daruwalla sollte diese Begegnung mit Deepas Schambein – ungeachtet ihrer Schmerzen und Schreie – für sich als einzigen »außerehelichen« sexuellen Kontakt verbuchen. Er würde ihn nie vergessen.
Da hatte man ihn aus dem Publikum geholt, um der Frau eines Zwergs in ihrer Not zu helfen. Und nun war er, vor den Augen der unbeeindruckten Menge, der verletzten Frau mit dem Gesicht in den Schritt geknallt. Was Wunder, daß er weder Deepa noch die gemischten Gefühle, die sie bei ihm hervorgerufen hatte, vergessen konnte.
Noch heute, nach all den Jahren, errötete Farrokh vor [27] Verlegenheit und verspürte ein angenehmes Prickeln, wenn er an den erregenden, straffen Bauch der Trapezkünstlerin zurückdachte. Dort, wo seine Wange an der Innenseite ihres Schenkels gelegen hatte, vermeinte er noch immer ihre schweißnassen Strümpfe zu spüren. Die ganze Zeit hörte er Deepas Schmerzensschreie (während er sich ungeschickt bemühte, sich von ihr hinunterzuwälzen), und außerdem hörte er den Knorpel in seiner Nase knacken, denn Deepas Schambein war hart wie ein Knöchel oder Ellbogen. Und als er ihren gefährlichen Duft einatmete, glaubte er endlich den Geruch von Sex identifiziert zu haben, der ihm wie ein erdiges Gemisch aus Tod und Blumen vorkam.
Dort, in dem schwankenden Netz, machte ihm Vinod zum erstenmal Vorwürfe. »Das alles ist nur passiert, weil Sie unbedingt Zwergenblut wollen«, sagte der Zwerg.
Der Doktor sinnt über Lady Duckworths Brüste nach
In fünfzehn Jahren hatten die indischen Zollbehörden Dr. Daruwalla ganze zweimal aufgehalten, beide Male wegen der Einwegkanülen – ungefähr hundert an der Zahl. Beide Male mußte er den Unterschied erklären zwischen normalen Spritzen, mit denen Injektionen gegeben werden, und den sogenannten Vacutainern, mit denen Blut abgenommen wird. Im zweiten Fall sind weder die Glasröhrchen noch die Nadelaufsätze aus Plastik mit Kolben versehen. Der Doktor führte keine Spritzen mit, mit denen man Medikamente spritzte, sondern Vacutainer, mit denen man Blut abnahm.
»Und wem wird Blut abgenommen?« hatte der Zollbeamte gefragt.
Sogar diese Frage hatte sich leichter beantworten und [28] erläutern lassen als das Problem, das sich ihm im Augenblickstellte.
Das augenblickliche Problem bestand darin, daß Dr. Daruwalla schlechte Nachrichten für den berühmten Schauspieler mit dem unwahrscheinlichen Namen Inspector Dhar hatte. Der Doktor, der sich gerne vor der Aufgabe gedrückt hätte, nahm sich vor, dem Filmstar die schlechte Nachricht an einem öffentlichen Ort mitzuteilen. Da Inspector Dhar für sein beherrschtes Auftreten in der Öffentlichkeit berühmt war, glaubte sich Farrokh darauf verlassen zu können, daß der Schauspieler Haltung bewahren würde. Nicht jedermann in Bombay hätte einen privaten Club als öffentlichen Ort betrachtet, aber nach Dr. Daruwallas Ansicht war dieser für die bevorstehende heikle Unterredung genau richtig: nicht zu privat und nicht zu öffentlich.
Als der Doktor an jenem Morgen im Duckworth Sports Club eintraf, fand er nichts dabei, als er über dem Golfplatz hoch am Himmel einen Geier erblickte. Er betrachtete den Todesvogel keineswegs als schlechtes Omen für die unliebsame Nachricht, die er zu überbringen hatte. Der Club befand sich in Mahalaxmi, unweit vom Malabar Hill, und jedermann in Bombay wußte, warum es die Geier nach Malabar Hill zog. Wenn ein Leichnam in die Türme des Schweigens gebracht wurde, konnten die Geier bis auf dreißig Meilen im Umkreis von Bombay die faulenden Überreste riechen.
Farrokh war mit den Bestattungsriten der Parsen, Doongarwadi genannt, vertraut. Die sogenannten Türme des Schweigens, die den Parsen als Begräbnisstätte dienen, sind sieben gewaltige Mauerringe auf dem Malabar Hill, in die sie die nackten Leiber ihrer Toten legen, um sie von den Aasfressern sauber abpicken zu lassen. Dr. Daruwalla, der selbst ein Parse war, stammte von persischen Anhängern der Lehre des Zarathustra ab, die im siebten und achten Jahrhundert nach Indien [29] gekommen waren, um der Verfolgung durch die Muslime zu entgehen. Doch Farrokhs Vater war ein derart vehementer und erbitterter Atheist gewesen, daß sein Sohn den Glauben seiner Vorfahren nie praktiziert hatte. Farrokhs Übertritt zum Christentum hätte seinen gottlosen Vater ohne Zweifel umgebracht, wenn dieser nicht schon tot gewesen wäre; denn Dr. Daruwalla konvertierte erst mit knapp vierzig Jahren.
Da Dr. Daruwalla inzwischen Christ war, würden seine sterblichen Überreste niemals in die Türme des Schweigens gebracht werden; doch trotz des hitzigen Atheismus seines Vaters respektierte er die Bräuche der anderen Parsen und gläubigen Anhänger der zoroastrischen Lehre – und rechnete sogar damit, Geier zur Ridge Road und zurückfliegen zu sehen. Und so überraschte es ihn auch nicht, daß dieser eine Geier über dem Duckworth-Golfplatz es offensichtlich nicht eilig hatte, zu den Türmen des Schweigens zu gelangen. Dort war alles mit dichtem Pflanzengestrüpp bewachsen, und niemand, nicht einmal ein Parse, war auf dem Bestattungsgelände willkommen, es sei denn, er war tot.
Im allgemeinen war Dr. Daruwalla den Geiern wohlgesonnen. Die Kalksteinmauern trugen dazu bei, daß sich selbst größere Knochen rasch zersetzten, und die Teile der toten Parsen, die unbeschadet blieben, wurden in der Monsunzeit vom Regen fortgeschwemmt. Was die Entsorgung der Toten betraf, hatten die Parsen nach Ansicht des Doktors eine bewundernswerte Lösung gefunden.
Aber zurück zu den Lebenden. Dr. Daruwalla war an diesem Morgen, wie an den meisten Tagen, früh aufgestanden. Unter den ersten Operationen in der Klinik für Verkrüppelte Kinder, wo er nach wie vor unentgeltlich als chirurgischer Konsiliar arbeitete, waren ein Klumpfuß und ein Schiefhals. Die zweite Operation wird heutzutage nur selten durchgeführt – und gehörte auch nicht zu den Eingriffen, denen Farrokhs [30] Hauptinteresse während seiner sporadischen orthopädischen Tätigkeit in Bombay galt. Er interessierte sich mehr für Knochen- und Gelenkinfektionen. In Indien treten solche Infektionen üblicherweise nach Verkehrsunfällen mit komplizierten Frakturen auf; die Fraktur ist der Luft ausgesetzt, weil die Haut verletzt ist, und fünf Wochen nach dem Unfall quillt Eiter aus einer Fistel (einem von faltiger Haut umgebenen Verbindungsgang zwischen infizierter Stelle und Oberhaut) in der Wunde. Solche Infektionen sind chronisch, weil der Knochen abgestorben ist und sich abgestorbener Knochen, Sequester genannt, wie ein Fremdkörper verhält. Deshalb wurde Farrokh von seinen Orthopädenkollegen in Bombay gern als »Sequester«-Daruwalla bezeichnet – ein paar, die ihn besonders gut kannten, nannten ihn auch »Zwergenblut«-Daruwalla. Aber Spaß beiseite, Knochen- und Gelenkentzündungen waren kein weiteres Hobby, sondern Farrokhs Spezialgebiet.
In Kanada kam es dem Doktor oft so vor, als bekäme er in seiner orthopädischen Praxis beinahe so viele Sportverletzungen zu sehen wie Geburtsschäden oder spastische Versteifungen. In Toronto war Dr. Daruwallas Spezialgebiet nach wie vor die Kinderorthopädie, aber viel dringender gebraucht – und daher lebendiger – fühlte er sich in Bombay. In Indien kamen die Orthopädiepatienten oft mit Taschentüchern um die Beine in die Klinik. Diese Taschentücher bedeckten Fistelgänge, aus denen kleine Mengen Eiter sickerten – jahrelang. Zudem nahmen in Bombay Patienten wie auch Chirurgen Amputationen und einfache, schnell angepaßte Prothesen eher in Kauf. In Toronto, wo Dr. Daruwalla für eine neue Technik im Bereich der Mikrogefäßchirurgie bekannt war, wären solche Behandlungsmethoden undenkbar gewesen.
In Indien war keine Heilung möglich, ohne daß der abgestorbene Knochen entfernt wurde, und da häufig zuviel abgestorbener Knochen entfernt werden mußte, wäre der Arm oder [31] das Bein nicht mehr belastbar gewesen. In Kanada hingegen konnte Farrokh dank langfristiger, intravenös verabreichter Antibiotika den abgestorbenen Knochen entfernen und anschließend einen Muskel samt Blutversorgung in den infizierten Bereich einsetzen. Eingriffe dieser Art waren in Bombay nicht möglich – es sei denn, Dr. Daruwalla hätte ausschließlich sehr reiche Leute in Krankenhäusern wie Jaslok behandelt. In der Klinik für Verkrüppelte Kinder beschränkte sich der Doktor darauf, die Funktionsfähigkeit der Gliedmaßen so schnell wie möglich wiederherzustellen, was häufig auf eine Amputation und eine Prothese statt wirklicher Heilung hinauslief. Für Dr. Daruwalla war ein Fistelgang, aus dem Eiter sickerte, nicht das Schlimmste; in Indien ließ er den Eiter sickern.
Der Doktor war ein überzeugter Anglikaner, der die Katholiken mit Mißtrauen und Ehrfurcht zugleich betrachtete. Wie die meisten konvertierten Christen ließ sich Dr. Daruwalla vom Weihnachtstrubel anstecken, der in Bombay nicht mit so viel kommerziellem Pomp und penetranter Betriebsamkeit einhergeht wie in den christlichen Ländern. Dieses Jahr beging Dr. Daruwalla Weihnachten mit maßvoller Fröhlichkeit: Am Heiligabend hatte er eine katholische Messe besucht, am Weihnachtstag einen anglikanischen Gottesdienst. Er ging nur an Festtagen in die Kirche, aber auch das nicht regelmäßig. Sein doppelter Kirchgang war eine unerklärliche Überdosis, so daß sich seine Frau Sorgen um ihn machte.
Farrokhs Frau war Wienerin, mit Mädchennamen Julia Zilk – nicht verwandt mit dem Bürgermeister gleichen Namens. Das ehemalige Fräulein Zilk stammte aus einer vornehmen und einflußreichen katholischen Familie. Während der seltenen Aufenthalte der Daruwallas in Bombay hatten die Kinder Jesuitenschulen besucht; nicht etwa, weil sie katholisch erzogen wurden, sondern weil Farrokh die »familiären Verbindungen« zu diesen Schulen aufrechterhalten wollte, die nicht [32] jedermann zugänglich waren. Dr. Daruwallas Kinder waren konfirmierte Anglikaner, die in Toronto auf eine anglikanische Schule gingen.
Doch obwohl Farrokh den protestantischen Glauben vorzog, lud er am zweiten Weihnachtsfeiertag lieber seine wenigen jesuitischen Bekannten ein, weil sie ungleich lebhaftere Gesprächspartner waren als die Anglikaner, die Dr. Daruwalla in Bombay kannte. Weihnachten war an sich eine fröhliche Zeit, in der der Doktor stets vor Wohlwollen überquoll. Zur Weihnachtszeit konnte er beinahe vergessen, daß die Begeisterung, mit der er vor zwanzig Jahren zum Christentum übergetreten war, allmählich abflaute.
Dr. Daruwalla dachte nicht weiter über den Geier über dem Golfplatz des Duckworth Club nach. Die einzige Wolke an seinem Horizont war die Frage, wie er Inspector Dhar die beunruhigende Neuigkeit beibringen sollte, die für den lieben Jungen keineswegs eine frohe Botschaft sein würde. Für ihn selbst war die Woche bis zu dieser unvorhersehbaren Hiobsbotschaft gar nicht so schlecht verlaufen.
Es war die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. In Bombay war es ungewöhnlich kühl und trocken. Die Zahl der aktiven Mitglieder des Duckworth Sports Club war bei sechstausend angekommen. Weil für neue Mitglieder eine Wartezeit von 22 Jahren bestand, war diese Mitgliederzahl nur langsam erreicht worden. An diesem Morgen fand eine Sitzung des Mitgliederausschusses statt, bei der der distinguierte Dr. Daruwalla den Ehrenvorsitz führte und in der darüber entschieden werden sollte, ob Mitglied Nummer sechstausend in besonderer Form von seinem außergewöhnlichen Status in Kenntnis gesetzt werden sollte. Die Vorschläge reichten von einer Ehrentafel im Billardzimmer (wo zwischen den Trophäen ansehnliche Lücken klafften) über einen kleinen Empfang im Ladies’ Garden (wo die Bougainvilleenblüten von einer noch nicht diagnostizierten [33] Pflanzenkrankheit befallen waren) bis hin zu einer schlichten, maschinegeschriebenen Meldung, die neben der Liste der Vorläufig Ausgewählten Mitglieder ausgehängt werden sollte.
Farrokh hatte sich oft gegen die Überschrift dieser Liste gewehrt, die in der Eingangshalle des Duckworth Club in einem verschlossenen Glaskästchen hing. Er beklagte sich darüber, daß »vorläufig ausgewählt« nichts anderes bedeutete als »nominiert« – sie wurden nämlich keineswegs ausgewählt –, aber diese Bezeichnung war seit der Gründung des Clubs vor einhundertdreißig Jahren eben üblich. Neben der kurzen Namensliste hockte eine Spinne. Sie hockte schon so lange dort, daß sie vermutlich tot war – oder vielleicht strebte die Spinne ebenfalls die feste Mitgliedschaft an. Dieser Scherz stammte von Dr. Daruwalla, war aber schon so alt, daß das Gerücht ging, sämtliche sechstausend Mitglieder hätten ihn bereits weitererzählt.
Es war Vormittag, und die Ausschußmitglieder tranken im Kartenzimmer Thums Up Cola und Gold Spot Orangenlimonade, als Dr. Daruwalla vorschlug, die Angelegenheit fallenzulassen.
»Fallenlassen?« fragte Mr. Dua, der seit einem unvergeßlichen Tennisunfall auf einem Ohr taub war: Sein Partner im Doppel hatte einen Doppelfehler gemacht und den Schläger erbost von sich geschleudert. Bedauerlicherweise war er zu diesem Zeitpunkt erst »vorläufig ausgewählt«, und daß er seiner schlechten Laune so empörend freien Lauf ließ, bescherte seinem Streben nach fester Mitgliedschaft ein frühzeitiges Ende.
»Ich beantrage«, rief Dr. Daruwalla, »daß Mitglied Nummer sechstausend nicht besonders gefeiert wird!« Der Antrag wurde unterstützt und rasch verabschiedet; nicht einmal eine getippte Notiz würde das Ereignis verkünden. Dr. Sorabjee, ein Kollege von Farrokh in der Klinik für Verkrüppelte Kinder, meinte scherzhaft, diese Entscheidung gehöre zu den klügsten, die der Mitgliederausschuß je getroffen habe. In Wirklichkeit, so dachte [34] Dr. Daruwalla, wollte nur niemand riskieren, die Spinne aufzuscheuchen.
Die Ausschußmitglieder saßen schweigend im Kartenzimmer, zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Beratung. Die Deckenventilatoren brachten die ordentlichen Kartenhäufchen, die genau plaziert auf den jeweiligen, straff mit grünem Filz bespannten Tischen lagen, nur geringfügig in Unordnung. Ein Kellner, der eine leere Thums-Up-Flasche vom Tisch der Ausschußmitglieder entfernte, rückte, bevor er den Raum verließ, ein leicht derangiertes Kartenspiel zurecht, obwohl nur die obersten zwei Karten leicht verschoben waren.
In diesem Augenblick betrat Mr. Bannerjee das Kartenzimmer, um nach seinem Golfpartner, Mr. Lal, Ausschau zu halten. Der alte Mr. Lal war noch nicht zu den gewohnten neun Löchern erschienen, und Mr. Bannerjee berichtete dem Ausschuß von dem amüsanten Ergebnis ihrer gestrigen Runde. Mr. Lal, der einen Schlag in Führung lag, hatte diesen Vorsprung durch einen spektakulären Schnitzer am neunten Loch eingebüßt; er hatte einen Chip weit über das Green hinaus in ein Dickicht kränkelnder Bougainvilleen geschlagen, in dem er dann kreuzunglücklich und ohne Erfolg herumdrosch.
Statt ins Clubhaus zurückzukehren, hatte Mr. Lal Mr. Bannerjee die Hand geschüttelt und war wutentbrannt zu den Bougainvilleen gestapft, wo ihn Mr. Bannerjee dann sich selbst überlassen hatte. Mr. Lal wollte unbedingt üben, wie er dieser Falle entrinnen konnte, falls er je wieder hineintappen sollte. Blütenblätter flogen umher, als Mr. Bannerjee sich von seinem Freund trennte. An diesem Abend bemerkte der Gärtner (der Obermali höchstpersönlich) zu seinem Mißfallen den Schaden an den Zweigen und Blüten, doch der alte Mr. Lal gehörte zu den besonders ehrenwerten Clubmitgliedern – und wenn er darauf bestand zu trainieren, wie er wieder aus den Bougainvilleen herauskam, würde niemand die Stirn haben, ihn daran zu hindern. [35] Und nun kam Mr. Lal zu spät. Um Mr. Bannerjee zu beruhigen, meinte Dr. Daruwalla, sein Kontrahent würde sicher noch üben und er solle doch in den ruinierten Bougainvilleen nach ihmsuchen.
So löste sich die Ausschußsitzung unter dem typischen, oberflächlichen Gelächter auf. Mr. Bannerjee suchte Mr. Lal im Umkleideraum der Herren; Dr. Sorabjee begab sich in die Klinik zu seiner Sprechstunde; Mr. Dua, über dessen Taubheit man sich nicht zu wundern brauchte, nachdem er früher ein lärmendes Autoreifengeschäft betrieben hatte, schlenderte ins Billardzimmer, um sich an ein paar unschuldigen Kugeln zu versuchen, deren Klacken er kaum hören würde. Die anderen Ausschußmitglieder blieben, wo sie waren, wandten sich den bereitliegenden Spielkarten zu oder machten es sich in den kühlen Ledersesseln in der Bibliothek bequem, wo sie ihr Kingfisher Lager oder ihr London Diätbier bestellten. Inzwischen war es später Vormittag, nach allgemeinem Dafürhalten jedoch noch zu früh für einen Gin Tonic oder einen Schuß Rum in die Cola.
Im Umkleideraum der Herren und in der Bar fanden sich jetzt die jüngeren Mitglieder und eigentlichen Sportler ein, die von ihrem Tennismatch oder vom Badminton oder Squash zurückkamen. Um diese Tageszeit tranken sie zumeist Tee. Die Spieler, die vom Golfplatz zurückkehrten, beschwerten sich lautstark über die unansehnlichen Blütenblätter, die es inzwischen zum neunten Loch hinübergeweht hatte. (Sie gingen irrtümlich davon aus, daß der Befall der Bougainvilleen noch unerfreulichere Ausmaße angenommen hatte.) Mr. Bannerjee erzählte seine Geschichte noch ein paarmal, und jedesmal schilderte er Mr. Lals Bemühungen, den Bougainvilleen Herr zu werden, als noch verwegener und noch destruktiver. Überall im Clubhaus und im Ankleideraum war man bester Stimmung. Mr. Bannerjee schien es nichts auszumachen, daß der Vormittag zu weit fortgeschritten war, um noch Golf zu spielen.
[36] Das unerwartet kühle Wetter änderte nichts an den Gewohnheiten der Duckworthianer, die Golf und Tennis vor elf Uhr vormittags oder nach vier Uhr nachmittags zu spielen pflegten. Während der Mittagsstunden tranken die Clubmitglieder etwas, nahmen einen Lunch zu sich oder saßen einfach nur unter den Deckenventilatoren oder im tiefen Schatten des Ladies’ Garden, der nie ausschließlich von Damen genutzt (und auch nicht übermäßig von ihnen frequentiert) wurde – heutzutage jedenfalls nicht mehr. Doch den Namen des Gartens hatte man seit den Zeiten der purdah unverändert beibehalten, als bei einigen Muslimen und Hindus die Frauen noch in völliger Abgeschiedenheit lebten, um nicht den Blicken der Männer oder fremder Leute ausgesetzt zu sein. Farrokh fand das eigenartig, denn die Gründungsmitglieder des Duckworth Sports Club waren Briten gewesen, die hier nach wie vor willkommen waren und sogar einen kleinen Anteil der Mitglieder stellten. Soweit Dr. Daruwalla wußte, war es bei den Briten nie üblich gewesen, daß sich die Frauen separierten. Die Gründer hatten einen Club im Sinn gehabt, der jedem Bürger von Bombay offenstand, vorausgesetzt, er hatte sich als führende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens hervorgetan. Wie Farrokh und die anderen Mitglieder des Ausschusses bestätigt hätten, ließ sich über die Definition von »führende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens« eine ganze Regenzeit lang – und länger – diskutieren.
Traditionellerweise war der Vorsitzende des Duckworth Club der Gouverneur von Maharashtra. Lord Duckworth, nach dem der Club benannt worden war, hatte es allerdings nie zum Gouverneur gebracht. Lord D. (wie er genannt wurde) hatte dieses Amt lange angestrebt, doch wegen der berühmt-berüchtigten Auftritte seiner Frau nicht erreicht. Lady Duckworth war mit Exhibitionismus im allgemeinen geschlagen und dem unwiderstehlichen Bedürfnis, ihre Brüste zu entblößen, im [37] besonderen. Obwohl diese Unsitte Lord und Lady Duckworth die Zuneigung vieler Clubmitglieder eintrug, war sie mit einem Regierungsamt einfach nicht zu vereinbaren.
Dr. Daruwalla stand in dem kühlen, leeren Tanzsaal, wo er wieder einmal die unzähligen prachtvollen Trophäen und die faszinierenden alten Fotografien verblichener Mitglieder betrachtete. Farrokh genoß es, seinen Vater und seinen Großvater und die zahllosen uralten Herren, die zu ihren Freunden gezählt hatten, in diesem Rahmen zu betrachten. Er bildete sich ein, sich an jeden Menschen erinnern zu können, der ihm hier je die Hand auf die Schulter oder auf den Kopf gelegt hatte. Dr. Daruwallas Vertrautheit mit diesen Fotografien täuschte über die Tatsache hinweg, daß er nur wenige seiner neunundfünfzig Lebensjahre in Indien verbracht hatte. Wenn er zu Besuch nach Bombay kam, reagierte er empfindlich auf alles und alle, die ihn daran erinnerten, wie wenig er das Land, in dem er geboren war, kannte und verstand. Je mehr Zeit er im sicheren Hort des Duckworth Club verbrachte, um so besser konnte er sich die Illusion bewahren, daß er sich in Indien wohl fühlte.
Daheim in Toronto, wo er die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens verbracht hatte, stand der Doktor vor allem bei Indern, die nie in Indien gewesen waren oder nie dorthin zurückkehren würden, in dem Ruf, ein echter »alter Indien-Hase« zu sein; man fand ihn sogar ziemlich tapfer. Schließlich kehrte er alle paar Jahre in das Land seiner Herkunft zurück. Und dort arbeitete er als Arzt – unter Umständen, die man sich als primitiv vorstellte, in einem Land, das bis zur Grenze der Klaustrophobie überbevölkert war. Wo blieben da die Annehmlichkeiten, die es mit dem kanadischen Lebensstandard hätten aufnehmen können?
In Indien gab es doch Wasserknappheit und Brotstreiks, und Öl und Reis wurden rationiert, ganz zu schweigen von der völlig unterschiedlichen Zubereitung der Speisen und diesen [38] komischen Gasflaschen, die natürlich immer mitten in der Dinnerparty leer wurden. Und man hörte ja auch häufig von der lausigen Bauweise der Häuser – abbröckelnder Putz und dergleichen. Aber Dr. Daruwalla kehrte nur selten während der Monsunmonate nach Indien zurück, die in Bombay die »primitivsten« waren. Außerdem neigte Farrokh gegenüber seinen Mitbürgern in Toronto dazu, die Tatsache, daß er nie lange in Indien blieb, herunterzuspielen.
In Toronto schilderte der Doktor seine Kindheit (in Bombay) sowohl farbenfroher als auch typischer indisch, als sie in Wirklichkeit gewesen war. Er hatte als Junge die (von Jesuiten geführte) St. Ignatius-Schule in Mazgaon besucht und in seiner Freizeit die Vorzüge organisierter Sport- und Tanzveranstaltungen im Duckworth Club genossen. Zum Studium schickten ihn seine Eltern nach Österreich. Selbst die acht Jahre in Wien, wo er Medizin studierte, verliefen zahm und unter Aufsicht – er wohnte die ganze Zeit bei seinem älteren Bruder.
Doch im Tanzsaal des Duckworth Club, in der hehren Umgebung dieser Porträts verblichener Mitglieder, konnte sich Dr. Daruwalla vorübergehend einbilden, daß er wirklich von irgendwoher kam und irgendwo hingehörte. Mit zunehmendem Alter – er war jetzt fast sechzig – sah er (freilich nur im stillen) ein, daß er in Toronto oft indischer auftrat, als er in Wirklichkeit war. Er konnte von einer Sekunde auf die andere einen Hindi-Akzent annehmen oder ihn ablegen, je nachdem, mit wem er es zu tun hatte. Nur ein anderer Parse hätte gemerkt, daß Englisch die eigentliche Muttersprache des Doktors war und er sein Hindi in der Schule gelernt hatte. Umgekehrt wurde sich Farrokh in Indien schamvoll bewußt, wie betont europäisch oder nordamerikanisch er sich hier gab. In Bombay verschwand sein Hindi-Akzent, und wer ihn englisch sprechen hörte, mußte annehmen, daß er sich in Kanada vollständig assimiliert hatte. In Wirklichkeit fühlte sich Dr. Daruwalla nur [39] inmitten der alten Fotografien im Tanzsaal des Duckworth Club zu Hause.
Die Geschichte von Lady Duckworth kannte Dr. Daruwalla nur vom Hörensagen. Auf den beeindruckenden Fotos, die es von ihr gab, waren ihre Brüste angemessen, wenn auch etwas spärlich bedeckt. In der Tat zeigten die Bilder von Lady Duckworth einen hohen, ansehnlichen Busen, selbst als die Dame schon in recht fortgeschrittenem Alter war; und ihre Entblößungsmanie soll mit den Jahren sogar noch zugenommen haben. Angeblich waren ihre Brüste auch noch jenseits der Siebzig durchaus wohlgestaltet (und wert, enthüllt zu werden).
Mit fünfundsiebzig hatte sie sich auf der kreisrunden Auffahrt zum Club vor einer Schar junger Leute entblößt, die zum Ball der Söhne und Töchter von Mitgliedern kamen. Die Folge dieses Vorfalls war eine Massenkarambolage, die angeblich dazu führte, daß die Betonschwellen entlang der Zufahrt erhöht wurden. Nach Farrokhs Ansicht hielt man sich im Duckworth Club beharrlich an das Tempo, das die Schilder an beiden Enden der Auffahrt vorschrieben: GANZ LANGSAM! Doch das war Dr. Daruwalla eigentlich ganz recht; er empfand die Vorschrift, GANZ LANGSAM zu fahren, keineswegs als Zumutung, bedauerte es allerdings, daß es ihm nicht vergönnt gewesen war, wenigstens einen Blick auf Lady Duckworths längst verblichene Brüste zu werfen. Zu ihrer Zeit hatte sich der Club sicher nicht so langsam bewegt.
Dr. Daruwalla stieß, wie sicher schon hundertmal, einen lauten Seufzer im leeren Tanzsaal aus und sagte leise zu sich selbst: »Das waren die guten alten Zeiten.« Aber es war nur ein Scherz; er meinte es nicht ernst. Diese »guten alten Zeiten« waren für ihn ebenso unergründlich wie Kanada – seine kalte Wahlheimat – oder Indien, wo er nur so tat, als würde er sich wohlfühlen. Außerdem sprach oder seufzte Farrokh nie so laut, daß ihn jemand hörte.
[40] Er stand in dem weitläufigen, kühlen Saal und horchte: Er hörte die Kellner und Hilfskellner im Speisesaal, die die Tische für den Lunch deckten; er hörte das Klacken und Anschlagen der Billardkugeln und das entschiedene, gebieterische Klatschen der Spielkarten, die an einem der Tische aufgedeckt wurden. Es war bereits nach elf Uhr, zwei Unermüdliche spielten noch immer Tennis; dem weichen, gemächlichen Ploppen des Balls nach zu schließen, war es kein sonderlich schwungvolles Match.
Das Gefährt, das die Zufahrtsstraße entlangraste und mit Hingabe über jede Bremsschwelle ratterte, gehörte ohne Zweifel dem Obergärtner, denn es folgte das dröhnende Klappern von Hacken und Rechen und Spaten, und dann ein unverständlicher Fluch – der Obermali war ein Schwachkopf.
Eine Fotografie mochte Farrokh besonders gern. Er betrachtete sie aufmerksam und schloß dann die Augen, um sich das Bild deutlicher einzuprägen. Lord Duckworths Gesichtsausdruck verriet ein großes Maß an Nächstenliebe, Toleranz und Geduld, und doch lag in seinem geistesabwesenden Blick so etwas wie Bestürzung, als hätte er gerade erst seine eigene Nutzlosigkeit erkannt und akzeptiert. Obwohl Lord Duckworth breite Schultern und einen mächtigen Brustkorb hatte und entschlossen ein Schwert in der Hand hielt, verrieten die nach unten gezogenen Augenwinkel und die herabhängenden Schnurrbartenden die Resignation eines freundlichen Dummkopfs. Er war andauernd fast Gouverneur von Maharashtra, aber eben nie wirklich. Und die Hand, die er um Lady Duckworths mädchenhafte Taille gelegt hatte, berührte sie deutlich ohne Gewicht und hielt sie ohne Kraft – sofern sie sie überhaupt hielt.
Lord D. beging am Silvesterabend Selbstmord, genau zu Beginn des Jahrhunderts. Lady Duckworth entblößte ihre Brüste noch viele Jahre lang, aber man war sich einig, daß sie sich als [41] Witwe zwar häufiger entblößte, aber nur halbherzig. Ein paar Zyniker meinten, daß Lady D., hätte sie weitergelebt und Indien noch länger ihre Reize gezeigt, womöglich die Unabhängigkeit vereitelt hätte.
Auf dem Foto, das Dr. Daruwalla so gern mochte, zeigte Lady Duckworths Kinn nach unten, und ihre Augen blickten spitzbübisch nach oben, als wäre sie gerade dabei ertappt worden, wie sie in ihr eigenes hinreißendes Dekolleté spitzt, und hätte sofort weggeschaut. Ihr Busen war ein breiter, kräftiger Sims, auf dem ihr hübsches Gesicht ruhte. Selbst wenn diese Frau vollständig bekleidet war, hatte sie etwas Ungehemmtes an sich. Ihre Arme hingen neben dem Körper herunter, aber die Finger waren weit gespreizt – die Handflächen der Kamera zugewandt wie für eine Kreuzigung –, und eine ungebärdige Strähne ihres angeblich blonden Haares, das ansonsten hoch über ihrem graziösen Hals festgesteckt war, hatte sich gelöst und wand sich, schlangengleich und kringelig wie bei einem Kind, um ein absolut vollkommenes, kleines Ohr.
In späteren Jahren wurde Lady Duckworths blondes Haar grau, ohne seine dichte Fülle oder seinen intensiven Glanz einzubüßen; ihre Brüste, obwohl so häufig und ausgiebig entblößt, hingen nie nach unten. Dr. Daruwalla war glücklich verheiratet. Trotzdem hätte er – sogar seiner lieben Frau gegenüber – zugegeben, daß er in Lady Duckworth verliebt war; er hatte sich schon als Kind in ihre Fotografien und in ihre Geschichte verliebt.
Aber manchmal stimmte es den Doktor auch traurig, wenn er zuviel Zeit im Tanzsaal verbrachte und sich die Fotografien der ehemaligen Clubmitglieder ansah. Die meisten waren inzwischen gestorben. Sie waren, wie die Zirkusleute von ihren Toten sagen, ohne Netz abgestürzt. Wenn sie von den Lebenden sprachen, kehrten sie den Ausdruck um. Sooft sich Dr. Daruwalla nach Vinods Gesundheit erkundigte – er versäumte [42] auch nie nachzufragen, wie es der Frau des Zwergs ging –, antwortete Vinod stets: »Wir fallen noch immer ins Netz.«
Von Lady Duckworths Brüsten hätte Farrokh – zumindest aufgrund der Fotos – behauptet, daß sie noch immer ins Netz fielen. Vielleicht waren sie ja unsterblich.
Mr. Lal hat das Netz verfehlt
Und dann plötzlich riß ein kleiner und scheinbar unbedeutender Vorfall Dr. Daruwalla aus seinem verzückten Nachsinnen über Lady Duckworths Busen. Der Doktor müßte schon einen Zugang zu seinem Unterbewußtsein haben, wollte er sich später daran erinnern, denn es handelte sich lediglich um eine winzige Turbulenz im Speisesaal, die seine Aufmerksamkeit erregte. Eine Krähe, die etwas Glänzendes im Schnabel hielt, war durch die offene Verandatür hereingeschwirrt und verwegen auf dem breiten, ruderblattähnlichen Flügel eines Deckenventilators gelandet. Zwar brachte sie das Ding in eine bedenkliche Schieflage, aber sie drehte Runde um Runde auf dem Flügel und kleckerte dabei gleichmäßig im Kreis – auf den Boden, auf einen Teil des Tischtuchs und auf einen Teller Salat, haarscharf neben die Gabel. Ein Kellner wedelte mit seiner Serviette, und die Krähe flog auf, entwischte mit heiserem Krächzen durch die Verandatür und schwang sich über dem Golfplatz, der glänzend in der Mittagssonne lag, in den Himmel. Was immer sie im Schnabel gehabt hatte, war verschwunden, verschluckt vielleicht. Erst stürzten die Kellner und Hilfskellner herbei, um das beschmutzte Tischtuch und das Gedeck auszuwechseln, obwohl es ohnehin noch zu früh für den Lunch war; dann wurde ein Hausdiener gerufen, um den Boden aufzuwischen.
Da Dr. Daruwalla am frühen Morgen operierte, aß er eher zu Mittag als die meisten Duckworthianer. Er hatte sich mit [43] Inspector Dhar für halb eins zum Lunch verabredet. Der Doktor schlenderte in den Ladies’ Garden, wo er eine Lücke in der dicht zugewachsenen Laube entdeckte, die den Blick auf ein Stück Himmel über dem Golfplatz freigab; dort machte er es sich in einem rosafarbenen Korbstuhl bequem. Als er sich hinsetzte, wurde ihm offenbar sein kleiner Schmerbauch bewußt, denn er bestellte sich ein London Diätbier, obwohl er eigentlich Lust auf ein Kingfisher Lager hatte.
Zu seiner Überraschung sah Dr. Daruwalla abermals einen Geier (möglicherweise denselben) über dem Golfplatz; nur flog er diesmal in geringerer Höhe, als befände er sich nicht auf dem Weg zu den Türmen des Schweigens oder käme von dort, sondern als wollte er landen. Da der Doktor wußte, wie vehement die Parsen ihre Bestattungsrituale verteidigten, belustigte ihn der Gedanke, daß sie womöglich alles, was irgendeinen Geier irgendwie ablenken könnte, als Kränkung empfanden. Vielleicht war ein Pferd auf der Rennbahn von Mahalaxmi tot umgefallen, vielleicht hatte in Tardeo jemand einen Hund getötet, oder bei Hadschi Alis Grabmal war eine Leiche angespült worden. Wie auch immer, dieser Geier vernachlässigte jedenfalls seine heilige Pflicht in den Türmen des Schweigens.
Dr. Daruwalla blickte auf die Uhr. Er erwartete seinen Freund jeden Augenblick zum Lunch; er nippte an seinem London Diätbier und versuchte sich einzubilden, es sei ein Kingfisher Lager; und er stellte sich vor, daß er wieder schlank war. (Dabei war er nie wirklich schlank gewesen.) Während der Doktor den Geier beobachtete, der in präzisen Spiralen zur Landung ansetzte, gesellte sich ein zweiter Geier dazu, und dann noch einer, so daß Dr. Daruwalla unwillkürlich ein Schauder über den Rücken lief. Er vergaß völlig, sich seelisch darauf vorzubereiten, daß er Inspector Dhar eine schlechte Nachricht überbringen mußte. So fasziniert betrachtete er den Vogel, daß er gar nicht mitbekam, wie sein gutaussehender jüngerer Freund [44] mit der für ihn typischen unheimlichen Lautlosigkeit und Eleganz auftauchte.
Dhar legte Dr. Daruwalla die Hand auf die Schulter und sagte: »Da draußen liegt ein Toter, Farrokh. Wer ist das?« Dies bewog einen neuen Kellner – denselben, der die Krähe vom Ventilator verjagt hatte –, eine Suppenterrine samt Schöpfkelle fallen zu lassen. Der Kellner hatte Inspector Dhar natürlich erkannt; der Schock rührte daher, daß er den Filmstar ohne den leisesten Hindi-Akzent hatte sprechen hören. Das scheppernde Klirren rief Mr. Bannerjee auf den Plan.
»Die Geier landen auf dem neunten Green!« rief er, während er auf Dr. Daruwalla und Inspector Dhar zustürzte und beide am Arm packte. »Ich glaube, es ist der arme Mr. Lal! Er muß in den Bougainvilleensträuchern gestorben sein!«
Dr. Daruwalla flüsterte Dhar etwas zu. Der verzog keine Miene, als Farrokh sagte: »Das fällt in Ihr Fach, Inspector.« Wieder so ein Scherz, der für den Doktor typisch war. Trotzdem ging Dhar, ohne zu zögern, voraus über den Fairway. Bald war ein Dutzend dieser zähen Vögel zu sehen, die in ihrer wenig einnehmenden Art umherflatterten und -hopsten und das neunte Green beschmutzten. Sie reckten ihre langen Hälse in die Luft und tauchten dann damit in die Bougainvilleen ein; ihre höckrigen Schnäbel waren mit hellrotem Blut bespritzt.
Mr. Bannerjee weigerte sich, das Green zu betreten, und Dr. Daruwalla war erstaunt über den Verwesungsgeruch, der von den Geiern ausging; überwältigt blieb er kurz vor der Fahne des neunten Lochs stehen. Doch Inspector Dhar marschierte zwischen den stinkenden Vögeln hindurch und geradewegs in die Bougainvilleen hinein. Die Geier ringsum flogen auf und davon. Mein Gott, dachte Farrokh, er benimmt sich wie ein echter Polizeiinspektor – dabei ist er nur ein Schauspieler, aber das ist ihm gar nicht klar!
Der Kellner, der die Krähe vom Deckenventilator verjagt [45] und, weniger erfolgreich, mit Suppenterrine und Schöpflöffel gerungen hatte, folgte den aufgeregten Duckworthianern ein Stück weit auf den Golfplatz, kehrte jedoch in den Speisesaal zurück, als er sah, wie Inspector Dhar die Geier aufscheuchte. Der Kellner gehörte zu den zahlreichen Inspector-Dhar-Fans, die alle seine Filme gesehen hatten (einige sogar ein halbes dutzendmal), weshalb man getrost behaupten durfte, daß er eine Vorliebe für primitive Gewalt und brutales Blutvergießen hatte; ganz zu schweigen davon, daß er fasziniert war von Bombays vulgärstem Ambiente – dem allerschäbigsten, miesesten Abschaum der Stadt, der in allen Inspector-Dhar-Filmen ausgeschlachtet wurde. Doch als der Kellner die Schar Geier erblickte, die der berühmte Schauspieler in die Flucht geschlagen hatte, brachte ihn die Erkenntnis, daß sich in der Nähe des neunten Lochs eine echte Leiche befand, gründlich aus der Fassung. Er schlich in den Club zurück, wo er von dem ältlichen Butler, Mr. Sethna, der seinen Job Farrokhs verstorbenem Vater verdankte, mit mißbilligendem Blick empfangen wurde.
»Diesmal hat Inspector Dhar eine echte Leiche gefunden!« sagte der Kellner zu dem alten Butler.
Mr. Sethna entgegnete: »Sie sind heute für den Ladies’ Garden eingeteilt. Bleiben Sie gefälligst auf Ihrem Posten!«
Der alte Mr. Sethna mißbilligte die Inspector-Dhar-Filme. Er war ein Mensch, der grundsätzlich sehr vieles mißbilligte – eine Eigenschaft, die seine Stellung im Duckworth Club noch weiter festigte, wo er sich stets so verhielt, als sei er mit den Vollmachten des Clubsekretärs ausgestattet. Mr. Sethna mit seinem mißbilligenden Stirnrunzeln herrschte schon länger über den Speisesaal und den Ladies’ Garden, als Inspector Dhar Mitglied im Club war – obwohl Mr. Sethna nicht immer den Duckworthianern als Butler gedient hatte. Zuvor war er Butler im Ripon Club gewesen, einem Club, dem nur Parsen angehören und der nicht durch die Ausübung irgendeines Sports besudelt wird. Im [46] Ripon Club widmete man sich ausschließlich gutem Essen und guten Gesprächen – und damit basta. Dr. Daruwalla war auch dort Mitglied. Beide Clubs zusammen wurden seinem vielseitigen Naturell gerecht: Da er gleichzeitig Parse und Christ war, Bürger von Bombay und Bürger von Toronto, orthopädischer Chirurg und Sammler von Zwergenblut, hätte ein einziger Club ihn nie zufriedenstellen können.
Was Mr. Sethna betraf, der aus einer Parsenfamilie ohne altes Vermögen stammte, so hatte ihm der Ripon Club eher zugesagt als der Duckworth Club. Doch Umstände, bei denen sich sein höchst mißbilligender Charakter Bahn brach, hatten zu seiner Entlassung geführt. Dank dieses »höchst mißbilligenden Charakters« hatte Mr. Sethna bereits sein keineswegs altes Vermögen eingebüßt, was keineswegs so einfach gewesen war. Dieses Geld stammte aus der Kolonialzeit, es war britisches Geld, das Mr. Sethna jedoch derart mißbilligte, daß er es fuchsschlau und vorsätzlich durchbrachte. Er hatte mehr als ein durchschnittliches Menschenalter auf der Rennbahn von Mahalaxmi zugebracht, doch aus diesen Wett-Zeiten war ihm nur die Erinnerung an das Getrappel der Pferdehufe geblieben, das er mit seinen langen Fingern gekonnt auf dem silbernen Serviertablett nachtrommelte.
Mr. Sethna war entfernt mit den Guzdars verwandt, einer altehrwürdigen und vermögenden Parsenfamilie, die Schiffe für die britische Marine gebaut und sich ihren Reichtum erhalten hatte. Leider ergab es sich, daß ein junges Clubmitglied Mr. Sethnas empfindliche Gefühle für seine weitläufige Familie verletzte; der gestrenge Butler hatte eine kompromittierende Bemerkung über die Tugendhaftigkeit einer jungen Dame aus der Familie Guzdar aufgeschnappt. In ihrem derben Sinn für Humor ließen sich diese jungen, nichtreligiösen Parsen auch zu einer kompromittierenden Bemerkung über die kosmische Verflechtung von Spenta Mainyu (dem Geist Gottes bei Zarathustra) und Angra [47] Mainyu (dem Geist des Bösen) hinreißen und fügten hinzu, bei Mr. Sethnas entfernter Cousine habe wohl der Geist des Sexus ihre Gunst errungen.
Der junge Stutzer, der dieses verbale Unheil anrichtete, trug eine Perücke – eine Eitelkeit, die Mr. Sethna ebenfalls mißbilligte. Und deshalb goß er dem Gentleman heißen Tee auf den Scheitel, so daß dieser aufsprang und sich in Anwesenheit seiner erstaunten Tischgenossen buchstäblich die Haare vom Kopf riß.
Obwohl viele Clubmitglieder – alter Geldadel und Neureiche – Mr. Sethnas Tat für höchst ehrenwert hielten, empfanden sie ein derartiges Verhalten bei einem Butler als ungebührlich. »Gewalttätiger Angriff mittels heißen Tees« lautete denn auch die Begründung für Mr. Sethnas Entlassung. Doch bekam der Butler von Dr. Daruwallas Vater, in dessen Augen der Vorfall eine Heldentat war, die denkbar besten Empfehlungen, dank derer er umgehend vom Duckworth Club eingestellt wurde. Die verunglimpfte junge Dame war über jeden Tadel erhaben; Mr. Sethna hatte ihre in Zweifel gezogene Tugendhaftigkeit also völlig zu Recht verteidigt. Der Butler war ein so fanatischer Anhänger der Lehre Zarathustras, daß Farrokhs Vater mit seiner Vorliebe für überspitzte Formulierungen behauptet hatte, Mr. Sethna sei ein Parse, der ganz Persien auf seinen Schultern trage.
Auf jeden, der unter Mr. Sethnas mißbilligendem Stirnrunzeln im Speisesaal des Duckworth Club oder im Ladies’ Garden zu leiden hatte, machte der Butler den Eindruck, als würde er gern jedermann heißen Tee über den Kopf gießen. Er war groß und extrem hager, als mißbilligte er prinzipiell jede Nahrungsaufnahme, und seine hochmütige Hakennase sah aus, als mißbilligte er auch den Geruch von allem und jedem. Zudem war der alte Butler so hellhäutig – die meisten Parsen sind hellhäutiger als die meisten anderen Inder –, daß man ihm auch Mißbilligung aus rassischen Gründen unterstellte.
Im Augenblick galt seine Mißbilligung dem Durcheinander [48] auf dem Golfplatz. Seine Lippen waren dünn und verkniffen, und er hatte das schmale, vorspringende Kinn einer Ziege mit dem entsprechenden Bartbüschel. Er mißbilligte jeglichen Sport und machte keinerlei Hehl aus seiner Abneigung gegen die Vermischung von sportlicher Betätigung und würdevolleren Beschäftigungen wie kultiviertem Essen und scharfsinnigen Diskussionen.
Jetzt herrschte heller Aufruhr auf dem Golfplatz. Männer rannten halbnackt aus dem Umkleideraum – als hätten sie in ihrer Sportbekleidung (wenn sie komplett angezogen waren) nicht schon abscheulich genug ausgesehen, dachte Mr. Sethna. Als Parse hielt Mr. Sethna die Gerechtigkeit sehr hoch, und er fand es geradezu unmoralisch, wenn sich etwas so Ernstes und Endgültiges wie ein Todesfall an einem so irritierend trivialen Ort wie einem Golfplatz ereignete. Als gläubiger Mensch, dessen nackter Körper eines nicht mehr fernen Tages in den Türmen des Schweigens liegen würde, empfand der alte Butler die Anwesenheit so vieler Geier als zutiefst bewegend. Er zog es daher vor, sie zu ignorieren und seine Aufmerksamkeit – und seine Verachtung – dem menschlichen Getümmel zuzuwenden. Jemand hatte den schwachsinnigen Obergärtner herbeigerufen, der jetzt mit seinem ratternden Gefährt hirnlos über den Golfplatz fuhr und dabei das Gras ausrupfte, das die Hilfsgärtner erst kürzlich mit der Walze geglättet hatten.
Da sich Inspector Dhar tief im Bougainvilleengesträuch befand, konnte Mr. Sethna ihn zwar nicht sehen, zweifelte aber nicht daran, daß der vulgäre Filmstar irgendwo mitten in diesem Schlamassel steckte. Bei dem bloßen Gedanken an Inspector Dhar seufzte Mr. Sethna mißbilligend.
Da ertönte das helle Klingen einer Gabel an einem Wasserglas – eine unfeine Art, den Kellner zu rufen, wie Mr. Sethna fand. Als er sich dem Anstoß erregenden Tisch zuwandte, stellte er fest, daß nicht etwa der Kellner, sondern er selbst von der [49] neuen Mrs. Dogar herbeizitiert wurde. Je nachdem, ob man mit ihr redete oder hinter ihrem Rücken über sie sprach, hieß sie die schöne Mrs. Dogar oder die zweite Mrs. Dogar. Mr. Sethna fand sie nicht besonders schön, und daß er zweite Ehen mißbilligte, verstand sich von selbst.
Außerdem war man sich (unter den Clubmitgliedern) einig, daß Mrs. Dogars Schönheit eher grobschlächtiger Art und zudem im Laufe der Jahre verblichen war. Keine noch so großen Geldmengen aus Mr. Dogars Tasche vermochten den schauerlichen Geschmack seiner neuen Frau zu verbessern. Kein noch so durchtrainierter Körper – ein Ziel, dem die zweite Mrs. Dogar angeblich im Übermaß huldigte – konnte selbst einen oberflächlichen Betrachter darüber hinwegtäuschen, daß sie mindestens zweiundvierzig war. Mr. Sethnas kritischer Blick sagte ihm, daß sie bereits auf die Fünfzig zuging (wenn nicht darüber hinaus); zudem war sie seiner Ansicht nach viel zu groß. Und so manch golfbegeisterter Duckworthianer nahm Anstoß an ihrer unverhohlenen, unsensiblen Meinung, Golf zu spielen sei für jemanden, der sich gesund erhalten wolle, eine unzureichende körperliche Betätigung.
An diesem Tag speiste Mrs. Dogar allein – eine Angewohnheit, die Mr. Sethna ebenfalls mißbilligte. Er fand, daß es Frauen in einem anständigen Club nicht gestattet sein dürfte, allein zu speisen. Die Ehe war noch so jung, daß Mr. Dogar seiner Frau beim Lunch häufig Gesellschaft leistete; und doch schon wieder so alt, daß er sich die Freiheit nahm, solche Verabredungen zum Essen abzusagen, falls ihm irgend etwas Wichtigeres dazwischenkam. Und in jüngster Zeit hatte er sich angewöhnt, in letzter Minute abzusagen, so daß seiner Frau keine Zeit blieb umzudisponieren. Mr. Sethna hatte beobachtet, daß die neue Mrs. Dogar ziemlich unruhig und ärgerlich wurde, wenn ihr Mann sie versetzte.
Andererseits hatte der Butler bei den gemeinsamen [50]