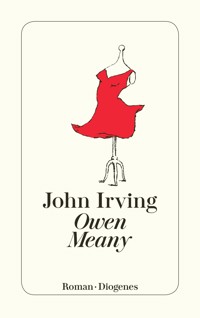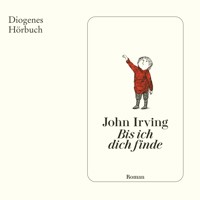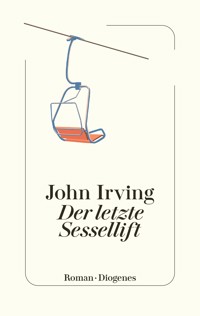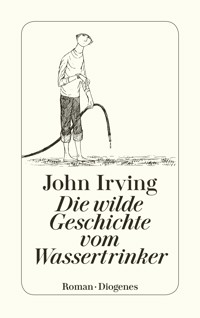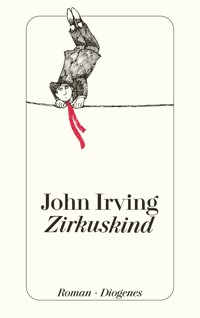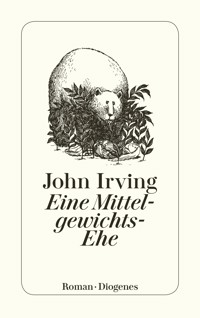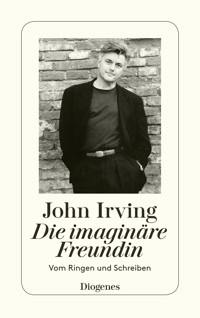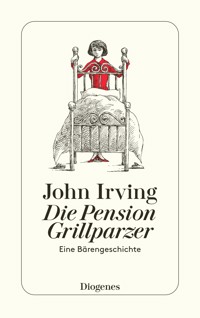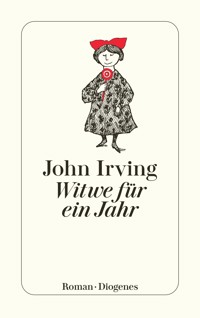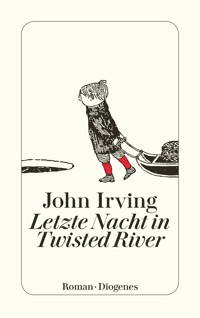11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während einer Indienreportage wird einem New Yorker Journalisten vor laufender Kamera die linke Hand von einem hungrigen Zirkuslöwen abgebissen; Millionen Fernsehzuschauer sind Zeugen des Unfalls. In Boston wartet ein verschrobener Handchirurg auf eine Gelegenheit, die erste amerikanische Handtransplantation vorzunehmen. Und eine junge Ehefrau in Wisconsin hat es sich in den Kopf gesetzt, dem einhändigen Reporter die linke Hand ihres Mannes zu geben – wenn dieser stirbt. Doch der Mann ist jung und kerngesund.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
John Irving
Die vierte
Hand
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Nikolaus Stingl
Titel der 2001 bei
Random House, Inc., New York,
erschienenen Originalausgabe:
›The Fourth Hand‹
Copyright © 2001 by Garp Enterprises, Ltd.
Die deutsche Erstausgabe
erschien 2002 im Diogenes Verlag
Abdruck der Auszüge aus Michael Ondaatje,
›Der englische Patient‹, in der Übersetzung
von Adelheid Dormagen,
Carl Hanser Verlag, München 1993,
mit freundlicher Genehmigung
Auszüge aus E. B. White, ›Klein Stuart‹,
in der Übersetzung von Ute Haffmanns,
Diogenes Verlag, Zürich 1978 und 2002
Umschlagillustration von
Edward Gorey
Mit freundlicher Genehmigung des
Edward Gorey Charitable Trust, New York
Für Richard Gladstein und
Lasse Hallström
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23370 4 (7.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60130 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] »Ein Reisender, der jemanden sucht, kommt nicht sehr schnell vorwärts.«
Der Arbeiter in E.B. White,
[7] Inhalt
1 Der Löwenmann [9]
2 Der frühere Mittelfeldspieler [42]
3 Vor der Bekanntschaft mit Mrs. Clausen [76]
4 Japanisches Zwischenspiel [87]
5 Ein Unfall am Super-Bowl-Sonntag [130]
6 Der Pferdefuß [153]
7 Das Stechen [174]
8 Abstoßung und Erfolg [195]
9 Wallingford lernt eine Sympathisantin kennen [217]
10 Wie man es darauf anlegt, gefeuert zu werden [270]
11 Im Norden [321]
12 Lambeau Field [383]
Danksagung [437]
[9] 1
Der Löwenmann
Stellen Sie sich einen Mann auf dem Weg zu einem knapp dreißigsekündigen Ereignis vor – dem Verlust seiner linken Hand, noch in jungen Jahren.
Als Schüler war er vielversprechend, ein liebenswerter Junge mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn, ohne jedoch schrecklich originell zu sein. Soweit sich seine Klassenkameraden aus der Grundschule an den künftigen Handempfänger erinnern konnten, hätten sie ihn niemals als waghalsig bezeichnet. Auch später, in der High School, war er ungeachtet seines Erfolges bei Mädchen schwerlich kühn, geschweige denn ein Draufgänger. Er sah zwar unbestreitbar gut aus, doch in der Erinnerung seiner ehemaligen Freundinnen war das Attraktivste an ihm, daß er nicht nein sagen konnte.
Während seiner Collegezeit hätte kein Mensch vorausgesagt, daß es ihm bestimmt war, berühmt zu werden. »Er war so anspruchslos«, sagte eine seiner Exfreundinnen.
Eine andere junge Frau, die in der Graduate School kurz mit ihm ging, war der gleichen Meinung. »Er hatte nicht das Selbstbewußtsein eines Menschen, der irgendwann einmal etwas Besonderes leisten würde«, wie sie es formulierte.
Er trug ein dauerhaftes und gleichzeitig befremdliches Lächeln zur Schau – die Miene von jemandem, der weiß, [10] daß er einem schon einmal begegnet ist, sich aber nicht an den genauen Anlaß erinnern kann und nun überlegt, ob die frühere Begegnung bei einer Beerdigung oder in einem Bordell stattgefunden hat. Das wiederum erklärt, warum sein Lächeln eine beunruhigende Mischung aus Kummer und Verlegenheit zeigte.
Er hatte eine Affäre mit seiner akademischen Betreuerin gehabt; sie war entweder Ausdruck oder Ursache seiner mangelnden Zielstrebigkeit als höheres Semester. Nachträglich – sie war geschieden und hatte eine fast erwachsene Tochter – stellte sie fest: »Auf jemanden, der so gut aussah, konnte man sich überhaupt nicht verlassen. Außerdem war er der klassische Fall eines Menschen, der hinter den Erwartungen zurückbleibt – er war nicht so hoffnungslos, wie man zunächst meinte. Man wollte ihm helfen. Man wollte ihn verändern. Und man wollte auf jeden Fall mit ihm schlafen.«
In ihre Augen trat plötzlich ein Leuchten, das vorher nicht dagewesen war; es kam und ging wie ein Farbwechsel bei Tagesende, als könne dieses Leuchten jede noch so große Entfernung zurücklegen. Sie verwies auf »seine Empfindlichkeit gegen Spott« und betonte, »wie rührend das war«.
Wie aber kam er zu seinem Entschluß, sich einer Handtransplantation zu unterziehen? Würde nicht nur ein Abenteurer oder Idealist das Risiko auf sich nehmen, das mit dem Erwerb einer neuen Hand verbunden ist?
Niemand, der ihn kannte, hätte ihn je als Abenteurer oder Idealisten bezeichnet, aber er war gewiß einmal idealistisch gewesen. Als Junge hatte er bestimmt Träume [11] gehabt; selbst wenn er seine Ziele für sich behielt, sie unausgesprochen ließ, gehabt hatte er welche.
Seine akademische Betreuerin, die sich in der Rolle der Expertin sichtlich wohl fühlte, maß dem Verlust seiner Eltern noch während seiner Collegezeit einige Bedeutung bei. Aber seine Eltern hatten ihn üppig versorgt; trotz ihres Todes war er finanziell abgesichert. Er hätte auf dem College bleiben können, bis er dort eine Lebensstellung bekommen hätte – er hätte für den Rest seines Lebens die Graduate School besuchen können. Doch obwohl er stets ein erfolgreicher Student gewesen war, empfand ihn keiner seiner Lehrer je als sonderlich motiviert. Er war kein Initiator – er nahm einfach wahr, was angeboten wurde.
Er besaß sämtliche Merkmale eines Menschen, der sich mit dem Verlust einer Hand abfinden würde, indem er aus seinen Beschränkungen das Beste machte. Jeder, der ihn kannte, ging davon aus, daß er irgendwann mit einer Hand zufrieden sein würde.
Außerdem war er Fernsehjournalist. Reichte eine Hand dafür nicht aus?
Aber er glaubte nun einmal, daß er eine neue Hand brauchte, und er hatte vollkommen begriffen, was bei der Transplantation in medizinischer Hinsicht alles schiefgehen konnte. Was er sich allerdings nicht klarmachte, erklärt, warum er noch nie sehr experimentierfreudig gewesen war; ihm fehlte die Vorstellungskraft, den beunruhigenden Gedanken zu fassen, daß die neue Hand nicht ausschließlich ihm gehören würde. Schließlich hatte sie zunächst einmal jemand anderem gehört.
Wie passend, daß er Fernsehjournalist war. Die meisten [12] Fernsehjournalisten sind ziemlich gewieft – in dem Sinne, daß sie schnell von Begriff sind und instinktiv zum Kern der Sache kommen. Beim Fernsehen gibt es kein Zaudern. Jemand, der sich für eine Handtransplantation entscheidet, fackelt nicht lange, oder?
Wie auch immer, er hieß Patrick Wallingford, und er hätte seine Berühmtheit, ohne zu zögern, gegen eine neue linke Hand eingetauscht. Zur Zeit des Unfalls war Patrick in der Welt des Fernsehjournalismus auf dem Weg nach oben. Er hatte für zwei der drei großen Sender gearbeitet und sich dort wiederholt darüber beklagt, welch üblen Einfluß die Einschaltquoten auf die Nachrichtensendungen hatten. Wie oft war es vorgekommen, daß irgendein Programmdirektor, der sich in der Männertoilette besser auskannte als im Regieraum, eine »Marketingentscheidung« traf, die eine Meldung verwässerte? (In Wallingfords Augen hatten die Programmdirektoren vor den Marketingexperten kapituliert.)
Patrick glaubte, schlicht gesagt, daß die finanziellen Erwartungen der Sender an ihre Nachrichtenredaktionen der Tod der Nachrichten waren. Warum wurde eigentlich erwartet, daß Nachrichtensendungen ebensoviel Geld einbrachten wie das, was bei den Sendern Unterhaltung hieß? Warum stand eine Nachrichtenredaktion überhaupt unter dem Druck, Gewinn machen zu müssen? Nachrichten waren nicht das, was in Hollywood passierte; Nachrichten waren auch nicht die Baseballmeisterschaften oder der Super Bowl. Nachrichten (und damit meinte Wallingford echte Nachrichten – das heißt fundierte Berichterstattung) sollten mit irgendwelchen Serien nicht um Einschaltquoten konkurrieren müssen.
[13] Patrick Wallingford arbeitete noch für einen der großen Sender, als im November 1989 die Berliner Mauer fiel. Er war begeistert, daß er in einem solchen historischen Moment in Deutschland war, aber die Berichte, die er von Berlin aus lieferte, wurden ständig gekürzt – manchmal auf die Hälfte der Länge, die sie nach seinem Empfinden verdienten. Ein Programmdirektor im Nachrichtenstudio in New York sagte zu Wallingford: »Nachrichten in der Kategorie Außenpolitik sind einen Scheißdreck wert.«
Als ebendieser Sender seine Büros in Übersee zu schließen begann, tat Patrick den Schritt, den auch schon andere Fernsehjournalisten getan haben. Er wechselte zu einem reinen Nachrichtensender; es war kein besonders guter Sender, aber es war immerhin ein rund um die Uhr sendender internationaler Nachrichtenkanal.
War Wallingford so naiv zu glauben, ein reiner Nachrichtensender würde nicht auf die Einschaltquoten achten? Tatsächlich schwärmte man bei dem internationalen Sender für minutengenaue Einschaltquoten, mit deren Hilfe sich präzise bestimmen ließ, wann die Aufmerksamkeit der Zuschauer zunahm oder nachließ.
Dennoch war man sich unter Wallingfords Kollegen in den Medien im wesentlichen einig, daß er offensichtlich das Zeug zum Moderator hatte. Er sah unbestreitbar gut aus – sein scharfgeschnittenes Gesicht war fürs Fernsehen perfekt geeignet –, und er hatte seine Erfahrungen als Sonderkorrespondent gemacht. Mit zu den bittersten zählte eigenartigerweise die Feindschaft seiner Frau.
Mittlerweile war sie seine Exfrau. Er schob das auf die vielen Reisen, aber seine damalige Frau versicherte, das [14] Problem seien andere Frauen. Einmalige sexuelle Begegnungen hatten es Patrick tatsächlich angetan, und das blieb auch weiterhin so, ob er nun reiste oder nicht.
Kurz vor Patricks Unfall hatte jemand eine Vaterschaftsklage gegen ihn angestrengt. Obwohl die Klage abgewiesen wurde – der DNS-Test war negativ –, erboste schon die bloße Unterstellung seiner Vaterschaft Wallingfords Frau. Neben der offenkundigen Untreue ihres damaligen Ehemannes hatte sie einen weiteren Grund, aufgebracht zu sein. Obwohl sie schon so lange Kinder wollte, hatte Patrick sich standhaft geweigert. (Auch das schob er auf die vielen Reisen.)
Mittlerweile pflegte Wallingfords Exfrau – sie hieß Marilyn – zu sagen, sie wünschte, ihr Exmann hätte mehr als nur seine linke Hand verloren. Sie hatte rasch wieder geheiratet, war schwanger geworden, hatte ein Kind bekommen; dann hatte sie sich wieder scheiden lassen. Außerdem sagte Marilyn gern, die Wehenschmerzen bei der Geburt des Kindes – sosehr sie es sich gewünscht hätte – seien größer gewesen als Patricks Schmerzen beim Verlust seiner linken Hand.
Patrick Wallingford war kein aufbrausender Mensch; eine normalerweise ausgeglichene Gemütsverfassung gehörte ebensosehr zu seinem Markenzeichen wie sein unverschämt gutes Aussehen. Doch die Schmerzen beim Verlust seiner linken Hand waren Wallingfords am leidenschaftlichsten gehüteter Besitz. Es machte ihn wütend, daß seine Exfrau seine Schmerzen bagatellisierte, indem sie sie für geringer erklärte als ihre »ganz normalen« Wehenschmerzen, wie er gern sagte.
Auch auf die Behauptung seiner Exfrau, er sei zwanghaft [15] hinter den Frauen her, reagierte Wallingford nicht immer ausgeglichen. Seiner Meinung nach war er nie hinter den Frauen her gewesen. Das hieß, Wallingford verführte keine Frauen; er ließ sich einfach von ihnen verführen. Er rief sie nie an – sie riefen ihn an. Er glich einem Mädchen, das nicht nein sagen konnte – nur war er eben ein Junge, wie seine Exfrau zu sagen pflegte. (Patrick war Ende Zwanzig, Anfang Dreißig gewesen, als seine damalige Frau sich von ihm scheiden ließ, aber Marilyn zufolge war er immer ein kleiner Junge geblieben.)
Den Posten eines Moderators, der ihm bestimmt zu sein schien, hatte er noch immer nicht ergattert. Und nach dem Unfall trübten sich Wallingfords Aussichten. Irgendein Programmdirektor führte den »Zimperlichkeitsfaktor« an. Wer will die Morgen- oder Abendnachrichten schon von einem armen Schwein präsentiert bekommen, das sich von einem hungrigen Löwen die Hand hat abbeißen lassen? Das Ereignis mochte weniger als dreißig Sekunden gedauert haben – der gesamte Bericht war nur drei Minuten lang –, aber niemand, der einen Fernseher besaß, hatte es verpaßt. Ein paar Wochen lang lief es wiederholt in der Glotze, weltweit.
Wallingford war in Indien. Sein Nachrichtensender, den die Snobs in der Medienelite wegen seiner Vorliebe für Desaströses häufig als ›Apokalypse International‹ oder ›Katastrophenkanal‹ bezeichneten, hatte ihn zu einem indischen Zirkus in Gujarat geschickt. (Kein vernünftiger Nachrichtensender hätte einen Sonderkorrespondenten von New York zu einem Zirkus in Indien geschickt.)
Der Great Ganesh Circus trat gerade in Junagadh auf, und eine seiner Trapezkünstlerinnen, eine junge Frau, war [16] abgestürzt. Sie war berühmt für das »Fliegen« – wie die Arbeit solcher Künstler genannt wird – ohne Sicherheitsnetz, und bei dem Sturz aus einer Höhe von fünfundzwanzig Metern kam zwar nicht sie selbst, wohl aber ihr Ehemann und Trainer, der versuchte, sie aufzufangen, ums Leben. Obwohl ihr herabfallender Körper ihn erschlug, schaffte er es, ihren Sturz zu dämpfen.
Der indische Staat untersagte umgehend das Fliegen ohne Netz, und der Great Ganesh, wie auch andere kleine Zirkusse in Indien, protestierte ebenso umgehend gegen diese Regelung. Seit Jahren schon versuchte ein bestimmter Minister und übereifriger Tierschützer die Verwendung von Tieren in indischen Zirkussen verbieten zu lassen, und daher reagierten die Zirkusse empfindlich auf staatliche Eingriffe jeder Art. Außerdem drängten sich – wie der leicht erregbare Direktor des Great Ganesh Circus Patrick Wallingford vor laufender Kamera erklärte – die Zuschauer jeden Nachmittag und Abend im Zelt, eben weil die Trapezkünstler ohne Netz arbeiteten.
Daß die Netze ihrerseits in furchtbar schlechtem Zustand waren, hatte Wallingford bereits festgestellt. Von seinem Standort auf der trockenen, festgestampften Erde – dem »Boden« des Zeltes – aus sah Patrick im Aufblicken, daß das Maschenmuster zerfetzt und zerrissen war. Das Ganze ähnelte einem riesigen Spinnennetz, das ein in Panik geratener Vogel zerstört hat. Es war zweifelhaft, ob das Netz das Gewicht eines herabstürzenden Kindes, geschweige denn das eines Erwachsenen, halten konnte.
Viele der Künstler waren tatsächlich Kinder, und diese hauptsächlich Mädchen. Ihre Eltern hatten sie an den [17] Zirkus verkauft, damit sie ein besseres (sprich sichereres) Leben hatten. Dabei bestand beim Great Ganesh ein enormes Risiko. Der leicht erregbare Zirkusdirektor hatte die Wahrheit gesagt: Die Zuschauer drängten sich jeden Nachmittag und Abend im Zelt, um Unfälle zu sehen. Und oft waren die Opfer dieser Unfälle Kinder. Als Künstler waren sie begabte Amateure, gute kleine Sportler, aber sie waren unzureichend ausgebildet.
Warum die meisten Kinder Mädchen waren, dieses Thema hätte jeden guten Journalisten interessiert, und Wallingford war – ob man dem Persönlichkeitsbild, das seine Exfrau von ihm zeichnete, glaubte oder nicht – ein guter Journalist. Seine Intelligenz lag hauptsächlich in seiner Beobachtungsgabe, und das Fernsehen hatte ihn gelehrt, wie wichtig es ist, einen Riecher für das zu entwickeln, was schiefgehen könnte.
Ebendieser Riecher war zugleich die große Stärke und die große Schwäche des Fernsehens. Das Fernsehen wurde von Krisen, nicht von hehren Anliegen umgetrieben. An seinen Aufträgen als Sonderkorrespondent des Nachrichtensenders enttäuschte Patrick vor allem, wie häufig es vorkam, daß man eine wichtigere Story verpaßte oder ignorieren mußte. So waren die Kinderkünstler in einem indischen Zirkus mehrheitlich Mädchen, weil ihre Eltern nicht gewollt hatten, daß sie Prostituierte wurden; die nicht an einen Zirkus verkauften Jungen wurden schlimmstenfalls Bettler. (Oder sie verhungerten.)
Aber das war nicht die Geschichte, derentwegen man Patrick Wallingford nach Indien geschickt hatte. Eine Trapezkünstlerin, eine erwachsene Frau, war aus fünfundzwanzig [18] Meter Höhe abgestürzt und in den Armen ihres Mannes gelandet, der dabei ums Leben gekommen war. Der indische Staat hatte eingegriffen – mit dem Ergebnis, daß jeder Zirkus in Indien gegen die Vorschrift protestierte, daß die Akrobaten ab sofort mit Netz arbeiten mußten. Selbst die frisch verwitwete Trapezkünstlerin, die Frau, die abgestürzt war, schloß sich dem Protest an.
Wallingford hatte sie im Krankenhaus interviewt, wo sie wegen einer gebrochenen Hüfte und eines unklaren Schadens an der Milz behandelt wurde; sie sagte ihm, das Fliegen werde erst ohne Netz zu etwas Besonderem. Gewiß trauere sie um ihren verstorbenen Ehemann, aber er sei ebenfalls Trapezkünstler gewesen – auch er sei schon abgestürzt und habe seinen Sturz überlebt. Möglicherweise aber, deutete seine Witwe an, sei er bei jenem ersten Patzer in Wirklichkeit gar nicht davongekommen; durchaus denkbar, daß ihr Sturz auf ihn den eigentlichen Abschluß des früheren Vorfalls bilde.
Das war nun wirklich ein interessanter Gesichtspunkt, fand Wallingford, doch sein Nachrichtenredakteur, den jedermann von Herzen verabscheute, war von dem Interview enttäuscht. Und sämtliche Leute im Nachrichtenstudio in New York fanden, daß die verwitwete Trapezkünstlerin »zu ruhig« gewirkt habe; sie hatten ihre Katastrophenopfer lieber hysterisch.
Außerdem hatte die genesende Akrobatin gesagt, ihr verstorbener Mann befinde sich nun »in den Armen der Göttin, an die er glaubte« – ein verführerischer Satz. Sie meinte damit, daß ihr Mann an Durga, die Göttin der Zerstörung, geglaubt hatte. Die meisten Trapezkünstler glaubten an [19] Durga – die Göttin wird gemeinhin mit zehn Armen dargestellt. Die Witwe erklärte: »Durgas Arme sollen einen auffangen und festhalten, falls man je abstürzt.«
Auch das war ein interessanter Gesichtspunkt für Wallingford, nicht aber für die Leute im Nachrichtenstudio in New York; sie sagten, sie hätten »von Religion die Schnauze voll«. Patricks Nachrichtenredakteur teilte ihm mit, sie hätten in letzter Zeit zu viele Stories mit religiösem Hintergrund gesendet. Dicktuer, dachte Wallingford. Es half nicht, daß der Nachrichtenredakteur Dick hieß.
Er hatte Patrick zum Great Ganesh Circus zurückgeschickt, um noch »zusätzliches Lokalkolorit« einzufangen. Ferner hatte Dick behauptet, der Zirkusdirektor äußere sich offener als die Trapezkünstlerin.
Patrick hatte protestiert. »Irgendwas über die Kinderartisten ergäbe eine bessere Geschichte«, hatte er gesagt. Aber offenbar hatte man in New York auch »von Kindern die Schnauze voll«.
»Bring einfach mehr von dem Zirkusdirektor«, so Dicks Rat an Wallingford.
Parallel zur Aufgeregtheit des Zirkusdirektors wurden auch die Löwen in ihrem Käfig – die Löwen gaben den Hintergrund für das letzte Interview ab – unruhig und laut. In der Terminologie des Fernsehens war das Stück, das Wallingford aus Indien schickte, der »Knaller«, der die Sendung beenden sollte. Die Geschichte wäre ein noch besserer Knaller, wenn die Löwen laut genug brüllten.
Es war Fleischtag, und die Moslems, die das Fleisch brachten, waren aufgehalten worden. Der Übertragungswagen und die Film- und Tonapparatur – wie auch der [20] Kameramann und die Tontechnikerin – hatten sie eingeschüchtert. Die moslemischen Fleischwallahs waren angesichts der vielen ungewohnten Technologie wie angewurzelt stehengeblieben. Hauptsächlich aber war es der Anblick der Tontechnikerin, der sie hatte erstarren lassen.
Diese, eine hochgewachsene Blondine in engen Bluejeans, trug Kopfhörer und einen Werkzeuggürtel mit einem Sortiment von Accessoires, das den Fleischwallahs als ausgesprochen maskulin erscheinen mußte: eine Kombizange oder Drahtschere, ein Haufen Klemmen und Kabel und ein Gerät, bei dem es sich um einen Batterieprüfer hätte handeln können. Außerdem trug sie ein T-Shirt ohne BH.
Daß sie Deutsche war, wußte Wallingford, weil er in der Nacht zuvor mit ihr geschlafen hatte. Sie hatte ihm von ihrer ersten Reise nach Goa erzählt – sie hatte Urlaub gehabt und war mit einer anderen Deutschen unterwegs gewesen, und sie waren beide zu der Ansicht gekommen, daß sie nie mehr irgendwo anders als in Indien leben wollten.
Die andere war krank geworden und nach Hause gefahren, aber Monika hatte eine Möglichkeit gefunden, in Indien zu bleiben. So hieß sie – »Monika mit k«, hatte sie ihm gesagt. »Tontechniker können überall leben«, hatte sie erklärt. »Überall, wo es Töne gibt.«
»Versuch es doch mal mit New York«, hatte Patrick vorgeschlagen. »Töne gibt’s dort jede Menge, und das Wasser ist trinkbar.« Gedankenlos hatte er hinzugefügt: »Im Augenblick sind deutsche Frauen in New York sehr beliebt.«
»Wieso ›im Augenblick‹?« hatte sie gefragt.
Das war symptomatisch für die Schwierigkeiten, in die Patrick Wallingford bei Frauen ständig geriet; daß er [21] grundlos irgend etwas sagte, war der Art und Weise, wie er den Annäherungsversuchen von Frauen nachgab, nicht unähnlich. Es hatte keinen Grund gegeben, »im Augenblick sind deutsche Frauen in New York sehr beliebt« zu sagen, außer um weiterzureden. Es war seine Schwäche und Nachgiebigkeit gegenüber Frauen, sein stillschweigendes Einverständnis mit ihren Annäherungsversuchen, die Wallingfords Frau erbost hatten; sie hatte ihn zufällig gerade in seinem Hotelzimmer angerufen, als er Monika mit k vögelte.
Zwischen Junagadh und New York bestand ein Zeitunterschied von zehneinhalb Stunden, aber Patrick tat so, als wisse er nicht, ob Indien zehneinhalb Stunden voraus oder hinterher war. Als seine Frau anrief, sagte er immer nur: »Wie spät ist es bei dir, Schatz?«
»Du vögelst gerade jemanden, stimmt’s?« fragte seine Frau.
»Nein, Marilyn, das stimmt nicht«, log er. Die Deutsche unter ihm hielt still. Wallingford versuchte ebenfalls, stillzuhalten, aber beim Liebesakt stillzuhalten dürfte für einen Mann schwieriger sein.
»Ich dachte nur, du wüßtest gerne die Ergebnisse deines Vaterschaftstests«, sagte Marilyn. Das half Patrick stillzuhalten. »Also, er ist negativ – du bist nicht der Vater. Da bist du ja gerade noch mal davongekommen, was?«
Wallingford fiel dazu nur ein: »Das war nicht statthaft – daß sie dir die Ergebnisse meiner Blutuntersuchung mitgeteilt haben. Das war meine Blutuntersuchung.«
Unter ihm erstarrte Monika mit k; wo sie warm gewesen war, fühlte sie sich nun kühl an. »Was für eine Blutuntersuchung?« flüsterte sie Patrick ins Ohr.
[22] Doch Wallingford trug ein Kondom – die deutsche Tontechnikerin war vor vielem, wenn auch nicht vor allem geschützt. (Patrick trug immer ein Kondom, auch bei seiner Frau.)
»Wer ist es denn diesmal?« brüllte Marilyn ins Telefon. »Wen vögelst du denn da gerade?«
Zweierlei wurde Wallingford in diesem Augenblick klar: daß seine Ehe nicht zu retten war und daß er sie auch nicht retten wollte. Wie immer bei Frauen fügte sich Patrick. »Wer ist sie?« schrie seine Frau, aber Wallingford gab ihr keine Antwort. Statt dessen hielt er der Deutschen die Sprechmuschel an die Lippen.
Er mußte ihr eine Strähne ihres blonden Haars vom Ohr streichen, ehe er hineinflüstern konnte. »Sag ihr einfach deinen Namen.«
»Monika… mit k«, sagte die Deutsche in den Hörer.
Wallingford legte auf, wobei er bezweifelte, daß Marilyn zurückrufen würde – sie tat es auch nicht. Aber danach hatte er Monika mit k eine Menge zu erklären; sie schliefen in dieser Nacht nicht allzu gut.
So wie alles sich zunächst angelassen hatte, wirkte es am anderen Morgen, im Great Ganesh, ein wenig enttäuschend. Die wiederholten Klagen des Zirkusdirektors über den indischen Staat waren nicht annähernd so sympathisch wie die Schilderungen der abgestürzten Trapezkünstlerin von der zehnarmigen Göttin, an die sämtliche Akrobaten glaubten.
War man im Nachrichtenstudio in New York taub und blind? Die Witwe im Krankenhausbett war prima Material gewesen! Und Wallingford wollte immer noch darüber [23] berichten, in welchem Kontext es stand, daß die Trapezkünstlerin ohne Sicherheitsnetz abgestürzt war. Der Kontext waren die Kinderakrobaten, jene Kinder, die an den Zirkus verkauft worden waren.
Wenn nun die Trapezkünstlerin als Kind selbst an den Zirkus verkauft worden war? Wenn ihr verstorbener Mann vor einer Kindheit ohne Zukunft bewahrt worden war, nur um unter der großen Kuppel vom Schicksal – seiner aus fünfundzwanzig Meter Höhe in seine Arme fallenden Frau – ereilt zu werden? Das wäre doch interessant gewesen.
Statt dessen interviewte Patrick den sich ständig wiederholenden Zirkusdirektor vor dem Löwenkäfig – dieses banale Zirkusbild war es, was man in New York unter »zusätzlichem Lokalkolorit« verstand.
Kein Wunder, daß das Interview im Vergleich zu Wallingfords Nacht mit der deutschen Tontechnikerin enttäuschend wirkte. Monika mit k machte in ihrem T-Shirt ohne BH sichtlich Eindruck auf die Fleischwallahs, die an der Kleidung der Deutschen – oder deren Spärlichkeit – Anstoß nahmen. In ihrer Angst, ihrer Neugier, ihrer moralischen Empörung hätten sie ein besseres und authentischeres Moment von zusätzlichem Lokalkolorit abgegeben als der langweilige Zirkusdirektor.
In der Nähe des Löwenkäfigs, doch allem Anschein nach zu ängstlich, zu verblüfft oder zu empört, um näher zu kommen, verhielten die Moslems wie unter Schock. Ihre Holzkarren waren hoch mit dem süßlich riechenden Fleisch beladen, das bei den weitgehend vegetarisch lebenden (hinduistischen) Zirkusleuten unendlichen Ekel hervorrief. [24] Natürlich rochen auch die Löwen das Fleisch und ärgerten sich über die Verzögerung.
Als die Löwen zu brüllen anfingen, zoomte der Kameramann auf sie, und Patrick Wallingford – der einen Moment echter Spontaneität erkannte – hielt sein Mikrofon ganz nahe an ihren Käfig. Er bekam einen besseren Knaller, als er erwartet hatte.
Eine Pranke schoß hervor; eine Kralle erwischte Wallingfords linkes Handgelenk. In weniger als zwei Sekunden wurde sein linker Arm bis zum Ellbogen in den Käfig gerissen. Seine linke Schulter knallte gegen die Gitterstäbe; seine linke Hand steckte samt mehreren Zentimetern Unterarm im Maul eines Löwen.
In dem nun folgenden Tohuwabohu stritten sich zwei andere Löwen mit dem ersten um Patricks Hand und Handgelenk. Der Löwendompteur, der sich nie weit von seinen Tieren entfernte, griff ein; er schlug die Tiere mit einer Schaufel ins Gesicht. Wallingford blieb lange genug bei Bewußtsein, um die Schaufel zu erkennen – sie wurde hauptsächlich als Schippe für das große Geschäft der Löwen verwendet. (Er hatte sie erst kurz zuvor in Aktion gesehen.)
Patrick kippte irgendwo in der Nähe der Fleischkarren um, nicht weit von der Stelle, wo Monika mit k aus innerer Verbundenheit ebenfalls das Bewußtsein verloren hatte. Die Deutsche allerdings war, zur nicht geringen Bestürzung der Fleischwallahs, in einen der Fleischkarren gefallen; und als sie wieder zu sich kam, mußte sie feststellen, daß man ihr, während sie bewußtlos in dem feuchten Fleisch lag, den Werkzeuggürtel gestohlen hatte.
[25] Die deutsche Tontechnikerin behauptete außerdem, jemand habe während ihrer Ohnmacht ihre Brüste begrapscht – zum Beweis dafür hatte sie fingerabdruckgroße Quetschungen an beiden Brüsten. Unter den Blutflecken auf ihrem T-Shirt waren allerdings keine Handabdrücke. (Die Blutflecken stammten von dem Fleisch.) Wahrscheinlich rührten die Quetschungen an ihren Brüsten eher von ihrer Liebesnacht mit Patrick Wallingford her. Wer immer so dreist gewesen war, ihren Werkzeuggürtel zu klauen, hatte wahrscheinlich nicht den Mut gehabt, ihre Brüste anzufassen. Ihre Kopfhörer hatte niemand angerührt.
Wallingford seinerseits war von dem Löwenkäfig fortgezerrt worden, ohne zunächst wahrzunehmen, daß seine linke Hand samt Handgelenk weg war; er bemerkte jedoch, daß die Löwen noch immer um irgend etwas rauften. Im selben Moment, in dem ihm der süßliche Geruch des Hammelfleisches in die Nase stieg, wurde er gewahr, daß die Moslems von seinem herabbaumelnden linken Arm wie gebannt waren. (Die Kraft, mit der der Löwe gezogen hatte, hatte Patrick die Schulter ausgerenkt.) Und als er hinschaute, sah er, daß seine Uhr fehlte. Um die tat es ihm nicht leid – er hatte sie von seiner Frau geschenkt bekommen. Natürlich hinderte nichts mehr die Uhr daran, abzurutschen; seine linke Hand samt Handgelenk fehlte ebenfalls.
Wallingford hatte, da er unter den moslemischen Fleischwallahs kein vertrautes Gesicht sah, zweifellos gehofft, Monika mit k auszumachen, voller Entsetzen, aber gleichwohl bewundernd. Leider lag die Deutsche in einem der Hammelfleischkarren mit abgewandtem Gesicht platt auf dem Rücken.
[26] Einen gewissen bitteren Trost fand Patrick darin, daß er, wenn nicht das Gesicht, so doch immerhin das Profil seines ungerührten Kameramannes sah, der in der Wahrnehmung seiner Hauptaufgabe keinen Augenblick wankend wurde. Der unbeirrbare Profi ging näher an den Löwenkäfig heran, wo er einfing, wie sich die Löwen auf nicht sehr manierliche Weise die wenigen Überreste von Patricks Hand samt Handgelenk teilten. Wenn das kein echter Knaller war!
In den nächsten ein, zwei Wochen sah sich Wallingford immer wieder den Filmstreifen an, der zeigte, wie ihm seine Hand geraubt und wie sie verzehrt wurde. Ihn verwirrte, daß der Angriff ihn an etwas Rätselhaftes erinnerte, das seine akademische Betreuerin zu ihm gesagt hatte, als sie die Affäre beendete: »Eine Zeitlang ist es schmeichelhaft, mit einem Mann zusammenzusein, der sich so ganz und gar in einer Frau verlieren kann. Andererseits ist so wenig Eigenes in dir, daß ich den Verdacht habe, du könntest dich in jeder Frau verlieren.« Was in aller Welt sie damit gemeint haben mochte und wieso ausgerechnet das Gefressenwerden seiner Hand ihn veranlaßt hatte, sich an die kritischen Bemerkungen der Frau zu erinnern, wußte er nicht.
Hauptsächlich aber bekümmerte Wallingford an den weniger als dreißig Sekunden, die ein Löwe gebraucht hatte, um seine Hand samt Handgelenk zu verputzen, daß die atemberaubenden Bilder von ihm selbst einen Patrick Wallingford zeigten, wie man ihn noch nie gesehen hatte. Tiefstes Grauen hatte er nie zuvor erlebt. Die schlimmsten Schmerzen kamen später.
In Indien nutzte der Minister, der Tierschützer war, aus nie ganz einsichtigen Gründen die Handfreßepisode, um [27] den Kreuzzug gegen den Mißbrauch von Zirkustieren voranzubringen. Inwiefern es einen Mißbrauch darstellte, daß die Löwen seine Hand gefressen hatten, blieb Patrick verborgen.
Ihn beunruhigte vielmehr, daß alle Welt gesehen hatte, wie er sich vor Schmerzen und Angst krümmte und schrie; er hatte sich vor laufender Kamera in die Hose gemacht – nicht daß auch nur ein einziger Fernsehzuschauer das wirklich mitbekommen hätte. (Er hatte eine dunkle Hose angehabt.) Trotzdem wurde er von Millionen bemitleidet, vor deren Augen er entstellt worden war.
Noch fünf Jahre später, wann immer Wallingford sich an den Vorfall erinnerte oder davon träumte, beschäftigte ihn vorwiegend die Wirkung des Schmerzmittels. In den Vereinigten Staaten war das Medikament nicht erhältlich, jedenfalls hatte der indische Arzt ihm das gesagt. Seither hatte er versucht herauszufinden, worum es sich handelte.
Wie immer das Mittel auch hieß, es hatte Patricks Bewußtsein von seinen Schmerzen gehoben und ihn zugleich völlig von den Schmerzen selbst distanziert; er war sich vorgekommen wie der gleichgültige Beobachter eines anderen. Und indem das Mittel sein Bewußtsein hob, bewirkte es viel mehr, als nur seine Schmerzen zu lindern.
Der Arzt, der ihm das in Form einer kobaltblauen Kapsel dargereichte Medikament verschrieben hatte – »Nehmen Sie nur eine, Mr. Wallingford, und zwar alle zwölf Stunden« –, war ein Parsi, der ihn nach dem Löwenangriff in Junagadh behandelte. »Es verhilft Ihnen zu dem schönsten Traum, den Sie je haben werden, aber es hilft auch gegen Schmerzen«, fügte Dr. Chothia hinzu. »Nehmen Sie auf [28] keinen Fall zwei. Amerikaner nehmen immer zwei Tabletten auf einmal. Diesmal nicht.«
»Wie heißt es denn? Es hat ja wohl einen Namen.« Wallingford betrachtete das Mittel mit Argwohn.
»Wenn Sie eine genommen haben, wissen Sie sowieso nicht mehr, wie es heißt«, sagte ihm Dr. Chothia fröhlich. »Und in Amerika werden Sie den Namen nicht hören – Ihre Verbraucherschutzbehörde wird es niemals zulassen!«
»Wieso?« fragte Wallingford. Er hatte die erste Kapsel noch immer nicht genommen.
»Nur zu – nehmen Sie sie! Sie werden schon sehen«, sagte der Parsi. »Es gibt nichts Besseres.«
Trotz seiner Schmerzen hatte Patrick keine Lust, auf irgendeinen Drogentrip zu gehen.
»Bevor ich sie nehme, will ich wissen, warum die Verbraucherschutzbehörde sie niemals zulassen wird«, sagte er.
»Weil sie soviel Spaß macht!« rief Dr. Chothia. »Und dagegen hat Ihre Verbraucherschutzbehörde etwas. Nun nehmen Sie sie schon, ehe ich Ihnen den Spaß verderbe und Ihnen ein anderes Mittel verschreibe!«
Die Tablette hatte Patrick eingeschläfert – oder war es gar kein Schlaf? Für Schlaf jedenfalls war seine Wahrnehmung viel zu geschärft. Aber woher hätte er wissen sollen, daß er sich in einem Zustand des Vorherwissens befand? Woran erkennt man, daß man von seiner eigenen Zukunft träumt?
Wallingford schwebte über einem kleinen, dunklen See. Es mußte irgendeine Art von Flugzeug geben, sonst hätte Wallingford nicht dort sein können, doch in dem Traum sah [29] er das Flugzeug weder, noch hörte er es. Er ging einfach nieder, näherte sich dem kleinen See, der von dunkelgrünen Bäumen, Tannen und Kiefern, umgeben war. Unmengen von Mastbaumkiefern.
Felsnasen waren kaum zu sehen. Es sah nicht nach Maine aus, wo Wallingford als Kind im Sommerlager gewesen war. Nach Ontario sah es auch nicht aus; Patricks Eltern hatten einmal in der Georgian Bay, am Lake Huron, ein Cottage gemietet. Doch der See in dem Traum war kein Ort, an dem er je gewesen war.
Hier und da ragte ein Anlegesteg ins Wasser, und manchmal war daran ein Boot festgemacht. Wallingford sah auch ein Bootshaus, doch seine erste körperliche Empfindung in dem Traum war das Gefühl des Stegs an seinem nackten Rücken, die durch ein Handtuch hindurch verspürte Rauheit der Planken. Wie im Falle des Flugzeugs konnte er auch das Handtuch nicht sehen; er spürte nur etwas zwischen seiner Haut und dem Steg.
Die Sonne war gerade untergegangen. Er hatte keinen Sonnenuntergang gesehen, aber er merkte, daß die Sonnenhitze noch immer den Steg wärmte. Von Patricks fast vollkommenem Blick auf den dunklen See und die dunkleren Bäume abgesehen, bestand der Traum nur aus Empfindung.
Er spürte auch das Wasser, aber nicht, daß er darin war. Statt dessen hatte er das Gefühl, er wäre gerade aus dem Wasser gekommen. Sein Körper trocknete auf dem Landesteg, trotzdem war ihm noch immer kühl.
Dann sagte eine Frauenstimme – sie glich keiner anderen Frauenstimme, die Wallingford je gehört hatte, und war die erotischste Stimme der Welt –: »Mein Badeanzug fühlt sich [30] so kalt an. Ich ziehe ihn aus. Willst du deine Badehose nicht auch ausziehen?«
Von diesem Punkt in dem Traum an war sich Patrick seiner Erektion bewußt, und er hörte eine Stimme, die sehr nach seiner klang, »ja« sagen – auch er wollte seine nasse Badehose ausziehen.
Zusätzlich hörte man, wie das Wasser leise gegen den Steg plätscherte und von den feuchten Badeanzügen zwischen den Planken hindurch in den See zurücktropfte.
Er und die Frau waren jetzt nackt. Die Haut der Frau war zuerst naß und kalt und erwärmte sich dann an seiner Haut; ihr Atem strich heiß über seinen Hals, und er konnte ihr nasses Haar riechen. Außerdem hatten ihre straffen Schultern den Geruch des Sonnenlichts aufgenommen, und auf Patricks Zunge, die den Umriß ihres Ohrs nachzeichnete, lag etwas, das nach dem See schmeckte.
Natürlich war Wallingford auch in ihr – auf dem Steg an dem wunderschönen dunklen See schliefen sie unendlich lange miteinander. Und als er acht Stunden später erwachte, stellte er fest, daß er einen feuchten Traum gehabt hatte; trotzdem hatte er immer noch den riesigsten Steifen seines Lebens.
Die Schmerzen von der fehlenden Hand waren verschwunden. Sie würden, ungefähr zehn Stunden nachdem er die erste der kobaltblauen Kapseln eingenommen hatte, wiederkommen. Die zwei Stunden, die Patrick warten mußte, ehe er eine zweite Kapsel nehmen durfte, kamen ihm wie eine Ewigkeit vor; in jener trostlosen Zwischenphase konnte er mit Dr. Chothia über nichts anderes als die Tablette reden.
[31] »Was ist da drin?« fragte Wallingford den fröhlichen Parsi.
»Entwickelt worden ist sie als Mittel gegen Impotenz«, sagte ihm Dr. Chothia. »Aber sie hat nicht gewirkt.«
»Und wie sie wirkt«, meinte Wallingford.
»Tja… offensichtlich nicht gegen Impotenz«, antwortete der Parsi. »Gegen Schmerzen, ja – aber das hat man zufällig festgestellt. Bitte denken Sie daran, was ich gesagt habe, Mr. Wallingford. Nehmen Sie auf keinen Fall zwei.«
»Am liebsten würde ich drei oder vier nehmen«, erwiderte Patrick, doch an diesem Punkt legte der Parsi seine gewohnte Fröhlichkeit ab.
»Nein, das würden Sie nicht – glauben Sie mir«, warnte ihn Dr. Chothia.
Solange er noch in Indien war, hatte Wallingford – einzeln und im vorgeschriebenen Abstand von zwölf Stunden – zwei weitere von den kobaltblauen Kapseln eingenommen, und Dr. Chothia hatte ihm noch eine für den Flug mitgegeben. Patrick hatte den Parsi darauf hingewiesen, daß der Rückflug nach New York mehr als zwölf Stunden dauerte, doch der Arzt gab ihm für den Zeitpunkt, zu dem die Wirkung der letzten Feuchter-Traum-Pille nachlassen würde, nichts Stärkeres als Tylenol mit Kodein.
Wallingford hatte viermal nacheinander denselben Traum – das letzte Mal auf dem Flug von Frankfurt nach New York. Das Tylenol mit Kodein hatte er auf der ersten Etappe der langen Reise, von Bombay nach Frankfurt, genommen, weil er sich (trotz der Schmerzen) das Beste bis zum Schluß aufheben wollte.
Die Stewardess zwinkerte ihm zu, als sie ihn kurz vor der [32] Landung in New York aus seinem Blaue-Kapsel-Traum weckte. »Wenn das Schmerzen waren, die Sie da gehabt haben, dann hätte ich die gern mit Ihnen zusammen«, flüsterte sie. »Zu mir hat noch keiner so oft ›ja‹ gesagt!«
Obwohl sie Patrick ihre Telefonnummer gab, rief er sie nicht an. Fünf Jahre lang hatte Wallingford keinen so guten Sex mehr wie in dem Blaue-Kapsel-Traum. Und er brauchte noch länger, um zu begreifen, daß die kobaltblaue Kapsel, die Dr. Chothia ihm gegeben hatte, mehr war als ein schmerzstillendes Mittel und eine Sexpille – noch wichtiger, sie verhalf einem zu einem Blick in die Zukunft.
Doch ihr Hauptnutzen bestand darin, daß er dank ihr nicht mehr als einmal im Monat von dem Ausdruck träumte, der in den Augen des Löwen gelegen hatte, als das Tier seine Hand gepackt hielt. Die riesige, gerunzelte Stirn des Löwen; seine lohfarbenen, gewölbten Augenbrauen; die in seiner Mähne summenden Fliegen; die rechteckige, blutbespritzte und von Krallenspuren zernarbte Schnauze der Großkatze – diese Einzelheiten waren nicht so tief in Wallingfords Gedächtnis, dem Stoff seiner Träume, verankert wie die gelbbraunen Augen des Löwen, in denen Patrick so etwas wie eine leere Traurigkeit erkannt hatte. Nie würde er jene Augen vergessen – ihren leidenschaftslos musternden Blick in sein Gesicht, ihre gleichsam wissenschaftliche Distanziertheit.
Ungeachtet dessen, woran sich Wallingford erinnerte oder wovon er träumte, die Zuschauer des Senders mit dem passenden Spitznamen Apokalypse International jedenfalls erinnerten sich an jede einzelne, atemberaubende Sekunde der Handfreßepisode selbst – und träumten davon.
[33] Der Katastrophenkanal, der regelmäßig wegen seiner Vorliebe für bizarre Todes- und dumme Unfälle verspottet wurde, hatte im Zuge der Berichterstattung über genau so einen Todesfall genau so einen Unfall produziert und seinen Ruf dadurch auf beispiellose Weise gesteigert. Und diesmal war die Katastrophe einem Journalisten passiert! (Man glaube ja nicht, das hätte nicht zur Popularität der weniger als dreißigsekündigen Amputation beigetragen.)
Erwachsene identifizierten sich im allgemeinen mit der Hand, wenn auch nicht mit dem unglücklichen Reporter. Kinder neigten dazu, mit dem Löwen zu sympathisieren. Natürlich gab es hinsichtlich der Kinder Warnungen. Immerhin waren ganze Kindergartengruppen auseinandergefallen. Und Zweitkläßler – die endlich soweit waren, daß sie flüssig lesen und das Gelesene auch verstehen konnten – fielen auf eine analphabetische, rein visuelle Entwicklungsstufe zurück.
Eltern, die damals Kinder in der Grundschule hatten, werden stets an die Lehrerbriefe denken, die sie nach Hause geschickt bekamen, Briefe des Inhalts: »Wir empfehlen dringend, daß Sie Ihre Kinder nicht fernsehen lassen, bis die Geschichte mit dem Löwen nicht mehr gezeigt wird.«
Patricks ehemalige akademische Betreuerin war gerade mit ihrer einzigen Tochter auf Reisen, als der Unfall, der ihren Exliebhaber die Hand kostete, zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt wurde.
Die Tochter hatte es geschafft, in ihrem letzten Jahr im Internat schwanger zu werden; das war zwar keine sonderlich originelle Leistung, kam in einer reinen Mädchenschule aber dennoch unerwartet. Die nachfolgende Abtreibung [34] hatte die Tochter traumatisiert und zu einer Beurlaubung vom Unterricht geführt. Das verzweifelte Mädchen, das von seinem unsympathischen Freund sitzengelassen worden war, noch ehe es wußte, daß es ein Kind von ihm erwartete, würde das letzte Schuljahr wiederholen müssen.
Auch die Mutter hatte es schwer. Sie war noch in den Dreißigern gewesen, als sie Wallingford verführt hatte, der über zehn Jahre jünger, aber der bestaussehende Junge unter ihren höheren Semestern gewesen war. Mittlerweile Anfang Vierzig, machte sie gerade ihre zweite Scheidung durch, deren gütliche Abwicklung durch die unerfreuliche Enthüllung erschwert worden war, daß sie erst vor kurzem erneut mit einem ihrer Studenten – ihrem allerersten unteren Semester – geschlafen hatte.
Er war ein schöner Junge – leider der einzige Junge in ihrem unbedachten Kurs über die metaphysischen Dichter: unbedacht deshalb, weil sie hätte wissen müssen, daß eine solche »Kaste von Autoren«, wie Samuel Johnson sie genannt hatte, als er ihnen den Spitznamen »metaphysische Dichter« verlieh, hauptsächlich junge Frauen ansprechen würde.
Unbedacht war auch, daß sie den Jungen in ihren reinen Mädchenkurs aufnahm; darauf war er unzureichend vorbereitet. Aber er war in ihr Büro gekommen und hatte Andrew Marvells ›An die keusche Geliebte‹ rezitiert und dabei nur das Reimpaar »Und meiner Liebe Frucht sie sprieße / Empor zum prächt’gen Baum sie schieße« vermasselt.
Er sagte »Furcht« statt »Frucht«, und sie konnte seine Furcht fast mit Händen greifen, während er die nächsten Zeilen deklamierte.
[35] Einhundert Jahre will ich preisen
Deine Augen, deiner Stirne Ehr erweisen;
Zweihundert Jahre deine Brüste rühmen;
Doch allem anderen dreißigtausend ziemen.
Mannomann, hatte sie gedacht, denn sie hatte gewußt, daß es ihre Brüste und alles andere waren, woran er dachte. Und so hatte sie ihn aufgenommen.
Als die Mädchen in dem Kurs mit ihm flirteten, hatte sie das Bedürfnis verspürt, ihn zu beschützen. Zunächst redete sie sich ein, sie wolle ihn lediglich bemuttern. Als sie ihn abschob – ebenso umstandslos, wie ihre schwangere Tochter von ihrem ungenannten Freund abgeschoben worden war –, hatte der Junge ihren Kurs abgebrochen und seine Mutter angerufen.
Die Mutter des Jungen, die dem Kuratorium einer anderen Universität angehörte, schrieb dem Dekan der Fakultät: »Fällt das Schlafen mit einem Studenten nicht unter die Kategorie ›moralische Verderbtheit‹?« Ihre Frage hatte zur Folge gehabt, daß Patricks einstige akademische Betreuerin und Liebhaberin ihrerseits ein Semester Urlaub nahm.
Das ungeplante Freisemester, ihre zweite Scheidung, die ganz ähnlich gelagerte Schande ihrer Tochter… was sollte sie denn bloß tun?
Ihr künftiger zweiter Exehemann hatte sich widerstrebend bereit erklärt, ihre Kreditkarten noch einen Monat lang nicht sperren zu lassen. Das sollte er schwer bereuen. Spontan fuhr sie mit ihrer vom Unterricht beurlaubten Tochter nach Paris, wo die beiden eine Suite im ›Bristol‹ bezogen; das Hotel war viel zu teuer für sie, aber sie hatte [36] einmal eine Ansichtskarte davon erhalten und schon immer hinfahren wollen. Die Postkarte war von ihrem ersten Exmann gekommen – er war mit seiner zweiten Frau dort abgestiegen und hatte die Karte nur geschickt, um es ihr unter die Nase zu reiben.
Das ›Bristol‹ lag in der Rue du Faubourg Saint-Honoré, umgeben von eleganten Geschäften, wie sie sich nicht einmal eine Abenteurerin leisten konnte. Im Hotel angekommen, trauten sie und ihre Tochter sich nicht, irgendwohin zu gehen oder irgend etwas zu unternehmen. Sie kamen nicht mit der Extravaganz des Hotels zurecht. Im Foyer und in der Bar kamen sie sich zu einfach gekleidet vor und waren wie gebannt von den Menschen, die sich im ›Bristol‹ eindeutig sehr viel wohler fühlten. Dennoch gestanden sie sich nicht ein, daß es eine schlechte Idee gewesen war, hierherzukommen – jedenfalls nicht an ihrem ersten Abend.
Ganz in der Nähe, in einer der kleineren Straßen, gab es ein recht nettes, preisgünstiges Bistro, aber es war ein regnerischer, dunkler Abend, und sie wollten früh zu Bett – sie litten unter Jetlag. Sie hatten vor, zeitig zu essen, und wollten Paris erst am nächsten Tag richtig in Angriff nehmen, aber das Hotelrestaurant war sehr beliebt. Sie würden erst nach neun Uhr einen Tisch bekommen können, eine Zeit, zu der sie schon fest zu schlafen hofften.
Sie waren hierhergekommen, um sich für das Unrecht zu entschädigen, das man ihnen beiden, jedenfalls in ihren Augen, angetan hatte; in Wirklichkeit waren sie Opfer der Unerfülltheit des Fleisches, wobei ihre eigenen zahllosen Unzufriedenheiten eine maßgebliche Rolle gespielt hatten. Ob verdienter- oder unverdientermaßen, das ›Bristol‹ sollte [37] ihre Belohnung sein. Nun waren sie gezwungen, sich in ihre Suite zurückzuziehen und mit dem Zimmerservice vorliebzunehmen.
Der Zimmerservice im ›Bristol‹ hatte nichts Unelegantes – nur war das Ganze eben kein Abend in Paris, wie sie ihn sich vorgestellt hatten. Untypischerweise bemühten sich Mutter wie Tochter, das Beste daraus zu machen.
»Ich hätte mir nie träumen lassen, daß ich meine erste Nacht in Paris in einem Hotelzimmer mit meiner Mutter verbringe!« rief die Tochter aus; sie versuchte, darüber zu lachen.
»Von mir wirst du wenigstens nicht geschwängert«, bemerkte ihre Mutter. Auch darüber versuchten die beiden zu lachen.
Wallingfords ehemalige akademische Betreuerin begann die Litanei der enttäuschenden Männer in ihrem Leben herunterzubeten. Einen Teil dieser Liste kannte ihre Tochter bereits, aber sie bekam ihrerseits schon eine Liste zusammen, wenn diese bis jetzt auch erheblich kürzer war als die ihrer Mutter. Sie tranken zwei halbe Flaschen Wein aus der Minibar, ehe der rote Bordeaux kam, den sie zum Essen bestellt hatten, und sie tranken auch diesen. Dann riefen sie den Zimmerservice an und bestellten eine zweite Flasche.
Der Wein löste ihnen die Zunge – und das vielleicht in stärkerem Maße, als es in einem Gespräch zwischen Mutter und Tochter angebracht oder schicklich war. Daß ihre ungeratene Tochter von einer Vielzahl leichtsinniger Jungen hätte schwanger werden können, ehe sie den Rüpel kennenlernte, der es dann tatsächlich geschafft hatte, wäre für jede Mutter eine bittere Pille gewesen – auch in Paris. Daß [38] Patrick Wallingfords ehemalige akademische Betreuerin eine unverbesserliche Aufreißerin war, wurde selbst ihrer Tochter deutlich; daß ihre Mutter dank ihrer sexuellen Vorlieben mit immer jüngeren Männern, darunter schließlich auch einem Teenager, angebändelt hatte, war möglicherweise eine Erkenntnis, auf die keine Tochter gesteigerten Wert legte.
Während einer willkommenen Unterbrechung der endlosen Bekenntnisse ihrer Mutter – die nicht mehr ganz taufrische Bewunderin der metaphysischen Dichter unterschrieb gerade für die zweite Flasche Bordeaux und flirtete dabei schamlos mit dem Zimmerkellner – schaltete die Tochter auf der Suche nach Ablenkung von dieser ungewollten Vertraulichkeit den Fernseher ein. Wie es sich für ein erst kürzlich schick renoviertes Hotel gehörte, bot das ›Bristol‹ eine Vielzahl von Satellitensendern, und wie es der Zufall wollte, hatte die Mutter kaum die Tür hinter dem Zimmerkellner geschlossen und sich zu ihrer Tochter und dem Fernseher umgedreht, als sie sah, wie ihr Exliebhaber seine linke Hand an einen Löwen verlor. Einfach so!
Natürlich schrie sie, weshalb auch ihre Tochter schrie. Die zweite Flasche Bordeaux wäre dem Griff der Mutter entglitten, hätte sie den Flaschenhals nicht fest umklammert. (Möglicherweise stellte sie sich vor, die Flasche sei eine ihrer Hände, die gerade im Rachen eines Löwen verschwand.)
Die Handfreßepisode war vorüber, ehe die Mutter die verdrehte Geschichte ihrer Beziehung zu dem nun verstümmelten Fernsehjournalisten noch einmal erzählen konnte. Es sollte eine Stunde vergehen, bis der internationale [39] Nachrichtensender die Szene erneut brachte, obwohl alle fünfzehn Minuten ein beim Sender sogenannter »Anheizer« kam, der den bevorstehenden Bericht ankündigte – jedes Promo ein Teilstück von zehn bis fünfzehn Sekunden: Die Löwen, wie sie sich in ihrem Käfig um einen übriggebliebenen und nicht genau erkennbaren Bissen rauften; der an Patricks ausgerenkter Schulter baumelnde, handlose Arm; der verblüffte Ausdruck auf Wallingfords Gesicht, kurz bevor er in Ohnmacht fiel; die flüchtige Ansicht einer BH-losen Blondine mit Kopfhörern, die in einer wie Fleisch aussehenden Masse zu schlafen schien.
Mutter und Tochter blieben eine weitere Stunde auf, um sich die ganze Episode noch einmal anzusehen. Diesmal bemerkte die Mutter über die BH-lose Blondine: »Ich wette, er hat mit ihr gevögelt.«
In diesem Stil machten sie die zweite Flasche Bordeaux hindurch weiter. Die dritte Betrachtung des kompletten Ereignisses rief lasziv-hämisches Geschrei hervor – als bekäme Wallingford die Strafe, als die sie das Ganze sahen, stellvertretend für alle Männer, die sie je gekannt hatten.
»Nur daß es nicht seine Hand hätte sein müssen«, sagte die Mutter.
»Ja, genau«, bestätigte die Tochter.
Doch nach der dritten Betrachtung des grausigen Vorfalls nahm man das endgültige Verschlingen der Körperteile mit mißmutigem Schweigen auf, und die Mutter ertappte sich dabei, daß sie den Blick von Patricks Gesicht abwandte, kurz bevor er in Ohnmacht fiel.
»Armes Schwein«, sagte die Tochter leise. »Ich gehe schlafen.«
[40] »Ich glaube, einmal seh ich’s mir noch an«, antwortete ihre Mutter.
Die Tochter lag schlaflos im Bett; das flackernde Licht drang unter der Tür zum Wohnzimmer der Suite hindurch. Sie hörte ihre Mutter, die den Ton abgedreht hatte, vor sich hin schluchzen.
Pflichtschuldig setzte sich die Tochter zur Mutter auf die Wohnzimmercouch. Sie ließen den Ton des Fernsehers abgedreht; sie hielten sich an den Händen und sahen sich erneut den schrecklichen, aber animierenden Filmbericht an. Die hungrigen Löwen waren nebensächlich – Gegenstand der Verstümmelung waren die Männer.
»Warum brauchen wir sie, wo wir sie doch hassen?« fragte die Tochter müde.
»Wir hassen sie, weil wir sie brauchen«, antwortete die Mutter, leicht lallend.
Da war Wallingfords schmerzerfülltes Gesicht. Er fiel auf die Knie, aus seinem Unterarm spritzte Blut. Sein gutes Aussehen wurde von seinen Schmerzen überdeckt, aber er hatte eine derartige Wirkung auf Frauen, daß eine betrunkene, unter Jetlag leidende Mutter und ihre kaum weniger mitgenommene Tochter spürten, wie ihnen die Arme weh taten. Sie streckten sie sogar nach ihm aus, als er hinfiel.
Patrick Wallingford wurde nie von sich aus aktiv, doch er rief sexuelle Spannung und übersteigerte Sehnsucht hervor. Er zog Frauen jeden Alters und Typs wie magnetisch an; noch wenn er bewußtlos dalag, stellte er eine Gefahr für das weibliche Geschlecht dar.
Wie in Familien häufig der Fall, sprach die Tochter laut [41] aus, was die Mutter ebenfalls beobachtet, aber für sich behalten hatte. »Guck mal, die Löwinnen«, sagte die Tochter.
Nicht eine Löwin hatte die Hand angerührt. In ihren traurigen Augen lag ein gewisses Maß an Sehnsucht; und noch nachdem Wallingford in Ohnmacht gefallen war, wandten die Löwinnen nicht den Blick von ihm. Es schien beinahe so, als wären auch sie ganz hingerissen.
[42] 2
Der frühere Mittelfeldspieler
Das Team in Boston wurde geleitet von Dr. Nicholas M. Zajac, einem Handchirurgen bei Schatzman, Gingeleskie, Mengerink & Partner – dem führenden handmedizinischen Zentrum in Massachusetts. Zudem war Dr. Zajac außerordentlicher Professor für Chirurgie in Harvard. Es war seine Idee, über das Internet nach potentiellen Handspendern und -empfängern zu suchen (www.needahand.com).
Dr. Zajac war eine halbe Generation älter als Patrick Wallingford. Daß sowohl Deerfield als auch Amherst zu seiner Zeit reine Jungenschulen gewesen waren, reicht kaum aus, die von Geschlechtertrennung geprägte Haltung zu erklären, die sich in seinem Auftreten ebenso stark bemerkbar machte wie sein schlechter Geschmack in puncto Aftershave.
Aus seiner Zeit in Deerfield oder seinen vier Jahren in Amherst erinnerte sich kein Mensch an ihn. Er hatte sowohl in der Prep School als auch am College Lacrosse gespielt – er war sogar Anspieler –, aber nicht einmal seine Trainer erinnerten sich an ihn. Daß man in Sportmannschaften derart anonym bleibt, kommt außerordentlich selten vor; doch Nick Zajac hatte seine Jugend und sein frühes Mannesalter in einem auf geradezu unheimliche Weise undenkwürdigen, wenn auch erfolgreichen Streben nach Spitzenleistungen [43] verbracht, ohne Freunde und ohne eine einzige sexuelle Erfahrung.
Einem Kommilitonen, mit dem er sich eine weibliche Leiche teilte, blieb der künftige Dr. Zajac wegen der Bestürzung und Empörung bei deren Anblick für immer im Gedächtnis. »Daß sie schon lange tot war, machte ihm nichts aus«, entsann er sich. »Nick machte zu schaffen, daß die Leiche eine Frau war, und zwar eindeutig seine erste.«
Ebenfalls seine erste war Zajacs Ehefrau. Er gehörte zu den übertrieben dankbaren Männern, die die erste Frau heiraten, die mit ihnen schläft. Sowohl er als auch seine Frau sollten das bereuen.
Die weibliche Leiche hatte etwas mit Zajacs Entscheidung zu tun, sich auf Hände zu spezialisieren. Seinem früheren Laborpartner zufolge waren die Hände die einzigen Körperteile der Leiche, die zu untersuchen Zajac ertragen konnte.
Über Dr. Zajac müssen wir eindeutig noch mehr erfahren. Seine Magerkeit war zwanghaft; er konnte gar nicht dünn genug sein. Als Marathonläufer, Vogelbeobachter und Körneresser – eine Gewohnheit, die sich der Beobachtung von Finken verdankte – fühlte sich der Doktor auf außergewöhnliche Weise zu Vögeln und zu berühmten Menschen hingezogen. Er wurde Handchirurg für Stars.
Meistens handelte es sich um Sportstars, verletzte Sportler, wie etwa den Werfer der Boston Red Sox mit dem gerissenen vorderen radio-ulnaren Band an der Wurfhand. Der Werfer wurde später im Tausch für zwei Infielder, die sich nicht durchsetzten, und für einen als Schlagmann vorgesehenen Spieler, dessen Haupttalent darin bestand, seine [44] Frau zu schlagen, an die Toronto Blue Jays abgegeben. Zajac operierte auch den vorgesehenen Schlagmann. Bei dem Versuch, sich im Auto einzuschließen, hatte dessen Frau ihm mit der Wagentür die Hand eingeklemmt – wobei die zweite Grundphalange und der dritte Mittelhandknochen am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Erstaunlich viele Verletzungen von Sportstars ergaben sich außerhalb des Spielfeldes, des Platzes oder der Eisfläche – wie zum Beispiel bei dem inzwischen nicht mehr aktiven Torwart der Boston Bruins, der sich das Querband der linken Hand einriß, indem er ein Weinglas zu kräftig gegen seinen Ehering drückte. Und da war der häufig mit Strafen belegte Linebacker der New England Patriots, der sich bei dem Versuch, mit einem Schweizer Armeemesser eine Auster zu öffnen, eine Fingerarterie und mehrere Fingernerven durchtrennte. Sie waren risikobereit – sie neigten stark zu Unfällen –, aber sie waren berühmt. Eine Zeitlang bewunderte Dr. Zajac sie; ihre signierten Fotos, die körperliche Überlegenheit ausstrahlten, schauten von den Wänden seines Behandlungsraums herab.
Doch selbst die Sportunfälle der Sportstars waren häufig unnötig, wie etwa bei dem Center der Boston Celtics, der einen Rückwärts-Slam-Dunk versuchte, nachdem die Uhr schon abgelaufen war. Er verlor einfach die Kontrolle über den Ball und machte sich am Korbrand die palmare Faszie kaputt.
Egal – Dr. Zajac liebte sie alle. Und nicht nur die Sportler.
Rocksänger neigten offenbar zu zweierlei Arten von Hotelzimmerverletzungen. An vorderster Stelle stand dabei [45] das, was Zajac als »Zimmerservice-Koller« kategorisierte; er führte zu Stichwunden, Verbrühungen durch Tee und Kaffee und einer Unmenge ungeplanter Konfrontationen mit toten Gegenständen. Diesen dichtauf folgten die unzähligen Mißgeschicke auf feuchten Badezimmerböden, zu denen nicht nur Rock-, sondern auch Filmstars tendierten.
Filmstars hatten außerdem Unfälle in Restaurants und zwar hauptsächlich beim Verlassen derselben. Vom Standpunkt eines Handchirurgen aus war es besser, einen Fotografen als dessen Kamera zu schlagen. Im Interesse der Hand war jeder Ausdruck von Feindseligkeit gegenüber einem Metall-, Glas-, Holz-, Stein- oder Plastikgegenstand ein Fehler. Doch bei Prominenten war Gewalttätigkeit gegen Dinge die Hauptursache der Verletzungen, die der Doktor zu Gesicht bekam.
Wenn Dr. Zajac die sanftmütigen Gesichter seiner renommierten Patienten Revue passieren ließ, dann in der Erkenntnis, daß ihr Erfolg und ihre zur Schau gestellte Zufriedenheit nur Masken waren.
All dies mag Zajac beschäftigt haben, doch seine Kollegen bei Schatzman, Gingeleskie, Mengerink & Partner beschäftigen sich mit ihm. Zwar nannten sie Dr. Zajac nie ins Gesicht hinein prominentengeil, doch sie wußten um seine Schwäche und fühlten sich ihm überlegen – allerdings nur in dieser Hinsicht. Als Chirurg stach er sie alle aus, und auch das wußten sie und ärgerten sich darüber.
Wenn man sich bei Schatzman, Gingeleskie, Mengerink & Partner jeden Kommentars zu Zajacs Prominentengeilheit enthielt, so erlaubte man sich immerhin, den Superstar-Kollegen wegen seiner Magerkeit zu ermahnen. Man [46] glaubte allgemein, Zajacs Ehe sei gescheitert, weil er dünner als seine Frau geworden war, doch bei Schatzman, Gingeleskie, Mengerink & Partner hatte niemand Dr. Zajac zu einer vernünftigen Ernährungsweise bewegen und so seine Ehe retten können; um so unwahrscheinlicher, daß sie ihn nun, nach seiner Scheidung, zu einer Mastkur würden überreden können.
Es war hauptsächlich seine Liebe zu Vögeln, die Zajacs Nachbarn wahnsinnig machte. Aus Gründen, die auch den Ornithologen der Gegend verborgen blieben, war Dr. Zajac der Überzeugung, daß die Fülle von Hundekot in Greater Boston sich schädlich auf die Vogelwelt der Stadt auswirkte.
Es gab ein Bild von Zajac, an dem sich alle seine Kollegen weideten, obwohl nur einer von ihnen es tatsächlich gesehen hatte. An einem Sonntagmorgen suchte der berühmte Handchirurg – in kniehohen Stiefeln, seinem roten Flanellbademantel und einer grotesken New-England-Patriots-Skimütze, in der einen Hand eine braune Papiertüte, in der anderen einen Lacrosseschläger in Kindergröße – seinen verschneiten Garten in der Brattle Street nach Hundehaufen ab. Dr. Zajac hatte selbst zwar keinen Hund, aber er hatte mehrere rücksichtslose Nachbarn, und die Brattle Street war eine der beliebtesten Gassiführrouten von Cambridge.
Der Lacrosseschläger war für Zajacs einziges Kind bestimmt gewesen, einen unsportlichen Sohn, der ihn jedes dritte Wochenende besuchte. Der von der Scheidung seiner Eltern verstörte, problembeladene Junge war ein untergewichtiger Sechsjähriger, ein hartnäckiger Nichtesser – durchaus möglich, daß dies auf den Einfluß seiner Mutter [47] zurückging, die ihre Lebensaufgabe schlicht und einfach darin sah, Zajac verrückt zu machen.
Die Exfrau, die Hildred hieß, äußerte sich in wegwerfendem Ton zu dem Thema. »Wieso soll der Junge essen? Sein Vater tut es doch auch nicht. Er sieht, wie sein Vater hungert, also hungert er selbst auch!« Deshalb durfte Zajac seinen Sohn laut Scheidungsregelung nur alle drei Wochen, und nie länger als ein Wochenende, sehen. Dabei hat Massachusetts die sogenannte Scheidung ohne Verschulden! (Ein Begriff, den Wallingford als sein Lieblingsoxymoron bezeichnete.)
In Wirklichkeit zermarterte sich Dr. Zajac den Kopf über die Eßstörung seines geliebten Kindes und suchte sowohl medizinische als auch praktische Lösungen für das Leiden seines Sohnes. (Hildred nahm kaum zur Kenntnis, daß ihr verhungert aussehender Sohn überhaupt ein Problem hatte.) Der Junge hieß Rudy; und an den Wochenenden, an denen er seinen Vater besuchte, bekam er häufig das Schauspiel vorgeführt, wie Dr. Zajac sich mit üppigen Portionen zwangsernährte, die er später, in zurückgezogener, disziplinierter Stille, wieder erbrach. Doch ob mit oder ohne das Beispiel seines Vaters, Rudy aß kaum etwas.
Ein Kindergastroenterologe riet zu einem diagnostischen Eingriff, um eine mögliche Erkrankung des Colons auszuschließen. Ein anderer verschrieb einen Saft, einen unverdaulichen Zucker, der diuretisch wirkte. Ein dritter meinte, das Problem werde sich von selbst geben; das war der einzige gastroenterologische Rat, den sowohl Dr. Zajac als auch seine Exfrau akzeptieren konnten.
Unterdessen hatte Zajacs ehemalige im Haus wohnende [48] Haushälterin gekündigt – sie konnte nicht mit ansehen, welche Unmengen von Lebensmitteln jeden dritten Montag weggeworfen wurden. Weil Irma, die neue, ebenfalls im Haus wohnende Haushälterin, an dem Wort »Haushälterin« Anstoß nahm, achtete Zajac von Anfang an darauf, sie als seine »Assistentin« zu bezeichnen, obwohl die Hauptaufgaben der jungen Frau darin bestanden, das Haus sauber zu halten und die Wäsche zu besorgen. Vielleicht war es das obligatorische tägliche Entfernen der Hundehaufen aus dem Garten, das ihr jeden Schwung nahm – die Schande der braunen Papiertüte, ihre Ungeschicklichkeit mit dem Kinder-Lacrosseschläger, das Niedere der Arbeit.
Irma war eine unscheinbare, stämmig gebaute junge Frau Ende Zwanzig, und sie hatte nicht damit gerechnet, daß zur Arbeit für einen »Mediziner«, wie sie ihn nannte, auch etwas so Erniedrigendes wie der Kampf gegen die Scheißgewohnheiten der Brattle-Street-Hunde gehörte.
Außerdem kränkte sie, daß Dr. Zajac sie für eine Neueinwanderin hielt, für die Englisch eine Zweitsprache war. Englisch war Irmas erste und einzige Sprache, und das Mißverständnis rührte daher, daß Zajac nur sehr wenig verstand, wenn er zufällig ihre unglückliche Stimme am Telefon hörte.
Irma hatte ihren eigenen Apparat in ihrem an die Küche angrenzenden Zimmer und redete spät in der Nacht, wenn Zajac den Kühlschrank plünderte, oft ausführlich mit ihrer Mutter oder einer ihrer Schwestern. (Der skalpelldünne Chirurg beschränkte seine Imbisse auf rohe Möhren, die er in einer Schüssel mit schmelzendem Eis im Kühlschrank aufbewahrte.)
[49] Zajac kam es so vor, als spräche Irma eine Fremdsprache. Teilweise wurde sein Hörvermögen sicher auch durch sein unablässiges Kauen auf rohen Möhren und das unerträgliche Gezwitscher der über das ganze Haus verteilten Singvögel in Käfigen beeinträchtigt, aber der Hauptgrund für Zajacs falsche Annahme war, daß Irma jedesmal hysterisch weinte, wenn sie mit ihrer Mutter oder ihren Schwestern sprach. Sie berichtete ihnen, wie demütigend es war, von Dr. Zajac ständig unterbewertet zu werden.
Irma konnte kochen, aber der Doktor nahm kaum je regelmäßige Mahlzeiten zu sich. Sie konnte nähen, aber Zajac betraute seine Reinigung mit der Reparatur seiner Praxis- und Klinikkleidung; was ansonsten an Wäsche blieb, waren im wesentlichen die verschwitzten Kleider, in denen er joggte. Zajac joggte morgens (manchmal im Dunkeln) vor dem Frühstück, und er joggte erneut (oft im Dunkeln) am Ende des Tages.
Er war einer jener dünnen Männer Mitte Vierzig, die an den Ufern des Charles River entlangjoggen, als stünden sie in einem immerwährenden Fitneßwettbewerb mit sämtlichen Studenten, die ebenfalls in der Nähe des Memorial Drive joggen und gehen. Bei Schnee, bei Schneematsch, bei Schneeregen, bei Sommerhitze – selbst bei Gewittern – joggte und joggte der dürre Chirurg. Bei einer Größe von einsachtzig wog Dr. Zajac knapp über sechzig Kilo.
Irma, die eins siebenundsechzig groß war und achtundsechzig Kilo wog, war davon überzeugt, daß sie ihn haßte. Nachts schluchzte sie die Litanei der Kränkungen, die Zajac ihr zugefügt hatte, ins Telefon, doch wenn der Handchirurg sie hörte, dachte er nur: Tschechisch? Polnisch? Litauisch?
[50] Als Dr. Zajac sie fragte, woher sie kam, antwortete Irma indigniert: »Boston!« Schön für sie!, folgerte Zajac. Keiner ist so patriotisch wie der dankbare europäische Einwanderer. So beglückwünschte Dr. Zajac sie zu ihrem guten Englisch, »wenn man bedenkt«, und Irma weinte sich nachts am Telefon die Seele aus dem Leib.
Sie enthielt sich jeden Kommentars über die Lebensmittel, die der Doktor jeden dritten Freitag kaufte, und Dr. Zajac gab keine Erklärung für die jeden dritten Montag erteilte Anweisung, alles wegzuwerfen. Die Lebensmittel – ein ganzes Huhn, ein ganzer Schinken, Obst und Gemüse – waren dann jeweils auf dem Küchentisch zusammengetragen, und dabei lag ein getippter Zettel mit dem einzigen Wort BESEITIGEN.
Es mußte mit seinem Abscheu vor Hundekot zu tun haben, stellte sich Irma vor. Mit mythischer Schlichtheit ging sie davon aus, daß der Doktor unter einer Beseitigungsmanie litt. Sie hatte keine Ahnung. Selbst beim morgendlichen und abendlichen Joggen hatte Dr. Zajac einen Lacrosseschläger, einen für Erwachsene, bei sich, den er hielt, als führe er einen imaginären Ball.
Im Hause Zajac gab es viele Lacrosseschläger. Zusätzlich zu Rudys, der eher nach Spielzeug aussah, gab es zahlreiche Schläger in Erwachsenengröße und unterschiedlichen Graden von Abnutzung und Kaputtheit. Es gab sogar einen ramponierten Holzschläger, der aus der Zeit des Doktors in Deerfield stammte. Wegen seiner gerissenen und neu geknüpften Rohlederschnüre wie eine Waffe anmutend, war er mit schmutzigem Klebeband umwickelt und dreckverkrustet. Doch in Dr. Zajacs geschickten Händen durchbebte [51] den Schläger die nervöse Energie seiner bewegten Jugend, in der der neurasthenische Handchirurg ein untergewichtiger, aber überaus fähiger Mittelfeldspieler gewesen war.
Wenn der Doktor an den Ufern des Charles River entlangjoggte, vermittelte der altmodische Lacrosseschläger aus Holz die gleiche Wirkung wie das im Anschlag gehaltene Gewehr eines Soldaten. Mehr als ein Ruderer in Cambridge hatte es schon erlebt, wie ein, zwei Hundehaufen über sein Bootsheck sausten, und einer von Zajacs Medizinstudenten – ehedem Steuermann eines Harvard-Achters – behauptete, er hätte gerade noch einem auf seinen Kopf gezielten Hundehaufen ausweichen können.
Dr. Zajac bestritt, daß er den Steuermann habe treffen wollen. Er verfolgte lediglich das Ziel, den Memorial Drive von einem deutlichen Übermaß an Hundekot zu befreien, den er mit seinem Lacrosseschläger lüpfte und in den Charles River schleuderte. Doch der ehemalige Steuermann und Medizinstudent hatte nach ihrer ersten denkwürdigen Begegnung nach dem verrückten Mittelfeldspieler Ausschau gehalten, und es gab andere Ruderer und Steuerleute, die schworen, sie hätten gesehen, wie Zajac mit seinem alten Lacrosseschläger gekonnt einen Hundehaufen aufnahm und ihn auf sie schoß.
Belegt ist, daß der frühere Mittelfeldspieler von Deerfield zwei Tore gegen ein zuvor ungeschlagenes Team aus Andover und zweimal je drei Tore gegen Exeter erzielte. (Zwar erinnerte sich von Zajacs Mannschaftskameraden keiner an ihn, wohl aber so mancher seiner Gegner. Der Torwart von Exeter sagte es am treffendsten: »Nick Zajac hatte einen richtig fiesen Schuß.«)
[52] Dr. Zajacs Kollegen bei Schatzman, Gingeleskie, Mengerink & Partner hatten ihn außerdem darüber lästern hören, »wie absolut lächerlich es ist, einen Sport zu betreiben, bei dem man nach hinten schaut«, womit er seine Verachtung für Ruderer dokumentiert hatte. Na und? Ist exzentrisches Verhalten bei Erfolgsmenschen nicht ziemlich verbreitet?
Das Haus in der Brattle Street tönte von Singvögeln wider wie ein bewaldetes Tal. Die Erkerfenster des Speisezimmers waren mit großen schwarzen X besprayt, um zu verhindern, daß Vögel dagegen prallten. Dadurch sah Dr. Zajacs Heim ständig so aus, als wäre es von Vandalen heimgesucht worden. Ein Zaunkönig mit einem gebrochenen Flügel erholte sich in seinem eigenen Käfig in der Küche, wo erst vor kurzem – zu Irmas wachsendem Kummer – ein Seidenschwanz mit gebrochenem Hals gestorben war.