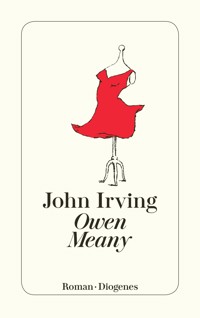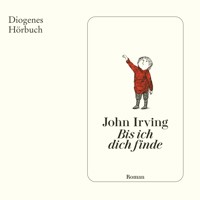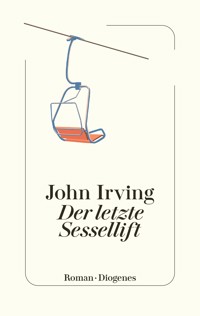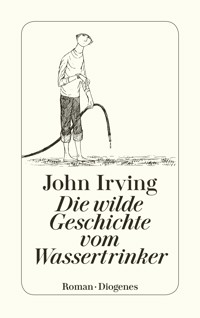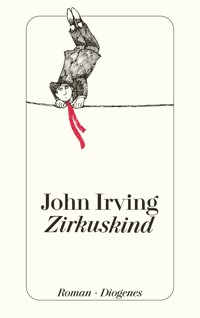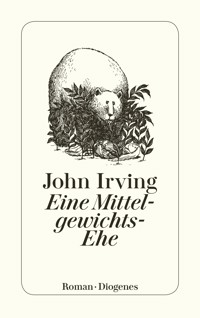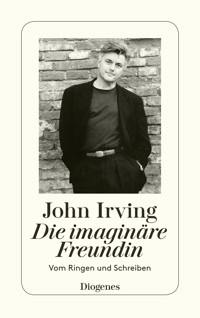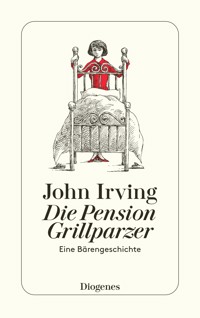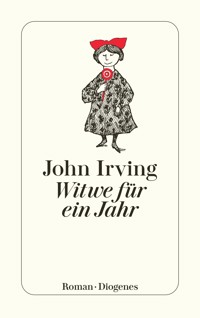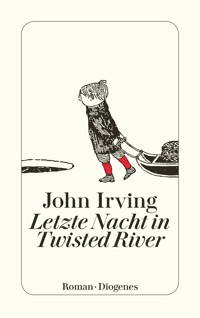9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer diesen Roman noch nicht gelesen hat, ist zu beneiden. Denn ihn erwartet eine Welt voller skurriler Ereignisse und liebenswert verschrobener Figuren in Neuengland und Wien. Garps Welt eben, in der alles passieren kann und meistens auch passiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 907
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
John Irving
Garp
und wie er die
Welt sah
Roman Aus dem Amerikanischen von
Titel der 1978 bei
E.P. Dutton, New York,
erschienenen Originalausgabe
›The World According to Garp‹
Die deutsche Erstausgabe erschien 1979
im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg
Die Übersetzung wurde für die
vorliegende Ausgabe von
Astrid Arz, Barbara Bauer, Kati Hertzsch
und Anna von Planta überarbeitet
Umschlagillustration
von Edward Gorey (Ausschnitt)
Mit freundlicher Genehmigung des
Edward Gorey Charitable Trust,
New York
Alle Rechte an dieser Ausgabe vorbehalten
Copyright © 1976 by Garp Enterprises Ltd.
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 06815 3 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60150 3
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]
[7] Inhalt
1 Boston Mercy [9]
2 Blut und Blau [51]
3 Was er später einmal werden wollte [99]
4 Abschlussprüfung [129]
5 In der Stadt, in der Mark Aurel starb [164]
6 Die Pension Grillparzer [221]
7 Mehr Triebe [255]
8 Zweite Kinder, zweite Romane, zweite Liebe [299]
9 Der ewige Gatte [334]
10 Der Hund im Durchgang und das Kind im Himmel [362]
11 Mrs. Ralph [385]
12 Es passiert Helen [417]
13 Walt erkältet sich [464]
14 Mark Aurel und wie er die Welt sah [516]
15 Bensenhaver und wie er die Welt sah [551]
16 Der erste Mörder [609]
17 Die erste feministische Beerdigung, und nicht nur die [672]
18 Erscheinungsformen des Sogs [719]
19 Ein Leben nach Garp [781]
[9] 1
Boston Mercy
Garps Mutter, Jenny Fields, wurde 1942 in Boston festgenommen, weil sie einen Mann in einem Kino verletzt hatte. Es war kurz nachdem die Japaner Pearl Harbor bombardiert hatten, und die Leute ließen den Soldaten viel durchgehen, weil plötzlich jeder Soldat war, Jenny Fields aber ließ Männern im Allgemeinen und Soldaten im Besonderen nichts durchgehen.
Im Kino hatte sie dreimal weiterrücken müssen, aber jedes Mal war der Soldat noch näher an sie herangerückt, bis sie an der modrigen Wand saß, wo irgendeine alberne Säule ihr fast die ganze Sicht auf die Wochenschau versperrte. Da beschloss sie, nicht noch einmal aufzustehen und weiterzurücken. Der Soldat jedoch rückte abermals weiter und setzte sich direkt neben sie.
Jenny war zweiundzwanzig. Sie hatte das College angefangen und gleich wieder verlassen, aber die Schwesternschule hatte sie als Klassenbeste absolviert, und sie war sehr gern Krankenschwester. Sie war eine athletisch wirkende junge Frau mit frischer Gesichtsfarbe, glänzendem dunklen Haar und einem Gang, den ihre Mutter als männlich bezeichnete (sie schwenkte die Arme), und ihr Gesäß und ihre Hüften waren so flach und schmal, dass sie von hinten wie ein Junge aussah. Jenny fand ihre Brüste zu groß; sie [10] war der Meinung, durch ihren üppigen Busen sehe sie wie ein »billiges Flittchen« aus.
Das war sie ganz und gar nicht. Tatsächlich war sie vom College abgegangen, als ihr der Verdacht kam, ihre Eltern hätten sie hauptsächlich deshalb nach Wellesley geschickt, damit sie sich von irgendeinem jungen Mann aus gutem Hause erst ausführen und dann zum Traualtar führen ließ. Das Wellesley College hatten ihre älteren Brüder empfohlen. Wellesley-Absolventinnen, hatten sie ihren Eltern versichert, gälten nicht als leichte Mädchen, sondern im Gegenteil als vorzügliche Heiratskandidatinnen. Jenny spürte, dass ihr Studium für ihre Eltern nur eine vornehme Methode war, Zeit zu schinden, als wäre sie in Wirklichkeit eine Kuh, die nur auf die Einführung des Instruments zur künstlichen Besamung vorbereitet würde.
Als Hauptfach hatte sie Anglistik gewählt, doch als sie den Eindruck gewann, dass ihre Kommilitoninnen vor allem anderen Bildung und sicheres Auftreten im Umgang mit Männern erwerben wollten, fiel es ihr nicht schwer, die Literatur für die Krankenpflege hinzuwerfen. Die Krankenpflege betrachtete sie als etwas, das sich unmittelbar in die Praxis umsetzen ließ, und außerdem hatten die Schwesternschülerinnen bei ihrer Berufswahl, soweit Jenny sehen konnte, keine anderweitigen Motive (später schrieb sie in ihrer berühmten Autobiographie, dass sich viel zu viele Schwestern viel zu vielen Ärzten feilboten, aber da hatte sie ihre Zeit als Krankenschwester längst hinter sich).
Sie mochte die einfache Uniform ohne jeden Firlefanz: Das Oberteil des Kittels ließ ihre Brüste kleiner wirken, die Schuhe waren bequem und passten zu ihren weit [11] ausholenden Schritten. Wenn sie Nachtwache hatte, konnte sie immerhin lesen. Und den Knaben vom College, die beleidigt und enttäuscht waren, wenn man keine Zugeständnisse machte, und überlegen und reserviert taten, wenn doch, trauerte sie nicht nach. Im Krankenhaus sah sie mehr Soldaten und junge Arbeiter als Studenten, und die waren offener und nicht so dünkelhaft in ihren Erwartungen; wenn man ihnen ein bisschen nachgab, hatte man wenigstens bei der nächsten Begegnung das Gefühl, dass sie sich freuten. Dann war plötzlich jeder junge Mann Soldat – und so aufgeblasen wie die Collegestudenten –, und Jenny Fields ließ sich überhaupt nicht mehr mit Männern ein.
»Meine Mutter«, schrieb Garp, »war ein einsamer Wolf.«
Die Fields hatten ihr Vermögen mit Schuhen gemacht, wenn auch Mrs. Fields, eine geborene Weeks aus Boston, einiges Geld mit in die Ehe gebracht hatte. Die Fields hatten mit ihren Schuhen so viel verdient, dass sie sich schon vor Jahren aus den Schuhfabriken zurückgezogen hatten. Sie lebten in einem großen, mit Schindeln gedeckten Haus in Dog’s Head Harbor an der Küste von New Hampshire. Jenny fuhr an ihren freien Tagen heim – hauptsächlich um ihre Mutter zufriedenzustellen und die alte Dame davon zu überzeugen, dass ihre Tochter, auch wenn sie als Krankenschwester »ihr Leben vergeudete«, wie die Mutter es ausdrückte, sich weder sprachlicher noch moralischer Laxheit hingab.
Jenny traf sich bei diesen Heimfahrten häufig mit ihren Brüdern an der North Station, damit sie im selben Zug nach Hause fahren konnten. Wie von allen Mitgliedern der [12] Familie Fields nicht anders erwartet, saßen sie auf der rechten Seite der Boston and Maine Railway, wenn der Zug Boston verließ, und auf der linken, wenn sie zurückkamen. Das entsprach den Wünschen des alten Mr. Fields, der zugab, dass die Aussicht auf jener Seite die hässlichere war, aber fand, dass alle Fields gezwungen sein sollten, die schmutzige Quelle ihrer finanziellen Unabhängigkeit und ihres privilegierten Lebens zu betrachten. Zur Rechten, wenn man Boston verließ, und zur Linken, wenn man zurückkehrte, sah man nämlich die Fields-Fabriken in Haverhill samt gewaltiger Reklametafel mit riesigem Arbeitsschuh, der einen festen Schritt auf den Betrachter zutat. Die Tafel prangte über dem Rangierbahnhof und spiegelte sich in unzähligen Miniaturausgaben in den Fabrikfenstern. Unter dem drohend vorwärtsschreitenden Fuß standen die Worte:
FIELDS FÜR DIE FÜSSE IN FABRIKEN UND AUF FELDERN!
Es gab auch ein Fields-Sortiment von Schwesternschuhen, und Mr. Fields schenkte seiner Tochter jedes Mal, wenn sie nach Hause kam, ein Paar – Jenny musste Dutzende davon besessen haben. Auch Mrs. Fields, die den Abgang ihrer Tochter vom Wellesley College bei jeder Gelegenheit mit einer düsteren Zukunft gleichsetzte, machte Jenny jedes Mal, wenn diese nach Hause kam, ein Geschenk. Und zwar schenkte sie ihrer Tochter eine Wärmflasche oder sagte es jedenfalls – und Jenny glaubte es ihr: Sie machte die Päckchen nie auf. Ihre Mutter sagte zum Beispiel: »Liebes, hast du noch die Wärmflasche, die ich dir geschenkt habe?« [13] Dann dachte Jenny kurz nach, nahm an, dass sie sie im Zug vergessen oder weggeworfen hatte, und sagte schließlich: »Vielleicht habe ich sie verloren, Mutter, aber ich brauche bestimmt keine neue.« Woraufhin Mrs. Fields ein weiteres, in Drugstorepapier eingewickeltes Päckchen aus seinem Versteck hervorholte und es ihrer Tochter aufnötigte. Und dann sagte Mrs. Fields:»Bitte, Jenny, pass besser auf. Und benutze sie, bitte!«
Als Krankenschwester fand Jenny Wärmflaschen ziemlich nutzlos; in ihren Augen waren sie nur rührende, kurios altmodische Seelentröster. Einige Päckchen fanden jedoch den Weg bis in ihr kleines Zimmer unweit des Boston Mercy Hospitals. Sie bewahrte sie in einem Wandschrank auf, angefüllt mit ebenso ungeöffneten Kartons voller Schwesternschuhe.
Sie fühlte sich ihrer Familie nicht verbunden und fand es seltsam, dass man sie als Kind mit Fürsorge überschüttet und dann plötzlich, zu einem bestimmten, vorher festgesetzten Zeitpunkt, den Strom der Zuneigung abgestellt und mit den Erwartungen begonnen hatte – als wäre es ganz normal, dass man eine kurze Phase hindurch Liebe empfing (und auch genug davon abbekam) und dann eine sehr viel längere und ernstzunehmendere Phase hindurch gewisse Verpflichtungen erfüllte. Als Jenny die Fesseln gesprengt und das Wellesley College für etwas so Gewöhnliches wie Krankenpflege aufgegeben hatte, hatte sie zugleich ihre Familie fallenlassen – und ihre Eltern und Geschwister machten sich daran, sie fallenzulassen, als könnten sie nicht anders. Die Fields hätten es zum Beispiel sehr viel angemessener gefunden, wenn Jenny Ärztin geworden oder [14] wenn sie auf dem College geblieben wäre, bis sie einen Arzt geheiratet hätte. Wenn sie ihre Brüder, ihre Mutter und ihren Vater sah, war ihnen allen von Mal zu Mal unbehaglicher zumute. Zu ihrem Bedauern mussten sie sich alle miteinander die über die langen Jahre erworbene Vertrautheit mühsam wieder abgewöhnen.
Familien müssen wohl so sein, dachte Jenny Fields. Falls sie selber je Kinder hätte, würde sie sie, wenn sie zwanzig waren, nicht weniger lieben als mit zwei. Womöglich brauchen sie einen mit zwanzig sogar noch mehr, dachte sie. Was braucht man im Grunde schon, wenn man zwei ist? Im Krankenhaus waren die Neugeborenen die einfachsten Patienten. Je älter sie wurden, umso bedürftiger waren sie – und umso unerwünschter und ungeliebter.
Jenny hatte das Gefühl, auf einem großen Schiff herangewachsen zu sein, ohne je den Maschinenraum gesehen, geschweige denn begriffen zu haben, wie die Maschinen darin funktionierten. Ihr gefiel, wie im Krankenhaus alles auf die Nahrungsaufnahme, -verwertung und -ausscheidung reduziert wurde. Als Kind hatte sie nie zugesehen, wie das schmutzige Geschirr abgewaschen wurde, hatte eine Zeitlang sogar geglaubt, nachdem die Dienstmädchen den Tisch abräumten, würden sie es wegwerfen (damals, bevor sie die Küche überhaupt nur betreten durfte). Und wenn der Milchwagen morgens die Flaschen brachte, dachte Jenny damals, er brächte auch das Geschirr mit den Mahlzeiten – so sehr glich das Klirren und Klappern den Geräuschen hinter der geschlossenen Küchentür, wo die Mädchen so geheimnisvoll mit dem Geschirr hantierten.
Jenny Fields war fünf, als sie zum ersten Mal das [15] Badezimmer ihres Vaters sah. Eines Morgens machte sie es ausfindig, indem sie dem Duft seines Kölnischwassers folgte. Sie fand eine dampfende Duschkabine – ziemlich modern für 1925 –, ein eigenes WC, eine Reihe von Flaschen, die so anders waren als die Flaschen ihrer Mutter, dass Jenny glaubte, sie habe den Unterschlupf eines fremden Mannes aufgespürt, der seit Jahren unentdeckt in ihrem Elternhaus lebte. Und so war es denn ja auch.
Im Krankenhaus wusste Jenny, wo alles abblieb, und sie erfuhr auch, wo fast alles – auf ziemlich unmagische Weise – herkam. In Dog’s Head Harbor, wo Jenny aufgewachsen war, hatte jedes Familienmitglied sein eigenes Bad, sein eigenes Zimmer und seine eigene Tür mit seinem eigenen Spiegel an der Innenseite gehabt. Im Krankenhaus war die Privatsphäre nicht heilig, war nichts ein Geheimnis – wenn man einen Spiegel wollte, musste man eine Schwester darum bitten.
Das größte Geheimnis, das Jenny als Kind je auf eigene Faust hatte erkunden dürfen, war der Keller gewesen mit dem großen Tongefäß, das jeden Montag mit Muscheln gefüllt wurde. Jennys Mutter streute abends Maismehl über die Muscheln, und jeden Morgen wurden sie mit frischem Meerwasser gespült, das durch ein langes Rohr direkt vom Strand in den Keller lief. Gegen Ende der Woche waren die Muscheln dick und frei von Sand; sie wurden jetzt zu groß für ihre Schalen, und ihre wulstigen obszönen Mantelfortsätze ragten ins Salzwasser. Freitags half Jenny der Köchin, sie zu sortieren: Die toten zogen den Sipho nicht ein, wenn man sie berührte.
Jenny bat um ein Buch über Muscheln. Sie las alles über [16] sie: wie sie sich ernährten, wie sie sich fortpflanzten, wie sie wuchsen. Sie waren die ersten Lebewesen, die sie ganz und gar verstand – ihr Leben, ihre Sexualität, ihren Tod. Menschliche Wesen waren in Dog’s Head Harbor nicht so zugänglich. Im Krankenhaus spürte Jenny Fields, wie sie verlorene Zeit aufholte; sie fand heraus, dass Menschen nicht viel geheimnisvoller oder anziehender waren als Muscheln.
»Meine Mutter«, schrieb Garp, »war kein Mensch, der feine Unterschiede machte.«
Ein Unterschied zwischen Muscheln und Menschen, der ihr hätte auffallen müssen, war der, dass die meisten Menschen einen gewissen Sinn für Humor besaßen. Aber Jenny hatte für Humor wenig übrig. Unter den Bostoner Krankenschwestern kursierte damals ein beliebter Witz, aber Jenny fand ihn gar nicht lustig. In diesem Witz spielte ein anderes Bostoner Krankenhaus eine Rolle. Neben dem Boston Mercy Hospital, allgemein Boston Mercy genannt, in dem Jenny arbeitete, gab es noch das Massachusetts General Hospital, Mass General genannt. Und als drittes schließlich das Peter-Bent-Brigham-Krankenhaus, kurz Peter Krank genannt.
Eines Tages, so der Witz, wurde ein Bostoner Taxifahrer von einem Mann angehalten, der vom Bordstein auf ihn zugetaumelt kam und auf der Straße fast in die Knie ging. Das Gesicht des Mannes war knallrot vor Schmerzen. Entweder war er kurz vorm Ersticken, oder er hielt den Atem an, jedenfalls fiel es ihm sichtlich schwer zu sprechen. Der Fahrer öffnete die Tür und half ihm beim Einsteigen. Der Mann legte sich mit dem Gesicht nach unten und angezogenen Knien auf den Boden vor der hinteren Sitzbank.
[17] »Krankenhaus! Krankenhaus!«, presste er hervor.
»Peter Krank?«, fragte der Fahrer. Das war das nächste Krankenhaus.
»Viel schlimmer als krank«, stöhnte der Mann. »Ich glaube, Molly hat ihn abgebissen.«
Es gab nicht viele Witze, die Jenny lustig fand, und dieser gehörte gewiss nicht dazu; Peterwitze waren nichts für Jenny, die sich von dem Thema fernhielt. Sie hatte erlebt, welche Schwierigkeiten so ein Peter machen konnte; Kinder waren noch nicht das Schlimmste. Natürlich sah sie Frauen, die keine Kinder wollten und über ihre Schwangerschaft unglücklich waren. Diese Frauen sollten kein Kind bekommen müssen, fand Jenny – obwohl ihr in erster Linie die Kinder leidtaten, die unter solchen Umständen geboren wurden. Sie sah auch Frauen, die sich auf ihr Kind freuten, und wünschte sich dann selber eines. Eines Tages, dachte Jenny Fields, will ich ein Kind – nur eins. Das Problem war nur, dass sie möglichst wenig mit einem Peter zu tun haben wollte, und mit einem Mann gleich gar nichts.
Die meisten Peter-Behandlungen, die Jenny zu sehen bekam, wurden an Soldaten vorgenommen. Die Entdeckung des Penicillins sollte der US-Army erst nach 1943 zugutekommen, und viele Soldaten bekamen noch bis 1945 kein Penicillin. Im Boston Mercy wurden Peter damals, um 1942, gewöhnlich mit Sulfonamiden und Arsen behandelt. Bei Tripper gab es Sulfathiazol – mit sehr viel Wasser. Und gegen Syphilis verabreichte man in der Zeit vor dem Penicillin ein Mittel namens Neo-Salvarsan. Jenny Fields fand, dies war der Inbegriff dessen, wohin Sex führen konnte –[18] dass man dem menschlichen Körper Arsen zuführte, um ihn zu säubern.
Auch die andere, lokale Peter-Behandlung erforderte viel Flüssigkeit. Jenny assistierte oft bei dieser Desinfektionsprozedur, weil der Patient dabei viel Zuspruch brauchte; manchmal musste er sogar festgehalten werden. Es war ein sehr einfaches Verfahren, bei dem man bis zu hundert Milliliter Flüssigkeit in den Penis und durch die überraschte Harnröhre jagte, bevor alles wieder rauskam. Aber die Prozedur war für alle Beteiligten ein bisschen ungemütlich. Der Mann, der einen Apparat für diese Behandlungsmethode erfand, hieß Valentine, und sein Apparat wurde Valentine-Irrigator genannt. Noch lange nachdem Dr. Valentines Irrigator verbessert, sogar noch nachdem er durch einen anderen Spülungsapparat ersetzt worden war, bezeichneten die Schwestern im Boston Mercy die Prozedur als Valentine-Therapie – eine angemessene Strafe für jeden Liebhaber, wie Jenny Fields fand.
»Meine Mutter«, schrieb Garp, »hatte wenig Sinn für Romantik.«
Als der Soldat im Kino sich das erste Mal umsetzte – bei seinem ersten Annäherungsversuch –, dachte Jenny Fields: Für den wäre die Valentine-Therapie genau das Richtige. Aber sie hatte keinen Irrigator dabei – er war zu groß für ihre Handtasche. Außerdem wäre dafür die bereitwillige Mitwirkung des Patienten nötig gewesen. Aber sie hatte etwas anderes dabei: ein Skalpell, das sie immer mit sich herumtrug. Sie hatte es nicht aus dem OP gestohlen – es war ein weggeworfenes Skalpell mit einer tiefen Scharte an der [19] Spitze (wahrscheinlich hatte ein Arzt es auf den Boden oder in ein Waschbecken fallen lassen). Für Feinarbeit taugte es nicht mehr, aber für Feinarbeit brauchte Jenny es auch nicht.
Zuerst hatte es das Seidenfutter ihrer Handtasche aufgeschlitzt. Dann hatte sie eine Hälfte einer alten Thermometerhülle gefunden, die genau über die Klinge passte und sie wie eine Füllfederkappe umhüllte. Diese Hülle zog sie ab, als der Soldat auf den Sitz neben ihr rückte und den Arm auf die Lehne legte, die sie (absurderweise) teilen sollten. Seine lange Hand, die vom Ende der Armlehne herunterbaumelte, zuckte wie die Flanke eines Pferdes, das Fliegen wegzittert. Jenny behielt die Hand am Skalpell in ihrer Tasche; mit der anderen Hand hielt sie die Tasche auf ihrem weißen Schoß fest. Sie stellte sich vor, dass ihr Schwesternkittel wie ein heiliger Schild leuchtete und dass das Geschmeiß neben ihr aus irgendeinem perversen Grund von diesem Leuchten angelockt wurde.
»Meine Mutter«, schrieb Garp, »war ihr Leben lang auf der Hut vor Männern, die Frauen die Handtasche oder die Unschuld rauben wollten.«
Der Soldat im Kino wollte nicht an ihre Tasche. Er fasste ihr Knie an. Jenny wies ihn ziemlich unverblümt zurecht. »Nehmen Sie Ihre stinkende Hand da weg«, sagte sie. Mehrere Leute drehten sich um.
»Ach, sei doch nicht so«, raunte der Soldat, und seine Hand fuhr schnell unter ihren Schwesternkittel; er musste feststellen, dass sie die Oberschenkel zusammengepresst hatte – und dann, dass sein ganzer Arm, von der Schulter bis zum Handgelenk, plötzlich aufgeschlitzt war wie eine [20] weiche Melone. Jenny hatte sein Rangabzeichen und sein Hemd sauber durchtrennt, Haut und Muskeln fachmännisch seziert und die Ellbogengelenksknochen freigelegt. (»Wenn ich ihn hätte töten wollen«, erklärte sie später gegenüber der Polizei, »hätte ich ihm die Pulsadern aufgeschnitten. Ich bin Krankenschwester. Ich weiß, wie Leute verbluten.«)
Der Soldat schrie, sprang auf, fiel auf seinen Stuhl zurück, schlug dabei mit seinem heilen Arm nach Jennys Kopf und traf sie so heftig am Ohr, dass ihr der Schädel brummte. Sie hieb mit dem Skalpell nach ihm und entfernte ein Stück von seiner Oberlippe, ungefähr von der Form und Dicke eines Daumennagels. (»Ich wollte ihm nicht die Kehle aufschlitzen«, erklärte sie später gegenüber der Polizei. »Ich wollte ihm die Nase abschneiden, aber ich habe sie nicht erwischt.«)
Heulend kroch der Soldat zum Mittelgang, und dort auf das schützende Licht im Foyer zu. Ein anderer Kinobesucher, der ihn sah, schrie vor Schreck auf.
Jenny wischte ihr Skalpell am Sitzpolster ab, schob die Thermometerhülle über die Klinge und steckte es wieder in die Handtasche. Dann ging sie ins Foyer, wo gellende Schmerzensschreie zu hören waren, während der Geschäftsführer von der Tür aus durch den dunklen Zuschauerraum rief: »Ist vielleicht ein Arzt anwesend? Bitte, ist ein Arzt da?«
Eine Krankenschwester war da, und sie ging hinaus, um Hilfe zu leisten, so gut sie konnte. Als der Soldat sie sah, schwanden ihm die Sinne, was nicht unbedingt am Blutverlust lag. Jenny wusste, wie Gesichtswunden bluteten –[21] der Schein trog. Die tiefere Wunde an seinem Arm musste natürlich sofort versorgt werden, aber der Soldat drohte nicht zu verbluten. Niemand außer Jenny schien das zu wissen – da war so viel Blut, und so viel davon war an ihrem weißen Schwesternkittel. Im Nu war klar, dass sie es getan hatte. Die Kartenabreißer wollten nicht zulassen, dass sie den bewusstlosen Soldaten anfasste, und irgendwer nahm ihr die Handtasche ab. Die wahnsinnige Schwester! Die rasende Messerstecherin! Jenny Fields bewahrte Ruhe. Sie glaubte, sie brauchte nur abzuwarten, bis die zuständigen Leute die Lage durchschaut hatten. Aber die Polizisten waren auch nicht sehr nett zu ihr.
»Sind Sie schon lange mit diesem Burschen gegangen?«, fragte der erste auf dem Weg zum Revier.
Und ein anderer fragte sie später: »Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, dass er Sie vergewaltigen wollte? Er sagt, er wollte nur Ihre Bekanntschaft machen.«
»Das ist aber eine fiese kleine Waffe, Schätzchen«, sagte ein Dritter. »So was solltest du lieber nicht mit dir herumtragen. Damit bekommst du nur Ärger.«
Also wartete Jenny darauf, dass ihre Brüder die Sache in Ordnung brächten. Sie waren beide Juristen – in Cambridge, auf der anderen Seite des Flusses: Der eine studierte Jura, der andere lehrte Jura.
Sie reagierten nicht gerade ermutigend, als sie kamen.
»Du hast deiner Mutter das Herz gebrochen«, sagte der eine.
»Wärst du nur in Wellesley geblieben«, sagte der andere.
»Ein alleinstehendes Mädchen muss sich schützen«, sagte Jenny. »Das gehört sich so.«
[22] Aber einer ihrer Brüder fragte sie, ob sie beweisen könne, dass sie mit dem Mann nicht schon vorher etwas gehabt hatte.
»Unter uns«, flüsterte der andere, »bist du schon lange mit diesem Kerl gegangen?«
Schließlich wurde die Sache bereinigt, als die Polizei herausfand, dass der Soldat aus New York war und dort eine Frau und ein Kind hatte. Er hatte in Boston Urlaub genommen und fürchtete mehr als alles andere, dass seine Frau von der Sache Wind bekam. Alle waren sich einig, dass das wirklich schrecklich wäre – für alle Beteiligten. So wurde Jenny ohne Anklageerhebung freigelassen. Als sie sich darüber beschwerte, dass die Polizei ihr das Skalpell nicht zurückgegeben hatte, sagte einer ihrer Brüder: »Herr im Himmel, Jennifer, dann stiehlst du eben noch eins!«
»Ich habe es nicht gestohlen«, sagte Jenny.
»Du solltest dir ein paar Freunde zulegen«, riet ihr der eine Bruder.
»In Wellesley«, sagten sie immer wieder.
»Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, als ich euch gerufen habe«, sagte Jenny.
»Wozu ist eine Familie denn da?«, sagte der eine.
»Blut ist dicker als Wasser«, sagte der andere – und erbleichte, als sein Blick auf ihre blutverschmierte Uniform fiel.
»Ich bin ein anständiges Mädchen«, erklärte Jenny ihren beiden Brüdern.
»Jennifer«, sagte der ältere – das erste Vorbild in ihrem Leben, weil er so klug war und immer wusste, was richtig war. Er machte ein ernstes, fast feierliches Gesicht und [23] sagte: »Man sollte sich besser nicht mit verheirateten Männern einlassen.«
»Wir werden es Mutter nicht erzählen«, sagte der andere.
»Und Vater erst recht nicht!«, sagte der erste mit einem Zwinkern. Bei diesem unbeholfenen Versuch, menschliche Wärme zu vermitteln, verzog er das Gesicht, weshalb Jenny schon meinte, das erste Vorbild ihres Lebens habe einen nervösen Tick entwickelt.
Neben den Brüdern war ein Briefkasten mit einem Plakat von Uncle Sam. Ein winziger Soldat, ganz in Braun, kletterte von Uncle Sams großen Händen herunter. Unter dem Plakat standen die Worte: HELFT UNSEREN JUNGS! Jennys ältester Bruder sah Jenny an, die das Plakat ansah.
»Und lass dich nicht mit Soldaten ein«, fügte er hinzu, obwohl er in Kürze selbst Soldat sein würde. Einer von den Soldaten, die nicht aus dem Krieg heimkehren sollten. Er sollte seiner Mutter das Herz brechen – etwas, wozu er sich einst so verächtlich geäußert hatte.
Ihr einziger anderer Bruder sollte lange nach Kriegsende bei einem Segelunfall ums Leben kommen. Er würde etliche Seemeilen vor dem Fields’schen Anwesen in Dog’s Head Harbor ertrinken. Von seiner trauernden Ehefrau würde Jennys Mutter sagen: »Sie ist noch jung und attraktiv, und die Kinder sind nicht unausstehlich. Bis jetzt jedenfalls. Nach angemessener Zeit kann sie sich nach einem Neuen umsehen.« Die Witwe des Bruders wandte sich schließlich, fast ein Jahr nach dem nassen Tod ihres Mannes, an Jenny. Sie fragte Jenny, ob sie fände, dass nun eine »angemessene Zeit« verstrichen sei, und ob sie jetzt anfangen könne, sich »nach einem Neuen umzusehen«. Sie hatte [24] Angst, Jennys Mutter zu verletzen, und wollte wissen, ob Jenny es für richtig hielt, die Trauer abzulegen.
»Wozu trauerst du, wenn dir nicht nach Trauern ist?«, fragte Jenny sie. In ihrer Autobiographie schrieb Jenny: »Diese arme Frau musste gesagt bekommen, was sie fühlen sollte.«
»Das sei die dümmste Frau gewesen, sagte meine Mutter, der sie je begegnet sei«, schrieb Garp. »Und sie hatte das Wellesley College besucht!«
Aber als Jenny Fields ihren Brüdern vor ihrer kleinen Pension beim Boston Mercy gute Nacht sagte, war sie zu verwirrt, um wütend zu sein. Außerdem hatte sie Schmerzen – das Ohr, auf das der Soldat sie geschlagen hatte, tat ihr weh, und unter den Schulterblättern hatte sie einen Muskelkrampf, so dass sie kaum schlafen konnte. Sie musste sich irgendwas gezerrt haben, als die Kartenabreißer sie im Foyer gepackt und ihr die Arme auf den Rücken gedreht hatten. Ihr fiel ein, dass eine Wärmflasche angeblich gut gegen Muskelschmerzen war, und sie stand auf, ging zum Wandschrank und öffnete eines der Päckchen, die ihre Mutter ihr geschenkt hatte.
Es war keine Wärmflasche – das war nur die beschönigende Bezeichnung für etwas gewesen, was ihre Mutter nicht über die Lippen brachte. In dem Päckchen befand sich eine Frauendusche. Jennys Mutter wusste, wozu sie dienten, und Jenny auch. Sie hatte im Krankenhaus vielen Patientinnen geholfen, sie zu benutzen, obwohl sie dort eher nicht zur Schwangerschaftsverhütung nach dem Liebemachen benutzt wurden; sie wurden zur allgemeinen Frauenhygiene und bei Geschlechtskrankheiten benutzt. [25] Für Jenny Fields war eine Frauendusche eine freundlichere, bequemere Version des Valentine-Irrigators.
Jenny öffnete alle Päckchen von ihrer Mutter. In jedem war eine Frauendusche. »Bitte, benutze sie, Liebes!«, hatte ihre Mutter sie angefleht. Jenny wusste, dass ihre Mutter es nur gut meinte und annahm, dass Jenny ein ebenso aktives wie verantwortungsloses Sexualleben führte. Erst recht »seit Wellesley«, wie ihre Mutter es ausgedrückt hätte. Seit Wellesley, glaubte Jennys Mutter, war Jenny »außer Rand und Band« (wie sie sich ebenfalls ausgedrückt hätte).
Jenny Fields kroch wieder ins Bett und legte sich die Frauendusche, in die sie heißes Wasser gefüllt hatte, zwischen die Schulterblätter; sie hoffte, die Klemmen, die dafür sorgten, dass das Wasser nicht den Schlauch hinunterlief, seien dicht, hielt aber sicherheitshalber den Schlauch wie einen Rosenkranz aus Gummi mit der Hand umklammert und tauchte das Ende mit den winzigen Löchern in ihr leeres Wasserglas. Die ganze Nacht lag Jenny da und lauschte dem Tröpfeln der Frauendusche.
In dieser Welt mit ihrer schmutzigen Phantasie, dachte sie, ist man entweder Ehefrau oder Hure – oder auf bestem Wege, das eine oder das andere zu werden. Wenn du in keine der beiden Kategorien passt, versuchen alle, dir das Gefühl zu vermitteln, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt. Aber, dachte sie, mit mir stimmt alles.
Das war natürlich der Anfang des Buches, das Jenny Fields viele Jahre später berühmt machen sollte. Ihre Autobiographie, hieß es, überbrücke bei aller Ungeschliffenheit die übliche Kluft zwischen literarischem Anspruch und Popularität, obwohl Garp behauptete, das Werk seiner [26] Mutter habe »den gleichen literarischen Wert wie der Versandkatalog von Sears Roebuck«.
Doch was war das Ordinäre an Jenny Fields? Nicht ihre juristisch geschulten Brüder, nicht der Soldat im Kino, der ihren Schwesternkittel besudelte. Nicht die Frauenduschen ihrer Mutter, obwohl sie am Ende schuld daran waren, dass Jenny vor die Tür gesetzt wurde. Ihre Wirtin (eine mürrische Person, die aus obskuren Gründen alle Frauen in Verdacht hatte, jederzeit vor Wollust explodieren zu wollen) entdeckte in Jennys winzigem Zimmer mit Bad insgesamt neun Frauenduschen. Kontaktschuld: Für die beunruhigte Wirtin war dies ein Indiz für eine – ihre eigene Angst noch übertreffende – Angst vor Ansteckung. Oder, schlimmer noch, diese Vielzahl von Frauenduschen wies auf ein tatsächliches, erschreckendes Duschbedürfnis hin, dessen denkbare Ursachen die Wirtin bis in ihre schlimmsten Träume verfolgten.
Man mochte sich gar nicht ausmalen, was sie sich zu den zwölf Paar Schwesternschuhen dachte. Jenny fand die Angelegenheit so absurd – und hatte selbst so zwiespältige Gefühle, was die Vorsichtsmaßnahmen ihrer Eltern betraf –, dass sie kaum protestierte. Sie zog um.
Aber all das machte sie noch lange nicht ordinär. Da ihre Brüder, ihre Eltern und ihre Wirtin ihr – ohne Rücksicht auf das Beispiel, das sie gab – ein liederliches Leben unterstellten, kam Jenny zu dem Schluss, dass jegliche Unschuldsbeweise zwecklos waren und sie nur in die Defensive drängten. Sie nahm sich eine kleine Wohnung, womit sie sich prompt die nächste Ladung originalverpackter Frauenduschen seitens ihrer Mutter und einen Haufen [27] Schwesternschuhe von ihrem Vater einhandelte. Ihr fiel wie Schuppen von den Augen, dass sie dachten: Wenn sie schon eine Hure sein muss, dann wenigstens eine saubere mit anständigen Schuhen.
Nicht zuletzt der Krieg hielt Jenny von langen Grübeleien darüber ab, wie gründlich ihre Familie sie missverstand – und noch dazu von Bitterkeit und Selbstmitleid. Jenny war keine Grüblerin. Sie war eine gute Krankenschwester, und sie bekam immer mehr zu tun. Viele Schwestern meldeten sich freiwillig zum Dienst in der Army, aber Jenny hatte kein Bedürfnis, die Uniform oder den Wohnort zu wechseln; sie war eine Einzelgängerin und legte keinen Wert darauf, lauter neue Leute kennenzulernen. Im Übrigen fand sie die Rangordnung im Boston Mercy irritierend genug – in einem Feldlazarett der Army konnte das nur noch schlimmer sein.
Vor allem die Neugeborenen hätten ihr gefehlt. Deshalb blieb sie, als so viele andere gingen. Als Krankenschwester, das spürte sie, war sie am besten auf der Entbindungsstation – und plötzlich gab es so viele Babys, deren Väter weit weg, gefallen oder vermisst waren. Jenny hatte vor allem den Wunsch, diesen Müttern Mut zu machen. Im Grunde beneidete sie sie sogar. In ihren Augen war es die ideale Situation: eine Mutter, allein mit einem Neugeborenen, der dazugehörige Mann am Himmel über Frankreich abgeschossen. Eine junge Frau mit ihrem Kind, und das ganze Leben noch vor sich – nur sie beide. Ein Kind ganz ohne Verpflichtungen, dachte Jenny Fields. Fast eine jungfräuliche Geburt. Zumindest würde keine weitere Peter-Behandlung erforderlich sein.
[28] Die Frauen waren mit ihrem Los natürlich nicht immer so zufrieden, wie Jenny es an ihrer Stelle gewesen wäre. Viele von ihnen waren traurig, andere fühlten sich im Stich gelassen; einige lehnten ihre Kinder ab; andere wollten einen Ehemann und einen Vater für ihre Kinder. Aber Jenny Fields war ihre Stütze – sie plädierte für das Alleinleben, sie machte ihnen klar, was für ein Glück sie hatten.
»Glauben Sie nicht, dass Sie eine gute Frau sind?«, fragte sie sie. Die meisten fanden, dass sie es waren.
»Und haben Sie nicht ein wunderbares Baby?« Die meisten fanden ihr Baby wunderbar.
»Und der Vater? Wie war er?« Ein Faulenzer, dachten viele. Ein Schwein, ein Flegel, ein Lügner – ein abgewrackter Nichtsnutz, ein Herumtreiber! Aber er ist tot!, schluchzten einige.
»Dann sind Sie jetzt doch besser dran, oder?«, fragte Jenny.
Einige schlossen sich ihrer Ansicht an, doch Jennys Ruf im Krankenhaus litt unter dieser Kampagne. Allgemein war das Krankenhaus nicht so ermutigend gegenüber ledigen Müttern.
»Die Jungfrau Maria-Jenny«, sagten die anderen Schwestern. »Die will kein Baby auf die leichte Tour. Soll sie doch den lieben Gott bitten, dass er ihr eins schenkt.«
In ihrer Autobiographie schrieb Jenny: »Ich wollte eine Arbeit haben, und ich wollte allein leben. Das machte mich sexuell verdächtig. Außerdem wollte ich ein Kind, aber ich wollte weder meinen Körper noch mein Leben mit jemandem teilen müssen, um eines zu bekommen. Auch das machte mich sexuell verdächtig.« Genau das machte sie [29] auch ordinär. (Und daher hatte sie ihren berühmten Titel: Eine sexuell Verdächtige. Die Autobiographie der Jenny Fields.)
Jenny Fields entdeckte, dass man mehr respektiert wurde, wenn man andere Leute schockierte, als wenn man versuchte, möglichst unauffällig sein eigenes Leben zu leben. Jenny erzählte den anderen Schwestern, dass sie sich eines Tages einen Mann suchen würde, um sich von ihm schwängern zu lassen – und sonst gar nichts. Die Möglichkeit, dass der Mann es mehr als einmal versuchen musste, zog sie nicht in Betracht. Die Schwestern erzählten das natürlich brühwarm weiter. Nicht lange, und Jenny bekam gleich mehrere Anträge. Sie musste sich schnell entscheiden: entweder beschämt den Rückzug antreten, weil ihr Geheimnis jetzt keines mehr war, oder dazu stehen.
Ein junger Medizinstudent bot sich unter der Bedingung an, dass er an einem verlängerten Wochenende mindestens sechs Versuche bekäme. Jenny erklärte ihm, er habe offenbar ein schwaches Selbstvertrauen; sie wolle ein Kind, das nicht so unsicher sei.
Ein Anästhesist sagte, er würde sogar für die Ausbildung des Kindes – bis zum College-Abschluss – aufkommen. Jenny erklärte ihm, seine Augen stünden zu eng beisammen, und er habe keine ebenmäßigen Zähne; sie wolle ihrem zukünftigen Kind keine solchen Makel aufbürden.
Der Freund einer anderen Krankenschwester ließ sich etwas besonders Gemeines für sie einfallen: Er überreichte ihr in der Krankenhauskantine ein bis zum Rand mit einer weißlichen, schleimigen Flüssigkeit gefülltes Glas.
»Sperma«, sagte er und deutete mit einem Kopfnicken [30] auf das Glas. »Das ist ein Schuss – ich mache keine halben Sachen. Wenn man nur einen Versuch hat, bin ich Ihr Mann.« Jenny hielt das Zeug hoch und musterte es kühl. Gott allein wusste, was wirklich darin war. Der Freund der Kollegin sagte: »Nur damit Sie sehen, was ich Ihnen bieten kann. Samen en masse«, fügte er grinsend hinzu. Jenny kippte den Inhalt des Glases in eine Topfpflanze.
»Ich will ein Kind«, sagte sie. »Ich habe nicht die Absicht, eine Samenbank aufzumachen.«
Jenny wusste, dass sie es schwer haben würde. Sie lernte, Hänseleien zu ertragen, aber auch zu kontern.
So kamen die anderen zu dem Schluss, Jenny Fields sei unfein, sie gehe zu weit. Ein Witz war ein Witz, aber Jenny schien es ernst damit zu sein. Entweder streckte sie die Waffen aus Sturheit nicht – oder, schlimmer noch, sie meinte wirklich, was sie sagte. Ihre Kollegen im Krankenhaus schafften es weder, sie zum Lachen, noch sie ins Bett zu bringen. Oder wie Garp über das Dilemma seiner Mutter schrieb: »Ihre Kollegen stellten fest, dass sie sich ihnen überlegen fühlte. Das können Kollegen grundsätzlich nicht leiden.«
Also legten sie eine härtere Gangart gegenüber Jenny Fields ein. Es war eine Entscheidung der Belegschaft – selbstverständlich »zu ihrem eigenen Besten«. Sie beschlossen, Jenny den Neugeborenen und ihren Müttern wegzunehmen. Sie hat immer nur die Kinder im Kopf, sagten sie. Jenny Fields muss weg von der Entbindungsstation. Haltet sie von den Brutkästen fern – sie hat ein zu weiches Herz, oder eine zu weiche Birne.
Und so trennten sie Jenny Fields von den Müttern und [31] ihren Kindern. Sie ist eine sehr gute Schwester, sagten sie alle; schicken wir sie ein bisschen auf die Intensivstation. Sie hatten die Erfahrung gemacht, dass die Schwestern auf der Intensivstation des Boston Mercy schnell das Interesse an ihren eigenen Problemen verloren. Jenny wusste natürlich, warum man sie von den Neugeborenen wegschickte; sie nahm den anderen nur übel, dass sie ihr so wenig Selbstbeherrschung zutrauten. Weil sie ihren Wunsch sonderbar fanden, nahmen sie an, sie könne sich auch nicht beherrschen. Die Leute sind unlogisch, dachte Jenny. Sie wusste, dass sie noch viel Zeit hatte, um schwanger zu werden. Sie hatte es nicht eilig. Es war einfach Teil eines langfristigen Plans.
Inzwischen war Krieg. Auf der Intensivstation bekam sie davon etwas mehr zu sehen. Die Lazarette schickten ihnen ihre Härtefälle, und das waren immer die hoffnungslosen Fälle. Es gab die üblichen älteren Patienten, die an den üblichen Schläuchen hingen; es gab die üblichen Arbeitsunfälle und Autounfälle und die schrecklichen Unfälle von Kindern. Aber hauptsächlich waren Soldaten auf der Station. Was ihnen widerfuhr, war kein Unfall.
Jenny unterteilte die Nichtunfälle, die den Soldaten widerfuhren, auf ihre eigene Weise und erfand ihre eigenen Kategorien für sie.
1. Männer mit Verbrennungen; die meisten hatten sich die Verbrennungen an Bord eines Schiffes zugezogen (die kompliziertesten Fälle kamen vom Chelsea Naval Hospital), manche aber auch in Flugzeugen oder am Boden. Jenny nannte sie »die Äußerlichen«.
2. Männer mit Schusswunden oder Verletzungen an [32] gefährlichen Stellen; sie hatten innere Schwierigkeiten, und Jenny nannte sie »die lebenswichtigen Organe«.
3. Männer, deren Verletzungen Jenny beinahe mystisch vorkamen; es waren Männer, die nicht mehr »da« waren, deren Köpfe oder Wirbelsäulen irgendwie in Mitleidenschaft gezogen waren. Manchmal waren sie gelähmt, manchmal dämmerten sie einfach dahin. Jenny nannte sie »die Abwesenden«. Manchmal hatte einer der Abwesenden auch äußerliche Verletzungen oder Schäden an lebenswichtigen Organen; das ganze Krankenhaus hatte einen Namen für sie:
4. Sie waren »die Halbtoten«.
»Mein Vater«, schrieb Garp, »war ein ›Halbtoter‹. Das muss ihn für meine Mutter sehr attraktiv gemacht haben. Ohne Haken und Ösen.«
Garps Vater hatte als Kugelturmschütze am Himmel über Frankreich einen dieser Unfälle gehabt, die keine waren.
»Der Kugelturmschütze«, schrieb Garp, »war das Mitglied der Bomberbesatzung, das dem vom Boden kommenden Flugabwehrfeuer am meisten ausgesetzt war. Dieses Feuer hieß Flak; Flakgeschosse sahen für den Kugelturmschützen oft wie hochgeschleuderte Tintentropfen aus, die sich am Himmel ausbreiteten, als wäre der Himmel ein Blatt Löschpapier. Der kleine Mann (denn wenn er klein war, passte er besser in den unteren Geschützturm hinein) kauerte mit seinen Maschinengewehren in seinem beengten Nest – einem Kokon, in dem er einem in Plexiglas gegossenen Insekt glich. Der Geschützturm war eine Metallkugel [33] mit einem gläsernen Bullauge; er saß wie ein aufgeblähter Nabel am Rumpf einer B-17, wie eine Zitze am Bauch des Bombers. In dieser winzigen Kuppel waren zwei Maschinengewehre und jener kleine, schmale Mann, der auf Jagdflugzeuge, die seinen Bomber angriffen, zielen sollte. Wenn sich der Geschützturm bewegte, drehte sich der Turmschütze mit. In dem Turm befanden sich Holzgriffe mit Knöpfen daran, um mit den Maschinengewehren zu feuern. Wenn er die Abzugshebel umklammert hielt, sah der Kugelturmschütze wie ein gefährlicher Fötus aus, der in der widersinnig exponierten Fruchtblase des Bombers hing und seine Mutter schützte. Mit den Griffen konnte man auch den Geschützturm steuern, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, damit der Turmschütze nicht die Propeller vorne abschoss. »Da der Himmel unter ihm war, muss sich der Turmschütze besonders ausgesetzt vorgekommen sein, wie ein Appendix. Bei der Landung wurde der Geschützturm eingefahren – normalerweise. Ein nicht eingefahrener Geschützturm schlug unweigerlich Funken auf der alten Piste – wie ein herunterhängendes Auspuffrohr eines Autos auf der Straße.«
Technical Sergeant Garp, der »halbtote« Schütze, dessen Vertrautheit mit dem gewaltsamen Tod jeder Beschreibung spottet, diente bei der Achten Luftflotte – der Luftflotte, die von England aus den Kontinent bombardierte. Sergeant Garp hatte bereits Erfahrung als Bugschütze in der B-17C und als Rumpfschütze im mittleren Teil der B-17E, bevor sie ihn zum Kugelturmschützen machten.
Garp mochte die Bordgeschütze im mittleren Teil der B-17E nicht. Dort mussten sich zwei Seitenschützen in den [34] Rumpf des Bombers zwängen: Ihre Fenster lagen einander gegenüber, und Garp bekam jedes Mal mit dem Ellbogen einen Schlag ans Ohr, wenn sein Kamerad sein MG in dem Augenblick schwenkte, in dem Garp sich mit seinem bewegte. Aus genau diesem Grund waren in späteren Modellen die Fenster der Rumpfschützen versetzt angeordnet. Doch diese Neuerung kam für Sergeant Garp zu spät.
Sein erster Feindflug war ein Tageseinsatz auf einer B-17Es gegen Rouen am 17. August 1942, bei dem es keine Verluste gab. Technical Sergeant Garp bekam von seinem Kameraden einen Schlag ans linke und zwei ans rechte Ohr. Das Problem war auch, dass der andere Schütze so viel größer war als Garp; die Ellbogen des Mannes waren auf gleicher Höhe wie Garps Ohren.
An jenem ersten Tag über Rouen saß im unteren Geschützturm ein Mann namens Fowler, der sogar noch kleiner war als Garp. Fowler war vor dem Krieg Jockey gewesen. Er war ein besserer Schütze als Garp, aber der Geschützturm war Garps größter Wunsch. Garp war Waise, muss aber gern allein gewesen sein, und er wollte sich der Nähe und den Ellbogenstößen des anderen Schützen im Rumpf irgendwie entziehen. Wie viele Bordschützen träumte natürlich auch Garp davon, nach seinem fünfzigsten oder fünfundfünfzigsten Einsatz zur Zweiten Luftflotte – dem Bomber-Ausbildungskommando – versetzt zu werden, wo er sich als Bordschützenausbilder zur Ruhe setzen konnte. Aber bis Fowler ums Leben kam, beneidete Garp ihn um seinen abgeschiedenen Posten, um seine Jockey-Einsamkeit.
»Ein mieses Loch, wenn du viel furzt«, behauptete [35] Fowler, ein Zyniker, der einen trockenen irritierenden Husten und einen üblen Ruf bei den Krankenschwestern des Feldlazaretts hatte.
Fowler kam bei einer Bruchlandung auf einer ungepflasterten Straße ums Leben. Ein Schlagloch hatte die Fahrgestellstreben abgerissen, das ganze Fahrgestell brach zusammen, und der Bomber machte eine harte Bauchlandung, die den Geschützturm mit der Wucht eines auf eine Weintraube fallenden Baumes zerquetschte. Fowler, der immer gesagt hatte, er habe mehr Vertrauen zu Maschinen als zu Pferden oder Menschen, hockte in dem nicht eingefahrenen Geschützturm, als das Flugzeug darauf landete. Die Rumpfschützen, darunter Sergeant Garp, sahen seine Überreste unter dem Bauch des Bombers hervorspritzen. Der Staffeladjutant, der am Boden dem Geschehen der Nächste war, übergab sich in seinem Jeep. Der Staffelkommandeur brauchte nicht erst die offizielle Bestätigung von Fowlers Tod abzuwarten, um ihn durch den zweitkleinsten Bordschützen der Staffel zu ersetzen. Der winzige Technical Sergeant Garp hatte schon immer Kugelturmschütze werden wollen. Im September 1942 war es so weit.
»Meine Mutter war auf Details versessen«, schrieb Garp. Wenn ein Verwundeter eingeliefert wurde, war Jenny Fields die Erste, die den Arzt fragte, wie es passiert sei. Und Jenny ordnete sie stillschweigend ein: die Äußerlichen, die lebenswichtigen Organe, die Abwesenden und die Halbtoten. Und sie dachte sich kleine Eselsbrücken für die Namen der Männer und ihre jeweiligen Missgeschicke aus. So zum Beispiel: Schütze Rochen brach sich die Knochen, [36] Sergeant Potter landete auf Schotter, Corporal Soden verlor seine Hoden, Captain Stout verbrannte die Haut, Major Longfellow hat ein kurzes Gedächtnis.
Sergeant Garp jedoch war ein Rätsel. Bei seinem fünfunddreißigsten Flug über Frankreich hörte der kleine Turmschütze plötzlich auf zu schießen. Dem Piloten fiel auf, dass der Geschützturm nicht mehr feuerte, und er dachte, Garp habe einen Treffer abbekommen. Davon hatte der Pilot am Rumpf seines Flugzeugs allerdings nichts gemerkt. Er hoffte, Garp habe es auch nicht sehr gemerkt. Nach der Landung verfrachtete der Pilot Garp schnell in den Motorrad-Beiwagen eines Feldarztes – die Krankenwagen waren alle im Einsatz. Sobald er in dem Beiwagen saß, begann der winzige Sergeant, an sich herumzuspielen. Der Pilot klappte den Wetterschutz aus Segeltuch über den Beiwagen. Die Haube hatte ein Seitenfenster, durch das der Arzt, der Pilot und die umstehenden Männer Garp beobachten konnten. Dafür, dass er so klein war, schien er eine außerordentlich große Erektion zu haben, aber er hantierte kaum geschickter daran herum als ein kleiner Junge – nicht halb so geschickt wie ein Affe im Zoo. Doch wie ein Affe schaute Garp aus seinem Käfig und starrte ohne Scham in die Gesichter der Umstehenden.
»Garp?«, sagte der Pilot. Garps Stirn war mit mehr oder weniger getrocknetem Blut gesprenkelt, aber seine Fliegermütze klebte oben an seinem Schädel und tropfte; sonst schien er nicht verletzt zu sein. »Garp!«, schrie der Pilot ihn an. An der Stelle, wo in der Metallkugel die Maschinengewehre gewesen waren, klaffte ein Riss. Augenscheinlich hatte eine Flakgranate die Läufe der Maschinengewehre [37] getroffen und dabei den Turm aufgerissen und sogar die Griffe mit den Knöpfen gelöst, obwohl Garps Händen nichts fehlte – außer etwas Geschick beim Masturbieren.
»Garp!«, rief der Pilot.
»Garp?«, sagte Garp. Er äffte den Piloten nach wie ein gelehriger Papagei oder eine Krähe. »Garp«, sagte Garp, als hätte er das Wort gerade neu gelernt. Der Pilot nickte Garp zu, als wollte er ihn ermuntern, sich seinen Namen zu merken. Garp lächelte. »Garp«, sagte er. Offenbar dachte er, dass man sich so begrüßte. Nicht guten Tag, guten Tag – sondern Garp, Garp!
»Du liebe Güte, Garp«, sagte der Pilot. Im Bullauge des Geschützturms waren ein paar Löcher und Risse zu sehen gewesen. Der Arzt öffnete jetzt den Reißverschluss am Seitenfenster der Beiwagenhaube und sah Garp in die Augen. Irgendetwas stimmte nicht mit Garps Augen: Sie verdrehten sich unabhängig voneinander. Wahrscheinlich, dachte der Arzt, fuhr für Garp die Welt Karussell – falls Garp überhaupt noch etwas sehen konnte. Zu diesem Zeitpunkt konnten der Pilot und der Arzt noch nicht wissen, dass bei der Explosion der Granate ein paar scharfe Splitter den Nervus oculomotorius in Garps Gehirn – und nicht nur diesen Teil seines Gehirns – beschädigt hatten. Der Oculomotorius besteht hauptsächlich aus motorischen Fasern, die die Muskulatur des Augapfels mit Nervenreizen versorgen. Davon abgesehen hatte Garps Gehirn einige Schnitte und Stiche abbekommen, die stark an eine – wenn auch ziemlich verpfuschte – präfrontale Lobotomie erinnerten.
Weil sich der Arzt große Sorgen machte, wie pfuscherhaft die Lobotomie an Sergeant Garp ausgefallen war, [38] beschloss er, die blutgetränkte Fliegermütze nicht abzunehmen, die an Garp klebte und ihm in die Stirn hing, wo sie auf einer dicken, glänzenden Beule auflag, die sich jetzt dort bildete. Alle hielten Ausschau nach dem Fahrer des Arztes, aber der Fahrer war weg, er übergab sich irgendwo, und der Arzt sagte sich, dass er jemanden finden musste, der sich zu Garp in den Beiwagen setzte, während er selbst das Motorrad steuerte.
»Garp?«, sagte Garp zu dem Arzt, um sein neues Wort auszuprobieren.
»Garp«, bestätigte der Arzt. Garp schien erfreut. Mit beiden kleinen Händen an seinem eindrucksvoll erigierten Penis hatte das Masturbieren schließlich Erfolg.
»Garp!«, entfuhr es ihm. In seiner Stimme schwangen Freude, aber auch Überraschung mit. Er verdrehte die Augen zu seinem Publikum und flehte die Welt an, vor ihm zu erscheinen und stillzustehen. Er wusste nicht recht, was er gemacht hatte. »Garp?«, fragte er voller Zweifel.
Der Pilot tätschelte seinen Arm und nickte den anderen Männern von der Flug- und Bodencrew zu, als wollte er sagen: Kommt, Leute, wir helfen dem Sergeant ein bisschen. Er soll sich wie zu Hause fühlen. Und in ehrfürchtigem Respekt vor Garps Ejakulation sagten die Männer alle »Garp! Garp! Garp!« zu ihm – ein beruhigender Robbenchor, bemüht, Garp zu besänftigen.
Garp nickte glücklich, aber der Arzt fasste ihn am Arm und flüsterte ihm besorgt zu: »Nein! Nicht den Kopf bewegen, okay, Garp? Bewegen Sie bitte nicht den Kopf!« Garps Augen wanderten an dem Piloten und dem Arzt vorbei, die darauf warteten, dass sie wieder zu ihnen [39] zurückkamen. »Tun Sie gar nichts, Garp«, flüsterte der Pilot. »Einfach nur stillsitzen, okay?«
Garps Gesicht strahlte reinen Frieden aus. Mit seinen beiden Händen, die seinen erschlaffenden Penis hielten, wirkte der kleine Sergeant, als hätte er genau das getan, was die Situation erforderte.
In England konnte man nichts für Sergeant Garp tun. So hatte er das Glück, dass er lange vor Kriegsende nach Boston heimtransportiert wurde. Im Grunde hatte er das irgendeinem Senator zu verdanken. In einem Leitartikel einer Bostoner Zeitung hatte es geheißen, die US-Navy bringe nur solche Verwundeten in die Heimat zurück, die aus wohlhabenden und angesehenen amerikanischen Familien stammten. Um dieses gemeine Gerücht zu zerstreuen, behauptete ein Senator, dass, sofern Schwerverwundete überhaupt das Glück hätten, nach Amerika zurückzukommen, »darunter sogar eine Waise sein könne – genau wie jeder andere«. Dann gab es einige Aufregung – es galt, eine verwundete Waise aufzutreiben, um die Worte des Senators in die Tat umzusetzen. Aber schließlich fand man den idealen Mann.
Technical Sergeant Garp war nicht nur Vollwaise – er war auch schwachsinnig, und sein Vokabular bestand aus einem einzigen Wort, so dass er sich nicht gegenüber der Presse äußern konnte. Und auf allen Fotos lächelte der Turmschütze Garp.
Als der sabbernde Sergeant ins Boston Mercy eingeliefert wurde, hatte Jenny Fields Mühe, ihn einzuordnen. Er war eindeutig ein »Abwesender«, fügsamer als ein Kind, aber sie wusste nicht genau, was ihm sonst noch alles fehlte.
[40] »Hallo. Wie geht es Ihnen?«, fragte sie ihn, als man ihn – er grinste – auf die Station schob.
»Garp!«, entfuhr es ihm. Der Oculomotorius war teilweise wiederhergestellt, und seine Augen hüpften jetzt eher, als dass sie sich verdrehten, aber seine Hände steckten in Gazefäustlingen – Garp hatte mit dem Feuer gespielt, das in der Krankenstation des Truppentransportschiffs ausgebrochen war. Er hatte die Flammen gesehen und die Hände nach ihnen ausgestreckt und einige Flammen zu seinem Gesicht hochgewedelt. Dabei hatte er sich die Augenbrauen versengt. Auf Jenny wirkte er wie eine rasierte Eule.
Mit den Verbrennungen war Garp gleichzeitig ein »Äußerlicher« und ein »Abwesender«. Außerdem konnte er, da seine Hände dick verbunden waren, nicht mehr masturbieren, was er, wie aus seinem Krankenblatt hervorging, häufig und mit Erfolg – und ohne jede Befangenheit – getan hatte. Diejenigen, die ihn seit seinem Unfall bei dem Schiffsbrand genauer beobachtet hatten, fürchteten, der kindliche Bordschütze werde in Depressionen versinken – weil ihm sein einziges Erwachsenenvergnügen genommen war, wenigstens, bis seine Hände verheilten.
Es war natürlich möglich, dass Garp auch Schäden an »lebenswichtigen Organen« davongetragen hatte. Viele Splitter waren in seinen Kopf eingedrungen; etliche steckten an zu heiklen Stellen, als dass man sie hätte entfernen können. Womöglich war nicht nur sein Gehirn durch die rabiate Lobotomie beschädigt; womöglich schritt die Zerstörung in seinem Inneren fort.
»Unser allgemeiner Verfall«, schrieb Garp, »ist auch [41] ohne Flakeinwirkung auf unseren Organismus schon kompliziert genug.«
Vor Sergeant Garp hatte es schon einmal einen Patienten mit ähnlich vielen Splittern im Schädel gegeben. Monatelang war es ihm gutgegangen – nur dass er Selbstgespräche führte und gelegentlich ins Bett pinkelte. Dann fielen ihm plötzlich die Haare aus, und er brachte seine Sätze nicht mehr zu Ende. Kurz vor seinem Tod waren ihm weibliche Brüste gewachsen.
Die Schatten und die weißen Nadeln auf den Röntgenbildern und alle anderen Anzeichen sprachen dafür, dass der Turmschütze Garp wahrscheinlich ein »Halbtoter« war. Aber in Jenny Fields’ Augen sah er sehr nett aus. Der ehemalige Kugelturmschütze, ein kleiner, properer Mann, war so unschuldig und geradeheraus in seinen Bedürfnissen wie ein Zweijähriger. Er rief »Garp!«, wenn er Hunger hatte, und »Garp!«, wenn er sich freute; er fragte »Garp?«, wenn ihn etwas verwirrte oder wenn er sich an Fremde wandte, und er sagte »Garp« ohne Fragezeichen, wenn er einen wiedererkannte. Meistens machte er, was man ihm sagte, aber es war kein Verlass auf ihn; er vergaß leicht, konnte manchmal so folgsam sein wie ein Sechsjähriger und war ein andermal so unbekümmert neugierig, als wäre er erst anderthalb.
Die Depressionen, die in seinen Begleitpapieren genau dokumentiert waren, schienen zeitlich mit seinen Erektionen zusammenzufallen. In diesen Augenblicken klemmte er seinen armen erwachsenen Peter zwischen seine gazigen, in Fäustlinge gehüllten Hände und weinte. Er weinte, weil die Gaze sich nicht so gut anfühlte wie die kurze [42] Erinnerung an seine Hände und weil ihm die Hände weh taten, wenn er etwas berührte. In solchen Augenblicken setzte sich Jenny Fields zu ihm. Sie massierte ihm den Rücken zwischen den Schulterblättern, bis er den Kopf wie eine Katze in den Nacken legte, und redete unablässig mit einer freundlichen Stimme voll lebhafter Modulationen auf ihn ein. Die meisten Schwestern leierten ihren Patienten etwas vor – mit einer gleichmäßigen, monotonen Stimme, die einschläfernd wirken sollte. Aber Jenny wusste, dass Garp etwas anderes brauchte als Schlaf. Sie wusste, dass er noch ein Baby war und sich langweilte – er brauchte ein bisschen Ablenkung. Also lenkte Jenny ihn ab. Sie stellte ihm das Radio an, aber manche Sendungen regten Garp auf – niemand wusste, warum. Andere lösten bei ihm gewaltige Erektionen aus, die wiederum zu Depressionen führten, und so fort. Eine Sendung, nur eine einzige, schenkte Garp einen feuchten Traum, der ihn so überraschte und erfreute, dass er immer darauf brannte, das Radio zu sehen. Aber Jenny konnte die Sendung nicht wiederfinden, die Sache ließ sich nicht wiederholen. Sie wusste, wenn sie den armen Garp an die Traumsendung anschließen könnte, würden ihre Arbeitstage und sein Leben sehr viel glücklicher verlaufen. Aber so einfach war das nicht.
Sie gab ihre Bemühungen auf, ihm ein neues Wort beizubringen. Wenn sie ihn fütterte und sah, dass ihm das Essen schmeckte, sagte sie: »Gut! Das ist gut!«
»Garp!«, stimmte er ihr zu.
Und wenn er Essen auf seinen Latz spuckte und das Gesicht verzog, sagte sie: »Schlecht! Das Zeug schmeckt schlecht, nicht wahr?«
[43] »Garp!«, würgte er.
Das erste Anzeichen, dass es mit ihm bergab ging, sah Jenny darin, dass er das G zu verlieren schien. Eines Morgens begrüßte er sie mit einem »Arp«.
»Garp«, sagte sie nachdrücklich zu ihm. »G-arp.«
»Arp«, sagte er. Da wusste sie, dass sie ihn verlor.
Täglich schien er jünger zu werden. Im Schlaf knetete er mit seinen zappelnden Fäusten die Luft, seine Lippen spitzten sich, seine Wangen machten saugende Bewegungen, und seine Augenlider zitterten. Jenny hatte viel Zeit mit Neugeborenen verbracht – sie wusste, dass der Turmschütze in seinen Träumen an der Mutterbrust lag. Eine Zeitlang erwog sie, einen Schnuller in der Entbindungsstation zu stehlen. Aber von der Station hielt sie sich mittlerweile fern; die Witze irritierten sie (»Da kommt Jungfrau Maria-Jenny und klaut einen Gumminippel für ihr Kind. Wer ist denn der glückliche Vater, Jenny?«). Sie sah zu, wie Sergeant Garp im Schlaf nuckelte, und versuchte, sich vorzustellen, dass seine letzte Regression friedlich verlaufen würde, dass er in sein Embryonalstadium zurückkehren und nicht mehr mit der Lunge atmen würde; dass seine Persönlichkeit sich selig spalten und dass die eine Hälfte dann von einem Ei und die andere von Sperma träumen würde. Schließlich würde er einfach nicht mehr sein.
Fast so war es dann auch. Garps Stillphase war schließlich so ausgeprägt, dass er wie ein Säugling alle vier Stunden aufwachte; er schrie sogar wie ein Baby mit hochrotem Gesicht, vergoss in einem Moment Tränen und ließ sich im nächsten wieder beruhigen – vom Radio, von Jennys Stimme. Einmal, als sie ihm den Rücken massierte, machte [44] er ein Bäuerchen. Jenny brach in Tränen aus. Sie saß an seinem Bett und wünschte ihm eine schnelle, schmerzlose Reise zurück in den Mutterschoß und weiter.
Wenn seine Hände doch nur heilen würden, dachte sie, dann könnte er wenigstens am Daumen lutschen. Wenn er aus seinen Saugträumen erwachte und hungrig war oder sich einbildete, hungrig zu sein, hielt Jenny ihm einen Finger an den Mund und ließ seine Lippen daran nuckeln. Obwohl er richtige ausgewachsene Zähne hatte, war er im Geist zahnlos, und nie biss er sie. Diese Beobachtung bewog Jenny eines Nachts, ihm die Brust zu geben. Er saugte unermüdlich, und es schien ihn nicht zu stören, dass dort nichts zu holen war. Jenny dachte, dass sie, wenn er weiterhin ihre Brust nahm, Milch haben würde; sie spürte ein starkes Ziehen in ihrem Schoß, das nicht nur mütterlich, sondern auch sexuell war. Ihre Gefühle waren so intensiv – sie glaubte eine Zeitlang, sie könne vielleicht ein Kind empfangen, indem sie den Baby-Turmschützen einfach nur stillte.
Fast so war es dann auch. Aber Bordschütze Garp war nicht ganz Baby. Eines Nachts, während er an ihrer Brust lag, bemerkte Jenny, dass er eine Erektion hatte – eine Erektion, dass sich die Decke hob; mit seinen unbeholfenen verbundenen Händen erregte er sich und wimmerte vor Enttäuschung, während er hungrig wie ein Wolf an ihrer Brust sog. Und so half sie ihm eines Nachts; mit ihrer kühlen, gepuderten Hand fasste sie ihn an. Er hörte auf, an ihrer Brust zu saugen, und rieb einfach nur den Mund an ihr.
»Ar«, stöhnte er. Er hatte das P verloren.
Einst ein Garp, dann ein Arp, jetzt nur noch ein Ar; sie [45] wusste, dass er starb. Er hatte nur noch einen Vokal und einen Konsonanten übrig.
Als er kam, fühlte sie seinen Erguss nass und heiß in ihrer Hand. Unter der Decke roch es wie in einem Treibhaus im Sommer, absurd fruchtbar – unkontrolliertes Wachstum. Als könnte man dort alles einpflanzen, und es würde gedeihen. Bei Garps Sperma musste Jenny Fields denken: Wenn man ein wenig davon in einem Treibhaus verspritzte, würden Kinder aus der Erde sprießen.
Jenny ließ sich die Sache vierundzwanzig Stunden durch den Kopf gehen.
»Garp?«, flüsterte Jenny.
Sie knöpfte das Oberteil ihres Schwesternkittels auf und holte ihre Brüste heraus, die sie immer zu groß gefunden hatte. »Garp?«, flüsterte sie ihm ins Ohr. Seine Augenlider flatterten, seine Lippen kamen näher. Um sie herum hing ein weißes Laken, ein Vorhang an Schienen, der sie von der übrigen Station trennte. Links von Garp lag ein »Äußerlicher« – Opfer eines Flammenwerfers, glitschig vor Salbe, in Mull gehüllt. Er hatte keine Augenlider mehr, so dass er immer alles zu beobachten schien, war aber blind. Jenny zog die klobigen Schwesternschuhe aus, löste die weißen Strümpfe, schlüpfte aus dem Kittel. Sie legte einen Finger an Garps Lippen.
Auf der anderen Seite von Garps weißverhängtem Bett lag ein »lebenswichtiges Organ«, das sich zum »Abwesenden« entwickelte. Der Mann hatte einen Großteil seines Dickdarms und sein Rektum eingebüßt; jetzt machte ihm die eine Niere zu schaffen, und seine Leber trieb ihn zum [46] Wahnsinn. Er hatte schreckliche Alpträume, in denen er zwanghaft versuchte, zu urinieren und seinen Darm zu entleeren, obwohl das für ihn der Geschichte angehörte: In Wirklichkeit merkte er gar nicht mehr, wenn er etwas davon machte, denn er machte es durch Schläuche in Gummibeutel. Er stöhnte oft, und anders als Garp mit vollständigen Worten.
»Scheiße«, stöhnte er.
»Garp?«, flüsterte Jenny. Sie schlüpfte aus ihrem Slip, nahm ihren Büstenhalter ab und schlug die Decke zurück.
»Jesus«, hauchte der »Äußerliche«; seine Lippen waren mit Brandblasen bedeckt.
»Gottverdammte Scheiße!«, brüllte das »lebenswichtige Organ«.
»Garp«, sagte Jenny Fields. Sie nahm seinen erigierten Penis und hockte sich rittlings auf ihn.
»Aaa«, machte Garp. Auch das R war weg. Er war auf einen einzigen Vokal angewiesen, um seine Freude oder Trauer auszudrücken. »Aaa«, machte er, als Jenny ihn in sich einführte und sich mit ihrem ganzen Gewicht auf ihn setzte.
»Garp?«, fragte sie. »Okay, Garp? Ist es gut, Garp?«
»Gut«, stimmte er klar und deutlich zu. Aber es war nur ein Wort aus seinem zerstörten Gedächtnis, das einen Moment lang freigelegt wurde, als er in ihr kam. Es war das erste und letzte richtige Wort, dass Jenny Fields ihn sprechen hörte: gut. Als er erschlaffte und sein Lebenssaft aus ihr heraussickerte, war er wieder auf Aaas reduziert, er schloss die Augen und schlief ein. Als Jenny ihm die Brust geben wollte, hatte er keinen Hunger.
[47] »Gott!«, rief der »Äußerliche«, wobei er sehr vorsichtig mit den Ts umging; auch seine Zunge hatte Brandwunden.
»Pisse!«, zischte das »lebenswichtige Organ«.
Jenny Fields wusch Garp und sich mit warmem Wasser aus einer weißen Emailleschüssel und Seife. Die Frauendusche würde sie selbstverständlich nicht benutzen, und sie zweifelte nicht daran, dass der Zauber gewirkt hatte. Sie fühlte sich empfänglicher als frisch gepflügter Boden – die genährte Erde –, und sie hatte gespürt, wie Garp sich in ihr so reichlich ergoss wie ein Wasserschlauch im Sommer (als könnte er einen Rasen sprengen).
Sie machte es kein zweites Mal mit ihm. Dafür gab es keinen Grund. Es machte ihr keinen Spaß. Von Zeit zu Zeit half sie ihm mit der Hand, und wenn er danach schrie, gab sie ihm die Brust. Aber nach ein paar Wochen hatte er keine Erektionen mehr. Als sie ihm die Verbände von den Händen abnahmen, stellten sie fest, dass selbst der Heilungsprozess rückwärts zu laufen schien; sie wickelten sie wieder ein. Er verlor jedes Interesse an ihrer Brust. Seine Träume kamen Jenny vor wie Träume, die ein Fisch haben mochte. Er war wieder im Mutterleib, Jenny wusste es; er nahm wieder eine embryonale Haltung ein – rollte sich in der Mitte des Bettes zusammen. Er gab keinen Laut mehr von sich. Eines Morgens beobachtete Jenny, wie er mit seinen kleinen kraftlosen Füßen strampelte; sie bildete sich ein, in sich ein Treten zu spüren. In Wirklichkeit war es noch zu früh dafür, sicher, aber sie wusste, dass es angefangen hatte.
Bald hörte Garp auch auf zu strampeln. Er kam immer noch zu seinem Sauerstoff, indem er Luft in die Lunge einatmete, aber Jenny wusste, dass dies nur ein Beweis für [48] die menschliche Anpassungsfähigkeit war. Er wollte nicht mehr essen; man musste ihn intravenös ernähren – so hing er wieder an einer Nabelschnur. Jenny sah seiner letzten Phase mit einiger Sorge entgegen. Würde es am Ende einen Kampf geben, ähnlich dem verzweifelten Kampf des Samens? Würde das Sperma sich ablösen und das nackte Ei sehnsüchtig auf den Tod warten? Wie würde sich die Seele bei der Rückreise des kleinen Garp am Ende aufspalten? Aber die Phase ging vorbei, ohne dass Jenny sie überhaupt bemerkte. Eines Tages, als sie freihatte, starb Technical Sergeant Garp.
»Wann sonst hätte er sterben können?«, schrieb Garp. »Er konnte sich nur davonstehlen, während meine Mutter dienstfrei hatte.«
»Natürlich fühlte ich etwas, als er starb«, schrieb Jenny Fields in ihrer berühmten Autobiographie. »Aber das Beste von ihm war in mir. Es war für uns beide das Beste, die einzige Möglichkeit, wie er weiterleben konnte, die einzige Art, wie ich ein Kind bekommen wollte. Dass der Rest der Welt das für einen unmoralischen Akt hält, beweist mir nur, dass der Rest der Welt die Rechte des Einzelnen nicht respektiert.«
Es war 1943. Als Jennys Schwangerschaft unübersehbar war, verlor sie ihre Stellung. Genau damit hatten ihre Eltern und Brüder natürlich gerechnet; sie waren nicht überrascht. Jenny hatte schon lange alle Versuche aufgegeben, sie von ihrer Reinheit zu überzeugen. Wie ein zufriedener Geist bewegte sie sich durch die geräumigen Flure ihres Elternhauses in Dog’s Head Harbor. Ihre Gelassenheit irritierte ihre Familie, und man ließ sie in Ruhe. Insgeheim war Jenny [49] ganz glücklich, doch bei all den vielen Gedanken, die sie sich über das Kind, das sie erwartete, gemacht haben muss, verwundert es, dass sie nie über einen Namen nachdachte.
Denn als Jenny Fields schließlich einen acht Pfund schweren Jungen zur Welt brachte, hatte sie keinen Namen parat. Jennys Mutter fragte sie, wie sie ihn nennen wolle. Aber Jenny hatte gerade erst entbunden und ein Beruhigungsmittel bekommen; sie war nicht sehr gesprächsbereit.
»Garp«, sagte sie.
Ihr Vater, der Schuhkönig, dachte, sie hätte gerülpst, aber ihre Mutter flüsterte ihm zu: »Er heißt Garp.«
»Garp?«, sagte er. Sie wussten, dass sie so vielleicht herausfinden konnten, wer der Vater des Kindes war. Jenny hatte natürlich kein Sterbenswörtchen gesagt.
»Krieg raus, ob das der Vorname oder der Nachname von dem Mistkerl ist«, flüsterte Jennys Vater Jennys Mutter zu.
Jenny war sehr schläfrig. »Garp«, sagte sie. »Einfach Garp. Das ist alles.«
»Ich glaube, es ist ein Nachname«, erklärte Jennys Mutter Jennys Vater.
»Und der Vorname?«, fragte Jennys Vater verärgert.
»Den habe ich nie erfahren«, murmelte Jenny. Das stimmte; sie kannte ihn nicht.
»Sie hat seinen Vornamen nie erfahren!«, brüllte ihr Vater.
»Bitte, Liebes«, sagte ihre Mutter. »Er muss doch einen Vornamen haben.«
»Technical Sergeant Garp«, sagte Jenny Fields.
»Ein gottverdammter Soldat, ich hab’s ja gewusst!«, sagte ihr Vater.
[50] »Technical Sergeant?«, fragte Jennys Mutter sie.
»T.S.«, sagte Jenny Fields. »T.S. Garp. So soll mein Kind heißen.« Sie schlief ein.
Ihr Vater tobte vor Wut. »T.S. Garp!«, brüllte er. »Was soll das für ein Name sein?«
»Sein ganz persönlicher Name«, erklärte Jenny ihm später. »Es ist sein eigener gottverdammter und ganz persönlicher Name.«
»Es hat viel Spaß gemacht, mit einem solchen Namen zur Schule zu gehen«, schrieb Garp. »Die Lehrer fragten immerzu, wofür die Initialen standen. Anfangs sagte ich, es seien nur Initialen, aber sie glaubten mir nie. Also musste ich sagen: ›Fragen Sie meine Mom. Sie sagt es Ihnen.‹ Und das taten sie. Und die gute alte Jenny sagte ihnen gründlich die Meinung.«
So wurde der Welt T.S. Garp beschert: geboren von einer guten Krankenschwester mit starkem Willen und mit dem Samen eines Kugelturmschützen – seinem letzten Schuss.
[51] 2
Blut und Blau
T.S. Garp hatte immer das Gefühl, er werde früh sterben. »Ich glaube«, schrieb Garp, »ich habe wie mein Vater einen Hang zur Kürze. Ich bin ein Ein-Schuss-Mann.«
Garp entging mit knapper Not dem Schicksal, auf dem Gelände einer reinen Mädchenschule aufzuwachsen – seiner Mutter war dort die Stelle der Schulschwester angeboten worden. Aber Jenny Fields sah die möglichen Probleme, die damit verbunden gewesen wären: ihr kleiner Garp von Frauen umgeben. (Jenny und Garp sollten eine Wohnung in einem der zur Schule gehörenden Wohnheime bekommen.) Sie malte sich die ersten sexuellen Erfahrungen ihres Sohnes aus – eine vom Anblick und von dem Geruch der Waschräume beflügelte Phantasie: Die Mädchen würden, nur so zum Spaß, das Kind in weichen Bergen weiblicher Unterwäsche begraben. Die Arbeit hätte Jenny gefallen, aber sie lehnte das Angebot Garp zuliebe ab. Stattdessen nahm sie eine Stellung an der großen, berühmten Steering School an. Dort würde sie allerdings nur eine von vielen Schulschwestern sein, und die Wohnung, die sie und Garp bekommen sollten, lag in dem kalten, mit vergitterten Fenstern versehenen Seitenflügel des Nebengebäudes, in dem die Krankenstation untergebracht war.
[52] »Mach dir nichts draus«, sagte ihr Vater. Es passte ihm nicht, dass Jenny überhaupt arbeiten wollte. Geld war genug da, und er wäre glücklicher gewesen, wenn sie sich auf dem Familiensitz in Dog’s Head Harbor versteckt hätte, bis ihr kleiner Bastard herangewachsen war und eigene Wege ging. »Wenn der Junge ein Fünkchen angeborener Intelligenz hat«, sagte er zu ihr, »sollte er später eventuell die Steering School besuchen, aber bis dahin gibt es meiner Meinung nach keine bessere Umgebung, in der ein Junge aufwachsen könnte.«
»Angeborene Intelligenz« – das war eine der vornehmen Formulierungen, mit denen ihr Vater auf Garps zweifelhafte genetische Herkunft anspielte. Die Steering School, die Jennys Vater und ihre Brüder besucht hatten, war damals eine reine Jungenschule. Jenny glaubte, das Beste für ihren Sohn zu tun, indem sie die Gefangenschaft dort aushielt, bis der kleine Garp das Gymnasium hinter sich gebracht hätte. »Ein Akt der Wiedergutmachung, weil du ihm einen Vater verweigerst«, wie ihr Vater sich ihr gegenüber ausdrückte.
»Es ist doch sonderbar«, schrieb Garp, »dass meine Mutter, die sich selbst gut genug kannte, um zu wissen, dass sie unter keinen Umständen mit einem Mann zusammenleben wollte, am Ende mit achthundert Jungen zusammenlebte.«
So wuchs der kleine Garp bei seiner Mutter im Nebengebäude der Krankenstation der Steering School auf. Er wurde nicht ganz wie ein »Lehrerbalg« – so nannten die Schüler alle minderjährigen Kinder der Lehrer und Mitarbeiter der Schule – behandelt. Eine Schulschwester gehörte [53] irgendwie nicht zur gleichen Schicht oder Kategorie wie die Lehrerschaft. Überdies machte Jenny keinen Versuch, einen Mythos um Garps Vater aufzubauen – um für sich selbst eine Heiratsgeschichte zurechtzulegen und ihren Sohn als ehelich auszugeben. Sie war eine Fields, und sie legte Wert darauf, den Leuten ihren Namen zu sagen. Ihr Sohn war ein Garp. Und sie legte Wert darauf, den Leuten seinen Namen zu sagen. »Es ist sein eigener Name«, sagte sie.