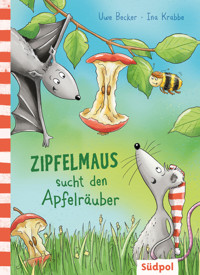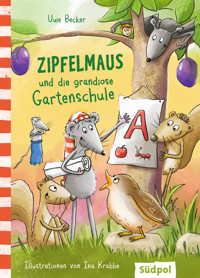17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: X-Texte zu Kultur und Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
Die Debatte um Inklusion hat seit der 2009 in Deutschland in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention deutlich an Popularität gewonnen. Auffällig ist, dass hier oftmals das Bild einer dichotomen Gesellschaft bemüht wird, in der es angeblich ein »Drinnen« und ein »Draußen« gibt. Der Inklusion wird dadurch der Charakter eines »heiligen Projekts« zugeschrieben, durch das Menschen mit Behinderung Aufnahme finden sollen in die Gesellschaft. Es gibt aber keine Exklusion aus der Gesellschaft. Allerdings bestehen innerhalb der Gesellschaft massive Ausgrenzungsprozesse. Diese zu beseitigen hieße, die Gesellschaft so zu transformieren, dass ihre Fokussierung auf Erwerbsarbeit und die Normierungen der leistungszentrierten Bildungsinstitutionen aufgegeben werden können.
Uwe Becker analysiert umfänglich die Ausgrenzungsdynamiken, die Menschen in den Bildungsinstitutionen, in Arbeitslosigkeit und Armut – begleitet von politischer Diffamierung – erleiden. Er fordert eine Korrektur der ökonomisch gesteuerten, erwerbsarbeitszentrierten Gesellschaftslogik ein, ohne die Inklusion zum Desaster für Menschen mit Behinderungen, deren Angehörige, Pädagoginnen, Pädagogen und alle gutwilligen Akteure dieses Projekts zu werden droht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Die Debatte um Inklusion hat seit der 2009 in Deutschland in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention deutlich an Popularität gewonnen. Auffällig ist, dass hier oftmals das Bild einer dichotomen Gesellschaft bemüht wird, in der es angeblich ein »Drinnen« und ein »Draußen« gibt. Der Inklusion wird dadurch der Charakter eines »heiligen Projekts« zugeschrieben, durch das Menschen mit Behinderung Aufnahme finden sollen in die Gesellschaft. Es gibt aber keine Exklusion aus der Gesellschaft. Allerdings bestehen innerhalb der Gesellschaft massive Ausgrenzungsprozesse. Diese zu beseitigen hieße, die Gesellschaft so zu transformieren, dass ihre Fokussierung auf Erwerbsarbeit und die Normierungen der leistungszentrierten Bildungsinstitutionen aufgegeben werden können.
Uwe Becker analysiert umfänglich die Ausgrenzungsdynamiken, die Menschen in den Bildungsinstitutionen, in Arbeitslosigkeit und Armut – begleitet von politischer Diffamierung – erleiden. Er fordert eine Korrektur der ökonomisch gesteuerten, erwerbsarbeitszentrierten Gesellschaftslogik ein, ohne die Inklusion zum Desaster für Menschen mit Behinderungen, deren Angehörige, Pädagoginnen, Pädagogen und alle gutwilligen Akteure dieses Projekts zu werden droht.
Uwe Becker ist ev. Sozialethiker, Honorarprofessor an der Evangelischen Fachhochschule Bochum, Vorstandssprecher der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik. Er publiziert zu arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Themen u.a. in der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Rundschau und der ZEIT.
Uwe Becker
Die Inklusionslüge
Behinderung im flexiblen Kapitalismus
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook transcript Verlag, Bielefeld 2015
© transcript Verlag, Bielefeld 2015
Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Covergestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld
Konvertierung: Michael Rauscher, Bielefeld
Print-ISBN: 978-3-8376-3056-5
PDF-ISBN: 978-3-8394-3056-9
ePUB-ISBN: 978-3-7328-3056-5
http://www.transcript-verlag.de
Inhalt
1.
Einführung
2.
Politik von ganz oben – Landung im Diffusen
3.
Alle sollen mitmachen
4.
Chancengerechtigkeit – die Lotterie des Sozialstaates wird inklusiv
5.
Beschädigte Inklusionsräume
6.
Der Raum der Erwerbsarbeit
7.
Der Raum der Bildung
8.
Der öffentliche Raum
9.
Inklusionslogiken
Literatur
1. Einführung
Dieses Buch widmet sich der kritischen Analyse einer gesellschaftlichen Utopie, die gegenwärtig unter dem Begriff »Inklusion« firmiert. Die Kritik gilt dabei nicht der Utopie an sich. Utopien sind weder grundsätzlich etwas Übles noch wird hier die Meinung vertreten, dass Utopien vor der Realität fliehen. Im Gegenteil, die utopischen Gesellschaftsentwürfe eines Thomas Morus’ (vgl. Morus 1992) oder eines Campanellas (vgl. Campanella 2012) waren zu ihrer Zeit anstößige »Gegenbilder zu den unmenschlichen, ungerechten und unglücklich machenden Entwicklungen« der konkreten Gesellschaft ihrer Zeit (Gil 1997: 32). Und sie sind allein schon wegen ihrer bis heute geltenden Inspiration von realitätsprägender Bedeutung. Man denke nur an die Vision eines sechsstündigen Arbeitstages bei Morus oder eines vierstündigen bei Campanella, auf die bis heute von den Befürwortern einer kollektiven Arbeitszeitverkürzung zurückgegriffen wird, auch wenn der Trend gegenwärtig in eine andere Richtung geht. Diese fast egalitären Arbeitszeitbedingungen, wie sie in diesen Utopien beschrieben werden, haben wegen ihrer Abweichung von der Realität einen bis heute inspirierenden Charakter. Das hat nachdenklich gemacht, das hat die bestehenden Verhältnisse kritisch hinterfragt, aber Werke wie »Utopia« von Thomas Morus oder »Der Sonnenstaat« von Campanella waren nie als »Handbuch der politischen Praxis« gedacht. Sie haben der politischen Realität den utopischen Spiegel vorgehalten, ihr die Alternative, das Anderssein als denkbare Möglichkeit vor Augen geführt. Man könnte auch sagen: Utopien sind eine Art gedankliche Kraftquelle, sich mit dem Bestehenden nicht als dem zwingend Notwendigen abzufinden. Dies gilt für biblische Bilder und Impulse eines »neuen Himmels und einer neuen Erde«, für den Gedanken der sozialen Gerechtigkeit, der Freiheit und der Autonomie bis hin zur Marx’schen Utopie einer klassenlosen Gesellschaft.
Solange Utopien sich als jener Stachel des Andersseins bewähren, die Realität sozusagen utopisch von außen angreifen, haben sie ihren guten Zweck. Die Kritik ist hingegen insbesondere dann geboten, wenn Parteien oder gar der Staat sich als Vollzugsorgan einer Utopie begreifen. Wenn politische Maßnahmen gewissermaßen mit der Aura utopischer Heiligkeit versehen werden, spätestens dann wird die geschichtliche und politische Wirklichkeit utopisch verklärt, sie wird unangreifbar und gewinnt totalitäre Züge. In der Regel unterliegt Politik in demokratischen Staaten nicht dieser utopischen Verklärungsgefahr. Aber das heißt nicht, dass sie sich nicht auch auf fragwürdige Weise der Utopien bedient, um die eigenen politischen Mittel anzupreisen.
Das Grundmuster der gängigen Art jener utopisch verklärten Legitimationsübung politischer Praxis ist folgendermaßen gestrickt: Man erklärt, der Utopie im Grundsatz verpflichtet zu sein, sei es der Idee der sozialen Gerechtigkeit, der Menschenwürde, der Freiheit, der Autonomie oder der Solidarität. Aber die Praktikabilität »utopischer Schritte« wird dem Gesetz der Machbarkeit, also der politischen Opportunität unterstellt. Dieses Opportunitätsdenken äußert sich meist durch den Verweis auf die begrenzte Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Anders gesagt: Politik gefällt sich in der »utopischen Haltung« bei gleichzeitiger Anwaltschaft für das finanzielle Realitätsprinzip, dem sich die Utopiepraxis zu fügen hat. Utopie wird so zur Makulatur, zum leeren »Bekenntnis«. Denn der Weg ins Zentrum der ökonomischen und politischen Mechanismen wird ihr verwehrt. Radikale Anfragen an ordnungspolitische Grundsätze und an scheinbar ökonomische Gesetzmäßigkeit zu stellen, steht ihr aus politisch-pragmatischer Sicht nicht zu.
Eine solche Politik der utopischen Haltung verwässert die Konturen des Konflikts. Denn je mehr Menschen sich auf eine utopische Grundidee verständigt haben, je größer ihr Abstraktionsgrad ist, je mehr Einigkeit also vermeintlich im Grundsätzlichen besteht, desto weniger will es lohnend erscheinen, über die Details zu diskutieren. Konkret: Keine Partei leistet sich eine Abkehr vom Prinzip der sozialen Gerechtigkeit. Die, die dies öffentlich proklamieren würde, stünde unter hohem Rechtfertigungsdruck. Was nun das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit für Fragen des Mindestlohns, der Höhe der Sozialleistungen oder einer gesetzlichen Mindestrente konkret bedeutet, wird zu einer finanztechnischen Diskursübung von Spezialisten, denen »normale Bürgerinnen und Bürger« kaum folgen können. Die ökonomischen und politischen Bastionen der »Beitragssatzstabilität«, der »Schuldenbremse«, der »Senkung der Staatsausgaben« werden dabei eigenartig tabuisiert. Dass eine bestimmte Form der Wirtschafts-, Steuer- und Arbeitsmarktpolitik ursächlich ist für ein eklatantes Defizit an sozialer Gerechtigkeit, dass die Rentenpolitik eine gravierende Entwicklung der Altersarmut produziert, das alles bleibt, als ökonomische »Notwendigkeiten« deklariert, dem kritischen Diskurs weitgehend entzogen. Mit anderen Worten: Die Debatte über die Utopie der sozialen Gerechtigkeit wird utopisch eingegrenzt. Sie bleibt eingezäunt in ein klar abgestecktes Gelände, um keinen »Flurschaden« in der gesamten Landschaft anzurichten.
Diese Mechanismen der Einzäunung eines utopischen Projekts greifen gegenwärtig in das Gebiet der »Inklusion«. Dem Ziel nach verfolgt Inklusion die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK), eine »Übereinkunft der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung«. Im März 2007 wurde diese von Deutschland unterzeichnet und ist seit 2009 als innerstaatliches deutsches Recht in Kraft gesetzt. Ihr zentrales Anliegen ist die Wegbereitung zur ungehinderten gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen mit Behinderung. Es geht darum, den »vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten« (Artikel 1). Beabsichtigt ist die Herstellung von »Chancengleichheit« auch für Menschen mit Behinderung (Artikel 3). Was das bedeutet und wie es praktisch auszusehen hat, wird gegenwärtig über soziale, universitäre und politische Fachkreise hinaus intensiv diskutiert. Allerdings trägt das nicht unbedingt zur Klärung von Begriff und Inhalt der Inklusion bei. Die Projektionen, die mit diesem Begriff verbunden sind, variieren vielfältig. In der Schulpolitik wird das Thema mit einer gewissen geradezu technisch anmutenden Kennziffermentalität inseriert. Man spricht hier gerne von »Inklusionsquoten«. Sonderpädagogik und Psychologie beschreiben hingegen wesentlich filigraner Inklusion als interaktiven, gruppendynamischen Prozess. Heribert Prantl geht eher demokratietheoretisch an die Sache heran und bezeichnet Inklusion als eine Realvision von der, wie er meint, »wir noch weit entfernt sind« (Prantl 2014: 73). Die Soziologie, namentlich sind hier Niklas Luhmann, Armin Nassehi, Martin Kronauer oder Rudolf Stichweh zu nennen, halten das Gegenüber von Inklusion und Exklusion für eine gesellschaftliche Konstruktion, die in ihrer populär gehandelten Schlichtheit kritisch zu betrachten ist. Folglich gewinnt man den Eindruck, dass diese Debatte den Weg von der »Unkenntnis zur Unkenntlichkeit« beschritten hat (Hinz 2014: 15). Die Probleme, die sich gerade wegen des utopischen, teilweise recht unkonkreten Charakters dieses Begriffs und der Sache ergeben, sind daher detailliert zu beleuchten. Ein »praktisches« Problem ist schon angedeutet: Viele scheinen engagiert vereint in diesem utopischen Gelände. Es sind Behinderten- und Sozialverbände, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterninitiativen und sozialrechtlich Kompetente, Leistungserbringer und Kostenträger, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Aber sie sind nicht allein. Überall in diesem utopischen Gelände trifft man auch auf politische Zirkel der Bundes-, Länder- und Kommunalpolitik. Und der Eindruck, der sich zunehmend verfestigt, ist, dass deren Präsenz einem maßgeblichen Ziel geschuldet ist: Sie wollen das utopische Gelände abstecken, einzäunen und letztlich kontrollieren. Der utopische Gehalt der Inklusion ist daher geradezu gefährlich. Er verleitet utopisch genügsamere Zeitgenossen der öffentlichen Hand – natürlich bei grundsätzlichem Verständnis für alle inklusionspolitischen Anliegen – frühzeitig dazu, den Utopiegehalt des Gegebenen für gesättigt zu erklären, mehr sei eben nicht »realistisch«. Die technisch-finanzielle Ebene dieser Auseinandersetzung ist bereits an vielen Stellen aufgebrochen. Die Forderungen vieler Sozialverbände und Behindertenrechtsorganisationen nach erheblichen öffentlichen Investitionen für das Bildungssystem, die Gestaltung der Sozialräume, öffentlich geförderte Arbeit, Kultur und soziale Dienstleistungen trifft auf eine kühle und scheinbar unangreifbare Finanzierungslogik. In keinem der Aktionspläne der Bundesländer zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention fehlt der Hinweis auf den Finanzierungsvorbehalt des Haushaltsrechts. Mit Blick auf die öffentliche Verschuldung und die Schuldenbremse des Fiskalpaktes, so muss man kritisch folgern, ist schon jetzt klar, dass diese »Landesaktionspläne« zur Inklusion einen reichlich eingeschränkten Aktionsradius haben. Dabei kalkulieren viele Kämmerer der öffentlichen Kassen nicht etwa Mehrausgaben ein, sondern spekulieren auf Einsparungen. Die Schließung von Förderschulen ermöglicht die Einsparung von finanziell aufwändigen Schulfahrdiensten und von sonderpädagogischem Fachpersonal. Die Abschaffung von Werkstätten für Menschen mit Behinderung, ihre Integration in Erwerbsarbeit, entlastet die öffentliche Hand, insbesondere die Kommunen. Auch der Abbau von stationärer Versorgung zugunsten betreuter Wohngruppen lässt auf Kostenreduktion hoffen. Das alles ist schon jetzt in Kostenstellenplanungen der öffentlichen Haushalte als perspektivische Einsparung vermerkt. Wie sollte da die öffentliche Hand nicht geradezu zum euphorischen Inklusionsbefürworter werden und der Utopie der Inklusion kräftig das Wort reden? Eine gute Idee, die auch noch billig zu haben ist. Das Dilemma ist: Diese Maßnahmen sind allesamt fachlich durchaus diskussionswürdig, wenn es um die Fragen geht, wie gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung qualitativ verbessert und gesichert werden kann. Aber diese Klärung ist im Sinne des von der BRK geforderten Selbstbestimmungsrechts von Menschen mit Behinderung selber vorzunehmen. Welche Art der Bildung, welche Form der Arbeit oder Tätigkeit und welche Wohnkultur Menschen mit Behinderung eingehen wollen, kann nicht per Verordnung mit dem inklusionspolitischen Rezeptblock der Kostenträgerseite verschrieben werden. Vielfach aber wird die Diskussion über und nicht mit Menschen mit Behinderung geführt, und der Kostensenkungsdruck ist doch zu offensichtlich das bewegende Motiv vieler Inklusionsbefürworter der öffentlichen Hand. Das wird nicht immer geschickt kaschiert durch das so ehrenwerte Leitmotiv, man wolle nun mit aller Kraft einem Menschenrecht auf gesellschaftliche Teilhabe dienstbar sein. Hinzu kommt das spannungsreiche Verhältnis zwischen Utopie und Realität, das zumindest dann gegeben ist, wenn im utopischen Übergriff Inklusion als vollzogen definiert wird, ohne die Utopieresistenz der Realität zu beseitigen. So ist beispielsweise die Kritik am System der Förderschulen, vor allen Dingen an der relativ hohen Zahl von Kindern und Jugendlichen, die in ihnen beschult werden, grundsätzlich berechtigt. Aber die Utopie des Projekts »eine Schule für alle« legitimiert noch nicht die Schließung der Förderschulen. Die Entbehrlichkeit von Förderschulen kann nur Ergebnis der realen Veränderung des Regelschulsystems sein. Und ihre Schließung kann nicht ohne Folgen für die Gestaltung des dreigliedrigen Schulsystems einfach postuliert werden. Die Einlösung eines derartigen »utopischen Projekts« ist hoch anspruchsvoll oder aber sie strandet im Diffusen (vgl. Speck 2011). Das alles zeigt an, wie schwierig es ist, wenn man sich auf eine gemeinsame Utopie einlässt, eine Idee, die alle verbindet, ohne sich vorher über die Vermeidung von konkreten Folgen und Nebenfolgen zu verständigen. Ein Grund mehr, sich kritisch mit dem utopischen Charakter der BRK auseinanderzusetzen.
Die hohe Moralität der Inklusionsdebatte birgt noch eine weitere Gefahr: Ihr Abheben auf eine fast schon metaphysische Ebene immunisiert gegen Kritik! Der geballte moralische Druck dieses Menschenrechtsdiskurses belegt gesellschaftstheoretische Anfragen an das Inklusionskonstrukt gelegentlich kategorisch mit dem Makel feindseliger Gesinnung. Dennoch muss gefragt werden, ob der Gebrauch von Begriffen wie »Teilhabe« oder »Chancengleichheit« in diesem Diskurs nicht allzu oft einer gewissen Naivität und Kritikabstinenz unterliegt, ohne diese Begriffe auch nur ansatzweise inhaltlich geschärft zu reflektieren. So muss, wer von Inklusion redet, logischerweise die Existenz von Exklusion voraussetzen. Die theoretischen Grundannahmen der in der Praxisdiskussion üblichen Semantik von »Inklusion und Exklusion« scheinen aber keineswegs konsequent geklärt und durchdacht zu sein. Es muss auch theoretisch Rechenschaft darüber gegeben werden, was denn die inhaltlichen Kriterien für die Definition von Exklusion und Inklusion sind. Wenn man schon meint, eine solche Grenzziehung bestimmen zu können, dann ist auch die Frage zu beantworten, wo sie denn »verläuft«, diese Grenze zwischen »drinnen« und »draußen«. Weder ist dieses Konstrukt legitimiert, noch ist geklärt, wem diesbezüglich die Klärungskompetenz in Sachen Grenzziehung zusteht. Also, wer ist wann und aufgrund welcher Maßstäbe überhaupt legitimiert zu definieren, dass Menschen aus der Gesellschaft »exkludiert« oder auch nicht mehr »exkludiert« sind? Der Luzerner Soziologe Rudolf Stichweh hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es bei der Konnotation von Inklusion und Exklusion ein hierarchisches Gefälle gibt. Exklusion hat den Charakter der Illegitimität, die sich besonders aus der Vorstellung speist, dass Menschen im Stadium der Exklusion sich außerhalb der Gesellschaft befinden (vgl. Stichweh 2009: 36f.). Die meist kreisförmig visualisierte Vorstellung von Gesellschaft, in der die Punkte außerhalb des Kreises die Exkludierten darstellen, bewirkt, dass »Exklusionen« oder besser Ausgrenzungen im »Innenkreis« der Gesellschaft keiner Thematisierung mehr bedürfen. Die Gesellschaft schottet sich so auf elegante Weise von der kritischen Wahrnehmung der in ihr produzierten Prozesse der Ausgrenzung ab. Das hier transportierte Gesellschaftsbild lässt völlig außer Acht, welche Brüche, Ungleichheiten und sozialen Verwerfungen schon jetzt »innerhalb« dieser Gesellschaft produziert werden. Sie tritt in diesem Bild als »unproblematische Einheit« auf, was nichts anderes produziert als ihre eigene Mystifizierung (Kronauer 2010: 20). Inklusion wird dann quasi zum sakralen Akt der Vergesellschaftung, und die »Zugehörigkeit« zur »Gemeinde« der Inkludierten verkommt zur inhaltsleeren Metapher für Teilhabe und Wohlfahrt. Die Unzulässigkeit dieser Identifikation ist vielfach belegt: So bedeutet Inklusion beispielsweise im Regelschulsystem noch längst nicht, eine schulische Schlüsselqualifikation zu erlangen, die aber für die gesellschaftliche Teilhabe immer wieder als das zwingend zu passierende Eintrittstor beschrieben wird. Und die Teilnahme am Arbeitsmarkt führt noch längst nicht zu einem Leben jenseits von Armut oder Angewiesenheit auf Sozialleistungen und ist auch nicht stetig garantiert. Letztlich kann der »Vollzug von Inklusion« in Erfahrungen von Ausgrenzung umschlagen, wenn die Leistungsanforderungen im System den individuellen Fähigkeiten nicht entsprechen. Inklusion hebt eben nicht die gesellschaftlichen Selektions- und Sanktionsmechanismen auf (vgl. Wansing 2012: 393). Die Debatte über Inklusion bleibt damit im Mainstream eigenartig unberührt von den kritischen Überlegungen zu gesellschaftlichen Mechanismen der Ausgrenzung. Wenn man schon im dichotomen Bild von »drinnen« und »draußen« verbleiben will, dann wäre jene Gesellschaft derer, die »drinnen« sind und zur Teilhabe einladen, kritisch danach zu befragen, ob ihr Innenleben so gastfreundlich und attraktiv ist, dass man dieser Einladung gerne folgt. Im hierarchischen Gefälle von Exklusion und Inklusion wird also der Raum der Inklusion gleichsam »heilig« gesprochen. Allein die Zugehörigkeit zu diesem Raum herzustellen, ist schon ein Akt der guten Tat, der keinerlei Legitimation mehr bedarf. Inklusion erschöpft sich damit formal auf diesen Akt der Aufnahme, ohne dass geklärt ist, welche normativen Vorstellungen sich hinter diesem Inklusionsvollzug verbergen. Denn natürlich unterliegt eine solche Vorstellung von Inklusion auch Normen, nach denen Inklusion als vollzogen definiert wird. Diese Normierungen spiegeln eine hierarchische Struktur machtvoller Instanzen, deren Definitionshoheit nicht frei ist von ökonomischen Interessen. Nun wäre die Dramaturgie dieses Inklusionsgeschehens und der inszenierten Semantik von Inklusion und Exklusion wesentlich unspektakulärer, wenn man redlich reflektieren würde, dass auch die sogenannte Exklusion Phänomene des gesellschaftlichen Innenlebens bezeichnet. Es geht hier keineswegs um alles oder gar nichts. Räume, die sich als nischenhafte Exklusionssphären jenseits der breiten Korridore der Inklusionspaläste platzieren, könnte man auch als innergesellschaftliche »Schonräume« verstehen, die sich der zentralen Funktionslogik einer auf Leistung und Konkurrenz gegründeten Gesellschaft entziehen. Ihre Illegitimität wäre durchaus zu bestreiten, zumal dann, wenn sie als selbstbestimmte Räume derer eingefordert würden, die sich einem gewissen Lebensstilmainstream verweigern. Die Rede von Inklusion und Exklusion birgt zudem stigmatisierendes Potenzial. Wenn jemand unter die Maßgabe politischer Inklusionsbestrebungen fällt, dann ist er mindestens latent mit der stigmatisierenden Vorstellung konfrontiert, er sei aus der Gesellschaft »exkludiert«, selbst wenn dies nicht mit seiner Selbstwahrnehmung übereinstimmt. Folglich müsste er sich stillschweigend zufrieden geben, wenn er endlich in den Innenkreis der Gesellschaft aufgenommen, seine »Inklusion« vollzogen ist, was immer das auch für negative Auswirkungen auf seine Lebensqualität hat. Zum Realitätstest des inklusiven Denkens gehört also seine theoretische Bestandskraft. Ohne eine kritische Analyse der gesellschaftlichen Mechanismen der Ausgrenzung arbeitet die Inklusionsdebatte den bestehenden ordnungspolitischen Kräften unkritisch und legitimatorisch zu. Man könnte auch sagen: Die Debatte um Inklusion ist politisch sehr willkommen, denn sie bietet der Politik die Möglichkeit, bestehende Ausgrenzungsdynamiken gesellschaftlicher Realität auszublenden. Die Inklusionslyrik des politischen Mainstream meistert die Paradoxie, gesellschaftliche »Räume« zum Aufenthalt anzupreisen, für die gleichzeitig reihenweise Menschen die Aufenthaltslizenz entzogen wird.
Der historische Ort der Umsetzung der BRK fällt eigenartig zusammen mit Zeiten der internationalen Finanz-, Banken- und Staatsverschuldungskrisen. Die Schuldenbremse quer über alle öffentlichen Haushalte, das Spardiktat bezüglich der Neuverschuldung von Bund und Ländern und der geforderte Abbau des enormen Schuldenstandes bringen die Politik in eine eigenartige Verlegenheit. Sie gerät anscheinend in eigener Sache zunehmend in Erklärungsnot. In bislang ungewohnter Weise haben Diskussionen zu Kredit-, Bürgschafts-, Kapital- und Zinsfragen, zu Rettungsschirmen und Fiskalpakten die medialen Kernthemen der politischen Performance dominiert. Das wirft immer wieder die Frage nach der Distanz der Politik zur Finanzwelt auf. Die Rede von der Alternativlosigkeit politischer Beschlüsse wird zwar selbstbewusst vorgetragen, wirksam begegnen kann sie der Frage, ob inzwischen nicht das »Ende der Politik« (Segbers 2011) erreicht sei, aber nicht. Wenn also politische Entscheidungen sich derart alternativlos darstellen, wenn der Sachzwang des finanzpolitisch Gebotenen so eindeutig erscheint, was, so die Frage, macht Politik noch zur Politik? Die These vom Ende der Politik verkennt die Sache. Politik ist, anders als man denkt, durchaus handlungsfähig und handelt, wenn auch nicht so, wie manche enttäuschten Mahner es sich wünschen. Politik ist durchaus aktiv, indem sie zum Beispiel die Finanzmarktakteure nicht nur lange hat aktiv gewähren lassen, sondern die Deregulierung ihrer Aktivitäten mit gesetzlichen Regelungen gestützt hat. Im Gegensatz zu dieser »Deregulierungsregelung« wird sie hingegen nahezu hyperaktiv regulativ, wenn es darum geht, die ökonomischen Sachzwänge eins zu eins an die Zivilgesellschaft weiterzugeben. Die Logik der Schuldenbremse tritt derart massiv auf, dass jede Kappung von Sozialleistungen, jeder Rückzug der Länder von Finanzierungsvorhaben im sozialen Sektor, jede Minderung der Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge als alternativloser Vollzug eines ökonomischen Gesetzes deklariert werden kann.
Was liegt näher, als sich in dieser Situation auf das Gelände der Utopie zu begeben? Insofern kommt der Politik durchaus gelegen, dass sie sich als Promoter der Inklusion in Szene setzen kann. Die ordnungspolitischen Grundpfeiler bleiben. Die angebots-, wettbewerbs- und wachstumsorientierte Sparpolitik feiert weiterhin Konjunktur, nicht nur in Deutschland, sondern als Mainstream auch in der Europäischen Union. Die wachsende gesellschaftliche Ungleichheit, zunehmende Altersarmut und prekäre Beschäftigungsverhältnisse en masse werden nicht mehr ernsthaft parlamentarisch diskutiert. Aber die Inserierung der Inklusion in Deutschland in vielen Landesaktionsplänen und einem nationalen Aktionsplan scheint der Politik zu bescheinigen, dass das Herz doch am rechten Fleck ist und dass sie noch offen ist für utopische Anliegen. Man kann auch formulieren: Inklusion bietet der Politik die vorzügliche Möglichkeit, utopische Aufgeschlossenheit zu signalisieren bei ansonsten ordnungspolitischer Verhaltensstarre. Sie solidarisiert sich gewissermaßen mit einer zivilgesellschaftlich guten Idee, ist Teil der Idee und kann sich im Lichte von Menschenrechten als deren Wortführer in Szene setzen. Wer also der Politik nur die Pragmatik der aktuellen und Macht austarierenden Entscheidungen vorwirft, übersieht, dass sie sich längst dem Feld der Utopie gewidmet hat. Allerdings ist auch diese Besetzung des utopischen Geländes der ansonsten geltenden ökonomischen Rationalität des gesellschaftlichen Lebens verpflichtet. Die aktive Mitwirkung am Inklusionsdiskurs ist nicht zu verwechseln mit der Bereitschaft, auch nur einen Cent vom Kurs der Einsparungspolitik und einer insgesamt neoliberal ausgerichteten Ökonomie abzurücken. Auch der Diskurs über Inhalt und Praxis der Inklusion bleibt folglich gefangen im Gehäuse dieser dominanten ökonomischen Logik. Sie ist sozusagen der Rahmen einer »obligatorischen Vollinklusion« (Stichweh 2005: 43) ohne Entrinnen.
Damit sind die wesentlichen Kritikpunkte benannt, die einer allzu leichtfertigen Rede von einer inklusiven Gesellschaft und demzufolge einer zu einfachen und »billigen« Vorstellung über ihre Praxis begegnen wollen. Sie sind also mehrfach anzusetzen: Erstens bezogen auf den Trend, Inklusion, im herkömmlichen Verständnis gedacht, als menschenrechtliches Einsparmodell umsetzen zu wollen. Es wird also zu fragen sein, wie ernsthaft und mit welchen Mitteln denn diese Inklusionspraxis gesellschaftlich in die Tat umgesetzt werden soll. Was wird geplant beispielsweise im Bereich der Bildungs- und der Arbeitsmarktpolitik? Welche finanziellen Mittel sollen zur Verfügung gestellt werden? Anders gefragt: Wie sehen die Niederungen der Politik aus, wenn sie die Höhenflüge der BRK verlässt, das gedruckte Menschenrechts-Papier zur Seite legt und sich an die inklusionspolitische Arbeit macht? Zweitens bezieht sich die Kritik auf die unreflektierte Programmatik einer Inklusionsvorstellung, die die pure »Teilhabe« an den Hauptinstanzen gesellschaftlicher Sozialisation, nämlich Bildung und Arbeit, zum inklusionspolitischen Saturierungspegel quotiert. Die Kritik an jener uniformen Vorstellung von Teilhabe gilt auch dem Tatbestand, dass sie oftmals Menschen mit Behinderung zugedacht wird und nicht immer auf ihre je konkrete Zustimmung und Einwilligung abzielt. Damit verbunden soll drittens gefragt werden nach der Attraktivität der »Inklusionsräume«, nach dem Innenleben der Gesellschaft, von dessen Qualität die Politik offensichtlich so überzeugt zu sein scheint. Die gegenteilige Erkenntnis, dass vielen Menschen für diese Räume bereits die Aufenthaltsgenehmigung entzogen wurde, gibt weitere Fragen auf: Welchen abstrusen »Containervorstellungen« über Inklusion unterliegt der Mainstream der Debatte, und in welche Systeme und welche Funktionen soll eigentlich »inkludiert« werden? Inklusion scheint ja nicht Angebot, sondern eher Norm dieser Gesellschaft zu sein, zumindest, wenn man den Faktor Erwerbsarbeit mit seiner normierenden Sogkraft als Zentrale dieser »Inklusionsräume« betrachtet. Dass es jedenfalls jenseits der Debatte über die BRK mit »Inklusion« immer auch um die Einbindung in diese generelle, das gesellschaftliche Leben allumfassende Logik geht, die keine »Exklusion« toleriert, ist offensichtlich. Inwieweit sollte nun in Folge der BRK eine andere Logik zur Anwendung kommen, wenn es um gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung geht?
Wenn man den Begriff der Inklusion für gesellschaftliche Transformationsprozesse überhaupt sinnvoll und kritisch verwenden will, dann meint er nicht den »Einschluss« in Bestehendes, sondern den Zusammenschluss von Vielfalt. Dann ergeben sich aus derartigen Inklusionsprozessen auch Veränderungen des gesellschaftlichen Gefüges und der zentralen ökonomischen Funktionslogik der Gesellschaft. Der politischen Verfassung obliegt bei einem solchen Inklusionsverständnis die Aufgabe, den gesellschaftlichen Subjekten »die für ein im vollen Sinne gutes menschliches Leben notwendigen Bedingungen zur Verfügung zu stellen«, die allen die Möglichkeiten bieten, »in einer Weise tätig zu sein, die konstitutiv für ein gutes menschliches Leben ist« (Nussbaum 1999: 90). Bedingungen zu schaffen, heißt aber Freiräume herzustellen und nicht präskriptiv den Raum dieser Möglichkeiten eines guten Lebens statisch zu definieren. Die Herstellung dieser Freiräume zur Gestaltung der Lebenswelt im eigenen Sinne, nach eigener Maßgabe ohne Zugriff eines normierenden Fremdzwangs, wäre eine Form der Inklusion, die in hohem Maße der autonomen Selbstbestimmung unterliegt und auch Menschen mit Behinderung Wahlfreiheit eröffnet. Inklusion in diesem Sinne, qualitativ als Befähigung zu einem guten Leben gedacht, setzt wesentlich elementarer an. Es geht dann um selbstbestimmte Räume der Geborgenheit in menschlichen Beziehungen, in räumlicher Umgebung, in einem als sinnvoll erachteten sozialen und kulturellen Kontext. Eine Gesellschaft mit einem in diesem Sinne inklusiven Anspruch hinterfragt daher auch das Zentrum ihrer normierenden Logik, die besonders durch ihre Konzentration auf den Faktor Erwerbsarbeit konfiguriert wird. Die neuen Logiken sind dann jeweils Ergebnis der ergänzenden Partizipation von Menschen, die sich möglicherweise gerade aufgrund ihrer Behinderung dieser Logik der Erwerbsarbeitszentrierung verweigern. Ein inklusives Gesellschaftsprojekt dieser Art hieße, eine auf Leistung und Konkurrenz gründende Gesellschaftsorganisation, wie sie bereits im Bildungssystem ihre Sozialisierungserfolge feiert, wenigstens teilweise in Frage zu stellen und sie ansatzweise neu zu gestalten. Inklusion, kritisch gedacht und radikal gestaltet, würde dieser Gesellschaft in der Tat ein neues, ein verändertes Gesicht und eine neue Zentrierung geben. Die Normalisierung des Alltags von Menschen mit Behinderung im Sinne ihrer uneingeschränkten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben heißt nicht, dass die Normierungen dieser Gesellschaft, insbesondere der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, einfach übernommen werden (vgl. Kelle/Mierendorff 2013). Empathie, Entschleunigung, Solidarität, Konkurrenzreduktion, Toleranz und eine Lebensführung ohne primär ökonomische Rationalität, das sind nur einige Aspekte einer inklusiveren Gesellschaft, die auch die Normen des gesellschaftlichen Lebens nicht ungeschoren lassen. Es wird sich zeigen, dass die Konsequenzen dieser »Utopie«, wenn sie real werden soll, möglicherweise nicht ganz im Sinne all derer sind, die jetzt so beherzt das Wort Inklusion im Munde führen.
2. Politik von ganz oben – Landung im Diffusen
Inklusion – wissen Sie, was gemeint ist?
»Wissen Sie, was Inklusion bedeutet?« Diese Frage wurde in einem Kurzfilm mehreren Bewohnerinnen und Bewohnern einer westfälischen Einrichtung der Behindertenhilfe gestellt. In ihren Antworten variierten Grundtöne einer gewissen Ratlosigkeit: »Weiß ich nicht, kenne ich nicht, nie gehört.« Eine Wette: Das Ergebnis einer entsprechenden Umfrage, gerichtet an die diffuse Laufkundschaft auf den Marktplätzen dieser Republik, würde zu keinem signifikant anderen Ergebnis führen. Mit anderen Worten: Begriff und Sache der Inklusion haben immer noch relativ exklusive Bedeutung. Sie sind weder allgemein bekannt noch allgemein verständlich. Und der überwiegende Teil der Menschen mit Behinderung, für die und zum Wohle derer jenes Zauberwort in naher Zukunft seine konkrete, politisch-magische Kraft entfalten soll, kann nur rätseln: »Weiß ich nicht, kenne ich nicht, nie gehört.«
Unter vielen sozial- und bildungspolitischen Akteuren, sei es in Organisationen von Menschen mit Behinderungen, in Parteien, Sozialverbänden, in Kultur und Wissenschaft findet hingegen eine leidenschaftliche Debatte über den richtigen Weg zur inklusiven Gesellschaft statt. Auch wenn unter ihnen keineswegs eindeutig geklärt ist, was denn nun mit Inklusion gemeint ist und welche konkreten Forderungen aus ihr resultieren, so hat man teilweise das Gefühl, dass dieser Eifer von hoher moralischer Qualität geleitet ist. Ähnlich wirken auch die Worte der ehemaligen Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Ursula von der Leyen, im Vorwort zum Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung unter dem Titel »Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft«: »Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der alle Menschen mitmachen können.« (Unser Weg 2011: 3) Das klingt irgendwie gut. Eine Aussage mit visionärem Klang. Das erinnert an fröhliche Kinderspiele an einem sonnigen Sommernachmittag: Alle sollen mitspielen, keiner darf »draußen« bleiben. Also: Eine Mitmachgesellschaft für alle! Eine Gesellschaft, in der alle irgendwie dabei sind! Allerdings bleiben bei genauerer Analyse dieses Satzes erste Fragen nicht aus: Wer ist denn dieses »Wir«, die Ministerin und ihr Haus, die Bundesregierung, die regierenden Parteien oder auch die Opposition? Oder will gar die Gesellschaft, dass alle mitmachen? Und wer nun auch immer will, dass alle mitmachen sollen, was heißt das dann für diejenigen, die vielleicht gar nicht mitmachen wollen? Wobei gleich weiter zu fragen ist: Mitmachen, wobei denn? Die Ex-Arbeitsministerin bringt ihre inklusionspolitischen Prioritäten nur wenige Zeilen später auf den Punkt. Das klingt dann vielleicht doch nicht mehr ganz so visionär und einladend: »›Dabei sein und mitmachen‹ bezieht sich auf alle Lebenslagen und gesellschaftlichen Bereiche. Ein zentraler Punkt ist die Teilhabe am Arbeitsleben. Arbeit stärkt das Selbstvertrauen, ist sinnstiftend, schafft Kontakte und Freundschaften.« (Ebd.) Nun müsste man doch weiter fragen, oder besser, man müsste diejenigen fragen, die bereits an diesem Arbeitsleben teilhaben. Können sie das uneingeschränkt unterschreiben, dass ihre Arbeit das Selbstvertrauen stärkt, dass sie sinnstiftend ist, Kontakte und Freundschaften schafft? Oder bewirkt Arbeit nicht für viele Menschen in manchen oder auch in allen Punkten genau das Gegenteil? Zumindest ist kritisch anzufragen, ob hier nicht ein normatives Werturteil durchschlägt, das vom bildungsbürgerlichen Hochsitz so manche Niederung der prekären Arbeitswelt übersieht.
Wir stoßen hier auf einen typischen Beleg für die Inklusionsargumentation. Sie bemüht das »Drinnen« und »Draußen«, das »Mitmachen« und »Zuschauen«. Eine Gesellschaft, in der alle mitmachen, das ist, einfach formuliert, scheinbar das utopische Projekt der Inklusion. Die mangelhafte Konkretheit dieser Utopie macht ihren Charme aus, aber eben auch ihre unverbindliche Unbestimmtheit. Die Metapher vom »Mitmachen« wirkt unmittelbar attraktiv. Sie bemüht eine »Makroebene der umfassenden Gesamtgesellschaft« (Wansing 2012: 381), der alle zustimmen können, weil keiner genau weiß, was konkret gemeint sein soll und wer davon wie betroffen ist. Erst die Offenlegung, dass es sich bei dem Mitmachen primär um Arbeit handelt, genauer gesagt, der weite und funktional sehr differenzierte Bereich der Erwerbsarbeit gemeint ist, lässt hellhörig werden. Denn zutreffend ist, dass diese Art des Mitmachens und das dadurch angestrebte Mithalten in der Gesellschaft auch vielen Menschen ohne Behinderung schon jetzt nicht gelingen. Tatsache ist, dass dieses Mitmachen keineswegs ein freudiges und freiwilliges Agieren aller Mitmachenden ist. Für nicht wenige ist es ein aus Not geborenes Agieren, um nicht völlig an den Rand gedrängt zu werden, nicht der Armut gänzlich zu verfallen und nicht dem Kreis jener anzugehören, die auch von politischer Seite immer wieder als die arbeitslosen, anstrengungslosen »Schmarotzer« der Nation bezeichnet werden.
Aus dieser Gesellschaft werden reihenweise durch den Faktor Erwerbsarbeit Menschen von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen. Sei es, dass ihre Arbeit nicht vor Armut schützt, sei es, dass sie zu denen gehören, denen der Zugang zur Erwerbsarbeit verwehrt ist. Ausgrenzung ist also ein wesentliches Merkmal des Aktionsfeldes, in dem mitgemacht werden soll. Inklusion wird für ein System angepriesen, das eben nicht nur Freude vermittelt, sondern auch geprägt ist von Konkurrenz, Erfahrungen des Scheiterns, der Armut und der Ausgrenzung. Wenn die Bedingungen dieses Systems nicht passgenau auf Menschen mit Behinderung zugeschnitten werden und »Normalitätserwartungen« nicht verändert werden, bleibt das System »an hochselektive Zugangskriterien gebunden, die sich im globalisierten wirtschaftlichen Wettbewerb weiter verschärfen. Menschen (mit Beeinträchtigungen) ›auf der gleichen Basis mit anderen‹ (BRK) in den Arbeitsmarkt einzubeziehen (Inklusion), bedeutet eben auch, sie den gleichen marktgesteuerten Selektionen, Zumutungen und (Neben-)Wirkungen von Erwerbsarbeit auszusetzen.« (Wansing 2012: 393) Die Gesellschaft, in die hinein zum Mitmachen eingeladen wird, hält Dynamiken und Prozesse vor, die zur massenhaften Ausgrenzung führen. Das gilt für den Bereich der Bildung, für den Arbeitsmarkt, und das gilt mit wachsender Tendenz auch für Menschen im Alter. Der stetige Anstieg der Erwerbsminderungsrente ist für letzteres nur ein Beleg.
So wirft ein einziger Satz einer Ministerin Fragen über Fragen auf, die es zu beantworten gilt. Nur ist noch nicht klar, ob das Verstehen, also die Beantwortung der Fragen, auch zwingend zum Mitmachen führt. Es könnte auch das Gegenteil eintreten: Dass das genaue Verstehen manche der Menschen mit Behinderung dazu geneigt sein lässt, nicht oder wenigstens nicht all das mitmachen zu wollen, was sie mitmachen sollen. Es könnte durchaus denkbar sein, dass das Verstehen auch Zaudern, Zögern, Widerstand und Protest auslöst, weil zwischen dem Begreifen einer Sache und dem Verfolgen derselben immer noch die Fähigkeit des Menschen steht, kritisch zu denken. Ein unkritisches »Mitmachen« sollte auch die Politik niemandem unterstellen, sicher auch nicht Menschen mit Behinderung. Es geht eben nicht nur um das Mitmachen, sondern auch um das Mitdenken. Es geht nicht nur um Aktion, sondern auch um Reflexion. Und die Erfahrung lehrt, dass Vorsicht geboten ist, wenn in politischen Zirkeln zu schnell klar zu sein scheint, was die Gesellschaft denken, wollen und – vor allen Dingen – tun soll.
Völkerrecht heißt nicht unbedingt, dass das Recht beim Volk ankommt
Um verstehen zu lernen, ist es wichtig, zunächst einmal die Quelle zu bewerten, auf die die Inklusionsdebatte, der Nationale Aktionsplan und die zahlreichen Landesaktionspläne Bezug nehmen. Gemeint ist also das am 13. Dezember 2006 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete »Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung«. Diese sogenannte Behindertenrechtskonvention (BRK) ist Ergebnis eines Umdenkungsprozesses. Denn auch in den Vereinten Nationen wurde Behinderung als ein eher sozialpolitisches oder gar medizinisches Thema verortet. Folglich lag das zuständige Ressort in der Kommission für Soziale Entwicklung oder bei der Weltgesundheitsorganisation (vgl. Degener 2006: 104). Die Forderung nach einer verbindlichen Menschenrechtskonvention ist fünf großen Nichtregierungsorganisationen von Menschen mit Behinderung zu verdanken, die letztlich dazu führte, dass die Generalversammlung 2002 einen »Ad-hoc-Ausschuss für ein umfassendes und integrales Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Rechte und Würde von Menschen mit Behinderung« (ebd.: 105) einsetzte. Vertreter und Vertreterinnen von NGOs, überwiegend Organisationen von Menschen mit Behinderung, wirkten maßgeblich an der Redaktionsarbeit mit, ganz nach dem Motto »nothing about us without us« (ebd.: 110). Folglich ist es, wie eine ihrer Mitautorinnen meint, bei dieser Erklärung gelungen, dass sie nicht »von Stellvertreterprofessionen«, sondern »von Organisationen der Behindertenbewegung selbst errungen wurde« (Degener 2009: 275). Im Kern hat diese Konvention den umfangreichen Katalog der Menschenrechte, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention Niederschlag gefunden haben, auf Menschen mit Behinderung zugeschnitten. Sie markiert damit »einen Wendepunkt zum menschenrechtlichen Modell von Behinderungen« (Masuch 2011: 246).
Obwohl es damit gelungen ist, dass der Text entscheidend aus der Sicht derer verfasst ist, um deren Recht es in der BRK geht, bleibt es ein Text der Vereinten Nationen. Er kommt gewissermaßen von »ganz oben«. Die BRK erklärt im ersten ihrer fünfzig Artikel: »Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.« Ihre allgemeinen Grundsätze werden in Art. 3 entfaltet. Danach geht es unter anderem um die Achtung der jedem Menschen innewohnenden Würde, um seine Autonomie und Freiheit, um die Nichtdiskriminierung, um die »volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft«, die Chancengleichheit und – mit Blick auf die Kinder mit Behinderung – um die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten und »ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität«.
Entsprechend weit sind auch in der Behindertenrechtskonvention die gesellschaftlichen und politischen Felder aufgeführt, um deren diskriminierungsfreie Ausgestaltung es geht: Das betrifft unter anderem die volle und barrierefreie Teilhabe an allen Lebensbereichen, das heißt die öffentliche Verkehrs- und Infrastruktur, die Schulen und die öffentlichen Einrichtungen und Dienste (Art. 9), die uneingeschränkt gleichberechtigte Anerkennung von Menschen mit Behinderung als Rechtssubjekte (Art. 12), die persönliche Freiheit und Sicherheit sowie die Freiheit von Folter, Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch (Art. 14-16), den Schutz der Unversehrtheit der Person (Art. 17), das Recht auf Freizügigkeit und den Erwerb oder Wechsel einer Staatsangehörigkeit (Art. 18), die freie Wahl des Aufenthaltsortes und der Art der Wohnform (Art. 19), das Recht auf Bildung, insbesondere durch Gewährleistung eines integrativen Bildungssystems auf allen Ebenen (Art. 24), das Recht auf Arbeit (Art. 27), das Recht auf ein Höchstmaß an Gesundheit und auf »gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit« (Art. 27), und das Recht auf Teilhabe am politischen, öffentlichen und kulturellen Leben (Art. 29-30). Im Schlussteil der Konvention wird ausdrücklich fixiert, dass die unterzeichnenden Staaten sich verpflichten, die innerstaatliche Durchführung der Konvention zu überwachen. Mindestens alle vier Jahre ist ein Bericht über den Stand der Umsetzung vorzulegen, der von einem unabhängigen, internationalen Ausschuss geprüft werden soll.
Die Konvention steht in der Tradition der Menschenrechtsentwicklung, angefangen von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 über die Erklärung der Menschenrechte durch die französische Nationalversammlung 1789 bis zur Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen 1948, kurz nach dem zweiten Weltkrieg (vgl. Wienberg 2013: 169). Mit der BRK wird auch die Willensbildung markiert, Menschen mit Behinderung endlich verbindlich als Bürgerrechtssubjekte anzuerkennen. Das ist eine enorme historische Errungenschaft. Nur ein grober Blick in die Historie zeigt, dass das über Jahrhunderte keineswegs selbstverständlich war. Menschen mit Behinderung erfuhren bis in die frühe Neuzeit, dass sie aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und in Armen-, Zucht- oder Arbeitshäusern eingesperrt wurden. Diese brutale Form der »Exklusion« wurde im Zuge der Entwicklung der Psychiatrie und den ersten »Heilanstalten« in Deutschland von einer »Separation« abgelöst, die die Betroffenen wenigstens von ihren Ketten befreite und ihnen in entsprechenden Anstalten ein Mindestmaß an gesundheitlicher Versorgung, Nahrung und Hygiene zukommen ließ. Die Zahl der in solchen »Heilanstalten« untergebrachten Personen stieg allerdings von 18.000 im Jahr 1865 auf 240.000 im Jahr 1913 an und war unter anderem auch Ergebnis einer staatlichen »Irrenüberwachung« (ebd.: 175). Diese nahm immer brutalere Formen an. »Geisteskrankheit« wurde zunehmend mit Gemeingefährlichkeit gleichgesetzt. Die Verwahrung dieser Menschen in Anstalten wurde einem ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkül unterzogen, das in den Hungerzeiten während und nach dem Ersten Weltkrieg den Ruf nach »Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens« eröffnete. Der Neuropathologe E. Hoche verwies bereits 1920 darauf, dass der »Aufwand pro Kopf und Jahr für Pflege der Idioten […] 1300 M betrug«, daher ließe sich »leicht ermessen, welches ungeheure Kapital in Form von Nahrungsmitteln, Kleidung und Heizung dem Nationalvermögen für einen unproduktiven Zweck [sic!] entzogen wird« (ebd.: 177). Die Forderung nach Vernichtung der »Ballastexistenzen« läutete die Phase der »Extinktion« ein: Auslöschung des »lebensunwerten Lebens« zunächst durch Zwangssterilisation und Kastration, durch Verhungernlassen und schließlich durch die massenhafte Vernichtung von mehreren Hunderttausend Menschen durch das Euthanasieprogramm des Naziregimes. Das sind in aller Kürze bilanziert wohl die perversesten Gräuel, die je an Menschen mit Behinderung vollzogen wurden.