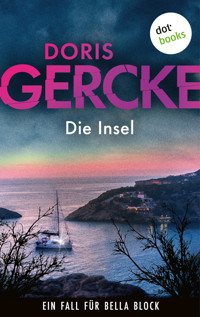
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Bella Block
- Sprache: Deutsch
Der fünfte Fall der Kultermittlerin Bella Block jetzt neu im eBook!Ein Strandurlaub, der tiefe Schatten wirft … Die Hamburger Privatdetektivin Bella Block ist urlaubsreif – auf einer spanischen Insel will sie einmal so richtig ausspannen. Doch statt der erhofften Urlaubsidylle erwarten sie verfallene Häuser, armselige Bars – und mysteriöse Gerüchte um eine Bucht, die einem alle finanzielle Sorgen nehmen kann. Betreibt hier etwa ein Drogenkartell seine schmutzigen Geschäfte? Bellas Neugier bringt sie schon bald in Schwierigkeiten, und nach einer unmissverständlichen Empfehlung zur Abreise – der Bella natürlich nicht nachkommt – überlebt sie nur knapp einen Mordanschlag. Festentschlossen, das Geheimnis der berüchtigten Bucht aufzudecken, wagt die Ermittlerin den Weg in die Höhle des Löwen: Was sie dort erwartet, übersteigt ihre kühnsten Vorstellungskräfte … »Mit präzisen Beschreibungen und stimmigen Dialogen schafft Doris Gercke Atmosphäre und gibt ihren Figuren den Atem der Authentizität.« Der SpiegelDer fünfte Fall der legendären Kommissarin Bella Block, der unabhängig gelesen werden kann – ein bitterböser Kriminalroman für die Fans Susanne Mischke.In Band 6 kehrt Bella in die verregnete Hansestadt zurück – und wird mit den Abgründen der Kinderprostitution konfrontiert …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Hamburger Privatdetektivin Bella Block ist urlaubsreif – auf einer spanischen Insel will sie einmal so richtig ausspannen. Doch statt der erhofften Urlaubsidylle erwarten sie verfallene Häuser, armselige Bars – und mysteriöse Gerüchte um eine Bucht, die einem alle finanzielle Sorgen nehmen kann. Betreibt hier etwa ein Drogenkartell seine schmutzigen Geschäfte? Bellas Neugier bringt sie schon bald in Schwierigkeiten, und nach einer unmissverständlichen Empfehlung zur Abreise – der Bella natürlich nicht nachkommt – überlebt sie nur knapp einen Mordanschlag. Festentschlossen, das Geheimnis der berüchtigten Bucht aufzudecken, wagt die Ermittlerin den Weg in die Höhle des Löwen: Was sie dort erwartet, übersteigt ihre kühnsten Vorstellungskräfte …
Über die Autorin:
Doris Gercke, 1937 in Greifswald geboren, ist eine der bekanntesten Krimi-Autorinnen Deutschlands. Berühmt wurde sie durch ihre Reihe um die Kultermittlerin Bella Block, im ZDF verfilmt mit Hannelore Hoger in der Titelrolle. Auf der Criminale 2000 erhielt sie den »Ehrenglauser« für ihr Gesamtwerk. Doris Gercke lebt in Hamburg.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre 17-teilige Reihe »Ein Fall für Bella Block«. Folgende Fälle sind als Hörbücher bei Saga Egmont erschienen: »Du musst hängen«, »Das lange Schweigen«, »Schlaf, Kindchen, schlaf« und »Das zweite Gesicht«.
***
eBook-Neuausgabe April 2025
Copyright © der Originalausgabe 1990 by Verlag am Galgenberg, Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung vonn Shutterstock/bobbypix, Akojandro
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-678-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Doris Gercke
Die Insel
Ein Fall für Bella Block 5
dotbooks.
Motto
Hier lenkt der Wunsch die Schiffe leise
Zur leeren Bucht durch grüne Fluren,
Und süß ist es: Man spürt und weiß
Nichts von der Erde fernem Murren.
(Alexander Blok)
Schöner noch
an einem Novembernachmittag
vor der Küste Teneriffas
beim Surfing den Blick
auf die schneebedeckte Kuppe
des Pico Teide zu richten
wissend dass die Aktien steigen.
(Uwe Timm)
Kapitel 1
Wie viel Geld haben wir?
So viel wir wollen. Kein Limit.
Der Mann und die Frau lächelten einander an. Ein schönes Paar, hoch gewachsen und schlank. Sie standen am Bug des Schiffes und betrachteten aufmerksam die kleine Stadt, die in der Bucht begann und nach ein paar hundert Metern endete, als habe sie keine Kraft mehr gehabt, die hinter der Bucht beginnenden Hügel hinaufzuklettern. Oben auf den Hügeln standen nur noch vereinzelt weiße Häuser. Von dort musste man einen wunderbaren Blick auf das Meer haben.
Das Schiff hatte in der Bucht ein Wendemanöver ausgeführt, schob sich langsam rückwärts an die Kaimauer heran und ging längsseits. Der Mann und die Frau hatten genug gesehen und wandten sich zum Gehen.
Am Niedergang zur Gangway drängten sich junge Leute. Sie trugen Rucksäcke. Die Männer hatten kurze Hosen an, die Mädchen weite Röcke und Sandalen. Der Mann und die Frau, die vom Bug des Schiffes aus das Panorama der Stadt betrachtet hatten, sahen einander an und verzogen angewidert ihre Gesichter. Sie gingen nicht weiter, sondern setzten sich auf eine der Holzbänke im Bug.
So ein Scheiß, hast du echt die Strohmatten liegen gelassen?
Immer ich, kannst ja auch einmal selbst auf deine Sachen aufpassen. Immer müssen wir Frauen euren Dreck wegmachen!
Echt, das ist jetzt nicht in Ordnung von dir ...
Der Mann konnte nicht weitersprechen, weil er lachen musste. Die Frau stimmte ein. Sie hatten den kleinen Dialog mit verstellter Stimme geführt und in jenem weinerlich-aggressiven Ton gesprochen, der, zugleich mit bestimmten Wörtern, Redewendungen und verballhornten Versatzstücken aus dem Vokabular der Psychotherapie, Einzug in die Umgangssprache der kleinbürgerlichen westdeutschen Mittelschicht gehalten hatte. »Beziehung« gehörte dazu, das Wort »offen« spielte eine wichtige Rolle. Auch »ich denke« wurde oft verwendet, nicht um diese durchaus wünschenswerte menschliche Beschäftigung zu bezeichnen, sondern als Einleitung für einen Satz, über dessen inhaltliche Leere mit einem bedeutungsvollen Klang hinweggetäuscht werden sollte. Soweit diese Sprache von Frauen benutzt wurde, galt sie unter den Sprechenden als Zeichen der durch die Frauenbewegung herbeigeführten, kulturellen Wende.
Die Frau betrachtete ihre schlanken Füße. Zwischen dem Saum der Hose und dem Leder der Schuhe waren ihre schmalen, braunen Fesseln zu sehen.
Ich hoffe, wir müssen nicht allzu viele Fußwege machen, sagte sie. Ich möchte mir ungern die Schuhe verderben.
Es wird schneller gehen als beim letzten Mal, antwortete er. Du hast die Stadt doch gesehen. Sie ist klein. Eine geniale Idee, hierherzugehen. Hast du die Eingeborenen gesehen? Sie tragen ihre Habe in Kartons. Da, siehst du? Er wies mit dem Kopf zum Niedergang. Eine abgearbeitete, schwarz gekleidete, ältere Frau nahm einen mit Bindfaden verschnürten Karton in ihre Hände. Sie hatte ihn auf dem Kopf über das Schiffsdeck getragen, bevor sie die Gangway hinunterstieg.
Ja, sagte die Frau, reich sind sie hier nicht.
Sie sprach ein wenig abwesend, weil sie damit beschäftigt war zuzusehen, wie die Frau mit dem Karton nach einem ihrer Schuhe angelte, der an der Schwelle hängen geblieben war. Es war ein Schuh aus schwarzem Tuch mit einer ausgefransten Sohle aus geflochtener Jute.
Komm, wir gehen, sagte der Mann und erhob sich. Die beiden waren fast gleich groß. Auf der Treppe und auf der Gangway ging er einen kleinen Schritt vor ihr. Als Letzte verließen sie das Schiff, das trotz seiner Größe nur wenige Passagiere auf die Insel gebracht hatte.
Der Mann und die Frau ließen sich unten am Heck ihr Gepäck aushändigen. Es war nicht viel, ein mittelgroßer lederner Koffer und eine lederne Reisetasche, teuer und ohne Reklameaufdruck einer jener Firmen aus der Lederbranche, die einer bestimmten Schicht von Reisenden das Gefühl von Zugehörigkeit zu vermitteln suchten. Die Taxifahrer, die sich ihnen aufdrängten, wiesen sie mit freundlichen Worten ab. Wenig später betraten sie ihr Zimmer in dem einzigen Hotel, das es in der Stadt gab. Sie zogen sich um, erkundigten sich beim Portier, wo man gut essen könne, und gaben ein reichliches Trinkgeld für die überflüssige Auskunft. Es gab nur zwei Restaurants, und eines davon kam für sie nicht in Frage. Sie aßen und tranken gut, plauderten ein wenig mit dem Wirt, gaben »für den Koch« ein reichliches Trinkgeld und erklärten, das Essen sei wunderbar gewesen. Sie würden am nächsten Abend wiederkommen.
Den folgenden Tag verbrachten sie damit, in der Stadt und in der Umgebung der Stadt herumzuspazieren. Hin und wieder tranken sie in einer der vielen kleinen armseligen Bars ein Glas Wein, scherzten mit verwitterten alten Männern, die dort ihre langen Tage verbrachten, und beobachteten aufmerksam die Gewohnheiten der Menschen. Am Abend kamen sie, wie angekündigt, in das Restaurant. Zufällig war der Bürgermeister anwesend, der das Restaurant sonst nur zu besonderen Gelegenheiten betrat. Der Wirt stellte ihn vor, und sie luden ihn ein. Später, man hatte schon gegessen, kamen ein Schreiber aus dem Gemeindebüro und der Hafenkommandant dazu. Man verbrachte einen angenehmen Abend.
Die folgenden Tage vergingen wie der erste. Die Einwohner der kleinen Stadt gewöhnten sich an das Paar, das so anders war als die Rucksacktouristen, die sie kannten.
Sie waren anders, weil sie Geld hatten. Der Mann und die Frau waren auf die Insel gekommen, um für sich und ihre Freunde ein Haus zu kaufen. Ein Haus oder auch zwei, jedenfalls sollte es ein schönes Haus sein und nicht in der Stadt liegen, wo es laut war.
Vielleicht brauchen wir auch ein etwas größeres Grundstück, sagten sie, damit wir noch ein paar Häuser bauen können. Wir haben viele Freunde. Wenn es bei Ihnen gute Bauarbeiter gibt – sagten sie mit fragender Stimme und lächelten den Bürgermeister an, dem es zur Gewohnheit geworden war, sich abends von ihnen zum Essen einladen zu lassen.
Das sind wichtige Leute, sagte er zu seiner Frau, bevor er das Haus verließ, um sich mit ihnen zu treffen. Seine Frau wäre nach ein paar Tagen gern einmal mitgegangen. Aber der Bürgermeister ließ es nicht zu.
Worüber redet ihr denn immer, fragte sie quengelig.
Und der Bürgermeister antwortete: Über Geschäfte, davon verstehst du nichts.
Der Bürgermeister ärgerte sich schon seit langem darüber, dass die Zentralverwaltung seine Insel vergessen hatte. Es gab eine Menge Probleme auf der Insel. Die Leute waren unzufrieden. Er aber wäre gern wieder gewählt worden. Was sollte er den Leuten bieten? Sie brauchten Arbeit und Geld. Beides hatte er nicht.
Wer weiß, dachte er, vielleicht ergibt sich jetzt eine Möglichkeit.
Wirklich, es ist besser, sie bleibt zu Hause, überlegte er, während er auf dem Weg zum Restaurant eine Hibiskusblüte abbrach und sie in ein Knopfloch seiner Jacke steckte. Was soll sie schon reden mit dieser großen, blonden Frau, die mich manchmal so merkwürdig anlächelt? Über die Kinder vielleicht, und dass sie gerade wieder ein neues ausbrütet?
Im Restaurant war die kleine Gesellschaft schon versammelt. Wie immer in der letzten Zeit ging es um Land und Häuser und Bauarbeiter. Die beiden Deutschen hatten einige schöne Grundstücke gefunden und würden sich bald entscheiden.
Klar, hier ist es schön, sagte der Hafenkommandant. Aber bevor Sie nicht die ganze Insel gesehen haben, sollten Sie nicht kaufen.
Zwischen ihm und dem Bürgermeister hatte sich eine kleine Konkurrenz um die Gunst der Ausländer entwickelt. Nicht, dass der Kommandant etwa auch gewählt werden wollte und sich günstige Geschäfte versprach. Nein, ihn ärgerte einfach, dass der Bürgermeister sich so aufspielte und ständig nur über Geschäfte redete, anstatt die Schönheiten der Insel herauszustreichen. Er dagegen war schließlich ein paar Jahre zur See gefahren und wusste, was solche Leute wollten. Sie wollten Ruhe und einen schönen Blick auf das Meer. Zu vorgerückter Stunde bot er ihnen für den nächsten Tag eine Fahrt mit dem Schiff rund um die Insel an. Natürlich stimmten die beiden zu. Sie waren entzückt von so viel Gastfreundschaft. Und wenn der Bürgermeister Zeit habe, dann solle er doch mitkommen.
Am Abend nach der Inselrundfahrt kamen der Mann und die Frau nicht zum Essen in das Restaurant. Sie seien müde von dem langen Tag auf dem Wasser, sagten sie. Dem Bürgermeister war es recht. So konnte er einen Abend mit der Familie verbringen, bevor seine Frau allzu ungnädig wurde.
Aber der Mann und die Frau gingen nicht früh schlafen, wie sie angedeutet hatten, sondern saßen noch lange in ihrem Zimmer vor einer Karte der Insel und führten ein ausgiebiges Telefongespräch, so teuer, dass die Frau des Bürgermeisters ihre Familie davon eine ganze Woche hätte ernähren können.
Am nächsten Vormittag erschienen sie im Büro des Bürgermeisters und machten ihm einen Vorschlag. Es ging um viel Geld und ein paar Garantien, die sie unbedingt brauchten. Dem Bürgermeister war sofort klar, dass mit ihrem Vorschlag für seine Insel der Aufschwung beginnen würde. Auch für ihn, natürlich, aber das kam erst in zweiter Linie. Zuerst hatte er sich immer für das Wohl der Gemeinde eingesetzt, wenn man es ihm auch in der letzten Zeit nicht mehr so recht gedankt hatte. Er traf sich noch am gleichen Abend mit dem Hafenkommandanten, der bei den Garantien, die die Fremden forderten, eine gewisse Rolle spielen würde. Die beiden hatten eine kleine Auseinandersetzung, nicht sehr heftig, schließlich gehörten sie derselben Partei an. Und war es nicht die Idee des Kommandanten gewesen, für die Fremden eine Inselrundfahrt zu organisieren? Die beiden Männer einigten sich bald, und am nächsten Abend traf man sich wieder zum Essen im Restaurant. Dem Wirt war nicht verborgen geblieben, dass die Dinge eine positive Wendung genommen hatten. Er brachte seinen besten Cognac zum Kaffee.
Auf die Zukunft, sagte der Bürgermeister und hob sein Glas.
Auf das Meer, sagte der Hafenkommandant, der es nicht lassen konnte, auf seine Weltoffenheit anzuspielen.
Auf die Zukunft, das Meer und die Schönheit des Lebens, sagten die Fremden und lächelten einander zu.
Kapitel 2
Der Schlüssel drehte sich im Schloss. Bella Block fand, dass Willy morgens zu viel Krach machte. Sie zog sich die Decke über den Kopf und versuchte, noch einmal einzuschlafen. Seit ein paar Monaten war es ihre – übrigens nicht ganz freiwillig angenommene – Gewohnheit, erst morgens gegen vier Uhr Schlaf zu finden. Willy kam zwischen acht und neun. Bella dachte darüber nach, wie sie es am besten anstellen könnte, noch einmal einzuschlafen. Aber sie hatte am Abend zuvor ein anstrengendes Gespräch mit ihrer Mutter gehabt. Bei der Erinnerung daran, dass sie sich zu einem Urlaub hatte überreden lassen, wurde sie hellwach. Ihr fiel ein, dass Sonnabend war. Sie hatte keine Verabredung mit irgendwelchen Klienten. Nur die Besprechung mit Willy stand auf dem Plan.
Dann, so überlegte sie, ist es nicht acht oder neun. Dann müsste es jetzt kurz vor zwölf ...
Der Kaffee ist fertig, brüllte Willy die Treppe hinauf.
Ich komme, rief Bella halblaut.
Unter der Dusche überlegte sie, weshalb Willy auf dem Gespräch bestanden haben mochte.
Wilhelmina van Laaken, genannt Willy, Jura-Studentin im achten Semester, machte sich ebenfalls Sorgen um ihren Gesundheitszustand. Das hatte Bella inzwischen begriffen. Während sie sich abtrocknete, betrachtete sie sich im Spiegel und stellte fest, dass, jedenfalls wenn man äußere Anzeichen ernst nahm, Willys Sorge durchaus berechtigt war.
Es wird Ihnen nicht verborgen geblieben sein, sagte Willy, während sie ein Baguette-Brötchen mit Butter bestrich, dass ich mich in den letzten Wochen mehr bei Ihnen als in meinen Vorlesungen aufgehalten habe.
Bella dachte, dass eine so umständliche Gesprächseinleitung auf ein besonderes Thema schließen ließ.
Ich hatte angenommen, antwortete sie, dass das mit Ihrem gespaltenen Verhältnis zum Wissenschaftsbetrieb zusammenhängt. Ich meine, Sie hätten irgendetwas in dieser Art angedeutet.
Tatsächlich hatte Willy ihr mehrmals ausführliche Vorträge darüber gehalten, dass die Begriffe »Jura« und »Wissenschaft« aus vielerlei Gründen nicht miteinander vereinbar seien. Bella versuchte, sich an Einzelheiten zu erinnern. Aber wie alles in den letzten Monaten, waren auch diese Gespräche durch sie hindurchgegangen, ohne dass sie sie wirklich wahrgenommen hatte.
Für eine Frau mit Verstand ist der Uni-Betrieb tödlich, sagte Willy. Leider gibt es zur Zeit noch gewisse gesellschaftliche Regeln, die es notwendig machen, dass ich einen kleinen Teil meiner Zeit dort verbringe, wenn ich ein Jura-Examen haben will. Und das wollen Sie.
Allerdings. Soll ich Ihnen aufzählen, für wen alles am Beginn seiner Karriere ein Jura-Abschluss gestanden hat? Wussten Sie, dass Goethe ...
Schlechtes Beispiel, Willy, unterbrach Bella lächelnd. Der hat das Jurastudium abgebrochen.
Eben, sagte Willy verschnupft, ich wollte gerade darauf hinweisen. Auf jeden Fall reicht die Juristerei aus, um Politiker zu werden; was ja bezeichnend ist, oder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir heute zusammen frühstücken, weil Sie mir Einzelheiten über den Zusammenhang von Jurastudium und der Karriere irgendwelcher Plattköpfe erzählen wollten. Können wir zur Sache kommen?
Willy schwieg einen Augenblick. Noch Kaffee?
Bella nickte. Willy goss Kaffee ein, legte ihre Serviette beiseite und zündete sich eine Zigarette an. Die Zeit brauchte sie, um sich den ersten Satz zurechtzulegen. Den ersten Satz einer etwas längeren Rede, wie Bella gleich feststellen sollte.
Ich bin jetzt seit fast sieben Monaten bei Ihnen, sagte Willy, legte den Kopf in den Nacken und ließ ihre Stupsnase angriffslustig wittern. Als ich hier anfing, habe ich Sie sehr bewundert. Klug, stark, erfahren, rücksichtslos gegenüber Männern, einfühlsam, wenn es um Frauen ging, erfolgreich, soweit man das in Ihrem Beruf sein kann. Von den Lektionen in russischer Lyrik will ich gar nicht reden. Dann kam diese Geschichte. Sie konnten nicht verhindern, dass irgendein Killer eine Frau mit Heroin umgebracht hat. Drogen spielten eine Rolle. Und Ihr Freund wurde erschossen.
Er hat sich selbst erschossen, sagte Bella nüchtern.
Seit dieser Zeit sind Sie verändert. Ich habe nicht die Absicht, die Veränderung in Einzelheiten zu beschreiben. Aber sie ist so erschreckend, dass ich vor ein paar Wochen beschlossen habe, etwas dagegen zu tun.
Bella sah Willy aufmerksam an. Sie war nicht neugierig auf das, was Willy sich ausgedacht hatte, wollte sie aber nicht kränken. Sie wartete.
Ich bitte Sie, sagte Willy, den sinnlosen Teil Ihrer Arbeit einzustellen. Sie gewinnen dadurch freie Zeit und ...
Was meinen Sie mit »sinnlos«, fragte Bella, die, seit sie mit vierzehn Jahren beschlossen hatte, dass es einen besonderen Sinn im Leben des Einzelnen nicht gäbe, mit der Vokabel, so wie sie im Allgemeinen gebraucht wurde, nicht viel anfangen konnte.
Halten Sie es für sinnvoll zu kämpfen, wenn von vornherein feststeht, dass man verliert?, fragte Willy herausfordernd.
Bevor Sie weitersprechen, sind Sie wohl so freundlich, mir eine Sache zu nennen, in der man kämpft und gewinnt, antwortete Bella.
Ihre Stimme klang hart, härter, als sie beabsichtigt hatte. Sie lächelte Willy entschuldigend an. Willy blieb unbeeindruckt.
Während Sie in den letzten Wochen hinter irgendwelchen Dealern her waren, bekiffte Ehefrauen vor dem Selbstmord bewahrten oder Amokschützen als vollgedröhnte Soldaten entlarvten, habe ich mich daran gemacht, Ihre Zeitung auszuwerten, die Sie die Güte hatten, seit Monaten neben dem Schreibtisch auf dem Fußboden liegen zu lassen.
Bella sah neben den Schreibtisch. Die Zeitungen waren verschwunden.
Ich habe die FAZ, eine grässliche Zeitung übrigens, unter dem Gesichtspunkt »Drogen« durchgeforstet. Das Ergebnis: Ich möchte Ihnen vorschlagen, keine Drogensachen mehr anzunehmen. Der jährliche Umsatz in diesem Geschäft wird auf dreihundert bis fünfhundert Milliarden Dollar geschätzt. Und er steigt. Ein Ende oder auch nur wirksame Maßnahmen sind nicht abzusehen. Gegen fünfhundert Milliarden ist kein Kraut gewachsen. Nicht mal Bella Block. Ich ...
Willy, sagte Bella, halten Sie einen Augenblick ein. Ich weiß zu schätzen, dass Sie sich Sorgen um mich machen. Bevor Sie aber in dieser Sache weiter ausholen, möchte ich Ihnen sagen, dass meine Mutter, die Sie ja inzwischen kennengelernt haben, gestern beschlossen hat, ich solle Urlaub im Süden machen. Und ich habe zugestimmt.
Bella und Willy sahen sich einen Augenblick schweigend an, bevor sie gleichzeitig zu lachen begannen.
Nein, sagte Willy schließlich, so geht das nicht. Ich hab doch nicht die ganze Zeit umsonst hier gesessen. Jetzt fahren Sie in den Süden, machen ein paar Wochen Urlaub, und wenn Sie zurück sind, steht irgendein Vater vor der Tür und beauftragt Sie, seine Tochter zu suchen, die vermutlich ein paar Kilometer weiter auf den Strich geht, um damit ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Dann geht die ganze Sache von vorn los. Es gibt keinen anderen Bereich, in dem Detektivarbeit so deutlich so sinnlos ist wie in diesem. Wer sagt Ihnen denn, dass der besorgte Vater nicht wenig später selbst Drogen nimmt? Weil er nicht mehr schlafen kann aus Sorge um seine Tochter oder weil ihm ein Geschäft schiefgegangen ist? Oder noch besser: Wer sagt Ihnen, dass er nicht irgendwann selbst ins Drogengeschäft einsteigt, wegen der hohen Verdienstspannen?
Sie übertreiben, Willy, sagte Bella, nur um überhaupt etwas zu sagen.
Willy war gekränkt. Sie stand auf und verließ das Zimmer. Gleich darauf kam sie zurück und knallte einen Stapel bunter Schnellhefter auf den Schreibtisch. Schweigend setzte sie sich und sah Bella anklagend an. Bella blieb nichts anderes übrig, als aufzustehen und einen Blick auf die Ordner zu werfen. Es war nicht zu übersehen, dass Willy sich viel Arbeit gemacht hatte. Bella nahm einen der Schnellhefter in die Hand und blätterte darin herum. Sie las »Washington – oder: Der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken«, sah zu Willy hinüber, lächelte und legte den Ordner zurück zu den anderen.




























